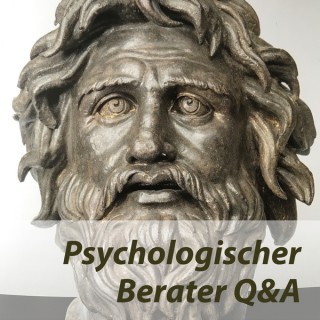Podcasts about freilegung
- 3PODCASTS
- 3EPISODES
- 38mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- May 12, 2018LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about freilegung
Episode 24 - Psychologie - Klientenzentrierte Gesprächsführung
Die Basis für ein erfolgreiches Kundengespräch sind: Kongruenz/Echtheit, Empathie d.h. Zuhören und Positive Wertschätzung des Gegenübers. Nur so gelangt der psychologische Berater mindestens in die Nähe der Emotionen seines Kunden, kann sie hervorkommen lassen und spiegeln. Erst über die Spiegelung hat der Klient die Möglichkeit, seine Emotionen zu erkennen, was sich an Einstellungen und Haltungen hinter ihnen versteckt und wie sie eventuell verändert werden können. Die Veränderung ist eine Arbeit, die der Kunde selbst bewältigen muß. Der Berater kann und soll keine Richtung vorgeben, sondern bei Freilegung und Erkennen der Ursachen für Emotionen helfen.
Akrosomale Exozytose von Säugerspermien
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
Für die erfolgreiche Befruchtung einer Eizelle ist die Calcium-regulierte Akrosomreaktion des Spermiums eine essentielle Voraussetzung. Sie bewirkt nicht nur die seit langem bekannte Freisetzung hydrolytischer Enzyme aus dem akrosomalen Vesikel zur Penetration der Eihülle (Zona pellucida), sondern legt auch das für die Spermien-Oozyten-Erkennung notwendige Izumo-Protein auf der Spermienoberfläche frei. Erst durch die nach Eizellkontakt induzierte großflächige Verschmelzung von äußerer akrosomaler Membran und der darüber liegenden Plasmamembran an hunderten von Fusionsstellen wird genügend Izumo-Protein auf der inneren akrosomalen Membran exponiert, um eine stabile Verbindung mit dem kürzlich auf der Eizelloberfläche identifizierten Interaktionspartner Juno zu gewährleisten. Welche Regulationsmechanismen der Koordination dieser multiplen Einzelfusionsereignisse bei der Akrosomreaktion zugrunde liegen, ist bislang jedoch weitgehend ungeklärt. In Neuronen wird die Präzision der Calcium-regulierten Neurotransmitter-Exozytose durch die cytomatrix of the active zone (CAZ), einem Netzwerk aus SNARE-regulierenden Gerüstproteinen, koordiniert. Aufgrund der funktionellen Parallelen zwischen den Exozytoseprozessen in Neuronen und Spermien sollte in der vorliegenden Arbeit geprüft werden, ob in Spermien ein analoges, CAZ-ähnliches Proteinnetzwerk die sich Reißverschluss-artig ausbreitende, multiple Fusionsporenbildung der Akrosomreaktion kontrolliert. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass das RIM2α-Protein die Hauptisoform der RIM-Proteinfamilie in Säugerspermien darstellt, deren Vertreter seit einiger Zeit als molekulare Knotenpunkte des CAZ-Proteinnetzwerkes an der Präsynapse gelten. Neben RIM2 wurde auch für ubMunc13-2, das in dieser Arbeit als prädominanter Subtyp der Munc13-CAZ-Proteinfamilie in Spermien identifiziert wurde, sowie für die beiden riesigen Gerüstproteine Piccolo/Aczonin und Bassoon eine distinkte Lokalisation in der akrosomalen Region von Nagerspermien nachgewiesen. Des Weiteren konnte belegt werden, dass RIM2 und ubMunc13-2 an Detergens-resistente Membranmikrodomänen in Spermien assoziiert sind, die seit einiger Zeit für die Rekrutierung der SNARE-Fusionsmaschinerie in Spermien bekannt sind. Eine potentielle Netzwerk-bildende Funktion von RIM2 wurde in in vitro Bindungsstudien, die u. a. mit massenspektrometrischen Analysen kombiniert wurden, bestätigt. Dabei zeigte sich, dass RIM2α sowohl testikuläres ubMunc13-2 als auch die CAZ-Proteine RIM-BP3 und das erstmals in Reproduktionsgewebe nachgewiesene ELKS/ERC2 sowie einige Zytoskelett-assoziierte Proteine bindet. Die funktionelle Bedeutung eines CAZ-ähnlichen Netzwerkes für die Akrosomreaktion wurde in quantitativen Exozytose-Analysen an epididymalen Spermien verifiziert. Eine selektive Blockierung einzelner Domänen von RIM2, aber auch von ubMunc13-2 und Piccolo/Aczonin reduzierte die Calcium-induzierte akrosomale Exozytoserate um mindestens 45 %. Die Funktion der α Isoform des RIM2-Proteins konnte durch funktionelle Exozytosestudien an RIM2α-defizienten Spermien einer entsprechenden Gen-defizienten Mauslinie verifiziert werden. Interessanterweise führte eine Erhöhung der intrazellulären Calcium-Konzentration durch das Calcium-Ionophor A23187 zu keinem signifikanten Unterschied der Akrosomreaktion von RIM2α-defizienten im Vergleich zu Wildtyp-Spermien. Dieser Befund könnte möglicherweise auf eine kompensatorische Wirkung anderer, ebenfalls in Spermien exprimierter RIM1- und RIM2-Isoformen zurückzuführen sein. Allerdings wurde für die Akrosomreaktion nach Stimulation mit isolierter und solublisierter Zona pellucida in RIM2α-defizienten im Vergleich zu Wildtyp-Spermien eine signifikante Reduzierung der akrosomalen Exozytose-Induktion festgestellt. Da die Applikation eines Calcium-Ionophors die Signalkaskade umgeht, die unter physiologischen Bedingungen zum Calcium-Influx und damit zur Membranfusion führt, scheint das RIM2α-Protein Komponenten der Signalkaskade und/oder die Calcium-Kanäle für die Akrosomreaktion zu rekrutieren. Somit könnte es dazu beitragen die gerichtete, großflächige Fusionsporenbildung nach Zona pellucida-Stimulation zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Dissertation durchgeführte Untersuchungen deuten außerdem an, dass RIM2α eine Interaktion mit dem Multi-PDZ-Domänen Protein 1 (MUPP1) eingehen könnte. MUPP1 ist im Komplex mit der Calcium/Calmodulin abhängigen Kinase II daran beteiligt, eine spontane, durch die sekundäre Reifung der Spermien im weiblichen Genitaltrakt begünstigte Akrosomreaktion zu verhindern. Als molekularer Knotenpunkt könnte RIM2 demnach sowohl eine spontane Exozytose verhindern als auch durch die Rekrutierung weiterer CAZ-Proteine und des Zytoskeletts die großflächige, multiple Fusionsporenbildung zur Freilegung von ausreichend Izumo-Molekülen auf der Spermienoberfläche sicherstellen. Eine Lokalisation in Detergens-resistenten Membranplattformen, wie sie auch für MUPP1 und die SNARE-Proteine in Spermien gezeigt wurde, könnte diese integrierende Funktion von RIM2 für die akrosomale Exozytose unterstützen.
Identifizierung von extrazellulären Bindungspartnern des Tumorendothelmarkers (TEM) 5 und Charakterisierung seiner Funktion bei der Angiogenese
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Tumorendothelmarker (TEM) 5 gehört zu den Adhäsions-G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und wird in Endothelzellen während der physiologischen Angiogenese und Tumorangiogenese exprimiert. Bisher wurden noch kein Ligand und keine Funktion von TEM5 beschrieben. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass TEM5 in Endothelzellen während der In Vitro-Angiogenese intrazellulär an einer konservierten Proteolysestelle (GPS) gespalten wird. Diese Proteolyse führte einerseits zur Translokation der nicht-kovalent verbunden TEM5-Fragmente an die Zelloberfläche und andererseits zur Freisetzung von löslichem TEM5 (sTEM5). Bindungsstudien haben ergeben, dass sTEM5 mit verschiedenen Glykosaminoglykanen interagiert. Sequenzanalysen und funktionelle und biochemische Studien haben gezeigt, dass sTEM5 eine kryptische RGD-Bindungsstelle für Integrin alpha(v)beta(3) enthält. Matrixmetalloprotease 9-prozessiertes, jedoch nicht unprozessiertes, sTEM5 vermittelte Endothelzelladhäsion durch direkte Interaktion mit Integrin alpha(v)beta(3). Die Interaktion von immobilisiertem proteolytisch prozessierten sTEM5 mit Integrin alpha(v)beta(3) vermittelte Überleben von Wachstumsfaktor-deprivierten Endothelzellen. Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu der Schlußfolgerung, dass sTEM5 während der Angiogenese von Endothelzellen freigesetzt wird und an Glykosaminoglykane in der extrazellulären Matrix und auf der Oberfläche von Zellen bindet. Proteolytische Prozessierung von sTEM5 führt zur Freilegung seines RGD-Motivs und vermittelt Überleben von Endothelzellen durch die Interaktion mit Integrin alpha(v)beta(3).