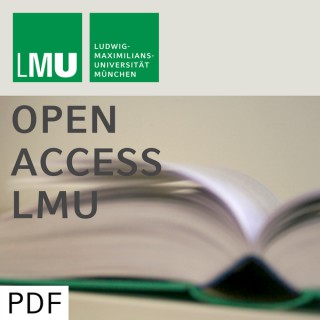Podcasts about cd45ro
- 5PODCASTS
- 5EPISODES
- 12mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Oct 4, 2021LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about cd45ro
Cobertura ScienceLink del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica: Tumores del SNC
La Dra. Leticia Vázquez Cortés, oncólogo médico adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, Michoacán, México nos comenta sobre lo más destacado entumores del sistema nervioso central (SNC), presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, resaltando los siguientes estudios: 343MO: Características clínicas y patrones de metilación del ADN a corto y largo plazo en gliomas de grado II-III afectan a individuos jóvenes, los cuales se caracterizan por un pronóstico de supervivencia que varía de meses a años. El tratamiento postoperatorio prolonga la supervivencia, pero tiene un impacto potencial en la calidad de vida y el funcionamiento cognitivo a largo plazo. Por lo tanto, se necesitan modelos de estratificación pronóstica refinados para guiar los estudios de tratamiento futuros. 344MO: Estudio del grupo español GEINO, el cual investigó el tratamiento del meduloblastoma en adultos (constituye el 1% de los tumores de SNC, es un tumor potencialmente curable con radioterapia al neuroeje y quimioterapia). Se registraron 71 pacientes, el 70.6% se encontraban con resección completa, 23.6% con resección parcial y 5.9% con biopsia. 345MO: El objetivo primario del estudio era observar los cambios en el microambiente inflamatorio después de los tratamientos de radioterapia en pacientes con metástasis cerebrales. Se realizó una división en 5 grupos, en los cuales se investigó los subconjuntos de células T, CD3, CD8, CD45RO, FOXP3, LAG3 y la expresión de PD-L1. Se analizaron 81 muestras, 55 de cáncer de pulmón, 15 de cáncer de mama, 4 cáncer de riñón, 1 de melanoma, 1 de colon y 5 de otros tipos de tumores. 354P: Estudio doble ciego de dos brazos, el objetivo primario fue comparar los beneficios de supervivencia de 12 ciclos vs. 6 ciclos con temozolomida adyuvante en adultos con gliomas de alto grado recién diagnosticados. 1265P: El objetivo primario del estudio fue seleccionar un método más eficaz para el diagnóstico de metástasis leptomeníngeas (ML) comparando varios métodos de detección. El objetivo secundario fue identificar patrones de mutación específicos de genes en el líquido cefalorraquídeo (LCR) con ML y explorar el valor de los marcadores tumorales del LCR y las pruebas de ADN tumoral circulante para guiar el tratamiento clínico. 371P: Bevacizumab en dosis bajas para el tratamiento de la necrosis cerebral focal postradiación. Se investigó un régimen de dosis baja de bevacizumab (dosis de carga de 400 mg seguida de 100 mg cada 4 semanas) en pacientes diagnosticados con necrosis cerebral por radiación focal. Dicho tratamiento es una alternativa eficaz y económica de dosis estándar.
Immunhistologie von Nickel-Epikutantestreaktionen im Vergleich zu Proben aus Gewebe um revidierte unzementierte Chrom-Kobalt-Molybdän-Hüftendoprothesen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
In dieser Arbeit wurden immunhistologische Charakteristika der Nickel-induzierten (Epikutantest-) Ekzemreaktion im Vergleich mit Nickel-exponierter, reaktionsloser Haut analysiert. Weiterhin wurden immunhistologische Untersuchungen an bei Revisionsoperationen erhaltenen Gewebeproben aus der Umgebung nicht-zementierter CrCOMo-basierter Hüftendoprothesen durchgeführt. Die Analysen wurden aus 10 Biopsien aus Nickelepikutantestarealen (5 Personen mit, 5 Personen ohne Nickelallergie) und an 6 periimplantären Gewebeproben durchgeführt. Für Nickel-allergische Personen (Ekzem im Testfeld) waren im Vergleich mit Nickel-exponierter, klinisch reaktionsloser Haut deutliche Infiltrate CD3+ T-Lymphozyten mit überwiegend CD4+ Zellen sichtbar. Das entzündliche Infiltrat wurde anhand der Expression von IL-2-Rezeptor und CD69 (als früher Aktivierungsmarker) als Hinweis auf aktivierte bzw. dem Wachstumsfaktor IL-2 empfängliche Zellen hinterfragt. Hier zeigte sich eine – wenn auch individuell schwankende – erhöhte Expression im Vergleich zu den nicht-allergischen Personen. Dazu passt auch die über Expression des Markers Ki-67 erkennbare, gesteigerte Proliferation innerhalb der Infiltratzellen in Gruppe 1. Daneben war die „physiologische“ proliferative Aktivität in den basalen Epidermisanschnitten erkennbar. Bei der Untersuchung von Adhäsionsstrukturen fiel in den mit Ekzem reagierenden Nickel-Testfeldern eine vergleichsweise deutliche Expression von ICAM-1 und E-Selektin (CD62E) auf. Dem könnte die bei einer Kontaktallergie unter TH1-Dominanz vorherrschende IFN-γ-Produktion zugrunde liegen. In einem TNF-α/IFN-γ-reichen Umfeld wird auch die Expression von CD40 als kostimulatorische Struktur für aktivierte T-Zellen gefördert. Eine CD40-Hochregulation war speziell in Proben der Gruppe 1 zu beobachten. Wir haben nun innerhalb der Biopsien nickelallergischer Personen auch CD45RO-tragende Zellen nachweisen können. Dies deutet auf die Anwesenheit von (Antigen-erkennenden) Memory-T-Zellen hin. An Gewebeproben aus periimplantärem Gewebe – erhalten bei Revisionsoperationen nicht-infektiöser unzementierter CrCoMo-Hüftgelenke – wurde in unserer Arbeit gefragt, ob sich Elemente wie bei der kutanen Spättypüberempfindlichkeitsreaktion auf Nickel finden lassen. Auch wenn diese Gewebe verschiedenen Legierungsmetallen und Partikeln noch dazu über Jahre hinweg exponiert waren, so fanden sich auch hier individuell schwankend: CD3+ Lymphozyten, meist CD4-dominiert; Hochregulation von Adhäsionsmolekülen; Expression der kostimulatorischen Struktur CD40; IL-2-R+ Zellen. Speziell im Präparat E2 waren auch deutlich CD45RO-tragende Zellen im Sinne von Memory-Zellen sichtbar. Bei diesem Patienten hatten Schmerzen, Lockerung und Ergussbildung zum Wechsel seiner Metall-Metall-Hüftendoprothese geführt. Zusammenfassend konnten mit den beschriebenen Methoden Charakteristika des Nickel-Kontaktekzems untersucht werden. Periimplantäre Gewebe aus revidierten Metall-Metall-Hüftendoprothesen können ebenfalls wie hier beschrieben lymphozytäre Entzündungsphänomene aufweisen. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt zur Untersuchung einer möglichen metallallergischen Komponente bei nicht-infektiöser Endoprothesenunverträglichkeit sein.
Pollen grains induce a rapid and biphasic eczematous immune response in atopic eczema patients
Introduction: Eczematous reactions to type I allergy-inducing antigens are documented in a subgroup of patients with atopic eczema. Yet, the underlying immunological mechanisms are not well understood. Material and Methods: To delineate the effect of native pollen grains on human skin of healthy and atopic individuals we performed patch tests (atopy patch test with native pollen grains, PPT). Nickel patch tests (NPT) served as an established model of contact dermatitis. Skin site biopsies were taken 6 - 96 h after allergen application and investigated immunohistochemically. Results: Histology of positive patch tests showed an influx of mononuclear cells (predominantly CD4+, CD25+, CD45RO+). This influx was detected earlier in the PPT reaction than in the immune response to nickel. A biphasic cytokine response could be detected in the PPT: IL-5 dominated in the early, IFN-gamma in the late phase. The NPT was continuously dominated by IFN-gamma. Dendritic cell subpopulations imitated the earlier kinetics of the mononuclear infiltrate. Discussion: Thus, pollen grains induce eczematous reactions in susceptible individuals. This reaction appears clinically and immunohistochemically similar to the contact hypersensitivity reaction to nickel but follows a faster kinetic and a biphasic course: Th2 and IgE in the early (24 h) and Th1 predominance in the late (96 h) phase. Copyright (c) 2007 S. Karger AG, Basel.
Phänotypische und funktionelle Charakterisierung lymphozytärer Subpopulationen nach ausgedehnter Verbrennungsverletzung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Die Immunantwort auf ein Verbrennungstrauma beginnt im Moment der Verletzung und resultiert in einer Monozytenaktivierung, die mit einer vermehrten Synthese und Ausschüttung von inflammatorischen Mediatoren einhergeht. Unter physiologischen Bedingungen dient ein ausgewogenes Zusammenspiel von pro- und antiinflammatorischen Zytokinen der Homöostase, wohingegen das Immunsystem nach massivem Trauma mit einer oft exzessiven Freisetzung proinflammatorischer Mediatoren reagiert. Patienten mit schwerer Verbrennungsverletzung sind daher hochgradig gefährdet ein ausgedehntes „systemic inflammatory response syndrome, (SIRS)“, d. h. eine maligne Ganzkörperinflammation, eine Sepsis oder eine Multiorgandysfunktion, assoziiert mit einer hohen Letalität, zu entwickeln. Eine überwiegend antiinflammatorische Immunantwort dagegen manifestiert sich als systemische Immundefizienz und Anergie mit einer signifikant erhöhten Infektionsanfälligkeit. Es besteht eine eindeutige Ursache-Effekt-Beziehung zwischen Trauma und Zytokinsystem. Mechanischer Stress führt zu schweren Störungen der Interaktion von Monozyten und T-Zellen mit der Folge einer schwerwiegenden Immundysfunktion, wobei PGE2 als einer der Hauptmediatoren der traumainduzierten Immundepression angesehen wird. Erhöhte PGE2-Spiegel sind mit einer reduzierten T-Zellmitogenese, IL-2-Produktion und IL-2-Rezeptorexpression korreliert und für eine Verschiebung der T-Helfer-Aktivität in Richtung eines dominierenden TH2 Phänotyps mit erhöhter Synthese der immunsuppressiven Zytokine IL-4 und IL-10 verantwortlich. Zytokine sind für die Kommunikation im Immunsystem, vor allem bei der Koordination einer Immunantwort durch T-Lymphozyten, von entscheidender Bedeutung. Als sezernierte Proteine waren sie bis vor kurzem der durchflusszytometrischen Analyse nur begrenzt zugänglich. Wir konnten sie wie in vorliegender Arbeit beschrieben in fixierten Zellen intrazellulär nachweisen, d. h. vor der Sekretion. Dieses Verfahren erlaubte es uns, die Expression der Zytokingene quantitativ, kinetisch, korreliert mit Oberflächenproteinen und auf die Einzelzelle bezogen analytisch zu erfassen, zumindest bis zur posttranslationalen Ebene. In peripheren mononukleären Blutzellen (PBMC) von 10 Patienten mit schwerer Verbrennungsverletzung (KOF >30%) und 15 gesunden Kontrollpersonen wurde die Zytokinsynthese mit Ionomycin und PMA polyklonal induziert und die Zellen anschließend mit fluorochromkonjugierten monoklonalen Antikörpern gegen IL-2, IL 4 und IFN-g, sowie gegen CD4-, CD8-, CD45RA- und CD45RO-Zelloberflächenantigene in unterschiedlichen Kombinationen gefärbt. Massives Verbrennungstrauma führte nach polyklonaler Stimulation der T Lymphozyten zu teils signifikanten systemischen Veränderungen der Zytokinexpression in den Kulturüberständen. Verglichen mit einer exzessiven IL-4 Freisetzung und stark erhöhter IL-10 Sekretion zeigten die IFN-g- und die IL-2 Synthese eine nur mäßige Steigerung gegenüber den gesunden Kontrollen. Wir sahen somit eine traumatisch induzierte Veränderung des Zytokinprofils in Richtung eines überwiegend TH2-artigen, immunsuppressiven Phänotyps. Diese Verschiebung von einer eher zytotoxischen (TH1) zu einer weitgehend humoralen und daher abgeschwächten Immunantwort ist mit einer erhöhten Infektionsanfälligkeit verbunden. Mit der durchflusszytometrischen Einzelzellanalyse gelang uns dann erstmalig die Identifikation der CD8+ Zelle, die ursächlich für die gesteigerten Syntheseantworten im posttraumatischen Verlauf verantwortlich ist. Die Synthesekapazität der CD4+ T-Helferzellen blieb nahezu unverändert. Eine Ausnahme bildete die prozentuale Abnahme IFN-g positiver Gedächtniszellen (CD45RO+) zugunsten einer zunehmenden Zahl IFN-g produzierender naiver T Helferzellen (CD45RA+). In der CD8+ Subpopulation kam es in der ersten Woche nach Verbrennungsverletzung zu einer signifikanten Steigerung der IL-2, IL-4 und IFN-g de novo Synthese, die interessanterweise bei weiterer, differenzierter Analyse eine positive Korrelation mit dem klinischen Verlauf ergab. Patienten, die verstarben, zeigten im Vergleich zu den Überlebenden signifikant erhöhte IL-4 und IL-2 Syntheseraten der CD8+ Zellen. Betrachtet man die IL-2 Synthese dieser CD8+ Zellen genauer, nahm nur die Zahl IL-2-produzierender CD8+CD45RA+ Zellen signifikant zu, verglichen mit dem Kontrollkollektiv, wobei beide Patientenkollektive an dieser Entwicklung partizipierten. Auch die IFN-g Synthese der CD8+CD45RA+ Subpopulation zeigte an allen Tagen post Trauma eine signifikante Zunahme gegenüber den Kontrollen ohne aber mit der Überlebensrate zu korrelieren. Dagegen war der prozentuale Anteil IFN-g produzierender CD8+ CD45RO+ Zellen von Verstorbenen signifikant gegenüber den Überlebenden reduziert und blieb auch an allen Untersuchungstagen deutlich hinter dem Kontrollniveau zurück, das von den überlebenden Patienten z. T. signifikant übertroffen wurde. Neben der funktionellen Charakterisierung über die Zytokinexpression (intrazellulär) kann der Aktivierungsstatus des Immunsystems durchflusszytometrisch auch über eine Oberflächenphänotypisierung ermittelt werden, ohne aber damit funktionell unterschiedliche Subpopulationen von T Zellen definieren zu können. Einen ersten Hinweis auf die Aktivierung des Immunsystems von Verbrennungspatienten erhielten wir über die signifikante Zunahme von IL-2Ra (CD25) tragenden T-Zellen in der ersten Woche nach Trauma. Aktivierte T-Zellen exprimieren darüberhinaus MHC-Klasse II-Moleküle und verschiedene Adhäsionsmoleküle, denen bei der Wechselwirkung der Zellen entscheidende Bedeutung zukommt. Akzessorische Moleküle erhöhen beispielsweise die Avidität der T-Zell-APC Interaktion und wirken kostimulatorisch. Wir konnten nach schwerer Verbrennungsverletzung eine verstärkte Expression des vorherrschenden T-Zellrezeptors (TCR) a/b und der akzessorischen T Zellmoleküle CD2, CD7, CD28, CD29 und CD80 nachweisen. Die Zunahme von CD28-Molekülen auf der Oberfläche von CD4+ und CD8+ T-Zellen ist besonders bemerkenswert, da mit zunehmender Signalstärke des über CD28 vermittelten Signals die Differenzierung einer T-Zelle auf die TH2-Entwicklung ausgerichtet wird. Die Aktivierung von T-Lymphozyten ist außerdem mit markanten Veränderungen im Expressionsmuster einzelner CD45 Isoformen verknüpft. Die Induktion der CD45RO Isoform und der Verlust von CD45RA waren beim Schwerstverbrannten besonders auffällig. Die durchflusszytometrische Bestimmung des Aktivierungsstatus des Immunsystems hat unseres Erachtens das Potenzial einer Standardmethode zur Ermittlung von Hochrisikopatienten mit deren Hilfe immunsupprimierte Patienten und solche mit SIRS und Sepsis unterschieden werden können. Die zentrale Vorbedingung für eine effektivere Sepsistherapie stellt eine verbesserte Diagnostik im Sinne kontinuierlicher zellbiologischer Informationen („Online-Monitoring“) am Krankenbett dar, um die meist sehr schnell wechselnden immuninflammatorischen Zustandsbilder direkt zu erkennen und einer zeitgerechten, individuell adaptierten Behandlungsintervention zuzuführen.
Heterogeneity of CD4(+) and CD8(+) memory T cells in localized and generalized Wegener's granulomatosis
Memory T cells display phenotypic heterogeneity. Surface antigens previously regarded as exclusive markers of naive T cells, such as L-selectin ( CD62L), can also be detected on some memory T cells. Moreover, a fraction of CD45RO(+) ( positive for the short human isoform of CD45) memory T cells reverts to the CD45RA(+) ( positive for the long human isoform of CD45) phenotype. We analyzed patients with biopsy-proven localized Wegener's granulomatosis (WG) (n = 5), generalized WG (n = 16) and age- and sex-matched healthy controls ( n = 13) to further characterize memory T cells in WG. The cell-surface expression of CD45RO, CD45RA, CD62L, CCR3, CCR5 and CXCR3 was determined on blood-derived T cells by four-color flow cytometric analysis. The fractions of CCR5(+) and CCR3(+) cells within the CD4(+) CD45RO(+) and CD8(+) CD45RO(+) memory T cell populations were significantly expanded in localized and generalized WG. The mean percentage of Th1-type CCR5 expression was higher in localized WG. Upregulated CCR5 and CCR3 expression could also be detected on a fraction of CD45RA(+) T cells. CD62L expression was seen on approximately half of the memory T cell populations expressing chemokine receptors. This study demonstrates for the first time that expression of the inducible inflammatory chemokine receptors CCR5 and CCR3 on CD45RO(+) memory T cells, as well as on CD45RA(+) T cells ('revertants'), contributes to phenotypic heterogeneity in an autoimmune disease, namely WG. Upregulated CCR5 and CCR3 expression suggests that the cells belong to the effector memory T cell population. CCR5 and CCR3 expression on CD4(+) and CD8(+) memory T cells indicates a potential to respond to chemotactic gradients and might be important in T cell migration contributing to granuloma formation and vasculitis in WG.