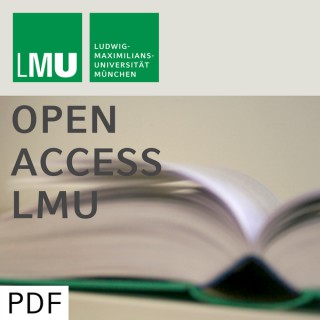Podcasts about cd1a
- 4PODCASTS
- 6EPISODES
- AVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jul 8, 2010LATEST
POPULARITY
Best podcasts about cd1a
Latest news about cd1a
Latest podcast episodes about cd1a
Eine prospektive klinische, histopathologische und immunhistochemische Analyse zur Differentialdiagnostik von akuter Graft versus Host Disease und akutem Arzneimittelexanthem
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Die allogene Knochenmarks- bzw. Stammzelltransplantation wird seit den späten 70er Jahren als kurativer Behandlungsansatz bei myeloproliferativen Syndromen wie Leukämien und Lymphomen etabliert. Eine schwere und häufige (25-45%) Komplikation dieser Transplantation ist die Wirt-gegen-Spender-Erkrankung bzw. Graft-versus-Host Disease (GvHD). Die Erkrankung ist mit einer hohen Letalität von etwa 30% unter moderner Therapie verbunden und manifestiert sich häufig zunächst an der Haut. Eine zuverlässige und rasche Diagnosesicherung ist für die Früherkennung und adäquate Therapie der GvHD entscheidend. Leider ist die akute, das heißt binnen 100 Tagen nach Transplantation auftretende GvHD (aGvHD) von akuten Arzneimittelreaktionen (AR) klinisch und histologisch schwer zu unterscheiden. Etablierte Kriterien für diese Differentialdiagnostik existieren nicht. Die Feststellung des histologischen Schweregrads der aGvHD ist bislang eher untersucherabhängig, die des klinischen Schweregrads ist dermatologisch sehr grob und zur Verlaufskontrolle eher ungeeignet. Diese Punkte zu optimieren und einen Beitrag zur Aufklärung der Immunpathologie der aGvHD zu leisten waren die Hauptziele der vorliegenden Dissertation. Zwanzig Patienten mit klinisch gesicherter aGvHD nach allogener Knochenmarks- oder Blutstammzelltransplantation und dreizehn Patienten mit klinisch verifizierter AR wurden in die Studie aufgenommen. Die klinischen Befunde wurden nach dem etablierten Glucksberg-Score sowie dem neu entwickelten klinischen GvHD-Schweregrad-Score (GvHSco) klassifiziert. Zusätzlich wurden Hautproben entnommen und histopathologisch sowie immunhistochemisch (Expression von CD1a, CD2, CD11c, CD20, CD25, CD34, CD68, CD197, CD206, CD207, CD 208, CD209, CD303 und S100) analysiert. Klinische und histologische Ergebnisse wurden einzeln analysiert und miteinander korreliert. Zur besseren Beschreibung des klinischen Schweregrades der kutanen GvHD wurde der klinische GvHSco a priori entwickelt. Er bietet durch die Standardisierung und die hundertteilige Skala im Vergleich zum Glucksberg Score Vorteile bezüglich der individuellen Verlaufskontrolle. Als histologische Schweregradkriterien korrelierten epidermotrope lymphozytäre Infiltration und Kontinuitätsverluste der Basalmembran (Epidermolyse) am deutlichsten mit dem klinischen Schweregrad. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde auf der Basis des histologischen Scores nach Lerner durch Ergänzung des Kriteriums Epidermolyse und durch besondere Gewichtung des Kriteriums Lymphozyteninfiltration der Modifizierte Histologische Score zur Abschätzung des Schweregrads akuter GvHD (GvHiScore) entwickelt. Die Vorteile dieser modifizierten Klassifikation sind die genaue, Untersucher-unabhängige Definition und die feinere Stratifizierung der Schweregrade. So wird eine bessere inter- und intraindividuelle Differenzierbarkeit erreicht. Als differentialdiagnostische Parameter sprachen hohe Zahlen reifer T-Zellen (CD2+, CD45RA+) und Makrophagen (CD68+), Epidermolyse, Basalzellballonierung, junktionales lymphozytäres Infiltrat differentialdiagnostisch für aGvHD, eosinophiles Infiltrat jedoch gegen eine aGvHD. Basierend auf diesen neuen Erkenntnissen wurde der differentialdiagnostische Test DSHIG („Differentialdiagnostischer Score mittels Histopathologie und Immunhistochemie für akute Graft versus Host Disease“) entwickelt. Der Test errechnet sich aus der Addition sieben dichotomer Kriterien. Die retrospektive Analyse des DSHIG ergibt eine Testspezifität und -sensitivität von 95% für die Differentialdiagnose „Akute GvHD“ versus „Akutes Arzneiexanthem“. Der differentialdiagnostisch vielversprechende DSHIG sollte prospektiv validiert werden. Bei der Lupusband-positiven akuten GvHD zeigte sich ein histologisch besonders schweres Bild mit ausgeprägter Epidermolyse. Ein Einfluss quoad vitam oder auf den klinischen Schweregrad ließ sich nicht zeigen. Die Lupusband-positiven Fälle traten bevorzugt in der späteren Phase von aGvHD auf. Für den klinischen Schweregrad und das Ein-Jahres-Überleben bei aGvHD günstig waren hohe Zellzahlen von IDEC (CD206+/CD11c+), plasmazytoiden Dendritischen Zellen (BDCA-2+) und Mastzellen. Diese Zusammenhänge wurden bislang nicht an Hautbiopsien gezeigt und könnten klinisch bedeutsam sein. Die in dieser Arbeit an Hand einer kleineren Fallzahl retrospektiv erstellten Scores sollten in zukünftigen Untersuchungen mit höherer Patientenzahl unabhängig prospektiv validiert werden. Die Dynamik der kutanen GvHD könnte darüber hinaus mit weitern Methoden wie durchflußzytometrischer Analyse und Gewinnung von sequentiellen Hautproben im zeitlichen Verlauf analysiert werden.
Surface marker expression profiles of dendritic cells (DC) generated from blasts in patients with acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS) are valuable tools to characterize and quantify DC in experimental settings
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Dendritic cells (DC) play a central role in connecting innate with specific adoptive immunity resulting in target specific activation T-cells. As professional antigen presenting cells (APC) DC specifically stimulate T-effector cells, especially tumor-cytotoxic T-cells. Therefore they are regarded as interesting candidates for anti-tumor or anti-leukemic vaccination strategies. The insufficient expression of costimulatory antigens, MHC molecules and tumor-associated antigens (TAA) on the surface of cancer cells and disturbed mechanisms of apoptosis are the main reason for an ineffective immune response in oncologic diseases. It was shown that acute myeloid leukemic cells can be differentiated to leukemia-derived DC (DCleu ), regaining the stimulatory capacity of professional DC while potentially presenting the whole leukemic antigen repertoire. Thus, vaccination strategies, using ex vivo or in vivo generated DC, might induce a highly specific anti-leukemic T-cell response circumventing the cumbersome identification of leukemia-associated antigens. In this thesis DC antigen (DCA) expression profiles of mononuclear cells (MNC) and dendritic cells (DC) generated from these MNC should be analyzed. The generated MNC and DC should be compared with respect to their DC antigen (DCA) expression profiles and the DCAs value to detect and quantify (leukemia-derived) DC in different AML/MDS subtypes and under different culture conditions. Therefore MNC and DC were generated from 137 patients with acute myeloid leukemia (AML) and 49 patients with myelodysplastic syndromes (MDS) under 6 different serum free culture conditions. DCA studied were: CD1a/1b/1c, CD206, CD25, CD137L, CD83, CD86, CD80 and CD40. DC-generating media were chosen according to their different mechanisms of inducing DC-differentiation: 1. ‚Basic method‘: TNF/GM-CSF/IL-4, 2. MCM-Mimic, 3. Ca Ionophore, 4. Picibanil, 5. Poly I:C and 6. Cytokines. Quality and quantity of generated DC was estimated by Flow cytometry applying a specified, ‘DC-based’ gating-strategy. Expression and coexpression profiles of 10 different DCA as well as various costimulatory molecules, maturation markers and blast antigens were evaluated. Only those DCA qualified for the quantification of leukemia-derived DC that were not expressed on uncultured MNC fractions. AML patients presented with an average of 58 % blasts, MDS patients with 13 % blasts in MNC fractions. DCA were expressed on average on less than 7% of uncultured MNC, however some of the markers could be expressed on up to 77% of uncultured cells in single AML cases. Consequently these DCA did not qualify for detection of DC in those cases. Highest expression rates were found for CD86 and CD40 in naïve AML and for CD137L and CD40 in naïve MDS samples. Other DCA (e.g. CD1a, 1b, 1c) were only rarely found on naïve blasts. DCA expression on uncultured AML and MDS MNC varied with FAB types and cytogenetic risk. After culture in different DC-differentiating media, on average 28% DC could be generated from AML MNC and 30% from MDS MNC, depending on methods used, with an average DC viability of more than 60% and an average DC maturity of 49% (AML) and 56% (MDS). On average 36% of leukemic blasts could be converted to DC. Proportions of DCleu in the total DC fraction varied from 40-58% and were on average 49% (AML) and 43% (MDS) after culture. Average results of all culture methods tested were comparable, however every method failed to create DC in some individual cases. The most important results of this thesis are: 1. It could be shown that DCA are expressed on naïve blasts in AML and MDS in individual patients. That means that the individual patients’ DCA-profiles have to be evaluated before DC-culture to find suitable DCA to detect and quantify (leukemia-derived) DC after culture. 2. Different methods of DC-generation qualify with varying individual efficiency to generate leukemic, mature, migratory and viable DC in individual cases. 3. To select the best DC-generating method the best DC-marker (no expression on naïve blasts, high expression on DC) has to be chosen to quantify DC in individual samples. 4. The use of only one method is not sufficient to create DC in every single AML and MDS sample. However, a successful, quantitative DC/DCleu -generation is possible in every case of AML and MDS by the combination of 3 different DC-generating media, but not every blast is convertible to DC leu . 5. There is a need for new, specific DC-markers that are not expressed on naïve blasts.
Adjuvant therapeutic vaccination in patients with non-small cell lung cancer made lymphopenic and reconstituted with autologous PBMC: first clinical experience and evidence of an immune response
Background: Given the considerable toxicity and modest benefit of adjuvant chemotherapy for non-small cell lung cancer (NSCLC), there is clearly a need for new treatment modalities in the adjuvant setting. Active specific immunotherapy may represent such an option. However, clinical responses have been rare so far. Manipulating the host by inducing lymphopenia before vaccination resulted in a magnification of the immune response in the preclinical setting. To evaluate feasibility and safety of an irradiated, autologous tumor cell vaccine given following induction of lymphopenia by chemotherapy and reinfusion of autologous peripheral blood mononuclear cells (PBMC), we are currently conducting a pilot-phase I clinical trial in patients with NSCLC following surgical resection. This paper reports on the first clinical experience and evidence of an immune response in patients suffering from NSCLC. Methods: NSCLC patients stages I-IIIA are recruited. Vaccines are generated from their resected lung specimens. Patients undergo leukapheresis to harvest their PBMC prior to or following the surgical procedure. Furthermore, patients receive preparative chemotherapy ( cyclophosphamide 350 mg/m(2) and fludarabine 20 mg/m(2) on 3 consecutive days) for induction of lymphopenia followed by reconstitution with their autologous PBMC. Vaccines are administered intradermally on day 1 following reconstitution and every two weeks for a total of up to five vaccinations. Granulocytemacrophagecolony- stimulating-factor (GM-CSF) is given continuously ( at a rate of 50 mu g/24 h) at the site of vaccination via minipump for six consecutive days after each vaccination. Results: To date, vaccines were successfully manufactured for 4 of 4 patients. The most common toxicities were local injection-site reactions and mild constitutional symptoms. Immune responses to chemotherapy, reconstitution and vaccination are measured by vaccine site and delayed type hypersensitivity (DTH) skin reactions. One patient developed positive DTH skin tests so far. Immunohistochemical assessment of punch biopsies taken at the local vaccine site reaction revealed a dense lymphocyte infiltrate. Further immunohistochemical differentiation showed that CD1a+ cells had been attracted to the vaccine site as well as predominantly CD4+ lymphocytes. The 3-day combination chemotherapy consisting of cyclophosphamide and fludarabine induced a profound lymphopenia in all patients. Sequential FACS analysis revealed that different T cell subsets (CD4, CD8, CD4CD25) as well as granulocytes, B cells and NK cells were significantly reduced. Here, we report on clinical safety and feasibility of this vaccination approach during lymphoid recovery and demonstrate a patient example. Conclusion: Thus far, all vaccines were well tolerated. The overall trial design seems safe and feasible. Vaccine site reactions associated with infusion of GM-CSF via mini-pump are consistent with the postulated mechanism of action. More detailed immune-monitoring is required to evaluate a potential systemic immune response. Further studies to exploit homeostasis-driven T cell proliferation for the induction of a specific anti-tumor immune response in this clinical setting are warranted.
Erweiterung eines diagnostischen Verfahrens zur Differenzierung entzündlicher Dermatosen mittels Immunphänotypisierung dendritischer Zellen der Epidermis
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Die Differentialdiagnose entzündlicher Hauterkrankungen setzt seitens des Dermatologen ein hohes Maß an klinischer Erfahrung voraus. Labortechnische und histologische Untersuchungsverfahren sind dabei nur eingeschränkt hilfreich. Ausgehend von der Annahme, dass erstens das atopische Ekzem ein krankheitsspezifisches Mikromilieu in der Epidermis und Dermis aufweist und dass sich zweitens dieses spezifische Mikromilieu im Phänotyp der immunkompetenten CD1a positiven epidermalen dendritischen Zellpopulation widerspiegelt, wurde seit 1995 ein Verfahren zur Immunphänotypisierung von Langerhans Zellen und IDEC entwickelt. Es konnte gezeigt werden, dass das atopische Ekzem durch eine hohe Expression des hochaffinen IgE-Rezeptors (FceRI) bei niedriger Expression des IgG-Rezeptors FcgRII auf den dentritischen Zellen der Epidermis hoch sensitiv und spezifisch von anderen Dermatosen abgegrenzt werden kann. Ziel der vorgelegten Arbeit war es, die standardisierte Phänotypisierung CD1a positiver epidermaler Zellen so zu erweitern, dass neben dem atopischen Ekzem auch die Diagnose anderer entzündlicher Hauterkrankungen möglich wird. Es wurden 296 Patienten mittels standardisierter Phänotypisierung epidermaler dendritischer Zellen untersucht. Bei 192 Patienten konnte nach Abschluss aller klinisch diagnostischen Untersuchungen eine eindeutige Diagnose gestellt werden, so dass die an diesen Patienten erhobenen Phänotypisierungsdaten für die Analyse krankheitsspezifischer Veränderungen im Oberflächenmarkerprofil von Langerhans Zellen und IDEC herangezogen wurden. Die Patienten verteilten sich auf 8 Gruppen: Normale Haut (n=31); Atopisches Ekzem (n=59); Psoriasis (n=41); Allergisches Kontaktekzem (n=23); Kontaktekzem bei atopischer Diathese (n=14); Lichen ruber (n=6); Mycosis fungoides (n=10) und Nummuläres Ekzem (n=8). Es konnte gezeigt werden, dass der prozentuale Anteil epidermaler dendritischer Zellen in Abhängigkeit von der Diagnose variiert und dass die bei allen entzündlichen Dermatosen nachweisbare Vermehrung epidermaler dendritischer Zellen vorrangig auf eine de novo Einwanderung von IDEC in die Epidermis zurückzuführen ist. Das wesentliche Ergebnis der vorgelegten Arbeit ist die Erweiterung der diagnostischen Phänotypisierung auf die Psoriasis und das allergische Kontaktekzem. So konnte die Psoriasis durch eine Ratio von CD64/CD11b auf IDEC sinnvoll abgegrenzt werden. Das Kontaktekzem war mittels einer Ratio aus E-Cadherin/CD86 auf Langerhans Zellen zu identifizieren. Die Gruppe der Patienten mit Kontaktekzem bei atopischer Diathese wurde durch die Ratio E-Cadherin/CD80 auf IDEC erkannt. Die bereits für das atopische Ekzem publizierte Ratio FcRI/CD32 auf allen CD1a positiven Zellen wurde mit der gleichen Ratio, ermittelt nur für IDEC, verglichen. Eine Verbesserung der Sensitivität und Spezifität für die Diagnosestellung des atopischen Ekzems konnte hierdurch nicht erreicht werden. Die starke Expression von FceRI auf LC und IDEC kennzeichnet das atopische Ekzem. Typisch für das atopische Ekzem ist weiterhin die Expression von CD36 auf LC und IDEC. Die Psoriasis ist durch eine besonders starke Expression der Fcg-Rezeptoren auf IDEC gekennzeichnet. Darüber hinaus findet sich eine erhöhte passive Anlagerung von sCD23 an IDEC bei Psoriasis. Gegenüber anderen Diagnosen ist die Expression von CD11b und CD11c auf IDEC vermindert. Für das Kontaktekzem ist die im Vergleich mit anderen entzündlichen Dermatosen niedrige CD49d Expression auf LC kennzeichnend. Die Einführung neuer diagnostischer Algorithmen in die Phänotypisierung epidermaler dendritischer Zellen konnte das diagnostische Spektrum dieser Methode deutlich erweitern. Neben atopischem Ekzem und normaler Haut wurden auch Algorithmen für die Psoriasis und das allergische Kontaktekzem beschrieben. Die systematische Analyse weiterer Dermatosen mit epidermaler Beteiligung dürfte auch für diese Erkrankungen diagnostische Algorithmen aufzeigen, die das Mikromilieu der entsprechenden Krankheiten widerspiegeln. Die Phänotypisierung epidermaler dendritischer Zellen dürfte insbesondere im Rahmen klinisch-therapeutischer Studien vermehrt zur Anwendung kommen, da mit dieser Methode eine objektive, quantitative Untersuchung einzelner behandelter oder unbehandelter Hautareale im zeitlichen Verlauf möglich ist.
Ex-vivo Untersuchungen zur Arzneimittelwirkung topischer Tacrolimus (FK-506) Anwendung auf epidermale dendritische Zellen in läsionaler Haut bei Patienten mit atopischem Ekzem
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Topical tacrolimus (FK506) leads to profound phenotypic and functional alterations of epidermal antigen-presenting dendritic cells in atopic dermatitis. BACKGROUND: Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease in which antigen-presenting epidermal dendritic cells (DCs), ie, Langerhans cells and the so-called inflammatory dendritic epidermal cells (IDECs) expressing the high-affinity receptor for IgE (FcepsilonRI) may play a significant pathophysiologic role. Therapeutic efficacy of the immunosuppressive macrolide tacrolimus (FK506) in AD has been demonstrated in clinical trials, but little is known of its mode of action. OBJECTIVE: The present study focused on the effects of topical tacrolimus treatment on epidermal CD1a+/FcepsilonRI+ DC populations in lesional AD. METHODS: Immunohistological analysis, epidermal DC phenotyping, and functional studies were performed on skin biopsy specimens from treated and untreated lesional skin of 10 patients with AD participating in a clinical trial with tacrolimus. RESULTS: Untreated lesional skin was characterized by a high proportion of CD1a+ cells, which was largely due to a high proportion of IDECs strongly expressing FcepsilonRI. Epidermal DCs isolated from untreated lesional skin exhibited high stimulatory activity toward autologous T cells, which was strongly reduced while clinical improvement was seen during application of tacrolimus. Concomitantly, a decreased FcepsilonRI expression was observed in both Langerhans cells and IDECs. Finally, topical tacrolimus led to a progressive decrease in the IDEC population within the pool of CD1a+ epidermal DCs and also to a decrease in their CD36 expression, which is indicative of lower local inflammation. CONCLUSION: Epidermal CD1a+ DCs may represent a target for topical tacrolimus in the treatment of AD.
Experimentelle Untersuchungen zur zellbiologischen Charakterisierung Inflammatorischer Dendritischer Epidermaler Zellen in entzündlich veränderter Epidermis
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Die entzündlich veränderte Epidermis unterscheidet sich von der Epidermis der normalen Haut durch das Auftreten einer zweiten dendritischen, von Langerhans Zellen (LC) abgrenzbaren Zellpopulation. Während Herkunft und Funktion dieser Inflammatorischen Dendritischen Epidermalen Zellen (IDEC) noch unbekannt sind, deuten die bislang durchgeführten immunphänotypischen Untersuchungen auf eine Monozyten-abhängige Genese hin. In der vorgelegten Arbeit wurden Untersuchungen an verschiedenen epidermalen Zellsuspensionen, sowie in vitro aus Monozyten hergestellten unreifen dendritischen Zellen (MoDC) durchgeführt, um durch eine standardisierte Untersuchung weiterführende Erkenntnisse zur Immunbiologie dieser dendritischen Zellen zu gewinnen. Zunächst konnte gezeigt werden, daß die in vitro hergestellten MoDC immunphänotypisch relativ genau den IDEC entsprechen, während der Immunphänotyp der LC deutliche Unterschiede zu dem der MoDC aufweist: Während sowohl IDEC als auch MoDC stark CD36, CD11b und CLA exprimieren, sind auf LC CD36 und CD11b nur minimal und CLA deutlich weniger stark exprimiert. Außerdem konnte gezeigt werden, daß die CD1a- Expression der MoDC mit längerer Kulturdauer stärker wird, und daß eine Zugabe von autologem Serum in die Kultur diese Ausreifung von Monozyten zu MoDC hemmt. Der zweite Teil dieser Arbeit befasste sich mit vergleichenden Zellzyklusuntersuchungen von LC und Keratinozyten aus normaler und entzündlich veränderter Haut. Hierzu wurde zunächst eine Untersuchungsmethode zur gleichzeitigen Bestimmung von Zellzyklus, CD1a- Expression und Vitalität etabliert. Es wurden verschiedene Parameter wie Zellzahl, Farbstoffkonzentration, Fixierung und Vitalfärbung an einem auf den Zellinien MOLT4 und U937 basierenden Modell optimiert, und später auf epidermale Zellsuspensionen übertragen. Dieses aus einem Zellgemisch einer CD1a-exprimierenden und einer CD1a-negativen Zellinie in seinen Anteilen frei wählbare Modell erlaubte die Optimierung der Färbetechnik und wies den vermehrten DNA-Gehalt der MOLT4-Zellen nach, was auf eine chromosomale Aberration in der MOLT4-Zellinie hindeutet. Keratinozyten und Langerhans Zellen wiesen einen normalen Zellzyklus innerhalb der normalen Haut auf, was die Resultate anderer Arbeitsgruppen bestätigte. In entzündlicher Haut war die Zellteilungsrate bei Keratinozyten und epidermalen dendritischen Zellen erhöht. Die erhöhte Zellteilungsrate der epidermalen dendritischen Zellen war bislang noch nicht untersucht worden. Schließlich wurden funktionelle Untersuchungen der immunphänotypisch nachgewiesenen kostimulatorischen Moleküle durchgeführt. Hierzu wurde die antigenpräsentierende Funktion mit der gemischten Haut-Lymphozyten-Reaktion untersucht. Durch den CD86 Antikörper konnte eine T-Zell-Proliferation in vitro effektiv gehemmt werden. Zusammenfassend konnte in dieser Arbeit eine Methode zur Untersuchung epidermaler dendritischer Zellen etabliert werden. IDEC ähneln in zahlreichen Aspekten den MoDC, wogegen LC deutliche Unterschiede aufweisen. Weitere Untersuchungen am Zellzyklus entzündlicher Haut, die auf die in der vorgelegten Arbeit etablierten Methode aufbauen, werden Aufschluß über die Teilungsraten von LC und IDEC geben. Anhand der Erkenntnisse über die Rezeptorexpression auf IDEC und MoDC ist eine genauere immunbiologische Einordnung der IDEC in die Gruppe der myeloiden dendritischen Zellen wahrscheinlich.