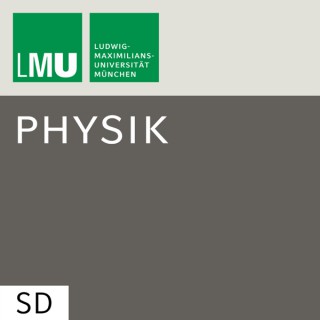Podcasts about schwingungsmoden
- 5PODCASTS
- 7EPISODES
- 5mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 26, 2012LATEST
POPULARITY
Best podcasts about schwingungsmoden
Latest podcast episodes about schwingungsmoden
In diesem Experiment werden zwei aneinander gekoppelte Pendel in unterschiedliche Schwingungsmoden versetzt. Diese Schwingungen werden aufgezeichnet und mit Hilfe der Fouriertransformation untersucht.
In diesem Experiment werden zwei aneinander gekoppelte Pendel in unterschiedliche Schwingungsmoden versetzt. Diese Schwingungen werden aufgezeichnet und mit Hilfe der Fouriertransformation untersucht.
Ultraschnelle photochemische Reaktionen
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/05
Diese Arbeit behandelt verschiedene ultraschnelle photochemische Prozesse. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Charakterisierung der perizyklischen Reaktionen photochromer Indolylfulgide und -fulgimide sowie der Untersuchung verschiedener Möglichkeiten der Beeinflussung dieser Reaktionen. Ein zweites Themengebiet sind die primären Energie- und Elektrontransferprozesse bei der Photosynthese von Purpurbakterien. Die zentralen Charakteristika dieser ultraschnellen photochemischen Reaktionen (Dynamik und Ausbeute) wurden mittels transienter Absorptionsspektroskopie in Abhängigkeit von äußeren Parametern, wie Temperatur, Anregungswellenlänge und Lösungsmittel, studiert. Hierzu wurde die bestehende Messanlage für Mehrimpulsexperimente ausgebaut und deren Impulserzeugung durch nicht-kollineare optisch parametrische Prozesse auf den nahinfraroten Spektralbereich erweitert. Die Ringschlussreaktion von Indolylfulgiden ist eine ultraschnelle, thermisch nicht aktivierte Reaktion auf der Zeitskala von etwa 0,3 ps. Ihre Quanteneffizienz liegt je nach Substitution der Probe und verwendetem Lösungsmittel zwischen 9 und 20%. Hingegen ist die Ringöffnungsreaktion thermisch aktiviert und verläuft über Barrieren auf der Potentialfläche des ersten elektronisch angeregten Zustands. Ihre Reaktionszeit ist abhängig von Substitution und Lösungsmittel und nimmt Werte zwischen 3 und 16 ps an; die Effizienz liegt im Bereich zwischen 0,1 und 15%. Durch Zuführen von thermischer Energie läuft die Ringöffnungsreaktion schneller und effizienter ab. Ihre Quantenausbeute erhöht sich ebenfalls, wenn man optische Überschussenergie durch Belichtung in die kurzwellige Flanke der Absorptionsbande zur Verfügung stellt. Eine weitere Möglichkeit, die Ringöffnungsquanteneffizienz von Indolylfulgiden zu steigern, ist die Anregung aktiver Schwingungsmoden. Für ein neu synthetisiertes Indolylfulgid mit zwei Cyclopropylringen konnte in einem neuartigen Mehrimpulsexperiment die Ringöffnungsquanteneffizienz nach einer vorgeschalteten Ringschlussreaktion um einen Faktor 3,4 auf annähernd 40% gesteigert werden. Für das Purpurbakterium Rhodobacter sphaeroides wurden verschiedene Energietransferprozesse betrachtet. Zunächst wurde der B800-B850-Transfer in den Antennenkomplexen LH2 mittels einer Mutantenstudie untersucht. Hierzu wurde die Aminosäuresequenz im Bereich der B850-Bindungstasche geändert, was eine verringerte thermische Stabilität und eine Verschiebung der Absorptionsspektren bewirkt. Letztere ist mit einer Verlängerung der Transferzeit von 0,7 ps (Wildtyp) auf bis zu 1,0 ps korreliert. Der Wildtyp – optimiert im Laufe der Evolution – besitzt unter allen untersuchten Proben die beste Funktionalität. In einem weiteren Experiment wurde die ultraschnelle Elektrontransferkaskade im Reaktionszentrum studiert. Über den Zerfall der stimulierten Emission des Special Pair P kann der erste Schritt zum Bakteriochlorophyll BA auf etwa 3,3 ps bestimmt werden. Durch die Beobachtung des transienten Zustands P+BA- wurde die Transferzeit des zweiten Schritts zum Bakteriophäophytin HA zu 0,9 ps ermittelt. An Rhodospirillum rubrum konnte schließlich gezeigt werden, dass die Anregung zwischen Reaktionszentrum und LH1-Antennen sehr schnell äquilibriert und der Elektrontransfer im Reaktionszentrum effektiv mit einer Zeitkonstante von etwa 40 ps abläuft.
Ultraschnelle photochrome Reaktionen eines Indolylfulgids und deren Steuerung durch Schwingungsanregung
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/05
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den perizyklischen Reaktionen eines photochromen trifluorierten Indolylfulgids und verschiedenen Möglichkeiten, die Dynamik und Effizienz der Ringöffnungsreaktion durch Zuführen von zusätzlicher Schwingungsenergie zu beeinflussen. Mittels transienter Absorptionsspektroskopie wurde die Reaktionsdynamik der Ringschluss- und Ringöffnungsreaktion dieses thermisch und photochemisch stabilen, reversiblen molekularen Schalters aufgeklärt: Die Ringschlussreaktion ist eine ultraschnelle Reaktion aus dem S1, die ohne langlebige Intermediate auf der Subpikosekunden-Zeitskala erfolgt. Eine Abhängigkeit von der Temperatur im Bereich zwischen 12 °C und 60 °C wurde bei ihr nicht beobachtet und auch bei Variation des umgebenden Lösungsmittels wird lediglich ihre Effizienz (10 - 18%), nicht aber ihre Dynamik (0,3 ps) geändert. Als aktive Moden der Reaktion wurden niederfrequente Torsionsmoden unter 100 cm-1 identifiziert. Mittels quantenchemischer Rechnungen wurden zyklisierbare und nicht zyklisierbare Konformere der offenen Form bestimmt. Die Ringöffnungsreaktion des trifluorierten Indolylfulgids stellt ebenfalls eine ultraschnelle Reaktion ohne langlebige Intermediate dar. Allerdings ist sie aktiviert und verläuft über zwei Barrieren im angeregten Zustand. Das verwendete Lösungsmittel ändert die Dynamik (2 - 11 ps) und Effizienz (1 - 6,7%) der Reaktion deutlich. Als aktive Moden der Reaktion findet man Schwingungen, die laut einer Normalmodenanalyse über den Bereich bis 1300 cm-1 verteilt sind. Erhöht man die Probentemperatur, so verkürzt sich die Reaktionszeit der Ringöffnung in 1,4-Dioxan von 10,3 ps bei 12 °C auf 7,6 ps bei 60 °C und die Quanteneffizienz erhöht sich von 3,1% (12 °C) auf 5,0% (60 °C). Durch Zuführen von optischer Überschussenergie wird die Reaktion ebenfalls effizienter. Dennoch bieten diese Verfahren keine signifikanten Freiheitsgrade, den Reaktionspfad zu lenken. Manipuliert man die Ringöffnungsreaktion hingegen dadurch, dass die geschlossenen Moleküle erst in einer vorgeschalteten Ringschlussreaktion gebildet werden, so wird die Ringöffnungsreaktion schneller, wenn die Verzögerungszeit zur vorgeschalteten Reaktion verkürzt wird. Des Weiteren weisen die transienten Absorptionssignale nichtexponentielles Verhalten auf, das mit zeitabhängigen Raten erklärt werden kann. Schließlich kann die Effizienz auf mehr als das dreifache gesteigert werden. Daraus kann geschlossen werden, dass die intramolekulare Schwingungsumverteilung nach einigen Pikosekunden noch nicht abgeschlossen ist und unterschiedliche Gruppen von Schwingungsmoden existieren, die durch die vorgeschaltete Reaktion verschieden stark populiert werden. Die in der Ringöffnungsreaktion aktiven Moden werden selektiv hoch angeregt und die Relaxation aus ihnen erfolgt auf einer Zeitskala von 5 ps.
Retinalbasierte Ionenpumpen - Ultrakurzzeitspektroskopie der Primärreaktion in unterschiedlichen Umgebungen
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/05
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Manipulation der Primärreaktion von Bakteriorhodopsin (BR). Dazu wurde die Primärreaktion mittels Ultrakurzzeitspektroskopie im Femto- und Pikosekundenbereich eingehend untersucht und erste kohärente Kontrollexperimente an einem Modellsystem durchgeführt. Zuerst wurde der Einfluss der Proteinumgebung, den das Gegenion zur Schiffschen Base des Retinals (Aspartat (D) Position 85) auf die Primärreaktion von BR ausübt, untersucht. Dabei wurde BR mit Halorhodopsin (HR) (fehlendes Gegenion, Threonin (T)) und der BR-Mutante D85T verglichen. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass nur in dem Fall, wenn ein Anion exakt in einem eingeschränkten Bereich um die Position 85 lokalisiert ist, eine BR-ähnliche stationäre Absorption und eine schnelle Primärreaktion mit der BR-typischen Zeitkonstante von 0.5 ps hervorgerufen wird. Fehlt dagegen das Anion oder befindet es sich außerhalb dieses eingeschränkten Bereichs, tritt eine Primärreaktion analog zur Primärreaktion von HR mit einer biexponentiellen Kinetik von 1 bis 10 ps auf. Da in der Literatur widersprüchliche Ergebnisse bezüglich der initialen Bewegungen im angeregten Zustand von BR vorliegen, wurde die Auswirkung der Anregungsdichten auf die Fluoreszenzdynamik analysiert: Bei hohen Anregungsdichten treten spektrale und dynamische Änderungen in der Fluoreszenz auf, die Mehrphotonenprozessen zugeordnet werden können. Diese Mehrphotoneneffekte erklären bestehende Diskrepanzen in der Literatur. Nur für niedrige Anregungsdichten sind lineare und native Anregungsbedingungen gewährleistet, unter denen sich ein biexponentielles Verhalten ergibt. Dabei wurde zum ersten Mal ein dynamischer Stokesshift beobachtet, der auf einen schnellen Umordnungsprozess auf der reaktiven Potentialfläche hindeutet. Ferner wurde der erste schnelle Prozess (
Phasengekoppelte, weit abstimmbare 7-fs-Lichtimpulse zur Untersuchung ultraschneller molekularer Dephasierung
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/05
Zur Untersuchung ultraschneller molekularer Quantendynamik und deren Dephasierung werden erstmals extrem kurze Lichtimpulse erzeugt, die aus nur wenigen Zyklen des elektrischen Feldes bestehen und sowohl im Sichtbaren als auch im Ultravioletten weit abstimmbar und untereinander phasengekoppelt sind. Im Sichtbaren gelingt die Erzeugung von 7-fs Impulsen durch nichtkollineare optisch-parametrische Verstärkung eines Weißlicht-Kontinuums und adaptive Kompression mit einem deformierbaren Spiegel in der Fourier-Ebene. Durch geeignete zeitliche Streckung aller beteiligten Impulse (optical parametric chirped pulse amplification) kann die spektrale Breite der Impulse stark erweitert und darüber hinaus leicht an experimentelle Fragestellungen angepasst werden. Bei einer hohen Repetitionsrate von 4 MHz werden nahinfrarote 12-fs Impulse mit Hilfe von cavity-dumping und Dauerstrich-Nachverstärkung erzeugt. Die Impulse haben eine ausreichende Intensität zur Erzeugung eines stabilen Weißlicht-Kontinuums in Saphir. Die spektrale Bandbreite von kollinearen optisch-nichtlinearen Frequenzmischprozessen ist generell durch die Phasenanpassung zwischen den beteiligten Wellen limitiert. Diese Beschränkung kann mit einem neuartigen Konzept zur achromatischen Phasenanpassung um zwei Größenordnungen überwunden werden. Dadurch gelingt erstmals die Erzeugung weit abstimmbarer ultravioletter 7-fs Impulse durch Frequenzverdopplung von spektral geeignet aufgespalteten Lichtfeldern. Diese Impulse sind die bisher kürzesten im ultravioletten Spektralbereich und eine Erzeugung von 2.5-fs-Impulsen ist möglich. Alternativ können ultraviolette 20-fs Impulse mit höherer Energie und größerem Abstimmbereich auch durch gestreckte Summenfrequenzmischung erzeugt werden. Ein neuartiges interferometrisches Messkonzept, zero-additonal-phase SPIDER, erlaubt erstmals die vollständige Charakterisierung der zeitlichen Impulsform und der spektralen Phase der extrem kurzen ultravioletten, sichtbaren und nahinfraroten Impulse direkt am Ort eines spektroskopischen Experiments. Die zeitlichen Eigenschaften der Impulse werden dabei erstmals durch die Messung nicht beeinflusst. Die interferometrische Kalibrierung erfolgt im bestehenden Aufbau und die Konsistenz der Messung kann mit einfachen Tests kontrolliert werden. Alternativ ermöglicht eine Autokorrelationsmessung ohne optischen Strahlteiler die dispersionsfreie Messung von Impulsdauern für sichtbare bis nahinfrarote sub-10-fs Impulse in einem besonders kompakten Aufbau. Unter Berücksichtigung von höheren Ordnungen der spektralen Phase wird eine analytische Theorie der Frequenzverdopplung entwickelt, die eine häufig beobachtete Frequenzverschiebung und über die Phasen-fehlanpassung hinausgehende spektrale Einengung erklärt. Theorie und Experiment zeigen, dass sich die verschiedenen Ordnungen der spektralen Phase unabhängig voneinander zur zweiten Harmonischen übertragen und höhere Ordnungen dabei unterdrückt werden. Das erlaubt die Erzeugung von nahezu Fourier-limitierten ultravioletten sub-20-fs Impulsen durch ausschließliche Kompression im Sichtbaren und durch Frequenzverdopplung zeitlich gestreckter Impulse. Die Impulse aus zwei getrennten parametrischen Verstärkern weisen zeitliche Schwankungen von weniger als einer Femtosekunde auf und sind zueinander phasenstarr. Die Phase der verstärkten Impulse ist nur durch die Phase des als Saat-Licht verwendeten Weißlicht-Kontinuums bestimmt. Dessen restliche Phasenfluktuationen sind direkt mit der Intensität des Pumpimpulses gekoppelt und einfache Überlegungen zur Filamentbildung erklären die Großenordnung und das Vorzeichen dieser Zusammenhänge. Die relativen Schwankungen der carrier-envelope-Phase können durch räumliche Interferometrie für jeden Einzelimpuls gemessen und mit experimentellen Daten korreliert werden. Für Impulszüge bei verschiedenen Wellenlängen wird eine relative Phase definiert und mit Hilfe eines optisch-nichtlinearen Interferometers gemessen, das auf kohärenter Anti-Stokes-Raman-Streuung basiert. Getrennte Spektralkomponenten eines Weißlicht-Kontinuums aus Saphir erweisen sich in hohem Maße als zueinander phasenstarr. Dies erlaubt die Erzeugung von weit abstimmbaren Impulszügen mit fester Phasenbeziehung trotz unterschiedlicher Zentralwellenlänge. Molekulare Quantenzustände verlieren ihre elektronischen und Schwingungs-Kohärenzen innerhalb kür-zester Zeit an die Lösungsmittelumgebung und makroskopische Polarisationen zerfallen durch homogene und inhomogene Dephasierung. Mit den nun verfügbaren kurzen Impulsen werden die Mechanismen der extrem schnellen elektronischen Dephasierung von verschiedenen Farbstoffen in Lösung durch Photon-Echo-Messungen untersucht. Es zeigt sich, dass die Dephasierungszeit von elektronischen Kohärenzen von der Flexibilität oder Starrheit der Molekülstruktur abhängt. Mit den phasengekoppelten Impulsen kann außerdem die unterschiedliche Dephasierungszeit von verschiedenen Schwingungsmoden ausgenutzt werden, um unter-schiedliche Moleküle trotz überlappender Energiebänder durch zeitlich verzögerte Heterodyn-Detektion zu unterscheiden. In der Raman-Mikroskopie wird dieser Effekte als neuartiger Kontrastmechanismus zur untergrundfreien und molekülspezifischen Bildgebung ausgenutzt.
Experimente mit einer linearen Ionenkette zur Realisierung eines Quantencomputers
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/05
Die in dieser Arbeit dargelegten Ergebnisse befassen sich mit Experimenten, welche den Mg-In-Ionenfallen-Quantencomputer zum Endziel haben. Als logisches Schaltelement eines solchen Quantencomputers kommen sowohl die Cirac-Zoller- als auch die Sörensen-Mölmer-Version eines CNOT-Gatters in Frage. In beiden Fällen müssen die Ionen durch Laserstrahlung gekühlt werden. Während das Cirac-Zoller-Gatter Grundzustandskühlung erfordert, wird beim Sörensen-Mölmer-Gatter lediglich der wesentlich einfacher zu erreichende Lamb-Dicke-Bereich benötigt. Aufgrund der Tatsache, daß zwei verschiedene Ionensorten für unterschiedliche Aufgaben verwendet werden, kombiniert man deren Vorzüge optimal miteinander. Zur direkten Seitenband-Kühlung verwendet man In, mit dem in unserer Arbeitsgruppe bereits Grundzustandskühlung demonstriert worden ist. Quanteninformation soll in den Mg-Ionen gespeichert werden. Da beim Sörensen-Mölmer-Gatter, solange man sich im Lamb-Dicke-Bereich befindet, die Quantenrechnung nicht von der thermischen Bewegung der Ionen abhängen, kann der heterogene Ionenkristall durch die Indiumionen kontinuierlich gekühlt werden, ohne daß die in den Mg-Ionen gespeicherte Quanteninformation dadurch beeinflußt wird. Dadurch kann die Dekohärenz der Schwingungsmoden minimiert, und die Anzahl möglicher Quantenoperationen maximiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde von Grunde auf ein neues Experiment geplant, aufgebaut und zahlreiche Versuche dazu durchgeführt. Es wurde ein völlig neuer, komplexer Vakuumrezipient entworfen und gebaut. Im Inneren des Vakuumrezipienten wurde ein schwingungsgedämpfter Aufbau einer neuartigen, selbstjustierenden Ionenfallenhalterung inklusive verbesserter Atomofenhalterung in ein kompaktes Gesamtsystem integriert. Die Falle wurde für die Speicherung zweier Ionensorten optimiert. Mit der linearen Endkappenfalle wurden zuerst Mg-Ionenkristalle erzeugt. Bei den Experimenten mit Indium konnten Mg-In-Wolken nachgewiesen werden, sowie sympathetische Kühlung von Indium durch die direkt lasergekühlten Magnesiumionen. In der neuen Vierstabfalle wurden zuerst Experimente mit einem Sekundärelektronen-Vervielfacher bei Kühlung mit Puffergas durchgeführt, wobei Speicherung von Magnesiumionen sowie von Dunkelionen aus dem Restgas nachgewiesen werden konnte. Bei diesen Messungen wurde gleichzeitig die Falle charakterisiert. Es wurden Stabilitätsdiagramm, radiale und axiale Schwingungsfrequenzen gemessen. Darüber hinaus wurden in der neuen Ionenfalle Magnesium-Ionenkristalle gespeichert und nachgewiesen. Die im Vergleich zur linearen Endkappenfalle wesentlich verbesserte Mikrobewegungskompensation demonstriert die Überlegenheit der automatischen Justage der neuen Ionenfalle.