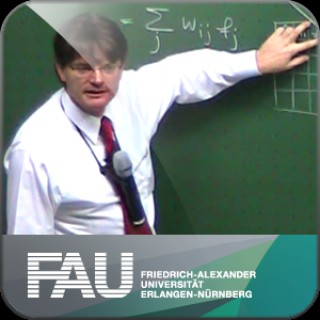Podcasts about morphologisch
- 8PODCASTS
- 8EPISODES
- 1h 8mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jul 20, 2021LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about morphologisch
dMMP dMMM' MM/ dMMm. dMMP'_---. _| _ p ;88;`. ,db; p > ;8P| `. (``T8b,__,'dP | | | `Y8b..dP ;_ | | |`T88P_ / `; :_.-~|d8P'`Y/ / _ TP ; 7` ,,__ > `._ /' / `_ `._ """"~~~~------|`;' ; ,' """~~~-----~~~'__[|;' _.-' ` ;--..._ .-'-._ ; / /`~~"' ,'`_ ,/ ;_ /' / ,/ | `~-l ; / ` ; /.._| /`---'; `----' ( / `---' Und für das Clickbaiting: Bananen, Siebträger, Tom Schilling, Pro7
Wertigkeit eines morphologisch-funktionellen, nicht invasiven Diagnosekonzeptes bestehend aus Multidetektor-Computer-Tomographie-Angiographie und Myokard-Perfusions-Szintigraphie in der Diagnostik der Koronaren Herzerkrankung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Thu, 29 May 2008 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/8589/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/8589/1/Matthiesen_Florian.pdf
Untersuchungen zur physiologischen Rolle der CNGB1-Untereinheit im Riechprozess anhand einer CNGB1-defizienten Mauslinie
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Zyklonukleotid-aktivierte Kationenkanäle (CNG-Kanäle) spielen eine Schlüsselrolle im Seh- und Riechprozess. Der olfaktorische CNG-Kanal besteht aus den Untereinheiten CNGA2, CNGA4 und CNGB1b. Sowohl CNGA4 als auch CNGB1b können in heterologen Expressionssystemen nur zusammen mit CNGA2 funktionelle Kanäle bilden. Sie werden auch als modulatorische Untereinheiten bezeichnet, da sie dem CNG-Kanal charakteristische Eigenschaften verleihen. In der vorliegenden Arbeit sollte die Rolle von CNGB1b im Riechprozess anhand einer CNGB1-defizienten Mauslinie (CNGB1KO-Maus) untersucht werden. CNGB1KO-Mäuse zeigten im Vergleich zu gleichaltrigen Wildtyp-Mäusen ein deutlich eingeschränktes Riechvermögen. Dieses äußerte sich in verringertem Körpergewicht, schlechterem Abschneiden in einem Riechtest und einem veränderten Elektroolfaktogramm (EOG). EOGs von CNGB1KO-Mäusen zeigten verglichen mit WT-Mäusen ein verzögertes Einsetzen, eine verkleinerte Amplitude und eine verlangsamte Rückbildung der Duftantwort. Als Ursache für die verzögert einsetzende Reizantwort konnte eine verringerte Sensitivität des CNG-Kanals gegenüber zyklischen Nukleotiden ausgemacht werden. Die verkleinerte Amplitude im EOG konnte durch eine verringerte Menge an Kanalprotein erklärt werden, was einen um Faktor zehn verminderten CNG-Strom zur Folge hatte. Das verlangsamte Abklingen der Duftantwort konnte auf ein Fehlen der Calcium-Calmodulin-abhängigen Inaktivierung des CNG-Stroms zurückgeführt werden. Eine Interaktion von CNGA2 und CNGA4 in CNGB1-defizienten Neuronen wurde durch Co-Immunpräzipitation nachgewiesen. Mittels immunhistochemischer Färbungen wurde gezeigt, dass CNGA2 und CNGA4 zwar assemblierten, nicht aber in die Zilienmembran der ORNs transportiert wurden. Vielmehr wurde der CNGA2/CNGA4-Kanal in subziliären Zellkompartimenten zurückgehalten. Der Versuch, die Translokation in das Zilium durch Hemmung des proteolytischen Abbaus der CNG-Untereinheiten zu ermöglichen, war nicht erfolgreich, was auf eine streng reglementierte Qualitätskontrolle in olfaktorischen Rezeptorneuronen schließen ließ. Morphologisch unterschied sich das olfaktorische System von CNGB1KO-Mäusen verglichen mit dem Wildtyp durch eine Reduktion der Schichtdicke des olfaktorischen Epithels sowie einen verkleinerten Bulbus olfactorius. Neurone des Bulbus olfactorius von CNGB1-defizienten Mäusen waren bezüglich ihrer Duftantwort nicht von Wildtyp-Neuronen zu unterscheiden. Für die Bedeutung der CNGB1b-Untereinheit kann festgehalten werden, dass sie dem olfaktorischen CNG-Kanal charakteristische Eigenschaften wie erhöhte Empfindlichkeit gegenüber zyklischen Nukleotiden, die Fähigkeit zur Calcium-Calmodulin-abhängigen Inaktivierung und kontrolliertes Single Channel Flickering verleiht. Zudem spielt die CNGB1b-Untereinheit zusammen mit CNGA4 eine essentielle Rolle für den Transport des CNG-Kanals in die Zilienmembran der ORNs. Darüber hinaus ist CNGB1b unentbehrlich für eine normale Entwicklung des olfaktorischen Systems.
Maireina W.B. Cooke. Morphologisch-anatomische Untersuchungen an einer Gattung cyphelloider Homobasidiomyceten
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Maireina W.B. Cooke is a representative of the so-called cyphelloid homobasidiomycetes. The members of this group of fungi produce minute (in most taxa about 1 mm in length and diameter), cup-, barrel-, or tube-shaped, typically pendant fruiting bodies with a smooth, even hymenophore that lines their concave inner surface and special external surface hyphae. Morphological and anatomical characters of cyphelloid homobasidiomycetes and their taxonomic relevance are outlined. Traditional concepts as well as the current state of knowledge of relationships and phylogeny of cyphelloid forms are summarized. A comprehensive key to the genera of cyphelloid homobasidiomycetes is presented. Due to its species composition the genus Maireina sensu COOKE 1962 represents a heterogenous assemblage of species that have to be accommodated in different taxa. Based on exhaustive anatomical studies Maireina W.B. Cooke is being revised. It is maintained as genus of its own and defined by features of the surface hyphae of the fruiting bodies. The representative morphological and anatomical characters of Maireina are described and its delimitation from anatomically similar taxa is discussed. Besides two species that previously had been transferred to Nochascypha Agerer another 13 of the original Maireina-species sensu COOKE are excluded or put into synonymy. Thorough descriptions accompanied by detailed drawings are given for the species that are interpreted as representatives of Cyphellopsis Donk or Merismodes Earle, respectively. A key to the species of the emendated genus Maireina is presented. The species are described and illustrated in detail and discussed at length. Maireina attenuatipilis und M. afibulata are proposed as new species.
Wirkung ionisierender Strahlung auf verschiedene Lungengewebe epithelialen Ursprungs
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
In der vorliegenden Arbeit sollte die Auswirkung unterschiedlicher Strahlendosen auf verschiedene Kultivierungsformen der Bronchialschleimhaut und eine Lungenkarzinomzelllinie untersucht werden. Untersuchungen zur Wirkung ionisierender Strahlen auf normales Bronchialepithel sind eher selten, obwohl die Affektion von tumorfreiem umgebendem Gewebe eine wichtige Rolle bezüglich der Nebenwirkungen einer Radiotherapie spielt. Gerade im palliativen Bereich, in dem die endoluminale Bestrahlung von Bronchus-Stenosen einen wichtigen Faktor für die Verbesserung der Lebensqualität darstellt, ist durch den engen Kontakt der Strahlenquelle zum gesunden Bronchialepithel eine Strahlenauswirkung gegeben. Die bisherige Datenlage legt eine relativ hohe Strahlentoleranz des Bronchialepithels nahe. Ob sich diese Ergebnisse bestätigen lassen, sollte anhand verschiedener Bronchial-Epithel-Kultivierungsformen untersucht werden. Primäres Ziel der Untersuchung war die Frage, ob die Art der Kultivierung einen Einfluss auf die Effektivität ionisierender Strahlen hat und ob Tumorzellen eine andere Reaktion zeigen. Die verwandten Modelle waren: - BEAS-2B Zelllinien - Primärkulturen aus Patientenmaterial - dreidimensionale Organkulturen - EPLC-32M1 Tumorzelllinien Als „handelsübliche“ Bronchialepithel-Zelllinie zur Monolayer-Kultivierung wurden die BEAS-2B-Zellen verwendet, hier handelt es sich um immortalisierte, humane bronchoepitheliale Zelllinie, die mit einem Adenovirus 12-SV40 Virus-Hybrid transfiziert war. Zwar sind viele Eigenschaften der normalen Bronchialschleimhaut in diesem Modell vorhanden, aber auch genetische Abweichungen wie Veränderungen des Chromosomensatzes sind beschrieben. Mit zunehmender Passagezahl können die Zellen auch eine kanzerogene Wirkung zeigen. Zum direkten Vergleich wurden Primärkulturen aus Patientenmaterial gewonnen, welche als Monolayer kultiviert wurden. Problematisch war hier die schwierige Kultivierbarkeit. Die dreidimensionalen Organkulturen stellen vom Aufbau her eine in vivo-nahe Kulturform dar. Zentrum der Organkultur ist ein bindegewebiger Kern, welcher von einem respiratorischen Epithel umgeben ist. Morphologisch ist das kultivierte Epithel nicht von dem in vivo zu unterscheiden. Als Tumormodell wurde eine EPLC-32M1 Zelllinie verwandt, die wie die BEAS-2B Linie und die Primärkulturen als Monolayer wachsen. Hier handelt es sich um eine squamöse Karzinom Zelllinie, deren Ursprungsgewebe ein Plattenepithelkarzinom der Lunge war. Die Ähnlichkeit zum Primärtumor ist nur noch gering ausgeprägt. Bekannterweise gehört das Plattenepithelkarzinom der Lunge zu den nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen, welche im Vergleich zu Kleinzellern nur eine geringe Strahlensensitivität aufweisen. Als Parameter für die Zellschädigung wurde die Lactatdehydrogenase verwandt, ein zytoplasmatisches Enzym, welches bei Zellmembranläsionen freigesetzt wird. Mit der LDH steht ein klinisch häufig eingesetzter, etablierter Parameter zu Detektion von Zellschäden zur Verfügung. Hier konnte eine Bestimmung im Kulturmedium erfolgen, wodurch Verlaufsbeobachtungen ohne Beeinflussung der Kulturen möglich waren. Ferner wurde die Zellzahlen nach Bestrahlung ermittelt, um eine Aussage über das Zellüberleben machen zu können. Zusammenfassung der Ergebnisse: - Die Organkulturen und Primärkulturen zeigten nach einer Latenz von 48 Stunden nach der Bestrahlung eine gesteigerte LDH-Aktivität, die hier gleichzeitig ihr Maximum erreichte. - Bei der BEAS-2B Linie kam es innerhalb der ersten 24 Stunden zu einem deutlichen LDH-Anstieg. - Tumorzellen zeigten ein gänzlich anderes Verlaufsmuster bezüglich der LDH. Hier kam es nach 3 Tagen zu einem kontinuierlichen Anstieg. - Die Zellzahlen im Organkulturmodell wiesen 4 Tage nach Bestrahlung keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsgruppen auf. - Bei den Primärkulturen und den BEAS-2B Zellen fand sich in den bestrahlten Gruppen eine signifikant, nicht dosisabhängig erniedrigte Zellzahl. - Im Tumorzell-Modell war dosisabhängig eine Zellzahlminderung in den bestrahlten Gruppen zu beobachten. Schlussfolgerungen: Sowohl vom LDH-Verhalten, als auch von den Ergebnissen der Zellzahlbestimmung zeigten sich die dreidimensionalen Organkulturen wenig anfällig für die Wirkung ionisierender Strahlen. Nachdem dieses Modell die in vivo-Situation gut wiederspiegelt, unterstützen die Ergebnisse die Daten, welche eine hohe Strahlentoleranz von Bronchialepithel nahe legen. Von den übrigen Kultivierungsformen scheinen die aus Patientenmaterial gewonnenen Primärkulturen die höchste Strahlenresistenz aufzuweisen, wahrscheinlich sind hierfür Zelleigenschaften verantwortlich, die in den gentechnisch veränderten Zelllinien nicht mehr in der Art und Weise ausgeprägt sind wie in vivo. So nehmen viele intrazelluläre Faktoren wie Zytokine, Wachstumsfaktoren, Proteinkinasen oder auch Onkogene Einfluss auf die Strahlensensibilität einer Zelle. Entscheidend scheint besonders der p53- Status zu sein. Am strahlensensitivsten zeigten sich die BEAS-2B und die EPLC-32M1 Linien. Das hängt womöglich mit der Veränderung des genetischen Materials durch die Immortalisationsprozesse und die im Vergleich höhere Proliferationsrate zusammen. Möglich ist auch eine erhöhte Strahlensensibilität aufgrund des im Vergleich zu den Organkulturen schwächer ausgeprägten Zell-Zell-Kontaktes, der fehlenden dreidimensionalen Struktur und dem geringeren Anteil differenzierter Zellen. Nicht außer Acht lassen darf man individuelle Einflüsse, welche womöglich in den von Patientenmaterial stammenden Kulturen eine Rolle spielen. Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass der dreidimensionale Aufbau und die hierarchische Struktur des Bronchialepithels maßgeblich die Strahlensensibilität beeinflussen. Monolayer sind zur Untersuchung von Strahlenfolgen in vivo nur sehr bedingt geeignet. Ausblick auf zukünftige Fragestellungen: Nachdem in der vorliegenden Arbeit nur eine Tumorzelllinie untersucht wurde, wäre es von Interesse, die Auswirkung ionisierender Strahlung auf verschiedene Lungenkarzinom- Zelllinien zu vergleichen, welche in vivo deutliche Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit aufweisen. Anbieten würde sich hier der Vergleich mit strahlensensiblen kleinzelligen Bronchialkarzinom. Möglicherweise kann auch hier eine dreidimensionale Kultivierung von Tumorzellen aus Patientenmaterial etabliert werden, um einen größeren Zell-Zell-Kontakt im Tumor-Modell zu ermöglichen. Auch wäre hier durch die fehlenden gentechnischen Veränderungen eine bessere Vergleichbarkeit mit der in vivo- Situation möglich. Auch die Untersuchung von Ko-Kulturen aus normaler Bronchialschleimhaut und verschiedenen Bronchialkarzinomzelllinien bietet die Möglichkeit, Auswirkungen von Interaktionen zwischen Normalgewebe und Tumorgewebe nach Einwirkung ionisierender Strahlen näher zu eruieren. Dieses Modell käme der Situation beim Patienten am nächsten. Interessant wäre in diesen Modellen auch die Überprüfung weiterer Zelltod-Parameter. So könnten hier verschiedene Apoptosemarker wie zum Beispiel die Nukleosomen im Überstand verschiedener Ko-Kulturmodelle bestimmt werden, um eine bessere Aussage über das Ausmaß der Zellschädigung zu erhalten. Im Kontext mit der Untersuchung von Nukleosomen scheint auch die Bestimmung von Calcium eine sinnvolle Ergänzung darzustellen. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, das Verhalten von Zellkulturen nach Bestrahlung, gerade hinsichtlich einer möglichen Resistenzbildung zu untersuchen.
Die Gattung Russula
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Für die vorliegende Arbeit wurden 59 Ektomykorrhizen aus der Gattung Russula und drei Ektomykorrhizen aus der Gattung Lactarius morphologisch und anatomisch charakterisiert. Für die Identifizierung der Mykorrhizen wurden die DNA der Fruchtkörper und der Mykorrhizen isoliert. Mit den pilzspezifischen Primerpaaren ITS1/ITS2 und ITS1F/ITS4B wurde die ITS-Region der ribosomalen Kern-DNA mittels PCR amplifiziert. Mit vier Restriktionsenzymen wurde eine RFLP-Analyse durchgeführt. Alle Mykorrhizen ließen sich eindeutig durch den Vergleich der so erhaltenen Bandenmuster den Fruchtkörpern zuordnen. Das Enzym Taq I zeigte die größte Spezifität, mit ihm konnten auch sehr nah verwandte Arten getrennt werden. Zusammen mit den bereits in der Literatur beschriebenen Ektomykorrhizen sind damit insgesamt 56 Arten und eine Varietät aus Europa berücksichtigt. Dies entspricht ca. einem Drittel der in Mitteleuropa vorkommenden Russula-Arten. Zehn außereuropäischer Arten aus Afrika, Nord- und Südamerika ergänzen das Bild.. Die einzelnen morphologischen und anatomischen Merkmalskomplexe der Mykorrhizen und Rhizomorphen wurden ausführlich besprochen und mit denen der Fruchtkörper verglichen. Die Mykorrhizen der Schwestergattung Lactarius und weiterer Gattungen wurden ihnen gegenübergestellt. Die Mantelstrukturen der Mykorrhizen besitzen die meisten Merkmale, die sich zur Lösung systematische Fragestellungen eignen. Eine herausragende Rolle spielen hierbei die für die Russulaceae typischen gloeopleren Elemente. Sie können in den Mykorrhizen der Gattung Russula als Gloeocystiden oder als gloeoplere Zellen vorliegen. Man kann die Mykorrhizen danach in zwei Hauptgruppen einteilen: In solche die Cystiden besitzen und in solche die keine besitzen. Diese Zweiteilung entspricht aber nicht der bekannten in Compactae und Genuinae, die sich als künstlich erwiesen hat. Beiden Gruppen lassen sich noch weiter unterteilen. Mykorrhizen mit Cystiden: · Die Sektion Gossypinae, mit R. gossypina aus Madagaskar, unterscheidet sich von allen anderen Mykorrhizen der Gattung durch eine wollige Manteloberfläche. Hierin sieht sie jenen von Lactarius piperatus sehr ähnlich. · Die Mykorrhizen der Sektionen Compactae und Lactarioides besitzen Gloeocystiden, die zwei apicale Knöpfchen tragen. Sie sind dennoch voneinander zu trennen, da der Aufbau der mittleren Mantelschichten sehr verschieden ist. · Für R. fuegiana aus dem südlichen Südamerika ist aufgrund der einzigartigen Mykorrhizamäntel eine eigene Sektion “Fuegianae” zu schaffen. · Die Eigenständigkeit der Sektion Delicoarchaeae mit der Art R. aucarum (Bolivien) wird auch durch die Besonderheiten der Mykorrhizen bestätigt. · Die Sektion Heteropyllae lässt sich durch das Vorhanden sein von Nadelcystiden definieren. Ihre Subsektionen Heteropyllae, Griseinae, Ilicinae, Virescentinae, Amoeninae und Pseudoepitheliosinae (R. aff. parasitica aus Kamerun) unterscheiden sich in Form der Nadelcystiden, Vorhandensein von Gloeocystiden und Aufbau der mittleren Mantelschicht. · Auf Grund ihrer hyphenartigen Cystiden ist R. cyanoxantha aus der Sektion Heteropyllae in eine eigene Sektion Indolentes gestellt worden. · Die Sektion Ingratae zeigt eine einheitliche Flaschenform der Gloeocystiden. Die Subsektionen Foetentinae und Pectinatinae unterscheiden sich in der mittleren Mantelschicht, die Sekt. Subvelatae in zusätzlichen Nadelcystiden. · Erstmals sind mit R. acriannulata und R. aff. radicans aus West Afrika Mykorrhizen aus der Sektion Crassotunicatae, Subsekt. Aureotactinae beschrieben. Mykorrhizen ohne Cystiden: · Es können Mykorrhizenmäntel aus angulären Zellen und Mäntel aus puzzelteilartigen Zellen mit einem Hyphennetz auf der Außenseite unterschieden werden. · Die Sektion Russula - wie sie hier aufgefasst wird - ist durch anguläre Mantelzellen bestimmt. Die Mäntel der Subsektionen Russula und Atropupurinae unterscheiden sich durch ihr Zellmuster. · R. ochroleuca und R. viscida stehen mit einer eigenen Subsekt. Ochroleucinae in der Sekt. Russula. Beide besitzen ein gelbes Pigment in der Mykorrhizenausenseite, das sich mit KOH rot färbt. · R. fellea Subsekt. Felleinae gehört ebenfalls in die Sekt. Russula. · R. raoultii wird aus der Sekt. Citrinae in die Subsekt. Russula gestellt. · Alle untersuchten Arten der europäischen Sektionen Firmae, Rigidae Tenellae Insidiosinae, Viridantes, Alutaceae, Integrinae und Amethystinae besitzen Mykorrhizen mit puzzelteilartigen Mantelzellen und Hyphennetz. Sie lassen sich auf Grund der Ausprägung des Hyphennetzes und der Form der äußeren Mantelzellen zwar trennen, aber die Unterteilung ist nicht in allen Fällen so eindeutig wie in den anderen Gruppen.. · Für die südamerikanische R. nothofaginea wird die neue Sektion Nothofagineae vorgeschlagen. Die für die Gattung Russula typischen Rhizomorphen besitzen Gefäßhyphen und sogenannte leiterartige Hyphen im inneren Teil. Wenn die Mykorrhizen Cystiden tragen, ist dies auch bei den Rhizomorphen der Fall. Die Übereinstimmungen und Unterschiede dieser so erzielten Einteilung der Gattung Russula zu den bestehenden Systemen von ROMAGNESI, SINGER, BON und SARNARI wurden diskutiert. Der Vergleich mit molekulartechnisch gewonnenen Hypothesen zur Phylogenie der Gattung aus der Literatur ergab, dass diese weitestgehend mit den anatomischen Ergebnissen korrespondieren. Eine Besonderheit in der Lebensweise wurde für die beiden Mitglieder der Sekt. Firmae, Subsekt. Exalbicantinae, R. exalbicans und R. gracillima, aufgedeckt. Sie bilden zusammen mit den Arten Lactarius pubescens und L. torminosus, Subgenus Piperites, Sekt. Piperites, sogenannte Doppelmykorrhizen. Morphologisch und anatomisch gleichen diese den Mykorrhizen des jeweiligen Lactarius. Nur im Hartigschen Netz ist die Beteiligung der Russula erkennbar. Mit molekularen Methoden lässt sich die DNA beider Partner, Lactarius und Russula, in den Doppelmykorrhizen nachweisen. Ein Bestimmungsschlüssel ermöglicht die Identifizierung aller behandelten Ektomykorrhizen anhand anatomischer Merkmale auf Sektions-, Subsektions- und Artebene. Die vorgelegte Arbeit konnte exemplarisch zeigen, wie wichtig die Merkmale der Ektomykorrhizen und Rhizomorphen für die Lösung systematischer Fragestellungen sind. Bei zukünftigen Arbeiten sollten deshalb die unterirdischen Strukturen immer mitberücksichtigt werden.