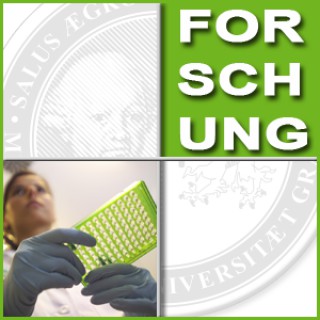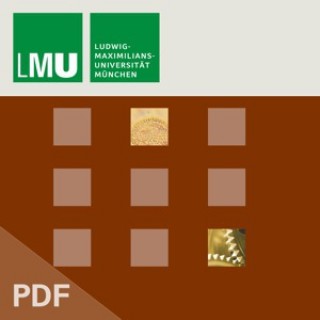Podcasts about enzym
- 71PODCASTS
- 94EPISODES
- 28mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 9, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about enzym
Latest podcast episodes about enzym
Die Mär von furzenden Klimakuh – warum Methan kein Monster ist - TE Wecker am 09.11.2025
Die Mär von furzenden Klimakuh – warum Methan kein Monster ist Kaum ein Tier wurde in den vergangenen Jahren so dämonisiert wie die Kuh. Ihr wird vorgeworfen, mit jedem Rülpser das Klima zu zerstören. Dabei ist das Bild von der „furzenden Klimakuh“ wissenschaftlich falsch und politisch überzeichnet. Methan entsteht bei der Verdauung von Pflanzenfasern durch Mikroben im Pansen – ein natürlicher Prozess, der seit Millionen Jahren existiert und den Kohlenstoffkreislauf stabil hält. Die Kuh „produziert“ also kein neues Treibhausgas, sie setzt nur frei, was das Gras zuvor der Luft entzogen hat. Trotzdem soll nun ein Zusatzmittel namens Bovaer Abhilfe schaffen. Es blockiert im Pansen der Kuh das Enzym, das Methan freisetzt, und senkt so die Emissionen um ein Drittel. Doch Kühe sollen bereits erkrankt im Stall umgefallen sein, Verbraucher kippen die Milch dieser Kühe in den Ausguss. Ungeprüft gingen diese Märchen durch Medien. Dabei entsteht Methan nicht zufällig, sondern erfüllt im Pansen eine Funktion: Es entfernt Wasserstoff, der bei der Fermentation entsteht. Wird dieser Weg blockiert, muss der Stoffwechsel andere, teils instabilere Umwege gehen. Die Euphorie über das „klimafreundliche Rind“ blendet aus, dass Methan ein kurzlebiges Gas ist, das sich nach rund zwölf Jahren von selbst abbaut. Seine Konzentration bleibt stabil, solange Tierzahlen und Futterbasis gleichbleiben. Von einer „Erschöpfung des Klimabudgets“ kann also keine Rede sein. Methan ist Teil des natürlichen Atems der Erde – von Sümpfen, Mooren, Böden und Tieren. Ein TE Wecker über Methan, Mikroben und Missverständnisse – die Wahrheit über die Kuh als Klimasünderin. Webseite: https://www.tichyseinblick.de
Das Unternehmen c-LEcta entwickelt Enzyme, die dann unter anderem in der Lebensmittelproduktion zum Einsatz kommen. Nun ist die Firma in ein neues Quartier in Leipzig umgezogen. Die Erfolgsgeschichte eines Startups.
400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr – aber kein Plan, wohin damit. Während in Genf um ein UN-Abkommen gerungen wird, findet Christian auf einem Leipziger Friedhof ein Enzym, das Plastik zersetzen kann. Aber ist das die Lösung?**********Ihr hört: Moderation: Marcel Bohn Gesprächspartner: Christian Sonnendecker, Biochemiker an der Uni Leipzig Gesprächspartnerin: Jule Reimer, Deutschlandfunk Umwelt- und Verbraucherredaktion**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: TikTok und Instagram .**********Ihr habt Anregungen, Wünsche, Themenideen? Dann schreibt uns an Info@deutschlandfunknova.de
In dieser Hörgang-Episode spricht Prof. Dr. Georg Stary von der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien über aktuelle Entwicklungen in der Behandlung von Psoriasis. Im Fokus steht das neue Christian-Doppler-Labor für chronisch-entzündliche Hautkrankheiten, das Stary leitet – ein Projekt, das akademische Forschung mit industrieller Expertise verbindet. Ein zentrales Thema des Gesprächs ist die Rolle der T-Zellen im Immunsystem und deren Fehlsteuerung bei der Schuppenflechte. Prof. Stary erklärt anschaulich, wie bestimmte Botenstoffe wie Interleukin-17 und -23 die Entzündungsreaktion vorantreiben – und wie neue Therapien gezielt in diesen Prozess eingreifen können. Besonders vielversprechend: Ansätze, die nicht nur die Symptome lindern, sondern das Gleichgewicht des Immunsystems nachhaltig wiederherstellen. Ein neu entdecktes Enzym könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Darüber hinaus gibt Stary Einblicke in aktuelle Studien, den Einfluss von Umweltfaktoren wie Fettleibigkeit und das Potenzial, diese Erkenntnisse auch auf andere chronisch-entzündliche Erkrankungen zu übertragen. Eine informative Episode für alle, die moderne Dermatologie und translationalen Fortschritt hautnah erleben wollen.
Nattokinase und Anthocyane, Gefässchutz und Auflösung von S-Proteinen?
Die Blutgefäße sind unser unsichtbares Lebensnetzwerk – doch erst, wenn Probleme auftreten, wird uns bewusst, wie wichtig sie sind. Können Nattokinase und Anthocyane gezielt dazu beitragen können, die Gefäßgesundheit zu erhalten? Können wir damit die SpikeProteine wirklich auflösen? Nattokinase ist ein hochaktives Enzym, das helfen kann, Mikrogerinnsel abzubauen und das Blut fließfähiger zu machen – ein zentraler Faktor für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Anthocyane aus wilden Blaubeeren neutralisieren oxidativen Stress, wirken entzündungshemmend und fördern die Durchblutung – wissenschaftlich belegt. https://mentoren-verlag.de/werke/gesund-sterben-das-ist-moeglich-das-buch/ Das Hörbuch "Gesund sterben" gibt es z. B. bei Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/album/7KLQDQBdUS9aTFPB9EL8LB?si=MmcqRgoiTdKWg_CUYEfWcw PODCAST: https://juttasuffner.podigee.io/ DANKE für Eure positive Rezession https://www.provenexpert.com/blueantoxr-jutta-suffner/ BEERENSTARKER Zellschutz https://blueantox.com 10% RABATT : https://blueantox.com/discount/YT10
#172 Können Vitalstoffe schaden? - Risiken und Nebenwirkungen von Überdosierung und falscher Anwendung
In dieser aufschlussreichen Episode widmen wir uns der Frage, ob Vitalstoffe schaden können und welche Risiken eine Überdosierung oder falsche Anwendung mit sich bringen. Du erfährst, wie die Balance von #vitalstoffe entscheidend für deine Gesundheit ist und warum zu viel des Guten auch schädlich sein kann. Wir beleuchten spezifische Vitalstoffe wie #selen und seine Wirkung auf die #gluthationperoxidase, ein wichtiges Enzym zur Bekämpfung von #ros (reaktiven Sauerstoffspezies). Ebenso diskutieren wir die Rolle von #vinamina und anderen Nährstoffen sowie ihre mögliche Beziehung zu #akne und anderen Hautproblemen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Folge ist der Einfluss von #medikamente, insbesondere #cortison, auf den Vitalstoffhaushalt und wie sie das Gleichgewicht deines Körpers beeinträchtigen können. Du erhältst wertvolle Tipps, wie du die richtige Dosierung findest und deine Gesundheit optimal unterstützt. Möchtest Du diesen Podcast finanziell unterstützen? Danke! Nutze ganz einfach paypal oder unsere Bankverbindung: Paypal Adresse: wirdunatur@online.de oder direkt über den Link: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GMQBVKBLBD2FY Kontoinhaber: MW Medien und Entertainment UG IBAN: DE12 1001 0010 0665 4301 33 BIC: PBNKDEFFXXX Verwendungszweck: Freiwillige Unterstützung oder Zuwendung Besuche auch unsere Homepage https://wir-du-natur.de und trage Dich zu unserem Newsletter ein. So bist Du immer auf dem neuesten Stand und kannst mit uns in Kontakt bleiben. #vitalstoffe #selen #gluthationperoxidase #ros #vinamina #akne #medikamente #cortison #überdosierung #nährstoffbalance #toxizität #immunsystem #vitamine #mineralstoffe #antioxidantien #gesundheit #prävention #mikronährstoffe #stoffwechsel #entgiftung #natürlicheheilmittel #zellschutz #nahrungsergänzung #gesundheitsvorsorge #bioverfügbarkeit #ernährung http://www.wzg-verlag.de/ https://deutscher-naturheilshop.de/ Ausführliche Beratung und weitere Informationen gibt es beim Naturheilverein Pforzheim: Tel.: 07231 358866 Mail: info@naturheilvereinpforzheim.de Wichtiger Hinweis (Disclaimer): Liebe Hörer, die Nutzung der Inhalte dieses Podcast erfolgt auf Eure eigene Gefahr und ist nur zur allgemeinen Information bestimmt. Bei Erkrankungen oder anhaltenden Beschwerden wird die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Heilpraktiker zwingend empfohlen. Die in diesem Podcast zusammengestellten Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen und/oder Behandlungen durch Ärzte oder Heilpraktiker dar. Wir stellen keine Diagnosen und erteilen ausdrücklich keine Ratschläge oder Empfehlungen hinsichtlich der Therapie konkreter Erkrankungen. Für etwaige Angaben über Verfahrensweisen und Anwendungsformen wird von uns keine Gewähr übernommen und jede Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr des Hörers. Bitte achtet auf Euch und wendet Euch bei persönlichen Anwendungsfragen vertrauensvoll an einen naturheilkundlichen Arzt oder Heilpraktiker. Wir sind in keiner Weise verantwortlich für etwaige Schädigungen, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der dargestellten Inhalte entstehen. Ihr seid für Eure Gesundheit stets selbst verantwortlich.
Der Forscher Rickard Öste von der Universität Lund in Schweden interessierte sich bereits in den 80ern für die Möglichkeit, Milch durch andere Arten von Lebensmitteln zu ersetzen. Er entwickelte ein Enzym, das Hafer spaltet und in eine milchige Flüssigkeit umwandelt. Danach führte er die Marke Oatly ein. Sammy Lorenz hat mit dem Geschäftsführer von Oatly DACH & Polen, Roland Griesebner geplaudert.
558. Roshan Pursharifi: Enzym för negativa utsläpp (FINALIST I STARTUP 4 CLIMATE)
BECCS betyder Bio-energy Carbon Capture and Storage, eller koldioxidlagring från biomassa - en metod som kan skapa negativa utsläpp och som lyfts av IPCC som en viktig pusselbit för att klara klimatmålen. Svenska AirZyme tar rygg på den här utvecklingen genom att ta en roll som underleverantör till branschen. Produkten är ett enzym som påskyndar och effektiviserar hanteringen av koldioxid - precis som i den mänskliga kroppen. Vi möter medgrundare Roshan Purshafiri för att ta reda på mer kring bolagets innovation och vart tekniken är på väg. Avsnittet produceras i samarbete med Startup 4 Climate, en tävling där AirZyme är en av åtta finalister. Finalen går av stapeln den 14 november 2024 i Stockholm. // Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och prenumerera på nyhetsbrevet.
Longevity Strategien zur Hautverjüngung mit Dr. Dr. Roider
Longevity Strategien zur Hautverjüngung mit Dr. Dr. Roider Im heutigen Interview geht es um Longevity Strategien zur Hautverjüngung, hierzu ist Dr. Dr. Roider zu Gast. Maximon ist ein Unternehmen, das sich auf Longevity spezialisiert hat und verschiedene Ventures im Bereich gesundes Altern aufgebaut hat. Die Klinik Ajun bietet diagnostische und therapeutische Dienstleistungen zur Verbesserung der Longevity an. Vitamin D spielt eine Rolle bei der Stärkung der Hautbarriere und kann bei bestimmten Hauterkrankungen wie Schuppenflechte helfen. Autoimmunreaktionen wie Schuppenflechte können durch Veränderungen im Lebensstil und Stressmanagement in Remission gebracht werden. Die zweite Studie untersuchte die Möglichkeit, ohne Sonnenlicht braun zu werden. Dabei wurde ein neuer Mechanismus entdeckt, der die Hautfarbe verändert. Es wurde ein Enzym namens NNT identifiziert, das den Bräunungsprozess aktiviert. Es gibt auch andere Ansätze zur Verjüngung der Haut, wie z.B. die Kontrolle des Zellmetabolismus, die Immunmodulation und die Anwendung von Mikrotraumata. Vitamin C wird als Antioxidans eingesetzt, während Peptide die Fibroblastensynthese stimulieren und zu einer strafferen Haut führen können. Kleine Dosen von Sonnenlicht können auch positive Auswirkungen auf die Haut haben. In diesem Teil des Gesprächs geht es um die Auswirkungen von Licht auf die Haut und die Rolle der Biofotomodulation bei der Hautverjüngung. Es wird erwähnt, dass die Durchblutung der Haut durch UV-Licht angeregt wird, um das Immunsystem zu aktivieren. Die Kombination von Morgensonne, UV-Strahlung und Abendsonne kann vorteilhaft sein. Die hyperbare Sauerstofftherapie wird auch diskutiert und ihre potenzielle Wirkung auf die Hautverjüngung. Es wird erwähnt, dass die Aion-Klinik verschiedene Pakete anbietet, die auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind. Du möchtest Epigenetic oder Longevity Coach werden? kostenloser Beratungstermin: https://calendly.com/inex-marina/kostenloses-erstgespraech?month=2024-02 INEX Academy: https://www.inex-health.com/education Zeitstempel und Themen: 00:00 Vorstellung von Dr. Elisabeth Reuter und Maximon 07:15 Die verschiedenen Ventures von Maximon 10:24 Die Klinik Ajun und der ganzheitliche Ansatz von Maximon 14:10 Forschung zu antimikrobiellen Peptiden und Vitamin D 26:42 Herausforderungen bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in ein Unternehmen 34:28 Longevity und Hautverjüngung: Kontrolle des Zellmetabolismus, Immunmodulation und Mikrotraumata 37:16 Antioxidantien, Peptide und Sonnenlicht: Schlüssel zur Hautverjüngung 46:15 Hautverjüngung durch Biofotomodulation und hyperbare Sauerstofftherapie 51:47 Das Konzept der Aion-Klinik: Longevity-Medizin für die obere Mittelschicht 59:21 Investitionen in die Gesundheit: Die Bedeutung von Gesundheitsinvestitionen Links: https://www.ayun.ch/de-ch https://www.maximon.com/
Створення та вихід на ринок нового продукту — у новому подкасті розглядаємо кейс компанії “Enzym Group” разом з маркетинг директором Андрієм Гапуком та викладачкою kmbs Марією Кочмарук. “Ідея нового продукту виникала в такому контексті: ринок дріжджів падав, це світова тенденція, і ми очікували, що вона буде зберігатись і надалі. Ми вирішили диверсифікувати наш бізнес і вкласти гроші в нові продукти. Ми побудували новий завод, який запустився у 2022, і почали виготовляти ці нові продукти: дріжджові екстракти та дріжджові пластівці. На рівні стартапу — запустили дріжджові пластівці “Flakes” в Україні”. У подкасті Андрій розповідає про контекст і творчу послідовність створення нового продукту в компанії, а Марія — порушує складні питання і підсвічує неочевидне у цьому процесі. 00.00 - 5.10 - продукти компанії “Enzym Group” 5.10 - 8.30 - підходи до створення нових продуктів 11.00 - 15.20 - хто клієнт та як тестували продукт? 15.20 - 18.40 - що показали дослідження про здорове харчування? 18.40 - 24.00 - різниця підходів досліджень: jobs-to be-done та ментальних моделей 35.00 - 50.00 - як заходили в мережі “Сільпо”, “АТБ” та “Goodwine” 57.00 - 1.06.20 - яким чином скласти бюджет на вихід нового продукту? 1.07.30 - 1.13.30 - як відбувалося виробництво перших партій? Найближчі програми з Марією Кочмарук: Діджитал маркетинг. Стратегічний рівень: https://bit.ly/41wdfgd Школа Маркетингу: https://bit.ly/3tod0Hp
Es klingt wirklich wie ein Märchen...Ein Enzym, das in jedem klassischen Komposthaufen zu finden ist kriegt Plastik klein. Genauer gesagt, kann dieses Enzym PET in seine Grundbausteine zerlegen. Daraus lässt sich dann - ohne Materialverlust - reines PET herstellen.Und was soll daran gut sein? Plastik bleibt Plastik. Und Plastik ist schädlich für unsere Umwelt.Soweit so richtig. Doch in der aktuellen Transformation hin zu optimalen Verpackungen kommen wir aktuell in vielen Bereichen nicht an Kunststoffen vorbei. Leider gibt es derzeit noch viele Verbund-Kunststoffe, die sich nicht bzw. nicht vollständig recyceln lassen. Sie werden letztendlich verbrannt und schädigen mit dem mächtigen CO2-Ausstoß unsere Umwelt.Wie das besser geht und weshalb man dafür künftig auf Erdöl verzichten kann, das erklärt uns Dr. Christian Sonnendecker in dieser Podcast-Folge. Er ist Wissenschaftler an der Uni Leipzig. Dort hat ein Forscherteam das PET-fressende Enzym entdeckt.Er gibt uns Einblicke, wie wir damit mehr für Nachhaltigkeit und eine gesündere Umwelt erreichen können.Das ist Wissenschaft, die Spaß macht!
Problem Plastikmüll – Fünf Lösungsansätze für unser Kunststoffproblem
Wir stecken in der Plastikkrise, sagt die Organisation Oceancare. Was tun mit dem Plastik, bevor er in den Seen und dem Meer endet? Die Forschung zeigt Lösungen – mit fluoreszierendem Kunststoff für besseres Recycling, plastikfressenden Würmern und einem Superenzym dank künstlicher Evolution. Das Plastik-Experiment Sie fressen sich durch Styropor und können davon leben. Schwarzkäferlarven, sogenannte Superwürmer. Chris Rinke von der University of Queensland in Australien hat zusammen mit seinem Team Schwarzkäferlarven und ihr Potenzial im Kampf gegen die Plastik-Berge untersucht. Doch funktioniert das wirklich? Grösseres Plastik-Problem als gedacht Weitaus mehr Plastik landet in der Umwelt als bisher angenommen, das bestätigt die Forschung von Roman Lehner, Wissenschaftlicher Projektleiter der Sail & Explore Association. Er untersucht den Plastikgehalt in Ozeanen und in Schweizer Seen. Schätzungsweise schwimmen sogar aus den Flüssen 20 Tonnen Mikroplastik pro Jahr in die Meere. Das unzerstörbare Material Plastik besteht aus langen Polymerketten. Meistens wird der Kunststoff aus Erdöl hergestellt. Dazu wird Erdöl in seine Einzelteile zerlegt und neu angeordnet. Synthetische Polymere lassen sich kaum aufbrechen und werden darum nur sehr langsam abgebaut. Teilweise braucht es 500 bis 1000 Jahre, bis sie sich zersetzen. Markierter Kunststoff Will man Plastik wiederverwenden, muss der Plastik gut sortiert und sortenrein sein. Denn Plastik ist nicht gleich Plastik. PVC, PET, PE, PTA – die unterschiedlichen Plastiksorten finden wir alle in unserem Alltag. Jochen Moesslein hat mit Polysecure eine fluoreszierende Markierung erfunden, die es ihnen ermöglicht, eine 99-prozentige Sortierquote zu erreichen. Dabei wird die Fluoreszenz in den Kunststoff oder das Etikett eingearbeitet und von einem Laser erkannt. Plastikfressender Pilz Pilz 943. Das ist der verheissungsvolle Kandidat aus den Schweizer Bergen, der Bio-Plastik frisst. Forschende der eidgenössischen Forschungsanstalt Wald, Schnee und Land (WSL) haben aus Bodenproben im Engadin über 800 Pilze und Bakterien isoliert mit dem Ziel: Mikroorganismen finden, die Bio-Plastik wie Kompostsäcke oder landwirtschaftliche Mulch-Folie abbauen. Der Pilz 943 hat sich hervorgetan. Er baut während zwei Monaten 50 Prozent eines Stücks Plastik ab. Superenzym gegen Plastik dank künstlicher Evolution Auf dem Friedhof in Leipizg haben Forschende ein Enzym gefunden, das bei 60-70° Celsius PET-Verpackungen innert einer Stunde in seine Einzelteile zerlegt. Das Team von Christian Sonnendecker und Wolfgang Zimmermann will nun die DNS des Enzyms modifizieren. Dank künstlicher Evolution zum Superenzym, das noch schneller Plastik zersetzen kann. Sie entwickeln eine Methode, wie sie Tausende Proben schnellstmöglich analysieren und dank künstlicher Intelligenz auswerten können. Chemisches Recycling Ein geheimer Cocktail aus Chemikalien erlaubt es Samantha Anderson und ihrem Team von Depoly, Plastikabfall zu recyclen. Dank des chemischen Recyclings können sie alle PET-Teile bei Zimmertemperatur aus dem Plastik-Abfall separieren. Dabei wird der Plastik-Grundstoff TPA rausgefiltert, ein weisses Pulver. Normalerweise wird dieses Pulver aus Erdöl hergestellt.
Problem Plastikmüll – Fünf Lösungsansätze für unser Kunststoffproblem
Wir stecken in der Plastikkrise, sagt die Organisation Oceancare. Was tun mit dem Plastik, bevor er in den Seen und dem Meer endet? Die Forschung zeigt Lösungen – mit fluoreszierendem Kunststoff für besseres Recycling, plastikfressenden Würmern und einem Superenzym dank künstlicher Evolution. Das Plastik-Experiment Sie fressen sich durch Styropor und können davon leben. Schwarzkäferlarven, sogenannte Superwürmer. Chris Rinke von der University of Queensland in Australien hat zusammen mit seinem Team Schwarzkäferlarven und ihr Potenzial im Kampf gegen die Plastik-Berge untersucht. Doch funktioniert das wirklich? Grösseres Plastik-Problem als gedacht Weitaus mehr Plastik landet in der Umwelt als bisher angenommen, das bestätigt die Forschung von Roman Lehner, Wissenschaftlicher Projektleiter der Sail & Explore Association. Er untersucht den Plastikgehalt in Ozeanen und in Schweizer Seen. Schätzungsweise schwimmen sogar aus den Flüssen 20 Tonnen Mikroplastik pro Jahr in die Meere. Das unzerstörbare Material Plastik besteht aus langen Polymerketten. Meistens wird der Kunststoff aus Erdöl hergestellt. Dazu wird Erdöl in seine Einzelteile zerlegt und neu angeordnet. Synthetische Polymere lassen sich kaum aufbrechen und werden darum nur sehr langsam abgebaut. Teilweise braucht es 500 bis 1000 Jahre, bis sie sich zersetzen. Markierter Kunststoff Will man Plastik wiederverwenden, muss der Plastik gut sortiert und sortenrein sein. Denn Plastik ist nicht gleich Plastik. PVC, PET, PE, PTA – die unterschiedlichen Plastiksorten finden wir alle in unserem Alltag. Jochen Moesslein hat mit Polysecure eine fluoreszierende Markierung erfunden, die es ihnen ermöglicht, eine 99-prozentige Sortierquote zu erreichen. Dabei wird die Fluoreszenz in den Kunststoff oder das Etikett eingearbeitet und von einem Laser erkannt. Plastikfressender Pilz Pilz 943. Das ist der verheissungsvolle Kandidat aus den Schweizer Bergen, der Bio-Plastik frisst. Forschende der eidgenössischen Forschungsanstalt Wald, Schnee und Land (WSL) haben aus Bodenproben im Engadin über 800 Pilze und Bakterien isoliert mit dem Ziel: Mikroorganismen finden, die Bio-Plastik wie Kompostsäcke oder landwirtschaftliche Mulch-Folie abbauen. Der Pilz 943 hat sich hervorgetan. Er baut während zwei Monaten 50 Prozent eines Stücks Plastik ab. Superenzym gegen Plastik dank künstlicher Evolution Auf dem Friedhof in Leipizg haben Forschende ein Enzym gefunden, das bei 60-70° Celsius PET-Verpackungen innert einer Stunde in seine Einzelteile zerlegt. Das Team von Christian Sonnendecker und Wolfgang Zimmermann will nun die DNS des Enzyms modifizieren. Dank künstlicher Evolution zum Superenzym, das noch schneller Plastik zersetzen kann. Sie entwickeln eine Methode, wie sie Tausende Proben schnellstmöglich analysieren und dank künstlicher Intelligenz auswerten können. Chemisches Recycling Ein geheimer Cocktail aus Chemikalien erlaubt es Samantha Anderson und ihrem Team von Depoly, Plastikabfall zu recyclen. Dank des chemischen Recyclings können sie alle PET-Teile bei Zimmertemperatur aus dem Plastik-Abfall separieren. Dabei wird der Plastik-Grundstoff TPA rausgefiltert, ein weisses Pulver. Normalerweise wird dieses Pulver aus Erdöl hergestellt.
Wie unterscheiden sich grüner und weißer Spargel?
Judith hat grünen Spargel zubereitet. Zurzeit gibt es auch weißen an Ständen und in Geschäften zu kaufen. Sie will wissen, worin der Unterschied besteht. Olaf weiß die Antwort.
BASF: World-Scale-Enzym Produktion in Österreich
Wirtschaft im 3/4 Takt - Ein Podcast der Österreichischen Standortagentur ABA
Harald Pflanzl Head Sub-Region North West & Central Europe BASF Österreich GmbH Millennium Tower, Handelskai 94 - 96 1200 Wien Phone: +43 1 87890-712, Email: harald.pflanzl@basf.com https://www.basf.com/ BASF investiert in Novartis' Kundl/Schaftenau Campus, Österreich: https://www.basf.com/at/de/media/news-releases/20201/05/p-21-203.html BASF Kundl: https://www.basf.com/at/de/who-we-are/organization/locations/europe-overview-sites-austria/Wien1.html BASF Pflanzenschutz Österreich: https://www.agrar.basf.at/de/%C3%9Cber-uns/ BASF Digital Farming: https://www.basf.com/at/de/media/news-releases/2020/11/p-20-358.html Deutsche Handelskammer in Österreich: https://oesterreich.ahk.de/ueber-uns/praesidium Naturwissenschaftlicher Didaktik-Preis für Volksschullehrer: https://www.meinbezirk.at/neunkirchen/c-lokales/lehrerin-sicherte-sich-naturwissenschaftlichen-didaktik-preis_a5217526 **Über die Austrian Business Agency: ** Die Austrian Business Agency ist die offizielle Ansiedelungsagentur der Republik Österreich. Von unserem Head-Office in Wien aus bearbeiten rund 30 Mitarbeiter Projekte in Europa, USA, Kanada und Asien. Als kostenloser Service bietet unser Team internationalen Investoren maßgeschneiderte Information, Unterstützung und Beratung in folgenden Bereichen: - Sämtliche Aspekte des Themas Wirtschaftsstandort Österreich im allgemeinen - Standortsuche und -auswahl - Suche nach geeignetem Firmensitz und Immobilien - Fragen der Betriebsgründung und beratende Begleitung bei Betriebsgründung - Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten - Arbeits- und steuerrechtliche Fragen - Suche nach österreichischen Beteiligungspartnern - Alle standortrelevanten Fragen nach Projektrealisierung Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website: https://investinaustria.at/de/ Fragen/Anregungen/Kommentare wenden Sie bitte direkt an ** podcast@aba.gv.at** Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Laboratoř: Nezdravá strava mění výrobu enzymů v játrech. Může mít větší vliv než léky
Výběr stravy výrazně působí na náš metabolismus. Může na něj působit dokonce víc než léky. To uvádí studie australských vědců v časopisu Cell Metabolism. U myší například doložili, že strava s výrazným přebytkem proteinů snižuje přesnost přepisu dědičné informace, a tím i kvalitu výroby enzymů v játrech.
Nezdravá strava mění výrobu enzymů v játrech. Může mít větší vliv než léky
Výběr stravy výrazně působí na náš metabolismus. Může na něj působit dokonce víc než léky. To uvádí studie australských vědců v časopisu Cell Metabolism. U myší například doložili, že strava s výrazným přebytkem proteinů snižuje přesnost přepisu dědičné informace, a tím i kvalitu výroby enzymů v játrech.Všechny díly podcastu Laboratoř můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.
Quartärstruktur von Proteinen einfach erklärt! - Definition | Hämoglobin | Aufbau | Bindungen Enzym | Funktion | Disulfibrücke
Unser Kurs auf der Webseite: https://www.selbstorientiert.org/shop/ Unser Kurs auf Amazon: https://amzn.to/3muASlI Unser YouTube-Video: https://www.youtube.com/c/selbstorientiert ___________________________________________________________________________
In dieser Folge geht es um ein Thema, das eigentlich ein Alptraum-Thema ist. Der Plötzliche Kindstod. So schrecklich dieses Schicksal ist, so groß ist nun die Hoffnung in der Forschung, dass in einem Enzym die Lösung des Problems liegen könnte. Wie groß die Chancen sind und vor allem wie schnell der plötzliche Kindstod möglicherweise aus der Welt geschafft werden kann - darüber wollen wir sprechen. 01:00 Was sind die Ursachen für den Plötzlichen Kindstod? 05:52 Ein inaktives Enzym 07:32 Betroffene Eltern warnen 11:33 Betroffene Eltern entlasten 13:24 Wie weit ist die Forschung?
#180 - YCombinator Warnung, TikTok Weltherrschaft & Startup Wertschöpfung
Daniel Cronin und Markus Raunig diskutieren diese Woche folgende Themen:⚡️ YCombinator & co warnen Startups vor der Krise (00:01:25)
Neu entdecktes Enzym zersetzt PET-Kunststoff in Rekordzeit
Plastikflaschen, Obstschalen, Folien: Diese leichten Verpackungen aus PET-Kunststoff werden zum Problem, wenn sie nicht recycelt werden. Wissenschaftler*innen der Universität Leipzig haben nun ein hocheffizientes Enzym entdeckt, das PET in Rekordzeit abbaut.
Mögliche Ursache für plötzlichen Kindstod entdeckt
In den letzten Jahrzehnten konnten einige Risikofaktoren für den Plötzlichen Kindstod ausgemacht werden, z.B. das Schlafen in Bauchlage. Eine Ursache war aber bislang unbekannt. Jetzt haben australische Forscher*innen eine mögliche Erklärung – ein Enzym im Gehirn.
Um eine Kunststoffverpackung vollständig abzubauen, benötigt das neuentdeckte Enzym laut den Forschenden nur wenige Stunden. Andere Enzyme, die bisher zum Recycling genutzt wurden, brauchen dafür mehrere Tage oder sogar Wochen. Von Daily Good News.
Im Labor für Biokatalyse der ZHAW forscht Biochemikerin Rebecca Buller mit ihrem Team an der Weiterentwicklung des Enzymes PETase. PETase kann PET-Kunststoff abbauen und könnte somit einen wichtigen Teil zur Lösung desg lobalen Plastikproblemes beitragen, zum Beispiel beim Recycling von PET-Flaschen. Wie werden die Enzyme im Labor verbessert und wo kann das Enzym zum Einsatz kommen? Joseba Zbinden hat bei Rebecca Buller nachgefragt.
Spargel- und Promigeschichten mit Chris Nanoo. Ruhm-Mates dieses Landes, hallo. Freut ihr euch auf einen guten, alten, lustigen Bekannten namens Chris Nanoo? Chrissi hat heute nicht nur einen Cameo-Auftritt, sondern quatscht eine ganze Stunde lang mit Paul. Erst in Pfungstadt zwischen McDonalds und einer Tankstelle auf dem Rastplatz und später dann von zu Hause. Für die meisten Menschen ist gerade die schönste Zeit des Jahres angebrochen: Die Spargelzeit. Damit sie auch schön bleibt, hat Chrissi direkt einen heißen Tipp für euch. In der Spargelsaison ist das Schwimmbad kein place to be. Nein, wirklich nicht. Ach, ihr glaubt nicht, wieviel es zum Thema Spargel zu besprechen gibt! Deshalb, neben all den Gesprächen aus der Folge, hier kurz ein Spargel-Fakt von mir (Hannah) aus dem Off: Damit der Spargel-Urin auffällig riecht, muss zunächst Asparagusinsäure zersetzt werden, denn die Säure selbst erzeugt den Geruch nicht. Für die Zersetzung ist im menschlichen Organismus ein Enzym zuständig. Das wiederum besitzt genetisch bedingt nicht jeder Mensch. Es gibt also Spargelesser*innen, bei denen die Schwefelanteile der Asparagusinsäure nicht frei werden. Dementsprechend riecht ihr Urin auch nicht auffällig. Und… Zu welchen Menschen gehörst du? Spaß bei Seite. Theoretisch ist Paul in den letzten 14 Stunden vor der Aufnahme dreimal gestorben. 1. Im Flugzeug von Miami nach Essen, bei heftigen Winden über den Rocky Mountains. 2. In einem Auto, weil der Fahrer fast eingepennt ist. 3. Bei der Fahrradtour mit Valtteri Bottas und Tiffany Cromwell. Paul erzählt Chrissi von den vielen Ereignissen und nostalgischen Momenten der letzten Tage und ihr seid mit dabei. Vielleicht sollte ich besser sagen, er schwallt ihn in den Schlaf, denn Chrissi hat nach dem Casper-Konzert in Mannheim und der spontanen Aufnahme im Auto irgendwann einen Zustand von absoluter Müdigkeit erreicht. Wie bekommt man die Handynummer von Lance Armstrong, was für Formel 1 Momente erlebt Paul gerade und ist Money Boy Millionär? Freut euch auf viele Geschichten mit und über A-Promis, die irgendwo auf einer Skala von Genie bis Wahnsinn einzuordnen sind. Und… Die Spargel-Debatte hat etwas bei den beiden ausgelöst, weshalb Gemüse, das verändert wird und einfach keinen Sinn ergibt, auch noch zum Thema der Folge wird. Paul und Chrissi beenden die das Gespräch damit, dass sie jemandem gönnen (wem wohl?) und der von vor allem Deutschen geliebten Emotion „Schadenfreude“ den Rücken kehren. Chris Nanoo Instagram: https://www.instagram.com/chrisnanoo/?hl=de Prosecco Laune: https://open.spotify.com/show/6s6Jci6TXtsKHS6fN4i7n6?si=0802e04cdaa444fb Kau & Schluck: https://open.spotify.com/show/3ea3oAxLArYLU9G0aN3T9k?si=bd2edd9e5c4749d1 Im Autokino: https://open.spotify.com/show/5xjSSzV7eQQIG9yCXyLpn3?si=f32d7d2d5aa64439 Post von Paul abonnieren: https://postvonpaul.substack.com Schreibt uns gerne jederzeit und schickt uns eine Sprachnachricht über die AWFNR Community WhatsApp Nummer: +4915753263804 Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/AWFNR
Fluency News Alemão #80 - Unendliche Möglichkeiten für das Kunststoffrecycling
Was ist los, Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe, Fluency News! Hier hast du die Möglichkeit, deine Hörfähigkeiten zu trainieren und dich über das Geschehen in der Welt auf dem Laufenden zu halten. Wir präsentieren dir einige der wichtigsten Nachrichten der Woche auf Deutsch und fügen Erklärungen auf Portugiesisch hinzu, die unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit erfordern. In dieser Folge sprechen wir über die Aufhebung eines jahrzehntealten Verbots in Kanada. Außerdem sprechen wir über die irrsinnigen Temperaturen in Indien und Pakistan, die bisher perfekte Funktion des Webb-Teleskops und die Möglichkeit, dass ein Enzym die Welt des Recyclings verändert. Besuche fluencytv.com, um Zugang zu weiteren kostenlosen Inhalten zu erhalten, und besuche Sie unsere Instagram-Seite, @fluencytvalemao! Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News, und wir warten auf dich! Diese Folge wurde von Hudson Kleinbing geschrieben.
Wenn diese Überschrift nicht ihr Interesse weckt, dann wissen wir auch nicht…aber in der heutigen Folge unseres Podcasts belohnen wir Sie mit der fehlerfreien Aussprache des Wortes Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase. Denn genau unter einer Genmutation dieses Enzyms leiden rund 40% der Bevölkerung. Was MTHFR ist, wie sich dieser Gendefekt auswirkt und welche Symptome sich zeigen, erklärt Dr. med. Sybille Freund in der heutigen Folge. Und spätestens DANN werden Sie MTHFR spannend finden - versprochen. Mehr über Dr. med. Sybille Freund erfahren Sie unter https://doktorfreund.de
#2212 Traffic lights / Proteins / Pony AI / Pigs / Inflection AI
CEO Elon Musk sagte am Sonntag, dass sein Unternehmen ein Gerät entwickeln sollte, das künstliche Intelligenz nutzt, um die Wartezeit an Ampeln zu verkürzen. https://www.benzinga.com/news/22/03/26011950/tesla-ceo-elon-musks-latest-idea-an-ai-driven-device-to-shorten-traffic-light-agony Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik zur Formulierung therapeutischer Proteine hat ein Team unter der Leitung von Rutgers-Forschern erfolgreich ein Enzym stabilisiert, das in der Lage ist, Narbengewebe von Rückenmarksverletzungen abzubauen und die Geweberegeneration zu fördern. https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220307113045.htm Pony.ai, ein Entwickler autonomer Fahrtechnologie, hat seinen ersten Abschluss seiner Serie-D-Finanzierung abgeschlossen. https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/07/autonomous-driving-systems-developer-pony-ai-valued-at-8-5-billion-after-latest-funding-round/49716/ Es macht nichts, Menschen bei Videospielen und den alten Beschäftigungen von Schach und Go zu verprügeln. https://www.theguardian.com/science/2022/mar/07/scientists-use-ai-to-decode-pig-calls Der LinkedIn-Milliardär Reid Hoffman hat zusammen mit DeepMind-Mitbegründer Mustafa Suleyman und der ehemaligen DeepMind-Forscherin Karén Simonyan ein neues Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz namens Inflection AI gegründet. https://www.cnbc.com/2022/03/08/reid-hoffman-has-set-up-a-new-ai-company-with-deepminds-co-founder.html Visit www.integratedaisolutions.com
Folge 44: HANNES ARENDHOLZ/ FOODBOOM
Gleich mehrere Premieren in einer Folge: Start der Aufnahme im Van, 1. Podcast meines Gastes UND die Kooperation aus Bild und Ton PLUS außergewöhnlichem Podcast-Snack. Den ganzen Tag zusammen verbracht und von Studio zu Studio getingelt mit: HANNES ARENDHOLZ. Einer der beiden Gründer von FOODBOOM. Aus einer abendlichen Spontanidee wurde schnell Ernst und das Ergebnis könnt ihr hier hören und auf den Kanälen von Hannes und FOODBOOM sehen. Die Aufregung war groß, aber der Snack bunt, gelungen und mega lecker! Echtes Schonmaterial für die Ohren. Kein Wunder, denn Hannes steht für Innovation und kreative Kunst. Wie schafft es Hannes seine FOODBOOM-Zuschauer auf seiner Reise zu integrieren? Was kann entstehen, wenn man zu 100% seiner Intuition folgt? FOODBOOM ist viel mehr als FOOD. Das wird schnell klar, wenn man den fast 3000qm umfassenden „Campus“ besucht. Tief beeindruckend die großen Pläne, das Selbstvertrauen und der Mut zum Risiko. Es geht hier spielerisch zu. Aus einer einst kleinen Familie ist eine richtig große Bande geworden. Welche Rolle spielen die Nachbarn sogar bei Vorstellungsgesprächen? Warum spielt Respekt und Integration eine so große Rolle? Wie definiert Hannes Erfolg? Warum gehörten Tränen, schlaflose Nächte und Konzentrationsschwäche zum Lernprozess dazu? An welcher Stelle haben sich Hannes und sein Partner Hilfe gesucht? Wie wird Führung bei FOODBOOM gelebt? Wer ist eigentlich dieser PAUL und was würde der Gesellschaft an Unternehmertum gut tun? Wie ist Hannes als Mensch tatsächlich und was hat Peter Pan damit zu tun? Was denkt man garnicht über ihn und warum ist eine große Hafenrundfahrt entscheidend für den weiteren Weg? Natürlich müssen wir über Ernährung sprechen! „Du bist, was du isst“…Hannes ist Experte in Selbsttests und wie sich welches Enzym im Körper spaltet. Was hat er zu berichten und zu empfehlen? Woher kommen die Rohstoffe, die für die Rezeptentwicklung verwendet werden? Wie wird mit der Lebensmittel-Nachhaltigkeit umgegangen? A pro pro Essen: Wir sind sehr gespannt, ob Jemand uns während der Aufnahme essen hört… Und wer Lust auf das Produktionsvideo und Rezept zu diesem Podcast-Snack hat: einfach bei Hannes und FOODBOOM vorbei schauen! Dankeschön! What a fantastic day! Mehr zum Thema, dem Podcast, dem Gast, den Supportern und Janet Braun findet ihr hier: https://www.janetbraun.de/ https://www.instagram.com/janet_braun_/ https://www.linkedin.com/in/janet-braun-8395a2157/ https://www.facebook.com/janet.braun.5 jb@janetbraun.de https://www.hafengoldfilm.de/ https://www.foodboom.de/ https://www.linkedin.com/in/hannes-arendholz-0b0565a9/?originalSubdomain=de
#043 - Genregulation bei Prokaryoten - Operonmodell - Substratinduktion
Wie regulieren Bakterien ihren Stoffwechsel- speziell: die Proteinbiosynthese von z.B. Enzymen? In dieser Folge lernst du dies am Beispiel von E. coli. Das ist ein Prokaryot, der je nach An-/Abwesenheit der Laktose (Substrat) die Produktion von Laktose-abbauendem Enzym induziert (Induktion) oder eben nicht. Viel Spaß! Link zum Skript (Staffel 3): https://lnk.bio/NS3w
Das Akademische Viertel #10 - über die basalen Übersetzungsvorgänge unseres Körpers und eine Forschung, die alles verändern könnte
Bei dem heutigen Spaziergang spricht Charlotte mit Kira Schmiedeknecht. Sie ist Promovendin der Medizin an der Philipps-Universität in Marburg. Die beiden sprechen über ein Enzym, das die Translation, also die Übersetzung der DNA in die RNA beeinflusst, was das an den Zellen verändert und wieso es ein Ansatz der Krebsforschung sein kann. Kira nimmt uns mit in den Alltag einer Medizinstudentin, die schon während ihres Studiums die eigene Forschung umsetzt. Haltet eure Laborbrillen bereit, es wird kleinteilig.
Das Akademische Viertel #10 - über die basalen Übersetzungsvorgänge unseres Körpers und eine Forschung, die alles verändern könnte
Bei dem heutigen Spaziergang spricht Charlotte mit Kira Schmiedeknecht. Sie ist Promovendin der Medizin an der Philipps-Universität in Marburg. Die beiden sprechen über ein Enzym, das die Translation, also die Übersetzung der DNA in die RNA beeinflusst, was das an den Zellen verändert und wieso es ein Ansatz der Krebsforschung sein kann. Kira nimmt uns mit in den Alltag einer Medizinstudentin, die schon während ihres Studiums die eigene Forschung umsetzt. Haltet eure Laborbrillen bereit, es wird kleinteilig.
Warum riecht unser Pipi nach dem Spargel-Essen?
Judith genießt den Spargel, den es jetzt wieder zu kaufen gibt. Dabei stößt sie auf eine Frage, die ihr jedes Jahr in den Sinn kommt. Sie will wissen, warum unser Pipi riecht, nachdem wir das Gemüse gegessen haben. Ist das bei Olaf auch so? Der verrät es in dieser neuen Folge.
KS151: Wie Kaffee und Kakao deine Hormone beeinflusst----more---- Koffein, ähnlich wie viele andere Themen im Gesundheitsbereich, scheinen unglaublich viele gesundheitliche Vorteile zu haben. Unzählige Studien beweisen, dass es gewichtsreduzierende Vorteile hat, Herzgesundheit steigert, die Gefahr eines Schlaganfalls reduziert und vieles mehr... Finden kann man Koffein in folgenden Produkten: Kaffee grüner Tee Matchatee Schokolade Kakao koffeeinierte Getränke (Energiedrinks) und Fitnessprodukte 3 Gründe warum Kaffee nichts ist für Frauen im reproduktiven Alter Allerdings werden die meisten dieser Studien an Männern durchgeführt und die Effekte auf Frauen im Reproduktiven Alter gehen schnell unter. Besonders folgende 3 Nebenwirkungen bei Frauen sind selten bekannt: Die Gefahr von Zysten in der Brust wird erhöht Frauen, die 1-2 Tassen Kaffee am Tag tranken, erhöhten das Risiko für fibrozystischen Brüsten um das 1.5fache 2-4 Tassen täglich steigerten das Risiko um das 2.3fache. Dies wurde in einer Studie mit 634 Frauen, die an fribrozystischen Brüsten litten und 1066 Frauen für Vergleichswerte, festgestellt. (Quelle) Frauen, vor allem über 30 leiden unter fribrozystischen Brüsten, die zwar nicht gefährlich sind und harmlose Knoten in der Brust sind, doch zu Beschwerden wie Empfindlichkeit führen können. Besonders während dem Abfall und Steigerung von Hormonen wie Östrogen, macht sich Empfindlichkeit, Schwellung und Schmerzen bemerkbar. Bei den meisten Frauen verschwinden die Beschwerden erst mit Einsetzen der Menopause. Östrogendominanz scheint in diesem Zusammenhang die größte Ursache zu sein und sollte nicht außer acht gelassen werden (siehe auch 2. Punkt unten). Doch auch bösartige Knoten in der Brust, die hormongetrieben sind, sowie andere Krebsarten, die in hormonellen Zusammenhang stehen, scheinen von Koffeinkonsum beeinflusst zu werden. (Quelle) Verstoffwechselung von Östrogen wird gemindert Um Koffein in der Leber zu verstoffwechseln, brauchen wir das Enzym CYP1A2. Je nachdem wieviel von diesem Enzym hergestellt wird, kann der Körper Kaffee abtransportieren oder eben nicht. Getestet werden kann die Effizienz von dem Gen CYP1A2 und somit die Menge an Enzym mithilfe eines Gentests. Leider zeigt sich, dass nur ca. 10% der Bevölkerung große Mengen dieses Enzyms herstellen und damit in der Lage dazu sind Kaffee zu verarbeiten. Für uns Frauen ist dieses Wissen von zusätzlicher Wichtigkeit, weil dasselbe Gen auch für den Abtransport von bereits genutztem Östrogen zuständig ist. Das bedeutet, dass eine Frau mit hohem Kaffeekonsum möglicherweise einen Großteil ihres Enzyms im Stoffwechselprozess von Kaffee nutzt und einfach nicht ausreichende Mengen für den Abtransport von Östrogen hat. Dies führt dann natürlich zu einer Östrogendominanz, die bekannterweise viele Symptome hat und auch zu PCOS und Unfruchtbarkeit sowie Endometriose führen kann. Auch ist die Gefahr unter einer Koffeinvergiftung zu leiden, wesentlich größer, wenn dieses nicht regelmäßig und vollständig abtransportiert werden kann. Symptome einer Koffeinvergiftung können sein: - Zittern - Angststörungen -Durchfall - schneller, ungleichmäßiger Herzschlag - Kopfschmerzen - Konzentrationsschwierigkeiten - Schlafstörungen - Atemprobleme Die Gefahr von unerklärter Unfruchtbarkeit wird erhöht Unerfüllter Kinderwunsch und wiederholte Fehlgeburten stellen ein immer größer werdendes Problem dar. Leider wird allerdings selten darauf hingewiesen, dass Ernährung und Lebensstil einen entscheidenden Einfluss auf diese Bereiche hat! Im folgenden gebe ich dir einen kleinen Überblick auf Faktoren, die von Kaffee beeinflusst werden und dir helfen können aktiv an Verbesserung und Optimierung deiner Chancen zu arbeiten. - Trinken Männer und/oder Frauen 3 Tassen Kaffee täglich, oder mehr, wird das Risiko für Fehlgeburten um 74% erhöht. - Koffein wir in Zusammenhang mit reduzierter und unterdrückter Fruchtbarkeit gebracht was die Empfängniswahrscheinlichkeit drastisch verringert. - Die Gefahr eines frühen Abgangs ist höher wenn eine Frau in den frühsten Schwangerschaftswochen Kaffee konsumiert (während sie sich der Schwangerschaft noch nicht bewusst ist). - Die Chancen einer erfolgreichen IVF Behandlung sind geringer wenn der Mann 2 Tassen Kaffee am Tag oder mehr trinkt. - Wertvolle Nährstoffe, die essentiell sind für die Eisprungphase werden schneller verbraucht was zu einem Nährstoffmangel führen kann - Die Säure in Kaffee kann die Darmflora schädigen und damit hormonstörend wirken. Für hardcore Kaffeeaddicts ist das eine schreckliche Nachricht und kann zu einer kleinen Panickattacke führen! Was mache ich bloß ohne meinen Kaffee? Kann ich dann überhaupt noch funktionieren? Und dann kommt den meisten ein Gedanke: Was ist mit koffeinfreiem Kaffee? Gute Frage! Theoretisch ist koffeinfreier Kaffee die Lösung für alle Probleme, die ich oben erwähnt habe. Praktisch ist es leider aber nicht der Fall. Es werden verschiedene Prozesse genutzt um Koffein aus Kaffeebohnen zu entfernen: ein chemischer Prozess, der zum einen nicht den gesamten Koffeingehalt entfernen kann und zum anderen natürlich unnötige Chemikalien zusetzt, die den Körper belasten und häufig außerdem Hormondisruptoren sind. Der zweite Prozess ist auf Wasserbasis und daher wesentlich schonender und, wenn richtig durchgeführt, nicht weniger effektiv als der chemische Prozess. Doch ist auch in diesem Fall trotzdem noch ein Restgehalt vorhanden, der alle oben genannten Effekte haben kann. Wie streicht man Kaffee aus dem Alltag? Erst ist es sinnvoll zu evaluieren wie man am Besten mit solchen Situationen zurechtkommt und welche Methoden die größten Erfolgschancen bieten. Bist du jemand, der von heute auf morgen etwas lassen kann oder erhöht das die Gefahr für dich das Handtuch zu schmeißen und es nicht durchzuziehen? Wenn du der "ganz-oder-gar-nicht-Typ" bist, habe ich folgende Tipps für dich: - finde eine Kaffeealternative (Rooibos, Löwenzahnwurzeltee usw.) - Nutze den Energiebooster um den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen - In den ersten Wochen ohne Kaffee können Entzugserscheinungen auftreten, denen man mit Magnesiumbädern und Natron entgegentreten kann Gehst du so einen großen Schritt lieber etwas langsamer an, empfehle ich dir folgendes: - upgrade deinen Kaffee! Das bedeutet, dein Kaffee ist von höchster Qualität, frisch geröstet und mit guten Alternativen gemacht (Milch=Kokosnussmilch; Zucker=flüssiger Stevia) - Nimm deinen Kaffee erst nach einer guten Mahlzeit um den Cortisolspiegel nicht künstlich hochzutreiben - Nicht mehr als eine Tasse am Tag!!! - Supplementiere deine Nährstoffe (besonders B Vitamine, Magnesium und Zink) Shownotes: Katis Show - VOM KINDERWUNSCH ZUR GESUNDE FAMILIEN kannst du außerdem hier finden: Apple Podcast Spotify Katis Show - VOM KINDERWUNSCH ZUR GESUNDE FAMILIEN bei Social Media: Facebook: Kati Siemens Nutrition Instagram: katis_siemens Blog: KINDERWUNSCH UND GESUNDE FAMILIEN Website: KS NUTRITION Academy: KS NUTRITION ACADEMY BONUS Hol dir den Zugang für unser Webinar IN 3 SCHRITTEN ZUR BESSEREN FRUCHTBARKEIT KOSTENLOS REGISTRIEREN
Wie Kaffee und Kakao deine Hormone beeinflusst!
KS151: Wie Kaffee und Kakao deine Hormone beeinflusst----more---- Koffein, ähnlich wie viele andere Themen im Gesundheitsbereich, scheinen unglaublich viele gesundheitliche Vorteile zu haben. Unzählige Studien beweisen, dass es gewichtsreduzierende Vorteile hat, Herzgesundheit steigert, die Gefahr eines Schlaganfalls reduziert und vieles mehr... Finden kann man Koffein in folgenden Produkten: Kaffee grüner Tee Matchatee Schokolade Kakao koffeeinierte Getränke (Energiedrinks) und Fitnessprodukte 3 Gründe warum Kaffee nichts ist für Frauen im reproduktiven Alter Allerdings werden die meisten dieser Studien an Männern durchgeführt und die Effekte auf Frauen im Reproduktiven Alter gehen schnell unter. Besonders folgende 3 Nebenwirkungen bei Frauen sind selten bekannt: Die Gefahr von Zysten in der Brust wird erhöht Frauen, die 1-2 Tassen Kaffee am Tag tranken, erhöhten das Risiko für fibrozystischen Brüsten um das 1.5fache2-4 Tassen täglich steigerten das Risiko um das 2.3fache. Dies wurde in einer Studie mit 634 Frauen, die an fribrozystischen Brüsten litten und 1066 Frauen für Vergleichswerte, festgestellt. (Quelle)Frauen, vor allem über 30 leiden unter fribrozystischen Brüsten, die zwar nicht gefährlich sind und harmlose Knoten in der Brust sind, doch zu Beschwerden wie Empfindlichkeit führen können. Besonders während dem Abfall und Steigerung von Hormonen wie Östrogen, macht sich Empfindlichkeit, Schwellung und Schmerzen bemerkbar. Bei den meisten Frauen verschwinden die Beschwerden erst mit Einsetzen der Menopause. Östrogendominanz scheint in diesem Zusammenhang die größte Ursache zu sein und sollte nicht außer acht gelassen werden (siehe auch 2. Punkt unten). Doch auch bösartige Knoten in der Brust, die hormongetrieben sind, sowie andere Krebsarten, die in hormonellen Zusammenhang stehen, scheinen von Koffeinkonsum beeinflusst zu werden. (Quelle) Verstoffwechselung von Östrogen wird gemindertUm Koffein in der Leber zu verstoffwechseln, brauchen wir das Enzym CYP1A2. Je nachdem wieviel von diesem Enzym hergestellt wird, kann der Körper Kaffee abtransportieren oder eben nicht. Getestet werden kann die Effizienz von dem Gen CYP1A2 und somit die Menge an Enzym mithilfe eines Gentests. Leider zeigt sich, dass nur ca. 10% der Bevölkerung große Mengen dieses Enzyms herstellen und damit in der Lage dazu sind Kaffee zu verarbeiten. Für uns Frauen ist dieses Wissen von zusätzlicher Wichtigkeit, weil dasselbe Gen auch für den Abtransport von bereits genutztem Östrogen zuständig ist. Das bedeutet, dass eine Frau mit hohem Kaffeekonsum möglicherweise einen Großteil ihres Enzyms im Stoffwechselprozess von Kaffee nutzt und einfach nicht ausreichende Mengen für den Abtransport von Östrogen hat. Dies führt dann natürlich zu einer Östrogendominanz, die bekannterweise viele Symptome hat und auch zu PCOS und Unfruchtbarkeit sowie Endometriose führen kann. Auch ist die Gefahr unter einer Koffeinvergiftung zu leiden, wesentlich größer, wenn dieses nicht regelmäßig und vollständig abtransportiert werden kann. Symptome einer Koffeinvergiftung können sein:- Zittern- Angststörungen-Durchfall- schneller, ungleichmäßiger Herzschlag- Kopfschmerzen- Konzentrationsschwierigkeiten- Schlafstörungen- Atemprobleme Die Gefahr von unerklärter Unfruchtbarkeit wird erhöhtUnerfüllter Kinderwunsch und wiederholte Fehlgeburten stellen ein immer größer werdendes Problem dar. Leider wird allerdings selten darauf hingewiesen, dass Ernährung und Lebensstil einen entscheidenden Einfluss auf diese Bereiche hat! Im folgenden gebe ich dir einen kleinen Überblick auf Faktoren, die von Kaffee beeinflusst werden und dir helfen können aktiv an Verbesserung und Optimierung deiner Chancen zu arbeiten. - Trinken Männer und/oder Frauen 3 Tassen Kaffee täglich, oder mehr, wird das Risiko für Fehlgeburten um 74% erhöht. - Koffein wir in Zusammenhang mit reduzierter und unterdrückter Fruchtbarkeit gebracht was die Empfängniswahrscheinlichkeit drastisch verringert.- Die Gefahr eines frühen Abgangs ist höher wenn eine Frau in den frühsten Schwangerschaftswochen Kaffee konsumiert (während sie sich der Schwangerschaft noch nicht bewusst ist). - Die Chancen einer erfolgreichen IVF Behandlung sind geringer wenn der Mann 2 Tassen Kaffee am Tag oder mehr trinkt. - Wertvolle Nährstoffe, die essentiell sind für die Eisprungphase werden schneller verbraucht was zu einem Nährstoffmangel führen kann- Die Säure in Kaffee kann die Darmflora schädigen und damit hormonstörend wirken. Für hardcore Kaffeeaddicts ist das eine schreckliche Nachricht und kann zu einer kleinen Panickattacke führen! Was mache ich bloß ohne meinen Kaffee? Kann ich dann überhaupt noch funktionieren? Und dann kommt den meisten ein Gedanke: Was ist mit koffeinfreiem Kaffee?Gute Frage! Theoretisch ist koffeinfreier Kaffee die Lösung für alle Probleme, die ich oben erwähnt habe. Praktisch ist es leider aber nicht der Fall. Es werden verschiedene Prozesse genutzt um Koffein aus Kaffeebohnen zu entfernen: ein chemischer Prozess, der zum einen nicht den gesamten Koffeingehalt entfernen kann und zum anderen natürlich unnötige Chemikalien zusetzt, die den Körper belasten und häufig außerdem Hormondisruptoren sind. Der zweite Prozess ist auf Wasserbasis und daher wesentlich schonender und, wenn richtig durchgeführt, nicht weniger effektiv als der chemische Prozess. Doch ist auch in diesem Fall trotzdem noch ein Restgehalt vorhanden, der alle oben genannten Effekte haben kann. Wie streicht man Kaffee aus dem Alltag? Erst ist es sinnvoll zu evaluieren wie man am Besten mit solchen Situationen zurechtkommt und welche Methoden die größten Erfolgschancen bieten. Bist du jemand, der von heute auf morgen etwas lassen kann oder erhöht das die Gefahr für dich das Handtuch zu schmeißen und es nicht durchzuziehen? Wenn du der "ganz-oder-gar-nicht-Typ" bist, habe ich folgende Tipps für dich:- finde eine Kaffeealternative (Rooibos, Löwenzahnwurzeltee usw.)- Nutze den Energiebooster um den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen- In den ersten Wochen ohne Kaffee können Entzugserscheinungen auftreten, denen man mit Magnesiumbädern und Natron entgegentreten kann Gehst du so einen großen Schritt lieber etwas langsamer an, empfehle ich dir folgendes:- upgrade deinen Kaffee! Das bedeutet, dein Kaffee ist von höchster Qualität, frisch geröstet und mit guten Alternativen gemacht (Milch=Kokosnussmilch; Zucker=flüssiger Stevia)- Nimm deinen Kaffee erst nach einer guten Mahlzeit um den Cortisolspiegel nicht künstlich hochzutreiben- Nicht mehr als eine Tasse am Tag!!!- Supplementiere deine Nährstoffe (besonders B Vitamine, Magnesium und Zink) Shownotes: Katis Show - VOM KINDERWUNSCH ZUR GESUNDE FAMILIEN kannst du außerdem hier finden:Apple PodcastSpotify Katis Show - VOM KINDERWUNSCH ZUR GESUNDE FAMILIEN bei Social Media:Facebook: Kati Siemens NutritionInstagram: katis_siemensBlog: KINDERWUNSCH UND GESUNDE FAMILIENWebsite: KS NUTRITIONAcademy: KS NUTRITION ACADEMY BONUS Hol dir den Zugang für unser Webinar IN 3 SCHRITTEN ZUR BESSEREN FRUCHTBARKEIT KOSTENLOS REGISTRIEREN
Nur 5 Jahre nachdem der Nobelpreis für Chemie an Wissenschaftler ging, die DNA-Reparatur erforschen, wurde er dieses Jahr an zwei Wissenschaftlerinnen verliehen, deren Entdeckung genau das Gegenteil macht: DNA zerschneiden. Im CRISPR/Cas-System ist die sogenannte “Gen-Schere” Cas9 das Enzym, welches in Kombination mit einer sehr genauen Positionsangabe zielgerichtet DNA an einer bestimmten Stelle schneidet. Damit schützen sich Bakterien vor einer Infektion mit bakterienspezifischen Viren (Bakteriophagen). Die “Positionsangabe” wird in der Bakterien DNA im sogenannten CRISPR-Locus gespeichert. CRISPR steht für “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” und bezeichnet kurze DNA-Basenpalindrome, zwischen denen nichtfunktionale Abschnitte der Phagen-DNA gespeichert werden. Diese Abschnitte sind im Endeffekt dafür verantwortlich, dass Cas9 Phagen-DNA als solche erkennt und spezifisch zerschneidet. Die Entdeckung dieses Systems war nicht weniger als eine Revolution für die Gentechnik, denn diese bakterielle Immunabwehr lässt sich leicht mit schon vorhandenen gentechnischen Methoden aus Bakterien extrahieren und auf Pflanzen und Tiere (inklusive der Menschen) übertragen. Es ist damit nicht nur möglich bestimmte Gene auszuschalten, sondern kleinste Veränderungen einzubringen. Damit ergeben sich neue Chancen für Patienten mit bisher unheilbaren genetische Erkrankungen, Pflanzen und Tiere an veränderte Umweltbedingungen anzupassen oder andere Eigenschaften zu verändern. Bis 2018 wurde die Methode auch hauptsächlich dafür verwendet. Dann machte ein chinesischer Wissenschaftler Schlagzeilen damit, 2 Babys ohne Wissen und Einwilligung der Eltern genetisch verändert zu haben. Mittlerweile soll wohl noch ein weiteres Kind dazugekommen sein. Genauere Informationen sind nicht zugänglich was diese Kinder angeht. Empfohlen wird die Anwendung der Methode beim Menschen (noch) nicht, da nicht abschließend geklärt ist, welche Begleitfolgen sie haben kann. Abschließend lässt sich sagen, dass der einzige Grund für die “späte” Verleihung des Nobelpreises war, dass seitdem es die Methode gibt ein Patentstreit den Großteil der Zeit dominiert. Neben der genauen Folgeabschätzung bei der technischen Anwendung, sind auch ethische Implikationen bisher nur ansatzweise in Abklärung. Feststeht, dass die Methode aus der molekularen Genetik nicht mehr wegzudenken ist. In der Bio-Frage geht es darum, ob die durch das Crispr/Cas-System verursachten Veränderungen auch gentechnisch nachweisbar sind. Den Blogbeitrag zur Folge findet ihr hier: http://zellmedien.de/?post_type=podcast&p=541 Unseren Podcast könnt ihr hier unterstützen: https://www.paypal.me/ZellKultur
Sind Kohlenhydrate ungesund?
In dieser Podcastfolge beschäftigt sich Primal State Gründer mit den vielschichtigen Kohlenhydraten. Sind sie gesund oder ungesund? Machen sie dick? Benötigt der Körper sie unbedingt? Am Ende dieser Folge weißt du, wie du im Alltag mit Kohlenhydraten umgehen kannst. Inhalt der Podcast-Folge: Kohlenhydrate sind Makronährstoffe, wie auch Proteine und Fette. Sie können aus einem oder mehreren Einfachzuckern bestehen. Je nachdem, wie die beteiligten Zucker aufgebaut sind, ergeben sich daraus unterschiedliche Produkte von Kohlenhydraten. Dabei ist es wichtig, zwischen verdaulichen und unverdaulichen Kohlenhydraten zu unterscheiden, da diese für den Körper völlig verschiedene Funktionen haben. Wir werfen hier einen Blick auf die verschiedenen Arten von Kohlenhydraten und erklären, was Einfach- Zweifach und Mehrfachzucker sind, wobei auch bekannte Vertreter der jeweiligen Gruppen genannt werden. Auch auf Stärke wird eingegangen, es wird beschrieben, in welcher Form diese in der Natur gefunden wird und zuletzt wird auch auf Glykogen, die Speicherform der Stärke eingegangen. Verschiedene Kohlenhydrate haben verschiedene Wirkungen im Körper. Glukose, ein Einfachzucker, gelangt beispielsweise über den Dünndarm ins Blut, wobei der Blutzucker über die Hormone Insulin und Glucagon immer stabil gehalten wird. Zweifachzucker wie Saccharose, also üblicher Haushaltszucker, werden im Dünndarm ebenfalls in die Einfachzucker abgebaut und aufgenommen. Falls dafür das jeweilige Enzym fehlt, kann es zu Problemen kommen. Der bekannteste Mehrfachzucker Stärke wird bei Bedarf in Glukose abgebaut. Die Glukose landet anschließend im Blut oder wird als Glykogen in den Glykogenspeichern des Körpers eingelagert, um bei Bedarf vom Körper verwendet zu werden. Dann gibt es da noch die Ballaststoffe. Sie gelangen quasi unverdaut in den Dickdarm, wo sie als Nahrungsgrundlage für die Darmbakterien dienen. Streng genommen sind Kohlenhydrate nicht essentiell für den Körper, also gibt es keinen Mindestbedarf. Sie können theoretisch Teil einer gesunden Ernährung sein, müssen es aber nicht. Jedoch ist es besser, Lebensmittel nicht pauschal nach ihrem Kohlenhydratgehalt zu beurteilen. Stattdessen sollte man lieber nach dem Gesundheitswert gehen. Gesunde Kohlenhydrat-Quellen zu verzehren, kann die Gesundheit und Ziele auf vielfältige Weise unterstützen. Die Menge an täglich verzehrten Kohlenhydraten aus gesunden Quellen sollte folglich von drei Faktoren abhängen: 1. der Ernährungsweise, 2. der körperlichen Betätigung und 3. den Zielen. Wenn diese drei Faktoren klar sind, dann sollte auch die Frage beantwortet sein, wie viele Kohlenhydrate man essen soll. Primal State auf weiteren Kanälen: Zur Webseite Primal-State.de Zur Facebook-Seite Zum Instagram Kanal Hier geht's zum YouTube Channel © Primal State Performance GmbH
Zink hilft bei Akne - aber wie? Und wie erkenne ich einen Zinkmangel
DERMI DIET! All about nutritional dermatology, acne, and skin health!
In dieser Folge erkläre ich dir was Zink eigentlich ist, Woran du merkst, dass du einen Zinkmangel hast, Warum du einen Zinkmangel unbedingt vermeiden solltest, und wie du das tun kannst. Am Ende gibt es wie immer eine kleine TO DO Liste für dich, damit du hier nicht nur liest, sondern auch DIREKT ins Handeln kommst! :) Wie kann Zink dir bei Akne helfen? Das Spurenelement Zink reguliert unter anderem den Fettsäurehaushalt in der Haut. Außerdem ist es an der Zellteilung beteiligt. Ist es in ausreichender Menge im Körper vorhanden, bremst es das Enzym 5-alpha-Reduktase. Folglich kann weniger 5-alpha-Dihydrosteron gebildet werden. Die Ursachen für die Entstehung einer Akne werden somit eingedämmt. Ursache von Akne ist, so meint man oft, eine zu hohe Testosteronproduktion. Allerdings löst nicht das Sexualhormon selbst Akne aus. Vielmehr geht es mit dem Enzym 5-alpha-Reduktase eine Verbindung ein, die als 5-alpha-Dihydrotestosteron bezeichnet wird. Bei empfindlichen Personen kommt es zu Überempfindlichkeiten der Talgdrüsen Rezeptoren, wodurch es zur vermehrten Talgproduktion kommt. .............................................. Such dir aus, auf welchem Wege du mir folgen möchtest. Instagram: Jacky_fitread oder Acneadieu https://www.instagram.com/acneadieu/?hl=de https://www.instagram.com/jacky_fitread/?hl=de Podcast: Acne Adieu https://www.podcast.de/podcast/776303/ oder auf Spotify und iTunes Facebook: Acne Adieu und Jacky FitRead Gesundheitsblog: www.fitreadandmore.com TIKTOK: Jacky FitRead Mein Shop: https://www.amazon.de/shop/jacky_fitread --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/dermidiet/message
Ob Fasching, Karneval, ein Sonnenbrand oder einfach Stress, überall lauert er der Lippen-Herpes... Inhalt: Was ist Lippen-Herpes (Herpes labialis) Herpes simplex-Virus Andere Herpes-Viren Symptome Vorbeugung Behandlung Salben Eindringen des Virus in die Zelle unterbinden Virus hemmen Zovirax Duo Wundheilung fördern Pflaster Hitze-Lippenstift (HerpoTherm®) Wann zum Arzt? Fragen, Anregungen und Themenwünsche Mehr Infos: // Meine Bitte an Sie: // Pharma-Song: // Zusammenfassung: Nächste Woche: Belege Wann ist Lippenherpes ansteckend, was tun? was ist das beste dagegen, welche creme? welches virus? wer bekommt lippenherpes und warum? und wann zum arzt? Was ist Lippen-Herpes (Herpes labialis)Eine Virusinfektion. Herpes simplex-VirusEs gibt zwei Typen, Typ 1 und Typ 2. Meist HSV-1. Infektion erfolgt meist schon im Kindesalter, entweder von der Mutter oder beim Kontakt mit anderen Kindern. Etwa 85% der Erwachsenen in Deutschland. HSV-2 auch Lippe aber häufigste Ursache von Genitalherpes (Penis, Scheide, Analbereich). Bei sexuellen Kontakten übertragen, also später. Weniger verbreitet als HSV-1, etwa 20 % der Bevölkerung. Andere Herpes-VirenVaricella-Zoster-Viren (VZV) verursacht Windpocken (Varicella) und Gürtelrose (Zoster). Epstein-Barr-Viren (EBV), das beim Erstkontak zum „Pfeifferschen Drüsenfieber“, auch als „infektiöse Mononukleose“ oder „Kissing disease“ (Kusskrankheit) bezeichnet. SymptomeErstinfektion oft symptomlos. Danach persistiert das Virus lebenslang. Virus kann jederzeit reaktiviert werden, bei HSV-1 eben meist in Form von Lippenherpes Ausbruch durch Fieber Sonnenbrand Schwächung des Immunsystems Stress Ekelempfinden Hormonschwankungen. Bei 40%, einmal im Leben eine Reaktivierung Bei 10-20%, vor allem jüngere Erwachsene, immer wieder. VorbeugungSelbst Sonnenbad meiden. Stress meiden oder trainieren damit umzugehen, z.B. Entspannungstechniken. Während Herpes-Ausbruch oft und gründlich Hände waschen. Andere Vom Ausbruch bis zum Abheilen (bis zu zwei Wochen) nicht dieselben Handtücher, Servietten, Lippenstifte, Gläser oder Besteck benutzen. BehandlungVirus -> Keine Antibiotika. Eine HSV-Infektion ist nicht heilbar. Oft symptomlose Erstinfektion, danach persistiert das Virus lebenslang im Organismus. SalbenWichtig: Nie mit den Fingern auftragen! Immer mithilfe eines Wattestäbchens auf das infizierte Areal. Beugt einer Ausbreitung des Virus auf weitere Bereiche des Körpers vor. Eindringen des Virus in die Zelle unterbindenMelissenextrakt (Lomaherpan®), Docosanol (Muxan®) und Zink-Heparin-Kombinationen Natürlich nur zu Beginn der Infektion. Virus hemmenAciclovir (Zovirax® und Generika) oder Penciclovir (Pencivir®) hemmen die Vermehrung der Herpesviren-DNA. Penciclovir scheint in der Bläschenphase ein wenig wirksamer zu sein. Muss durch ein Virus-spezifisches Enzym aktiviert werden. Das fehlt in gesunden Zellen. Werden also nur in den von Herpes befallenen Zellen aktiv. Nicht befallene Zellen werden "in Ruhe gelassen". Umso effektiver, je früher angewendet. Daher gleich bei ersten Anzeichen wie Kribbeln, bis zu fünfmal täglich über 5-7 Tage. Zovirax DuoRezeptfreie Lippenherpes-Creme mit dem virenhemmenden Aciclovir und dem entzündungslindernden Wirkstoff Cortison. Stoppt sowohl die Vermehrung der Lippenherpes-Viren und bekämpft die dadurch ausgelöste Entzündungsreaktion. Bei frühzeitiger Anwendung die Bläschenbildung sogar verhindert. Sollte trotz frühzeitiger Anwendung dennoch ein Bläschen entstehen, verkürzt Zovirax Duo zumindest die Heilungszeit und verringert die Gesamtfläche von Bläschen, Wunde und Kruste. Wundheilung fördernZinksulfat (Virudermin®) oder durch Austrocknung der Bläschen. PflasterEine weitere lokale Option Pflaster auf Hydrokolloid-Basis (z.B. Compeed®, Zoviprotect®). Es dämmt die äußerliche Verbreitung der He...
Dass unser Urin unangenehm riecht, nachdem wir Spargel gegessen haben, liegt an einem Enzym. Es baut die Asparagussäure ab, die auch Schwefel enthält. Wenn man viel trinkt, ist der unangenehme Geruch weniger intensiv.
Histaminintoleranz – Was braucht Dein Körper?! Teil 2
Erstens: Bringe Deinen Darm auf Vordermann: Bitterstoffe sind eine Wohltat für Leber, Galle, und Verdauungssystem: ANCENASAN® herbal / Die Kraft der 49 Kräuter - Glutenfreie Unterstützung und Regeneration sämtlicher Verdauungsorgane: https://amzn.to/2DhMUbc Probiotika bauen die Darmflora wieder auf: https://amzn.to/2NrkgZH Zweitens: Die Mineralstoffe Zink, Magneium und Kupfer braucht der Körper damit das Enzym Diaminoxidase arbeiten kann Sango-Koralle: http://gesundheitnextlevel.de/a/sangokoralle.php Zink-Kupfer-Mangan: https://amzn.to/2XmbMaR Drittens: Vitamin B6 immer am besten als B-Komplex: http://gesundheitnextlevel.de/a/bkomplex.php Viertens: OPC um Symptome zu mindern, entzündungshemmend, gegen oxidativen Stress: optimale Durchblutung mit OPC: http://opc.gesundheitnextlevel.de Fünftens: Vitamin C: Kann den Histaminabbau fördern 100% natürliche Vitamin C- Quelle: http://vitamin-c.gesundheitnextlevel.de Sechtens: Diaminoxidase-Kapseln: https://amzn.to/2SZzmMd Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit next Level. Wie versprochen der zweite Teil zum Thema Histaminintoleranz. Wenn Du den ersten Teil nicht gesehen hast, würde ich Dir raten jetzt Pause zu drücken und Dir den ersten Teil anzuschauen. Nur so verstehst Du die Zusammenhänge. Zurück zu Teil 1. Was hilft. Was sollte man beachten. Als erstes würde ich eine Darmsanierung mit Bitterkräutern, Probiotika und einer histaminarmen Ernährung machen. Die enthaltenen Bitterstoffe 49 Kräuter harmonisieren die Verdauung, halten schlank, beschleunigen den Fettstoffwechsel und können den Blutzucker verbessern. Sie sind eine Wohltat für Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase sowie Nieren und Darm. Zweitens: Da das Enzym Diaminoxidase nur mit ausreichend Magnesium, Zink und Kupfer ordnungsgemäß arbeiten kann würde ich eine Überprüfung bei Arzt machen. Magensium im guten 2:1 Verhältnis Calcium und Magnesium bekommst Du am besten über die natürliche Form, die Sango Koralle. Ich verlinke sie Dir in der Infobox. Zink sollte als Einzellpräparat mit Vorsicht eingenommen werden. Am besten ist ein Kombi-präparat aus beiden Soffen sinnvoll. Warum? Ein Zinküberschuss kann die Kupferaufnahme hemmen. Das Enzym Diaminoxidase ist aber ein Kupferhaltiges Enzym und braucht es. Drittens: Vitamin B6 bei Histaminintoleranz: Fehlt B6 kann auch nicht ausreichend Diaminoxidase produziert werden. Das verhandene Diaminoxidase wird nicht aktiviert. Die Heilung kann dadurch vereitelt werden. Gute B6 -Quellen sind Süsskartoffeln, Hirse, Lauch, Paprika und Trockenfrüchte. Viertens: OPC: OPC kann die körpereigene Histaminsynthese hemmen und somit zu einer Minderung der Symptome beitragen. OPC wirkt zudem entzündungshemmend und gegen oxidativen Stress. Fünftens: Vitamin C: Das Vitamin C kann es Histamin abbau fördern und sollte deshalb täglich in hohen Dosen eingenommen werden. Bitte keine reine Ascorbinsäure aus der Apotheke einnehmen diese schadet der Gesundheit. Und Sechstens: Diaminoxidase-Kapseln. Man kann das Enzym auch in Kapselform vor den Mahlzeiten einnhemen. Diese wirken jedoch nur im Darm und nicht im Blut. Die Histaminintoleranz kann erleichtert werden, aber trotzdem sollten die anderen Punkte beachtet werden, da die kapseln nur die biogegen Amine abbaut die sich im Darm befinden. Die Biogenen Amine die sich im Blut befinden und die Histamine werden damit nicht erreicht. Ich Liste Dir alles Stichpunkthaltig in der Infobox auf. Du kannst den gesamten Text auch noch mal nachlesen. Und die Produkte in guter Qualität verlinke ich Dir auch. Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Und bis zum nächsten Video. Alles gute Ciau. Erstens: Bringe Deinen Darm auf Vordermann: Bitterstoffe sind eine Wohltat für Leber, Galle, und Verdauungssystem: ANCENASAN® herbal / Die Kraft der 49 Kräuter - Glutenfreie Unterstützung und Regeneration sämtlicher Verdauungsorgane: https://amzn.to/2DhMUbc Probiotika bauen die Darmflora wieder auf: https://amzn.to/2NrkgZH Zweitens: Die Mineralstoffe Zink, Magneium und Kupfer braucht der Körper damit das Enzym Diaminoxidase arbeiten kann Sango-Koralle: http://gesundheitnextlevel.de/a/sangokoralle.php Zink-Kupfer-Mangan: https://amzn.to/2XmbMaR Drittens: Vitamin B6 immer am besten als B-Komplex: http://gesundheitnextlevel.de/a/bkomplex.php Viertens: OPC um Symptome zu mindern, entzündungshemmend, gegen oxidativen Stress: optimale Durchblutung mit OPC: http://opc.gesundheitnextlevel.de Fünftens: Vitamin C: Kann den Histaminabbau fördern 100% natürliche Vitamin C- Quelle: http://vitamin-c.gesundheitnextlevel.de Sechtens: Diaminoxidase-Kapseln: https://amzn.to/2SZzmMd
Rotklee - Extrakt um PSA-Werte zu senken und eine steigende Libidio https://amzn.to/2Dy82Lv Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit next Level. Wie versprochen das Video über die Männer und den Rotklee. Wer das erste Video zum Thema Frauen mit Wechseljahresbeschwerden, Frauenprobleme, Menstruationsbeschwerden noch nicht gesehen hat. Einfach bei Youtube schauen. Wenn ein Mann einen Östrogenmangel hat. So der Professor Dr, Joel Finkenstein kommt man zu folgendem Ergebnis. In jungen Jahren hat ein Mann eine Testosteronkonzentration von 550 Nanogramm. Wenn der Mann den Wert 300-350 Nanogramm unterschreitet nimmt automatisch das Östrogen ab und gleichzeitig erhöht sich der Körperfett-Anteil. Der Abfall des Östrogens führt genauso wie bei Frauen zu ähnlichen Symptomen wie Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Depressionen, Antriebsschwäche. Auch für die Libido braucht der Mann sowohl Östrogen als auch Testosteron. Dr. Finkelstein sagt: "Beide Geschlechter benötigten jeweils auch das Hormon des anderen Geschlechts, um eine angemessene Libido zu haben", Und Zweitens. Der Rotklee-Extrakt reduziert PSA-Werte. PSA bedeutet Prostata spezifisches Antigen. Was bedeutet das Ganze. Es handelt sich um ein Enzym das vom Prostata-Gewebe produziert wird. Und dieses Enzym verflüssigt den Samen und somit können sich Spermien schneller Bewegen. Im Normalfall gelangt nur wenig PSA ins Blut. Haben wir aber krankes Prostatagewebe wird zu viel PSA produziert. Es gelangt zuviel ins Blut. Die Werte steigen. Ein erhöhter Prostatawert kann auf eine Prostataentzündung, gutartige Prostatavergrößerung, Harnwegsentzündung, Druck auf Prostata usw. bedeuten. Rotklee reduziert die PSA-Werte ohne Nebenwirkungen. Ich verlinke das Produkt noch mal in der Infobox. Hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja. Zeig es mit einem Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Alles gute Ciau. Rotklee - Extrakt um PSA-Werte zu senken und eine steigende Libidio https://amzn.to/2Dy82Lv
Dr. Ron Unfiltered Uncensored Episode 282 Interview with Dr. Wong Systemic Enzym
Dr. Ron who is a Fellow of the American Academy of Family Practice and a Charter member of the American Academy of Emergency Medicine and a licensed Acupuncturist is joined by Dr. Gerry and Dr. Dan to host this weekly podcast on the latest medical news and information We are not influenced by Big Pharma and will give you honest opinions on the news, medical devices and we have terrific guests. We have over 150 years of combined medical experience and are grateful to share it with you. Thanks for your time. 347-989-8899 If you miss us, listen here or iTunes, iHeart, TuneIn, GooglePlay, Alexa, Blubrry. Show title is: Dr Ron Unfiltered Uncensored.
Dieses Enzym verlängert Dein Leben - Sirtuine
So geht Gesundheit! Der Gesundheitspodcast von Dr. Petra Bracht
Sirtuine, aktuell auch als “Wunderenzyme” bekannt, sollen das Leben nachweislich verlängern und Zellen reparieren. Sie werden nur dann aktiviert, wenn unser Magen leer ist. Gerade deshalb ist Intervallfasten die innovativste Ernährungsweise für ein langes und gesundes Leben. Dabei handelt es sich nicht um eine Diät oder einen Trend, sondern um eine bewusste Ernährung für beste Gesundheit.
Sirtuine, aktuell auch als “Wunderenzyme” bekannt, sollen das Leben nachweislich verlängern und Zellen reparieren. Sie werden nur dann aktiviert, wenn unser Magen leer ist. Gerade deshalb ist Intervallfasten die innovativste Ernährungsweise für ein langes und gesundes Leben. Dabei handelt es sich nicht um eine Diät oder einen Trend, sondern um eine bewusste Ernährung für beste Gesundheit.
Kurz informiert vom 19.04.2018: IP-Adressen, Reshoring, Microsoft OneNote, PET-zersetzenden Enzyms
IP-Adressen: Letzter IPv4-Block Europas geht zur Neige Europa gehen die IPv4-Adressen aus. Der letzte Europa zugeteilte Block von 16,7 Millionen Adressen ist praktisch weg. Mit Stand vom Dienstag sind davon nur noch rund 40.000 Adressen verfügbar. Das geht aus einer am Donnerstag von der europäischen IP-Adressverwaltung veröffentlichten Statistik hervor. Anderswo sieht es nicht besser aus; lediglich in Afrika gibt es noch einen kleinen Vorrat. Fabriken kehren aus China zurück Mit der Automatisierung gerät China als Billigstandort ins Hintertreffen: Immer mehr Firmen verlagern ihre Produktion zurück nach Deutschland – darunter der Modelleisenbahn-Hersteller Märklin, wie Recherchen der Zeitschrift Technology Review bestätigen. Die wichtigsten Gründe sind laut Steffen Kinkel von der Hochschule Karlsruhe: Einbußen an der Flexibilität und Lieferfähigkeit sowie Qualitätsprobleme. „Betriebe, die bei der Digitalisierung fortgeschritten sind, verlagern häufiger Teile ihrer Produktion wieder an den deutschen Standort zurück“, meint Kinkel. Microsoft Office 2019 ohne OneNote Microsoft hat offiziell bestätigt, dass die nächste Version von Microsoft Office, die im September erscheint, kein OneNote mehr enthalten wird. OneNote-Nutzer sollen stattdessen auf die mit Windows 10 installierte UWP-Version der Notizbuch-App zurückgreifen. Die 2016er Version soll allerdings weiterhin verfügbar bleiben. Verbessertes Bakterien-Enzym verdaut Plastikflaschen Vor zwei Jahren entdeckten japanische Forscher mutierte Bakterien, die sich von Plastikflaschen ernähren. Ein interessanter Ansatz gegen zunehmende Umweltverschmutzung etwa durch Einwegflaschen, allerdings arbeitet das Enzym zu langsam für den industriellen Einsatz. Jetzt haben britische und US-Wissenschaftler eine optimierte Enzymvariante gefunden, die Plastikflaschen um ein Vielfaches schneller zersetzt. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden sie auf heise.de
Gut Health 3/5 Digestive enzym
One Minute Health Hacks With DrJeff. Take charge of your health with selfcare!
Hey gang. Here is part 3 of the bulletproof digestive and gut health 5 step program to build a foundation for your overall health! Part 1 was probiotic. Part 2 was prebiotic. Part 3 is digestive enzymes. This just makes everything work a little better. You are building gut health that will serve you for life. Tag someone whose health is suffering. Please send me any questions. Enjoy this episode. Cheers
Speichermedien: Von der Buche in die Cloud.
Schon immer stürzten sich Menschen wie wild auf technische Neuigkeiten. Die Neugier auf das Neue bricht sämtliche Dämme. Deshalb ist die Neugier des Menschen Hauptantriebsachse des technischen und gesellschaftlichen Fortschritts. Jeder sucht Gesellschaft, Partner, Freunde, die Liebe des Lebens, sucht Glück, Sinn, Erfolg und Erfüllung. Sucht Unterhaltung, Kurzweil und Spiel. Nach wie vor – und so wird es, so lange es Menschen gibt, mit Sicherheit bleiben – gibt es für Menschen nichts Interessanteres als mit anderen Menschen zu kommunizieren, sie zu befragen, ihnen hinterher zu spionieren, oder anderweitig etwas in Erfahrung zu bringen, manchmal auch über den Rand des Legalen hinaus. Modern Stalking. Kommunikation ist aber viel mehr als „nur“ Gespräch. Menschliche Kommunikation ist alles, was zwischen menschlichen Individuen geschieht und von Menschen ausgeht. Jede bi- und multilaterale, aber auch jede unilaterale, also einseitige Aktion ist Interaktion und Kommunikation. Vom bloßen Anblick eines Objekts bis zum Gütertausch im weitesten Sinne. Kommunikation ist Gefühl, ist Erregung, Aufregung und Abregung, ist Nachdenken, ist Leben. Tauschhandlungen sind ohne vorbereitende, begleitende und abschließende verbale Kommunikation völlig undenkbar. Zwar existieren nonverbale, sogenannte „reziproke Rituale“, die aufgrund ihrer jahrhundertelangen Tradition ohne Begleittext, ohne Forderung, Frage, Antwort, Einwand etc. auskommen – wie z.B. unser wundervolles Weihnachtsfest. Will aber der X von Deutschland aus dem Y in China einen Windbeutel verkaufen, sieht die Sache schon komplizierter aus. Kommunikation ist gut für den Frieden. Handelsbeziehungen fördern die Völkerverständigung. Nationen, die miteinander Handel treiben, führen keinen Krieg. Menschen, die miteinander Tauschbeziehungen eingehen, sind gezwungen, sich gegenseitig mitzuteilen, was sie wollen und was sie zu geben bereit sind. Die Partner müssen sich verständigen: Über den Preis, den Versand und die pekuniäre und reale Abwicklung der Transaktion. Abstrakt gesehen, bedeutet Kommunikation nämlich den Versand und Transport von Inhalten. Um Inhalte zu transportieren, bedarf es zweier Arten von Medien: Eines Speichermediums, also eines Behälters, und eines Übertragungsmediums. Uns geht es hier aber nicht um den Transport von Äpfeln und Möhren, sondern um den Versand, Transfer und Empfang von Wissen und Informationen. Hierzu zählen wir auch Spiele, Filme und Musik. Diesbezüglich besitzt der Mensch das großartigste und komplexeste Speichermedium schlechthin: Ein Gehirn. Zwar hat ein Pferd einen größeren Kopf – dennoch ist das menschliche Gehirn ein Apparat von einzigartiger, alles überragender Komplexität und Leistungsfähigkeit. In der Gehirn-Hardware abgespeichert sind unsere Erinnerungen und Prägungen, aus denen wiederum unsere Wünsche und Phantasien entstehen, die wir anderen mitteilen können, so wir dies wollen und dürfen. Der menschliche, in der Konstruktion des Gehirns vorzufindende, dabei auch vorteilhafte Makel indes ist die Neigung, unangenehme Inhalte zu verdrängen und abstrakte Daten wie Texte und Termine, aber auch Gelerntes schlicht zu vergessen. Dies schreit nach Abhilfe. Die menschliche Idee und das zivilisatorische Enzym schlechthin war es nun, den Gedächtnisspeicher von innerhalb des Schädels nach außen zu verlegen. Zum einen würde dies dabei helfen, die Übersicht zu wahren, und zweitens müsste man sich nicht länger mit der leidigen Erinnerung an irgendwelche Termine und Verpflichtungen herumquälen. Drittens könnte man einen externen Speicher bei Bedarf auch anderen Personen zugänglich machen. Kurze Geschichte des Speichermediums Interessant, die Entwicklung des Speichermediums von seinen ersten AnfängenSupport the show (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2PU5W9H752VZJ&source=url)
Zuckerkrank in der Schwangerschaft – das passiert immer häufiger. Ein Forschungsteam hat nun ein Enzym entdeckt, das die Mutter und das ungeborene Kind schützen könnte. Die Plazenta soll dabei wie ein Schutzschild wirken. Der Beitrag Schutzschild erschien zuerst auf AirCampus.
Schutzschild - Schwangerschaftsdiabetes
Zuckerkrank in der Schwangerschaft – das passiert immer häufiger. Ein Forschungsteam hat nun ein Enzym entdeckt, das die Mutter und das ungeborene Kind schützen könnte. Die Plazenta soll dabei wie ein Schutzschild wirken.
Die Wissenschaft der ewig jungen Zellen | Elizabeth Blackburn
Was lässt unseren Körper altern, unsere Haut faltig, unsere Haare weiß und unser Immunsystem schwach werden? Die Biologin Elizabeth Blackburn erhielt anteilig den Nobelpreis für ihre Suche nach der Antwort auf diese Frage, für die Entdeckung der Telomerase. Dies ist ein Enzym, dass die Kappen an den Enden der Chromosomen auffüllt, die sich bei der Zellteilung abbauen. Lernen Sie Blackburns bahnbrechende Forschung kennen -- und nebenbei, wie man den Alterungsprozess mehr kontrollieren kann, als Sie denken.
Die Gefahren von LEDs: Photobiologie und Sonnenlicht - Interview mit Alexander Wunsch | Folge #119
Evolution Radio Show - Alles was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst
In Folge #119 Das Video der aktuellen Folge direkt auf Youtube öffnen Bitte beachten Sie auch immer den aktuellen "Haftungsausschluss (Disclaimer) und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen" auf https://paleolowcarb.de/haftungsausschluss/ 20% auf alle Produkte im BRAINEFFECT Shop Gutscheincode: Evolutionradioshow - 20% auf alle Produkte im BRAINEFFECT Shop unter www.brain-effect.com Und nicht vergessen: Wenn du uns auf Youtube siehst, und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere unseren Kanal „Evolution Radio Show“ Wenn du das Podcast hörst, dann findest du die Links für Apple iTunes und Android hier auf unserer Homepage Kurze Zusammenfassung Alexander Wunsch ist Arzt, Forscher und Referent in den Bereichen Lichttherapie, Photobiologie und Biophysik. Er erforscht Chancen und Risiken natürlicher und künstlicher optischer Strahlung auf Mensch und Umwelt, berät Politik, Medienvertreter und Industrie bei lichtbiologischen Fragen und entwickelt kurative, präventive und protektive Konzepte und Anwendungen für die Lichttherapie und Lichthygiene beim Menschen. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Photobiologie und Phototechnologie (DAfP), der deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) und Lehrbeauftragter für den Themenbereich “Light and Health” im internationalen Master-Studiengang “Architectural Lighting Design” der Hochschule Wismar. Er hält regelmäßig Vorträge über biophysikalische, lichtbiologische und lichtmedizinische Themen im In- und Ausland. ##Alle Vorträge von Alexander Wunsch auf Vimeo ##Wir sprechen in dieser Folge über Was unterscheidet künstliches Licht von natürlichem Licht Wie wirkt Licht auf die Zellen Warum sind gerade LEDs so schädlich für unsere Gesundheit? Welche Art von Leuchtmittel sollte man zu Hause nutzen und wie kann man sich am besten vor den negativen Effekten anderer Blaulichtquellen, wie Monitore, schützen? #Transkript Julia: Gut. Lieber Alexander Wunsch, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Dr. Alexander Wunsch: Schönen guten Tag. Julia: Wir werden gleich losstarten ins Thema, weil es ist komplex, es gibt viel zu sagen dazu. Vielleicht würde ich gerne so starten. Dass Sonnenlicht irgendwie wichtig ist, das ist schon würde ich fast sagen im Mainstream angekommen, aber eigentlich nur, was die Knochengesundheit und Vitamin D betrifft und alles darüber hinaus existiert eigentlich nicht in der Wahrnehmung. Doch Licht hat ganz, ganz viele Funktionen im Körper, die weit über dieses, nur über das Vitamin D hinausgehen. Vielleicht könnten Sie ganz kur erklären, auf welche Bereiche Licht oder vor allem natürliches Licht wirkt. Wofür brauchen wir Sonnenlicht? Dr. Alexander Wunsch: Hm, das ist die einfachste Frage sozusagen vorweg. Das Sonnenlicht, wie Sie schon gesagt haben, das ist für sämtliche Lebensprozesse letztlich essentiell und das Besondere am Sonnenlicht ist aus meiner Sicht jetzt nicht mal die genaue Spektralzusammensetzung, also aus welchen Wellenlängen das besteht, sondern zunächst mal im Kontext der Evolution ist das Sonnenlicht A) der Antrieb für sämtliche Vorgänge auf unserem Planeten, ob das jetzt klimatische Vorgänge sind oder ob das die chemische Evolution wäre oder auch die biologische Evolution, jeder Energieaustausch, stoffliche Veränderungen in den Molekülen, alles ist letzten Endes zurückführbar auf die Sonnenenergie und auch auf die Zusammensetzung des Sonnenlichts. Das Besondere ist hierbei, dass das Leben sich unter dem Licht der Sonne entwickelt hat und dass seit über 4 Milliarden Jahren sich die Zusammensetzung dieses Sonnenlichts praktisch nicht wesentlich verändert hat. Und dadurch haben alle Organismen gelernt, das Beste aus dem vorhandenen Spektrum herauszuziehen und auch zum Beispiel zu nutzen, um sich gegen die potentiell schädlichen Anteile zu wehren. Und dadurch ist das Sonnenlicht ein sehr komplexer Cocktail von Strahlung, also ein Strahlungsgemisch, das den Lebensprozessen praktisch in jeder Hinsicht förderlich ist. Das beginnt mit der visuellen Orientierung, das geht über die Absorption von ganz bestimmten Wellenlängen, dadurch die Erzeugung des Farbspektrums, das uns umgibt in der Natur, in unserem Environment, und dann zum Beispiel Vitamin D ist ein ganz kleiner Aspekt dessen, was in unserem Körper, in der Haut passiert, im Sinne von einer Photosynthese. Wir sind anders als Pflanzen nicht in der Lage selbst Sonnenenergie in chemische Energie umzuwandeln, deswegen müssen wir Pflanzen oder pflanzenfressende Tiere wiederum aufnehmen, um unseren Energiehaushalt in Balance zu halten. Aber zum Beispiel die Wärme, die klimatischen Bedingungen, die uns umgeben, die lassen sich auch auf das Sonnenlicht zurückführen. Und dann haben wir für die Wärmestrahlung nochmal eine entsprechende Aufteilung, also einmal ist es natürlich direkt die Temperatur, die uns umgibt, die auf Sonnenaktivität zurückzuführen ist, aber auch solche Strahlungsanteile, die wir nicht direkt als Wärme spüren, zum Beispiel den Nahinfrarotbereich, der aber sehr tief in unserem Körper letztlich eindringen kann. Sonnenlicht besteht zu über 40 Prozent aus Nahinfrarotstrahlung, die wir weder sehen noch fühlen können, die aber unser Gewebe durchdringt und zum Beispiel auf dem Energiehaushalt Einfluss nimmt, weil es direkt die Zellkraftwerke ansprechen kann. Julia: Und ich meine, das geht vielleicht auch zu weit, aber wie kann man sich das vorstellen, wie wirkt das Nahinfrarot? Wie wirkt das auf die Zelle direkt? Wie kann das Einfluss nehmen auf den Metabolismus? Dr. Alexander Wunsch: Zum einen hatte ich schon kurz angerissen, dass es einen Zusammenhang mit der Aktivität, mit der Stoffaktivität, Stoffwechselaktivität der Mitochondrien gibt, der Zellkraftwerke. In den Mitrochondrien selbst gibt's verschiedene Enzyme, die für die Energiegewinnung verantwortlich sind. Da gibt's ein Enzym mit einem, je nachdem, einem zungenbrecherischen Namen, die Cytochrom-C-Oxidase. Das ist der Komplex 4 in der Elektronentransportkette der Mitochondrien und dieses Enzym, das hat Absorptionsbereich im langwelligen Teil des Spektrums zwischen 600 und 850 Nanometer. Das wäre als irgendwo zwischen rotorange und Nahinfrarot mit etwa 850 Nanometern. Und in diesem Bereich hat die Cytochrom-C-Oxidase 4 Absorptions-Peaks und man weiß aus Versuchen, von Zellversuchen bis hin zu Experimenten auch am Menschen, dass die Bestrahlung mit diesem Spektralbereich dazu geeignet ist, die den Energiehaushalt in den Mitochondrien zu stabiliseren. Also gerade jetzt in Zellen, wo Energiemangel herrscht beispielsweise, kann man die verfügbare chemische Energie anheben. Das ist das ATP, Adenosintriphosphaat, wird in den Mitochondrien hergestellt und der Komplex 4 ist die vorletzte Stufe dieses Bereitstellungsprozesses. Also das letzte Enzym vor der ATP Synthase. ATP Synthase ist so eine kleine Turbine, die wie eine Druckerpresse ständig aus Adenosintriphosphat und anorganischem Phosphat dann das begehrte ATP zusammenpresst und diese Turbine wird durch einen Ladungsträger angetrieben. In der Mitochondrienmembran und darauf kann ich mit dem Licht Einfluss nehmen. Das ist so ein Aspekt, der im Zusammenhang mit einer medizinischen Anwendung oder phototherapeutischen Anfwendung immer wieder auch diskutiert wird. Das ist dieses Verfahren nennt man Photobiomodulation, also die Anwendung von langewelligem Licht, das keine Wärme Effekte im Gewebe erzeugt, aber trotzdem solche positiven, wir kommen zeitig wie beziehungsweise die Anhebung der ATP Konzentration und damit eine bessere Verfügbarkeit chemischer Energie. Wir stellen am Tag etwa so viel ATP in unseren ganzen Zellen her, wie wir wiegen. Das ist also ein sehr umfangreicher Prozess, der praktisch in allen Bereichen, wo Energie benötigt wird, ob das jetzt Muskelaktivitäten sind, ob das chemische Transportvorgänge sind, ob das Eiweiß oder Fettsynthese oder Zellmembranen, die hergestellt werden müssen. Also jeder Vorgang eigentlich im Körper, der ist energieabhängig und damit auch abhängig von diesem ATP. Und dann gibt's noch weitere Effekte, die man diesem langwelligen Licht, dem Nahinfrarotlicht zuordnen kann. Dabei geht's zum Beispiel um die Aktivierung von Wassermolekülen. Man weiß, dass der menschliche Körper aus etwa 70 Prozent Wasser besteht, unser Stoffwechsel findet also in diesem flüssigen Medium statt und durch das Licht kann ich Wassermoleküle gezielt in Bewegung versetzen, kann also die kinetische Energie im Wasserkompartiment erhöhen und damit zum Beispiel Stoffaustauschvorgänge verbessern, ohne dass ich dabei das Gewebe unerwünschtermaßen erhitzen würde. Das sind jetzt schon 2 wichtige Aspekte, wie ich auf Stoffwechselvorgänge optimierend Einfluss nehmen kann über dieses Nahinfrarotlicht. Julia: Wenn man das so hört, dann kriegt man wirklich mal nur so einen kleinen Einblick darin oder dahingehend, wie wichtig oder welche Rolle Licht oder vor allem gewisse Wellenlängen, die richtigen Wellenlängen auf unseren Körper haben. Wenn man aber sich die allgemeine Diskussion oder die Mainstream-Medien anschaut, wenn es da um Licht geht oder um Sonnenlicht, dann werden vor allem eigentlich die schädigenden Aspekte immer angesprochen. Es wird immer eher Angst gemacht, muss man fast sagen. Man darf nicht mehr rausgehen, also einerseits soll man zwar rausgehen wegen dem Vitamin D, auf der anderen Seite sollte man sich aber auf jeden Fall mit einem Lichtschutzfaktor 30 oder noch höher einschmieren und auf jeden Fall eine Sonnenbrille tragen und bloß kein Licht an die Haut und an die Augen lassen, weil dann kriegt man Hautkrebs oder Makula-Degeneration oder was auch immer. Das ist so ein richtiger Ambivalent, die Informationen, die man bekommt, und die Leute sind auch sehr verunsichert und ich habe direkt den Eindruck auch, wir fürchten uns vor Licht, mit dem wir seit 4 Millionen Jahren aufgewachsen/ oder seitdem wir auf der Welt sind, auf der Erde wandeln, ein Teil unserer Biologie war. Auf der anderen Seite haben wir nicht die gleiche Skepsis gegenüber Lichtquellen, die erst seit 100, 200 oder 300 Jahren in unserer Welt sind. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Vielleicht, ich meine das waren jetzt mehrere Aspekte in einem, muss ich mich schützen vor dem Sonnenlicht oder bis zu welchem Grad oder wie gehen Sie damit um? Ist es tatsächlich eine Gefahr oder was ist die richtige Dosis? Dr. Alexander Wunsch: Wir haben es hier, also auf solche vielschichtigen Fragen gibt's natürlich auch gerne mal eine vielschichtige Antwort. Während Sie die Frage formuliert haben, ist mir zunächst mal das Cui Bono eingefallen. Die Frage auf Lateinisch, die dann übersetzt lautet: Wem nützt es? Also wer profitiert davon, wenn die Menschen Angst vor der Sonne haben? Die Weltgesundheitsorganisation hat sich dazu entschlossen, die sogenannte No Sun Policy zu fahren. Also im Prinzip von der Sonnenexposition komplett abzuraten. Dadurch hat man natürlich das Problem, dass sich die Vitamin D Mangelerkrankungen immer weiter ausbreiten und die öffentlichen Stellen, jetzt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die meines Wissens sogar, wenn man da mal nachschaut, wer die ganzen Kosten sponsert und trägt, da bekommt man dann auch wieder Antworten, warum es möglicherweise profitabler ist den Menschen vor der Sonne Angst zu machen als ihnen praktisch beizubringen, wie man richtig mit der Sonne umgeht. Es ist definitiv komplexer den Menschen beizubringen, wie sie richtig mit der Sonne umgehen als zu sagen, gar keine Sonne und 30er Sonnenschutzfaktor. Das Problem ist, wenn man die Sonnencreme verwendet, halten sich die Menschen wesentlich länger im Sonnenlicht auf als es ihnen eigentlich guttut, bilden dabei aber kein Vitamin D und bilden auch keinen eigenen Sonnenschutz, den sie sonst aufbauen würden. Wenn man also ohne Sonnenschutzcreme in der richtigen Dosierung die Sonne genießt, dann baut man einen eigenen Sonnenschutz auf, den man auch immer dabeihat. Die Sonnencreme, die wird gerne mal vergessen im falschen Moment und plötzlich ist die Folge dann der Sonnenbrand, den man auf jeden Fall vermeiden sollte. Wir haben beim Sonnenlicht wie auch bei vielen anderen einwirkenden Reizen oder Energien eine U-förmige Reizantwort, also das wäre dann eine U-Shape Curve, eine Kurve, die aussieht wie ein U so ungefähr, wie ein bisschen flacher gezogenes U und das zeigt, der Optima in der Mitte ist der optimale Effekt zu erwarten, wenn wir die richtige Dosis haben. Wenn wir zu wenig Sonnenlicht bekommen, dann treten Mangelerscheinungen auf, die zum Beispiel beim Vitamin D erkennbar werden. Vitamin D Mangel geht mit einer erhöhten Sterblichkeit einher, geht mit Knochenkrankheiten wie zum Beispiel der Osteoperose oder der Osteomalazie einher. Wir beobachten bestimmte Krankheitsbilder, dass die gehäuft auftreten wie zum Beispiel kardiovaskuläre, also Herzkreislauferkrankungen, aber auch Infektionskrankheiten und Krebserkrankungen treten bei schwerem Vitamin D Mangel häufiger auf. Also die Unterdosierung ist ein Problem und die Überdosierung ist dann auch ein Problem, weil dann zum Beispiel Hautschäden erkennbar werden können, zum Beispiel Hautalterung, solche Sonnenfalten oder auch Hautkrebs, wobei man beim Hautkrebs wieder unterscheiden muss. Da gibt's das Melanom, das ist der schwarze Hautkrebs, der macht normalerweise weniger als ein Zehntel der gesamten Hautkrebsfälle aus und die restlichen 90 Prozent, die betreffen dann den hellen Hautkrebs, weil hier in den letzten Jahren auch die sogenannte aktinische Keratose, also eine Vorstufe in die Statistik mit einbezogen wurde und allein dadurch schon durch diese Definition das auch als Hautkrebs zu bezeichnen, die Erkrankungsraten statistisch natürlich in die Höhe geschnellt sind und deswegen, also zu viel Sonnenlicht ist ein Problem, zu wenig Sonnenlicht, und jetzt geht's darum, das Sonnenlicht ist Jahrmillionen dasselbe von seiner Zusammensetzung her. Früher hat es das Leben in seiner Entstehung begünstigt und heute haben wir im Prinzip einfach nur verlernt oder viele Menschen haben einfach verlernt oder nie gelernt, wie sie richtig mit dem Sonnenlicht umgehen. Das Sonnenlicht per se ist weder gut noch böse, sondern das Problem liegt eben am Menschen und daran, wie er mit dem Sonnenlicht umgeht. Und da werden halt viele Fehler gemacht, die man durch besseres Wissen beseitigen kann. Julia: Das heißt zum Beispiel, dass man einfach sich seinem Hauttyp entsprechend auch in der Sonne aufhält und nicht jetzt extra brät oder? Dr. Alexander Wunsch: Ja. Zunächst mal natürlich der Hauttyp. Also es gibt eine ganz individuelle Sonnenempfindlichkeit. Das ist relativ einfach die herauszufinden. Man sollte sich von unten rantasten und nicht von oben an die Verträglichkeitsschwelle, das heißt, wenn man nicht weiß, wie gut man die Sonne verträgt, dann sollte man halt mal mit 5 oder 10 Minuten anfangen, dann wieder aus der Sonne rausgehen und die Haut beobachten. Im Prinzip weiß es schon jeder, dass die Zeichen einer Überdosierung von Sonnenlicht zeitverzögert auftreten, das heißt nach 3 oder 4 Stunden merkt man erst, wenn man zu lange in der Sonne sich aufgehalten hat und da muss man eben vorausdenken. Das heißt, ich gebe mir eine ganz bestimmte gezielte Dosis und beobachte mich dann und das Herantasten ist der eine Aspekt, dass man die Schwellendosis praktisch herausfindet, wie viel kann ich mir zumuten ohne, dass meine Haut mit Überdosierungszeichen reagiert. Und das andere ist, dass man wissen muss, dass es eine Sonnengewöhnung gibt. Und die Sonnengewöhnung, die funktioniert nur, wenn man kein Sonnenschutzmittel verwendet, bedeutet aber, dass wenn ich jetzt beispielsweise in den Sommermonaten tatsächlich mal 4 Wochen am Stück jeden Tag Sonne hätte, dann würde ich vielleicht am 1. Tag 10 Minuten gut vertragen, am 2. Tag würde ich dann vielleicht schon zwei, drei Minuten länger gut vertragen, von mir aus auch 5 Minuten und so würde sich das dann eben steigern bis auf mehrere Stunden. Das heißt nach 4 Wochen vorsichtiger oder wohldosierter Sonnenexposition kann man sich durchaus auch zwei, drei Stunden im Sonnenlicht aufhalten ohne, dass man einen Sonnenbrand bekommt. Jetzt muss man sich allerdings fragen: Ist das überhaupt sinnvoll so lange in der Sonne zu sein? Normalerweise mein Sonnenhunger ist nicht so groß, dass ich zwei oder drei Stunden anpeilen würde, sondern jetzt in den Sommermonaten, wenn ich dazu komme, Heliotherapie zu machen, dann mache ich das zum Sonnenhöchststand so um 1 Uhr mittags herum. Wir haben ja Sommerzeit, dadurch ist der Sonnenhöchststand nicht um 12, sondern eher so roundabout 1 Uhr. Warum diese Uhrzeit eigentlich am besten ist? Wir haben den höchsten Gehalt an Ultraviolett B Strahlung, die in der Lage ist Vitamin D zu synthetisieren in der Haut und dadurch kann in der kürzestmöglichen Zeit das maximale Vitamin D erzeugen. Deswegen mittags um 1 Uhr ist optimal und wenn man da 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht jede Körperseite der Sonne aussetzt, dann fängt man auch an zu schwitzen und es wird einem heiß. Also mal ganz ehrlich, fühle ich mich nach den 20, 30 Minuten im Schatten dann auch wesentlich wohler als wenn ich jetzt weiter in der Sonne braten müsste. Und da gibt's aber halt ganz unterschiedliche, der Mensch gewöhnt sich ja an alles, und wer sich halt an das Braten in der Sonne gewöhnt hat, weil er zum Beispiel unter dem Schutz von Sonnencreme keinen Sonnenbrand bekommt, der kann das schon länger in der Sonne aushalten, aber gesund ist das natürlich nicht und vernünftig ist es auch nicht. Mehr als eine halbe Stunde pro Körperseite für jemand mit einer mitteleuropäisch hellen Haut ist eher kontraproduktiv. Julia: Ich meine, jetzt ist die Haut eine Sache, aber die andere sozusagen das andere Problemfeld, das sind auch die Augen und die werden eben geschützt durch Sonnenbrillen. Wie sehen Sie das? Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wie sollte man da umgehen und warum sollte man vielleicht sich auch überlegen da nicht auch an die Augen oder an die Retina zu lassen? Dr. Alexander Wunsch: Eine Sonnenbrille ist praktisch für die Augen das, was die Sonnencreme für die Haut darstellt, zumindest mal unter sage mal Normalbedingungen. Man kann bei Wikipedia zum Beispiel auch diese Sonnenschutzbrillen der Inuit sehen. Da gibt's Abbildungen dazu, das heißt, auch in recht einfachen Kulturen war das Thema Lichtschutz der Augen in Form von so Schlitzen in knöchernen Brillen auf jeden Fall ein wichtiges und wenn man eben in einer Umgebung ist wie jetzt zum Beispiel im ewigen Eis und es scheint die Sonnen und von überall, von oben und von der Seite, aus der Blickrichtung, überall hat man diese hohen Strahlungsintensitäten, da ist ein Augenschutz natürlich schon wichtig. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise im Schatten von irgendwelchen Pflanzen oder auch von mir aus von Gebäuden aufhält, dann ist eigentlich ein Hut viel, viel wichtiger als eine Sonnenbrille und dadurch, dass die Lichtreaktionen im Organismus konzertierte Aktionen sind, aus den Vorgängen, die in der Haut ablaufen, und den Vorgängen, die über das Auge gesteuert im Zwischenhirn ablaufen, ist es eigentlich für den Organismus leichter mit den Lichtbedingungen umzugehen oder sich an die Lichtbedingungen anzupassen, wenn er die Lichtbedingungen quasi ungefiltert bekommt. Und es ist immer sinnvoll, dass man, wenn es mehrere "Sinneskanäle", jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt, auch wenn der Sinneskanal von Licht, wie er über die Haut uns nicht direkt bewusst erreicht und die vegetativen Einflüsse von Licht über das Auge uns nicht direkt bewusst erreichen, sind es trotzdem Sinneskanäle. Da ist es wichtig, dass die verschiedenen Sinneskanäle den eigentlichen Sinnesreiz möglichst ungefiltert bekommen. Sonst kommt es zu einem Durcheinander in der Regulation. Julia: Wir haben jetzt viel eben über Sonnenlicht und vor allem über das natürliche Licht gesprochen. Ich würde aber auch gerne jetzt sozusagen den Sprung ins Innere machen, zum künstlichen Licht in die Räume hinein. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es herrscht so eine grundsätzliche Skepsis interessanterweise der Sonne gegenüber, andererseits überhaupt keine Skepsis den ganzen künstlichen Lichtquellen gegenüber, die wir aber teilweise erst ein paar hundert, also 200, 300 Jahre haben. Ist diese, sollten wir skeptisch sein und wenn ja, vielleicht auf welche, gibt's da Unterschiede? Sind manche künstliche Lichtquellen besser als andere? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Dr. Alexander Wunsch: Bei Lichtquellen, die 200, 300 Jahre alt sind, braucht man jetzt eigentlich weniger skeptisch zu sein. Also eigentlich ist es so, dass wir seit ein paar tausend Jahren schon Fackeln und Kerzen haben, seit ein paar hunderttausend Jahren haben wir das Feuer und das Feuer ist die erste künstliche Lichtquelle, die dadurch, dass das Feuer mit Rauch und Hitze verbunden ist, uns immer signalisiert hat, wenn wir in Gefahr gelaufen wären, es über zu dosieren. Und erst mit dem elektrischen Licht und da spezifisch mit der Glühlampe hatten wir dann eine Lichtquelle, bei der das Feuer so gebändigt worden war, dass es zum Beispiel die Luft nicht mehr verschmutzt hat, zumindest nicht in dem Raum, in dem man die Glühlampe betreibt. Die Wärme war trotzdem noch vorhanden, aber es war erstmals möglich jetzt unnatürlich helle Zustände in der Nacht herbeizuführen. Das erste Problem, was man mit solchen Kunstlichtwellen betrachten sollte, das ist die Rhythmusstörung, das heißt also, dass man die Nacht zum Tage macht und jeder, der mal Schichtarbeit, der mal Nachtschichten gemacht hat beispielsweise, der kann gut nachvollziehen, dass Nachtschichten oder Schichtarbeit für die Gesundheit abträglich sind. Also die wenigsten Menschen können das über einen längeren Zeitraum machen, ohne dass sie davon zumindest mal nachhaltige Störungen der inneren Uhr, des inneren Biorhythmus erleben. Unsere 24/7 Gesellschaft, dass wir 24 Stunden, also rund um die Uhr jeden Tag in der Woche alles Mögliche bekommen, alles machen könnten, rein theoretisch einkaufen und so weiter, Fernsehen einschalten, früher gab es ein Testbild und danach war nichts mehr und heute ist halt alles rund um die Uhr verfügbar. Das ist halt ein Problem und die Schichtarbeit ist letztendlich für die Gesundheit auch ein Problem und da ist der Katalysator, der uns das Ganze ermöglicht hat, schon das Kunstlicht. Und die Rhythmusstörungen sind heute im Kontext der Chronobiologieforschung immer besser untersucht, sodass wir auch immer besser verstehen, wie da mögliche Schädigungsmechanismen ablaufen. Am problematischsten sind eigentlich die Lichtquellen, die so ab den 1930er Jahren entwickelt wurden, die also auf die Glühlampe und auf die klassische Glühlampe gefolgt sind und das waren zunächst Entladungslampen, meistens Quecksilberdampfentladungslampen, die dann mit einer Fluoreszenzschicht ausgestattet wurden und diese Fluoreszenzlampen, im Volksmund vielleicht auch Neonlampen benannt, später dann Energiesparlampen, dabei handelt es sich um kalte Lichtquellen. Das heißt, das letzte Zeichen, dass wir das Licht überdosieren, nämlich die Hitze oder die Wäre, war hier auch schon beseitigt, und das Spektrum von Energiesparlampen, das ist sehr stark durch das Quecksilber, was für die Lichterzeugung sorgt im Inneren, geprägt und hat mit natürlichem Licht quasi überhaupt nichts zu tun. Glühlampenlicht ist zwar Kunstlicht, hat aber eine natürliche Spektralverteilung, und alle kalten Lichtquellen, heute ist ja die Energiesparlampe, die Entladungslampe mehr oder weniger aus der Mode gekommen. In den allermeisten Fällen greift man heute am liebsten zur LED und das ist auch das, was den Verbrauchern nahegelegt wird und versucht wird es dem Verbraucher schmackhaft zu machen. Und diese LEDs sind auch wieder energieeffiziente Kaltlichtquellen, bei denen die Spektralzusammensetzung letztlich ganz anders aufgebaut ist wie wir das in den Lichtquellen mit natürlicher Spektralverteilung finden. Und genau das ist das Problem, dass nämlich, das, was ich eingangs unseres Gesprächs schon genannt habe, wir haben uns an die Spektralverteilungen der natürlich vorhandenen Lichtquellen seit Jahrmillionen angepasst. Und wenn man jetzt an dieser Spektralverteilung auch nur geringfügige Änderungen durchführt, dann kann das mittel- und langfristig zu gravierenden Nachteilen für die Gesundheit führen. Das wären bei diesen Kaltlichtquellen zum einen Störungen der inneren Uhr, also Störungen der chronobiologischen Funktionen. Die chronobiologischen Funktionen sind ganz eng mit dem autonomen Nervensystem verknüpft und mit dem Hormonsystem, also Hormonstörungen, vegetative Störungen, sind die eine Gefahr und die andere Gefahr geht dann über, geht letztendlich von einer mangelnden Balance oder Harmonie der Spektralanteile in solchen kalten Lichtquellen aus und da wäre zum Beispiel zu nennen, dass die Netzhaut, aber auch die Haut, die solchem Licht ausgesetzt ist, Schäden erleiden kann. In erster Linie durch Sauerstoffradikale, die vermehrt gebildet werden, also erhöhter Zellstress auf der einen Seite und verringerte Reparaturvorgänge auf der anderen Seite. Da spielt dann zum Beispiel das Fehlen von diesem Nahinfrarotanteil, über den wir vorhin schon ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, dieser Nahinfrarotanteil Licht sorgt für eine Verbesserung des Stoffwechsels, für mehr Energie und im Auge zum Beispiel oder auch in der Haut des Gesichts sind diese Prozesse eben sehr wichtig, um mögliche Schäden zu reparieren. Und diese Prozesse fallen dann weg, Reparaturvorgänge fallen weg durch erhöhte Blauanteile, die wir praktisch bei allen LEDs, bei allen Weißlicht LEDs heute finden, sorgen für mehr Stress in der Zelle, für mehr Sauerstoffradikale und dadurch entsteht praktisch so eine Grätsche, das ist quasi eine Schere, die aufgeht, mehr Zellstress und mehr Zellschäden auf der einen Seite und weniger Reparatur und Regeneration auf der anderen Seite. Julia: Und da ist dann vermutlich auch wahrscheinlich das Problem einfach die lange Exposition oder? Zu dem Blaulicht, weil wir einfach dann viele, viele Stunden untertags eigentlich nur mehr diesem Licht ausgesetzt sind oder? Also ist es dann eine Zeitfrage auch? Weil so akut habe ich ja jetzt keinen, wie gesagt bei der Sonne merke ich es nach zwei, drei Stunden schon, aber ich habe nicht dieses gleiche Gefühl, wenn ich jetzt einen ganzen Tag unter LEDs verbringe. Dr. Alexander Wunsch: Ja klar. Ich meine, man kann zum Beispiel auch den ganzen Tag hinter einem Fenster verbringen im Sonnenlicht, da bekommt man auch keinen Sonnenbrand und die Sonnenfalten, die kriegt man eben erst 20 Jahre später oder die bemerkt man eben erst 20 Jahre später. Es gibt diese Fotos von zum Beispiel Lastwagenfahrern, (Julia: Genau (lachend)) die jetzt durch die Seitenscheibe ständig dem Sonnenlicht ausgesetzt waren und die Seitenscheibe filtert aber den UVB-Anteil raus, der für einen Sonnenbrand sorgen würde. Dadurch merkt man eigentlich nicht, dass da eine Hautbelastung stattfindet, sonst könnte man sich ja zum Beispiel mit Sonnenschutzcreme oder so schützen. Aber die meisten Fensterqualitäten lassen eben UVA-Strahlung sehr stark durch. Das können 60, 70, 80 Prozent sein von dem, was quasi beim Eintritt des Tageslichts ins Fenster vorhanden ist. Das heißt, ich bekomme unter Umständen beim Autofahren innerhalb von kürzester Zeit, also von wenigen Stunden, eine UVA-Überdosierung, von der ich aber direkt nichts bemerke. Ich habe zum Beispiel einen sehr eindrücklichen Versuch, wo man an der Haut spüren kann, wie dieses noch nicht mal UVA-Licht, sondern violettes LED-Licht, das erzeugt an der Lippe beispielsweise unmittelbar eine intensive Wärme, ist fast schon zu sanft formuliert, eigentlich ist es eine Art Hitze. Wenn ich dann mit einem so einem gelben Filter dazwischengehe, dann verschwindet diese Hitze augenblicklich. Damit kann man also anschaulich demonstrieren, dass dieses kurzwellige Licht spürbar die Haut nicht nur aufheizt, also das Gewebe nicht nur aufheizt, sondern es fängt auch an so unangenehm zu kribbeln. Das sind dann beispielsweise diese Sauerstoffradikale, die im Gewebe gebildet werden durch das kurzwellige Licht. Dadurch, dass man einen Filter dazwischenschaltet, sind diese negativen oder unangenehmen Warnehmungen schlagartig beseitigt. Sowas passiert letzten Endes im Auge, wenn wir Licht um uns herum haben, das mit hohen kurzwelligen Anteilen versehen ist. Nur die Netzhaut des Auges hat eben anders als die Haut ein paar Nerven, die jetzt Unbehagen oder ein Missempfinden vermitteln würden. Wozu hätte sich unser Auge jetzt auch gegen Kaltlichtquellen schützen sollen? Im Laufe der Evolution gab's niemals die Anforderungen dafür, sondern unser Auge musste Mechanismen entwickeln, mit dem Sonnenlicht klarzukommen, unser Auge musste Mechanismen entwickeln mit dem Feuerschein klarzukommen, aber eben nicht mit diesen Leuchtmitteln oder Lampen, die die Ingenieure, die Lichttechniker, in den letzten 80 Jahren entwickelt haben. Julia: Das heißt, was wären jetzt Ihre Empfehlungen oder was wären die besten Lampen für zuhause? Was sollte man dann da für Lampen haben oder wonach sollte man da auf jeden Fall schauen? Worauf sollte man da achten? Dr. Alexander Wunsch: Zum einen sollte man halt drauf achten, dass man dem Lichthunger, der den meisten Menschen angeboren ist, dass man den nicht versucht unbedingt mit Kunstlicht zu stillen, sondern dass man versucht den Lichthunger tagsüber mit dem natürlichen Tageslicht zu stillen und nachts sollte das Licht in erster Linie der Orientierung dienen und Kunstlicht mit natürlicher Spektralverteilung, da gibt's eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Das ist einmal die Standard-Glühlampe, die nicht mehr hergestellt werden darf und die Halogen-Glühlampe. Das sind die beiden künstlichen Lichtquellen, die eine natürliche Spektralverteilung aufweisen. Man hat dabei eine optimale Farbwiedergabe, man hat eine Spektralverteilung, an die unser Organismus seit Jahrmillionen sich anpassen konnte. Bei diesem Spektrum können wir davon ausgehen, dass unser Organismus damit optimale Strategien entwickeln konnte, um das Positive rauszuziehen und keinen negativen Effekte erleiden zu müssen. Von LEDs beispielsweise, Energiesparlampen, rate ich persönlich ab, außer in speziellen Anwendungsbereichen, also ich habe immer eine kleine Taschenlampe, die ist so groß wie mein kleiner Finger, in der Hosentasche. Das ist natürlich eine LED, weil da kommt mehr Licht raus als aus so einer Riesenlampe, die jetzt auch gar nicht mehr als Taschenlampe bezeichnet werden kann eigentlich, weil sie zu groß war und Monozellen drin. Also da hat sich durchaus was geändert und LEDs, zum Beispiel gibt's auch Fluoreszenz-LEDs, die ein breitbandiges gelbes Spektrum erzeugen. Da kann man eine oder zwei als Nachtbeleuchtung optimal verwenden. Das genügt absolut, um zum Beispiel den Weg ins Badezimmer und wieder zurück ins Bett zu finden, ohne dass man den Biorhythmus, ohne dass man den Melatoninhaushalt beispielsweise negativ beeinflusst. Man braucht in der Nacht nur ganz geringe Lichtstärken oder Beleuchtungsstärken, um sich orientieren zu können. Unser Auge ist im weiten Bereich anpassungsfähig und kann mit den verschiedensten Helligkeitspegeln umgehen und dabei sollte man zum Beispiel dann auch drauf achten, dass künstliches Licht vor sagen wir mal 1.000 Jahren kam sicherlich nicht von oben von der Decke, sondern höchstens aus der Horizontalebene oder eher noch vom Boden, das heißt, ein Lagerfeuer oder eine Fackel, die an der Wand hing, aber kein Licht von oben. Man sollte auch hier die natürlichen Richtungen, die wir beobachten können, die unterschiedlich sind am Tag und in der Nacht, sollte man eigentlich auch noch mitberücksichtigen. Also einfach mal zurückgucken, wie war es vor langer Zeit, dann weiß man, woran sich unser Körper eigentlich gewöhnt hat und wenn man das nachempfindet, dann kann man quasi auf einen evolutionären Erfahrungsschatz bauen, der in unserem Körper eingespeichert ist, auch wenn es uns nicht so bewusst ist. Julia: Wird das Spektrum oder wird das irgendwie angegeben eigentlich auf der Verpackung? Also wenn ich mir jetzt ein warmweißes Licht zum Beispiel kaufen möchte, wo steht das drauf oder worauf sollte ich da schauen beim Kauf dann von den Lampen? Dr. Alexander Wunsch: Ja, das steht schon drauf. Aber es gibt gerade bei dieser, ob jetzt warmweiß oder kaltweiß, da sprechen wir von der sogenannten Farbtemperatur des Lichtes, die wird in Kelvin angegeben. Kelvin ist die Temperatur ausgehend vom absoluten Nullpunkt, der liegt bei minus 273 Grad so round about. Das heißt also 320, 310 Kelvin entsprechen dann der Körpertemperatur, also 273 plus die 37 Grad Körpertemperatur, landen wir bei 310 Kelvin. Bei Lichtquellen ist es dann so, bei einer Glühlampe, die hat 2.700 Kelvin, eine Halogenlampe hat 3.100 Kelvin, und dann ist eigentlich Schluss. Denn es gibt kein Metall mit einem höheren Schmelzpunkt als Wolfram, also Wolfram ist der Glühfaden in der Glühlampe gefertigt, und deswegen können wir mit dem Glühvorgang keine höheren Farbtemperaturen erzeugen. Als Kunstlichtquelle mit einer echten höheren Temperatur bleibt dann eigentlich nur die Kohlebogenlampe, die aber technisch sehr anspruchsvoll ist und außerdem raucht und qualmt und meistens viel zu hell wäre. Die ist auch heute eigentlich nicht mehr handelsüblich. Für alle höheren Farbtemperaturen, kaltweiß, zum Beispiel jeder Computerbildschirm wird mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin ausgeliefert, da orientiert man sich an der Sonne, die sagen wir mal so 5.700 Kelvin Oberflächentemperatur hat und allerdings eben auch wirklich so heiß ist, genauso wie der Wolfram-Faden wirklich so heiß ist, wie es der angegebenen Farbtemperatur entspricht. Kaltlichtquellen, die weisen keine echte Farbtemperatur, keine physikalische Temperatur von 6.000 Kelvin auf, sondern eine sogenannte korrelierte Farbtemperatur. Das ist ein ähnlichster Farbeindruck, den eine Lichtquelle mit tatsächlich dieser Temperatur hervorrufen würde. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist im Prinzip eine Berechnungsmethode, um einer kalten Lichtquelle einen Farbeindruck zuweisen zu können. Da fängt die Irreführung letzten Endes an. Die Farbtemperaturen, die man auf den Packungen von Lampen findet, die beziehen sich nicht auf die echte Temperatur, sondern auf die ähnlichste Temperatur, die einen solchen Farbeindruck hervorrufen würde, also man kann sich an der Glühlampe mit einer echten Farbtemperatur so von 2.700 Kelvin natürlich die Finger verbrennen, aber man verbrennt sich bei einer LED mit 7.000 oder 8.000 Kelvin eben nicht die Finger, weil das Licht auf eine ganz andere Art erzeugt wird und weil hin- und her gerechnet wird und man dann hinterher einen Wert angibt, der aber letzten Endes über die Qualität des Lichts nichts aussagt. Das heißt also, eine warmweiße - und das ist immer warmweiß - Glühlampe hat sehr wenig Blau und sehr viel Nahinfrarot. Eine warmweiße LED hingegen kann relativ viel Blau enthalten und enthält kein Nahinfrarot. Aber es ist für das viele Blau dann zum Beispiel ein bisschen mehr Rot oder Orange oder Gelb beigemischt, sodass das Messgerät hinterher einen Wert ausgibt, der auch 2.700 Kelvin lautet. Aber diese 2.700 Kelvin von einer Kaltlichtquelle haben nichts mit den echten 2.700 Kelvin von einer thermischen Lichtquelle zu tun. Und deswegen, also es sind optische Täuschungen letztendlich. Das Licht scheint wärmer auszusehen bei so einer LED, bei einer warmweißen LED hat aber dann für eine warme Lichtquelle eigentlich viel zu viel Blauanteile. Julia: Das heißt eigentlich, egal, was da draufsteht bei der LED, sollte man eigentlich nicht verwenden im Haus, wenn es irgendwie geht, wenn man es beeinflussen kann, sondern auf Halogen oder vielleicht sogar auf echte Glühbirnen noch setzen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, die auch zu kaufen. Dr. Alexander Wunsch: Wenn man wirklich Licht verwenden möchte, Kunstlicht verwenden möchten, das für die Gesundheit die geringsten Risiken bietet, dann ist aus meiner Sicht im Moment nur die Glühlampe oder die Halogen-Glühlampe zu empfehlen. Und bei LEDs muss man immer berücksichtigen, dass die Hersteller versuchen das Ganze von der sinnlichen Anmutung her angenehm zu gestalten, angenehmer zu gestalten, aber sie bedienen sich dabei bestimmter Trick, zum Beispiel Filament-LEDs, das sind die neuesten LED-Formen, die sehen sogar wieder aus wie Glühlampen, haben auch die Schraubfassung, da sind dann solche kleinen LCDs aufgereiht. Dr. Alexander Wunsch: Es gibt heute solche Filament-LEDs, die sehen aus wie Glühlampen von der äußeren Form, haben auch eine Schraubfassung, und innendrin ist wie so ein Glühfaden, sodass man praktisch aus der Entfernung denkt, es handelt sich wieder um die gute alte Glühlampe. Aber tatsächlich ist es dann so, dass wenn man durch einen Graufilter oder durch eine sehr, sehr starke Sonnenbrille sich den Glühfaden, den scheinbaren Glühfaden anguckt, dann stellt man fest, dass hier zum Beispiel 4 kaltweiße LEDs und eine rote LED immer wieder in Folge zu erkennen sind. Das heißt, es ist ein Stream, also ein Streifen von winzigen LEDs, wo der Hersteller durch die Wahl der Lichtfarbe, dass er eben jede 5. LED mit einer roten Lichtfarbe versieht, dadurch erreicht er, dass der Messwert, die Farbtemperatur eher in Richtung warmem Licht geht. Tatsächlich haben wir aber eine Lichtzusammensetzung mit hohen Blauanteilen durch die weißen, eher kaltweißen LEDs und das Messgerät verrechnet dann die plötzliche Rotstrahlung, indem die kaltweiße Farbtemperatur nummerisch dann in Richtung warmweiß geht. Die Tricks oder die Möglichkeiten Einfluss auf die Spektralzusammensetzung zu nehmen, sind halt bei einer LED sehr groß und der Laie kann nicht auseinanderhalten, was da jetzt im Einzelnen passiert im Inneren einer solchen Lampe. Bei einer Glühlampe ist es ganz eindeutig, da ist es ein Faden aus Metall und der glüht und der gibt dementsprechend immer dasselbe Spektrum ab. Das können die modernen Lichtquellen halt leider nicht so einfach. Julia: Ja. Ich sehe schon, die Zeit verrennt und es gäbe noch so viele Fragen. Ich würde noch ganz gerne zum Abschluss die Anknüpfung an den Anfang machen. Und zwar haben Sie eben schon erzählt, dass man auch erstmal Licht und vor allem mit ganz speziellen Wellenlängen auch therapeutisch einsetzen kann und das ist etwas, mit dem Sie in Ihrer eigenen Praxis sehr viel arbeiten. Wir haben über das Nahinfrarot schon gesprochen. Ich würde jetzt gerne einfach nur, einfach auch aus Zeitgründen, gerne Infrarot herausnehmen, weil es auch etwas ist, womit viele Leute vielleicht schon Kontakt hatten, es gibt Infrarotkabinen. Ist das etwas, was empfehlenswert ist? Muss man da auch vorsichtig sein? Gibt's da Unterschiede? Das wäre eben wirklich etwas, eine tolle Information, auch für die Zuhörer und Zuschauer, weil sich jetzt viele überlegen, vielleicht sowas anzuschaffen und meist auch sehr verunsichert, weil es ein unglaubliches Angebot an verschiedenen Produkten gibt. Dr. Alexander Wunsch: Na ja, es wäre schön, wenn es da eine einfache Antwort drauf gäbe, aber beim Infrarotbereich haben wir auch wieder 3 verschiedene grobe Rasterungen. Es gibt das Infrarot A, es gibt das Infrarot B, Ferninfrarot oder Infrarot C und die wirken alle unterschiedlich auf den Organismus. Wenn es darum geht, dass man eine Tiefenwirkung erreicht, dann ist das Infrarot A eigentlich das einzige, was hier in der Lage ist, in die Tiefe des Gewebes zu kommen. Infrarot A bekommt man allerdings technisch eigentlich immer nur im Paket mit Infrarot B in Form von Glühlampen, die teilweise mit Filter ausgestattet sind, das sind die klassischen Infrarotlampen, die man so kaufen kann für relativ wenig Geld. In dem Moment, wo es dann um Infrarotkabinen geht, da gibt's unterschiedliche Ausführungen, solche, die eben quasi Fifty Fifty Infrarot A, Infrarot B haben, andere haben dann einen höheren Anteil in der Infrarot B und auch im Infrarot C Bereich. Je langwelliger das Ganze wird, umso mehr verlagert sich die Wirkung auf eine eigentlich reine Reizwirkung auf der Hautfläche. Denn schon Infrarot B ist langwellig, dass es nicht mehr in die Tiefe geht. Zum Beispiel eine Sauna, wenn der Saunaofen eine Temperatur von 200 Grad hat beispielsweise die Steine, dann haben wir es eher mit einem Dunkelstrahler zu tun, der eher im Infrarot C Bereich angesiedelt ist. Julia: Das heißt, was ich gesehen habe, es werden auch so Vollspektren Infrarot-Saunen angeboten. Ist es dann etwas, wenn man sagt, man möchte sozusagen ein abgerundetes Paket haben, ist das etwas, was man sich durchwegs anschaffen sollte oder eher nicht? Dr. Alexander Wunsch: Hm. Man muss sich dabei immer überlegen, worum es jetzt im Einzelfall geht. Die ganzen elektrischen Systeme können unter Umständen elektromagnetische Störstrahlungen erzeugen. Man ist jetzt anders als bei einer Schwitzhütte halt dann Magnetfeldern, elektromagnetischen Feldern unter Umständen ausgesetzt. Manche Menschen reagieren darauf eher mit einer Unverträglichkeit, Sonnenlicht beispielsweise hat weniger als 5 Prozent Infrarot B, also alles, was jetzt eine spürbare Wärme auf der Haut erzeugt, dabei handelt es sich dann um Infrarot-Technologien, die nicht mehr mit dem Sonnenlicht vergleichbar sind. Julia: Ja, es ist einfach interessant, weil da einfach viel am Markt ist und man dann verunsichert ist und gar nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll. Und einerseits sehr positives natürlich hört, deswegen ist das einfach interessant, einen Experten mal zu fragen, was Ihre Meinung dazu ist. Dr. Alexander Wunsch: Vielleicht, um da nochmal einen Satz anzuhängen, es ist gibt viele Hersteller von solchen Infrarot-Saunen, man kann da bei den verschiedenen Herstellern auch Berichte lesen über die Wirkungen. Wenn sich sowas gut anfühlt und wenn man es vernünftig dosiert, dann ist es sicherlich vorteilhaft. Nur mit solchen Empfehlungen diesbezüglich bin ich zurückhaltend, man weiß nie, was dann der Anwender letztendlich aus einer Empfehlung macht, denn die Frage, was ist die optimale Dosierung, das wäre dann im Einzelfall zu klären. Die meisten Wärmekabinen haben ein Strahlungsspektrum, das mit dem Spektrum des Sonnenlichtes nicht übereinstimmt. Die Glühlampe und eine Kerzenflamme haben im Prinzip ein sehr, sehr ähnliches Spektrum, das heißt Feuer, das Feuerspektrum und das Glühspektrum, die würde ich noch als natürlich bezeichnen. Aber schon da ist es dann für eine häufige Daueranwendung wieder ein Thema, dass ich eben ein paar tausend Watt an Strahlungsleistung eigentlich nicht mit Gleichstrom erbringen kann. Das heißt ich muss wieder den Wechseltrom verwenden und dann muss man einfach eine Abwägung machen. 20 Minuten Licht oder Wärmelicht, das mit 100 Hertz pulsiert, kann sogar besser funktionieren als wenn es ungepulst wäre, aber jetzt stundenlang in einer elektrischen Sauna zu sitzen, diesem künstlichen Strahlungsumfeld, kann unter Umständen auch für den ein oder anderen eher negative Wirkungen mitbringen. Julia: Ja. Ich sehe schon, es ist alles nicht ganz so einfach, wie man es sich eben wünschen würde, aber trotzdem danke für die Zeit, für diese tollen Ausführungen. Wo können jetzt Zuhörer und Zuschauer vielleicht mehr noch über Sie erfahren oder auch zum Beispiel über die Praxis in Heidelberg? Dr. Alexander Wunsch: Zum einen habe ich einen Vimeo Kanal, wo eine ganze Reihe von Vorträgen von mir frei verfügbar sind und wem das nicht reicht, wer also da gerne einen persönlicheren Kontakt hätte, es findet zum Beispiel im November, ich glaube, es ist der 18. November, in Heidelberg ein Seminar statt über die Wirkung von Licht, über die Wirkungen von Sonnenlicht, Kunstlicht und farbigem Licht. Das ist bestimmt ein guter Einstieg, wo man dann eben auch in so einer Seminarsituation auch spezifische Fragen stellen kann, wo auch individuell sozusagen maßgeschneidert dann Themen erörtert werden können. Ansonsten bezüglich der Praxis haben Sie mich jetzt noch angesprochen. Da ist das Problem eigentlich, also ich habe bezüglich des Medizintourismus meine Vorbehalte. Das heißt, wenn sich jemand jetzt sagen wir mal hunderte von Kilometern auf den Weg macht, um in einer bestimmten Praxis vorstellig zu werden, dann ist das Ganze so aufgeladen mit Erwartungen, wo es dann sehr schwer ist, das unter Umständen zu erfüllen. Da bin ich normalerweise nicht so der Freund davon, aber natürlich ist, ich bin niedergelassener Arzt und wenn jemand jetzt Probleme hat, dann sind die unter Umständen auch nur in diesem Rahmen angehbar. ###Praxis in Heidelberg ##Termine und Veranstaltungen ##PaleoConvention am 2. - 3. Septmeber in Berlin Bücher Weitere Folgen Schlafmangel, Stress und die besten Hacks für erhöhte Leistungsfähigkeit. Interview mit Biohacker und Unternehmer Fabian Foelsch Das Natur-Defizit Syndrom - Interview mit Prof. Dr. Jörg Spitz Better Body – Better Brain: Selbstoptimierung von Körper und Geist - Anja Leitz im Interview Wie die Neurochemie des Flow-Zustand mit Ernährung, Schlaf und chronischer Entzündung zusammenhängt - Interview mit Max Gotzler Artikel Publikationen von Alexander Wunsch [Baggerly, Carole A., et al. "Sunlight and vitamin D: Necessary for public health." Journal of the American College of Nutrition 34.4 (2015): 359-365.](Baggerly, Carole A., et al. "Sunlight and vitamin D: Necessary for public health." Journal of the American College of Nutrition 34.4 (2015): 359-365.) Eells, Janis T., et al. "Mitochondrial signal transduction in accelerated wound and retinal healing by near-infrared light therapy." Mitochondrion 4.5 (2004): 559-567. Webseiten Alexander Wunsch Paleo Low Carb - JULIAS BLOG | (auf Facebook folgen)
Die Ratsherren #19 – Lügen, die erste Wohnung & Liebestipps!
Robin war im Urlaub und hat einige Geschichten mitgebracht, außerdem hat uns “MrGermanPiano” ein alternatives Intro gebastelt. Dazu kommt das grobe Oberthema “Zum ersten Mal…”, bei dem zum Beispiel die erste eigene Wohnung eine Rolle spielt. https://www.youtube.com/watch?v=pq_mo-aqrEs Zum Thema Milch & der Mensch vom Hörer Michael: “Unser heutiges Rind (Bos taurus) stammt vom Wildrind (Bos primigenius) auch Auerochse genannt ab. Wie die meisten heutigen Haustiere wurde es in der Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt, domestiziert (lat.: „domesticare“ = „ins Haus bringen“). Diese Epoche zeichnet sich dadurch aus, dass sich ein Wechsel in der Lebensweise der nomadisch lebenden Jäger und Sammler-Gesellschaften der Altsteinzeit (Paläolithikum) vollzog. Mit dem Ende der Eiszeit und dem Beginn des Holozäns, der geologischen Epoche, in der wir uns heute befinden, veränderten sich die klimatischen Bedingungen drastisch. Die Menschen wurden seßhaft und begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Diese Bewegung hatte im Nahen Osten (genauer: im fruchtbaren Halbmond) ihren Ursprung und verbreitete sich aufgrund ansteigender Bevölkerungszahlen von dort aus nach Nordafrika und Europa. Daher sind quasi alle heutigen Menschen in Europa Abkömmlinge von immigrierenden Bauern aus dem Nahen Osten, was genetisch einwandfrei nachweisbar ist (das ist aber eine ganz eigene und kompliziertere Geschichte; sollte man bloß im Hinterkopf behalten, gerade in Anbetracht der Meinung mancher -leider aktueller- politischer Strömungen). Das Rind ist nach dem Hund, der als Ausnahme bereits im Paläolithikum vor mehr als 14 tausend Jahren domestiziert wurde, das älteste Haustier des Menschen. Es wurde im 11. Jahrtausend vor heute im mittleren Euphrattal und dem oberen Tigristal domestiziert, kurz darauf folgte die Ziege, danach Schaf und Schwein. Die Nutzung von Milch ist bereits sehr früh belegt, mittels chemischer Methoden lassen sich Lipide der Milch in archäologischer Keramik nachweisen. Diese Milch wurde aber wahrscheinlich nicht direkt getrunken, sondern zu Käse oder anderen sekundären Produkten verarbeitet. Das liegt daran, dass die Menschen zu dieser Zeit die Milch noch nicht ohne Probleme trinken konnten. Wie alle Säugetiere verliert auch der Mensch mit zunehmenden Alter die Fähigkeit, Milch zu verdauen. Die liegt daran, dass mit fortschreitendem Alter das Gen LCT, welches die Produktion der Laktase (ein Enzym, das zum Verdauen von Lactose (=Milchzucker) in Glucose (=Traubenzucker) benötigt wird) steuert, abgeschaltet wird. Die Lactose wird dann stattdessen von Bakterien im Darm verdaut, was zu Bauchkrämpfen usw. führt. Durch das lange Zusammenleben mit Haustieren hat sich jedoch beim Menschen eine bisher einzigartige Veränderung durchgesetzt: die Lactoseverträglichkeit. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass eine Mutation in jenem Gen MCM6 stattgefunden hat, welches die Produktion von Lactase an- bzw. abschaltet. Es ist wird wirkungsunfähig und die Lactaseproduktion nicht mehr gestoppt, somit ist der betroffene Mensch und seine Nachkommen dauerhaft befähigt, Milch zu trinken und zu verdauen. Damit ist der Mensch das bisher einzig bekannte Tier, das darauf spezialisert ist, die Milch anderer Tiere zu konsumieren. Es handelt sich dabei um eine außerordentlich nützliche Mutation, schließlich können so Tiere über einen längeren Zeitraum als Nahrungsquelle genutzt werden und nicht nur bei der Schlachtung. Gerade in Gebieten, die für Landwirtschaft ungeeignet sind (z.B. im hohen Norden aufgrund weniger Sonnentage) weist fast jeder Mensch diese Mutation auf. In Schweden und Norwegen sind beispielsweise 98% lactoseveträglich, in Deutschland immerhin noch um die 70% (Prozentsatz von Nord nach Süd abnehmend) und in Italien 40%. Schickt uns alles an: Eine Mail an dieratsherren@superkreuzburg.de Eine PM bei Twitter an @dieratsherren Die Frage bei ask.fm/dieratsherren Die Ratsherren bei iTunes findet ihr hier! Ihr habt Fragen/Anmerkungen/Hinweise? Schickt uns alles an: Eine Mail an frage@dieratsherren.de oder artikel@dieratsherren.de Eine PM bei Twitter an @dieratsherren ► Hompage - http://www.dieratsherren.de ► Spotify - https://open.spotify.com/show/0z0PSH2ahZvJr7lm2vPcqB ► iTunes - https://itunes.apple.com/de/podcast/die-ratsherren/id1104290546?l=en&mt=2 ► Zur YT-Playlist - https://www.youtube.com/playlist?list=PLk1edVCoRiNRn92if8pcl5bOaDsFmwuX- Die Musik The Baboushkas Reassemble by Scomber (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/scomber/45402 Ft: robwalkerpoet
Die Ratsherren #19 – Lügen, die erste Wohnung & Liebestipps!
Robin war im Urlaub und hat einige Geschichten mitgebracht, außerdem hat uns “MrGermanPiano” ein alternatives Intro gebastelt. Dazu kommt das grobe Oberthema “Zum ersten Mal…”, bei dem zum Beispiel die erste eigene Wohnung eine Rolle spielt. Schickt uns alles an: Eine Mail an dieratsherren@superkreuzburg.de Eine PM bei Twitter an @dieratsherren Die Frage bei ask.fm/dieratsherren Die Ratsherren bei iTunes findet ihr hier! Zum Thema Milch & der Mensch vom Hörer Michael: “Unser heutiges Rind (Bos taurus) stammt vom Wildrind (Bos primigenius) auch Auerochse genannt ab. Wie die meisten heutigen Haustiere wurde es in der Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt, domestiziert (lat.: „domesticare“ = „ins Haus bringen“). Diese Epoche zeichnet sich dadurch aus, dass sich ein Wechsel in der Lebensweise der nomadisch lebenden Jäger und Sammler-Gesellschaften der Altsteinzeit (Paläolithikum) vollzog. Mit dem Ende der Eiszeit und dem Beginn des Holozäns, der geologischen Epoche, in der wir uns heute befinden, veränderten sich die klimatischen Bedingungen drastisch. Die Menschen wurden seßhaft und begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Diese Bewegung hatte im Nahen Osten (genauer: im fruchtbaren Halbmond) ihren Ursprung und verbreitete sich aufgrund ansteigender Bevölkerungszahlen von dort aus nach Nordafrika und Europa. Daher sind quasi alle heutigen Menschen in Europa Abkömmlinge von immigrierenden Bauern aus dem Nahen Osten, was genetisch einwandfrei nachweisbar ist (das ist aber eine ganz eigene und kompliziertere Geschichte; sollte man bloß im Hinterkopf behalten, gerade in Anbetracht der Meinung mancher -leider aktueller- politischer Strömungen). Das Rind ist nach dem Hund, der als Ausnahme bereits im Paläolithikum vor mehr als 14 tausend Jahren domestiziert wurde, das älteste Haustier des Menschen. Es wurde im 11. Jahrtausend vor heute im mittleren Euphrattal und dem oberen Tigristal domestiziert, kurz darauf folgte die Ziege, danach Schaf und Schwein. Die Nutzung von Milch ist bereits sehr früh belegt, mittels chemischer Methoden lassen sich Lipide der Milch in archäologischer Keramik nachweisen. Diese Milch wurde aber wahrscheinlich nicht direkt getrunken, sondern zu Käse oder anderen sekundären Produkten verarbeitet. Das liegt daran, dass die Menschen zu dieser Zeit die Milch noch nicht ohne Probleme trinken konnten. Wie alle Säugetiere verliert auch der Mensch mit zunehmenden Alter die Fähigkeit, Milch zu verdauen. Die liegt daran, dass mit fortschreitendem Alter das Gen LCT, welches die Produktion der Laktase (ein Enzym, das zum Verdauen von Lactose (=Milchzucker) in Glucose (=Traubenzucker) benötigt wird) steuert, abgeschaltet wird. Die Lactose wird dann stattdessen von Bakterien im Darm verdaut, was zu Bauchkrämpfen usw. führt. Durch das lange Zusammenleben mit Haustieren hat sich jedoch beim Menschen eine bisher einzigartige Veränderung durchgesetzt: die Lactoseverträglichkeit. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass eine Mutation in jenem Gen MCM6 stattgefunden hat, welches die Produktion von Lactase an- bzw. abschaltet. Es ist wird wirkungsunfähig und die Lactaseproduktion nicht mehr gestoppt, somit ist der betroffene Mensch und seine Nachkommen dauerhaft befähigt, Milch zu trinken und zu verdauen. Damit ist der Mensch das bisher einzig bekannte Tier, das darauf spezialisert ist, die Milch anderer Tiere zu konsumieren. Es handelt sich dabei um eine außerordentlich nützliche Mutation, schließlich können so Tiere über einen längeren Zeitraum als Nahrungsquelle genutzt werden und nicht nur bei der Schlachtung. Gerade in Gebieten, die für Landwirtschaft ungeeignet sind (z.B. im hohen Norden aufgrund weniger Sonnentage) weist fast jeder Mensch diese Mutation auf. In Schweden und Norwegen sind beispielsweise 98% lactoseveträglich, in Deutschland immerhin noch um die 70% (Prozentsatz von Nord nach Süd abnehmend) und in Italien 40%. In Asien hingegen ist fast jeder Mensch lactoseintol...
… ist ein „Helfer-Enzym“, das in allen unseren Körperzellen vorkommt. Unter „Schlagzeilen“ wie „Antiaging“ und „Herzschutz-Enzym“ wird es seit Jahren in Form von Nahrungsergänzungen als Bestseller gehandelt. Doch was genau steckt hinter dem essenziellen Enzym, das bedeutende Aufgaben für die Energieversorgung und die gesamte Zellgesundheit wahrnimmt? Wie und warum kann Coenzym 10 tatsächlich die Blutfettwerte … Sendung 12: Coenzym Q10 weiterlesen →
#01 Rettung für das Klima? - Die Bilanz des Gipfels von Paris
MERS-Impfung - Schutz für Tier und Mensch/ Gesunder Dreck - Forscher finden schützendes Enzym vor Allergien/ Schwachstellen in der Tiefsee - Kabelrisse können Internet lahmlegen
#01 Klimavertrag-Tiefseekabel-Allergien-Luftpumpe
Rettung für das Klima? Die Bilanz des Gipfels von Paris / Schwachstellen in der Tiefsee - Kabelrisse können das Internet lahmlegen / Gesunder Dreck - Forscher finden Enzym, das vor Allergien schützt / Achtung Physik - Warum die Luftpumpe heiß wird.
Untersuchungen zur Rolle der Glutathion-Peroxidase 4 als möglicher Redox-Sensor in Säugetierzellen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
GPx4 besitzt vielfältige Funktionen im Redox-Metabolismus von Zellen. Ursprünglich wurde sie als ein Enzym beschrieben, das hoch effizient Phospholipidhydroperoxide zu den entsprechenden Alkoholen unter GSH-Verbrauch reduzieren kann. Weiterhin hatte sich in den letzten 10 bis 15 Jahren gezeigt, dass sie eine essenzielle Rolle als Thiolperoxidase in der Spermienreifung ausübt. Eine weitere Funktion stellt möglicherweise die eines Redox-Sensors dar, der auf die Änderung des zellulären Redox-Milieus mit der Aktivierung von antioxidativen Zellsignalwegen reagiert. Diese Funktion konnte bislang nur für das GPx4-Homolog in der Hefe nachgewiesen werden und kann aufgrund der Rolle, die die GPx4 bei der Spermienreifung in Mäusen spielt, auch für Säugetiere postuliert werden. Es handelt sich dabei um die Fähigkeit der GPx4 in ihrer Funktion als Thiolperoxidase Disulfid- oder auch Selenylsulfidbindungen zwischen anderen Proteinen zu bilden. Dabei ist die GPx4 vermutlich auch in der Lage, ihre eigenen Cysteine als Substrat zu akzeptieren, was allerdings im Falle der Spermienreifung zu einer Inaktivierung der peroxidativen Funktion führt. Diese Thiolperoxidasefunktion ist abhängig von der Menge an freiem GSH. Der Schwerpunkt dieser Arbeit war es, mögliche Interaktionspartner in somatischen Zellen zu identifizieren, wobei die Thiolperoxidasefunktion der GPx4 bei Änderung des zellulären Redox-Milieus in Form von oxidativem Stress ausgenutzt werden sollte. Als Methode wählten wir ein modifiziertes Tandem-Affinity-Purification-enhanced-Verfahren (TAPe). Mit Hilfe dessen wurde eine mit einem Strep/Flag-Tag versehene GPx4 oder verschiedene Mutanten stabil in induzierbaren GPx4 Knockout murinen embryonalen Fibroblasten exprimiert, sodass die getaggte GPx4 mittels des TAPe Verfahren aus den Zellen aufgereinigt werden konnte. Um intrazelluläre GSH-Konzentrationen zu reduzieren und die GPx4 zu oxidieren, wurden die Zellen vor der Lyse mit BSO und tBOOH vorbehandelt. Die Eluate aus diesen Aufreinigungen wurden anschließend anhand der Massenspektrometrie, Silberfärbung und Western Blots analysiert. Es ließen sich eine ganze Reihe von Proteinen identifizieren, die ebenfalls eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung des intrazellulären Redox-Milieus spielen und an der Regulierung von Zellsignalwegen beteiligt sind. Nach den bisherigen Analysen bedarf es aber noch einer Bestätigung mittels co-Immunpräzipitation und Immunoblot-Analysen. Besonders aktuelle Erkenntnisse, die neue Zelltodsignalwege, wie zum Beispiel die Ferroptose, analysieren, stellen eine interessante und äußerst relevante Richtung für zukünftige Projekte in der Erforschung der GPx4 und ihrer Rolle als Redox-Sensor und Regulator von Zelltodsignalwegen dar.
Einfluss eines Carboanhydrase XII-spezifischen Antikörpers auf das Tumorwachstum in vitro und in vivo sowie Onkosomen-basierte Generierung neuer tumorreaktiver Antikörper
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/06
In dieser Arbeit wurden Mikrovesikel, die von Tumor-Zelllinien in hohen Konzentrationen sekretiert wurden, zur Immunisierung von Ratten verwendet, um auf diese Weise monoklonale Anti-körper gegen membranständige Proteine zu generieren, die auf Tumorzellen vorhanden sind. Der Grund für diesen Ansatz ist, dass Mikrovesikel verschiedenste Membranproteine enthalten, die in Tumorzellen in hohem Maße exprimiert werden. Diese Mikrovesikel sind etwa hundertfach kleiner als die Zellen, denen sie entstammen und daher deutlich weniger komplex. Gleich-zeitig enthalten sie aber überproportional viele Membran-proteine. Viele, aber nicht alle dieser Proteine sind in der Onko-logie und Tumorimmunologie bereits als Tumor-assoziierte Antigene bekannt, weshalb diese Mikrovesikel hier als Onko-somen bezeichnet werden. Es hat sich herausgestellt, dass sich Onkosomen hervorragend zur Immunisierung verwenden lassen und durch ihre Immunogenität die Möglichkeit bieten, mono-klonale Antikörper gegen zunächst unbekannte, aber onko-logisch relevante Membranproteine zu generieren. Aus solchen Immunisierungen war in der Arbeitsgruppe der Antikörper 6A10 hervorgegangen, der mit hoher Spezifität und Effizienz die Tumor-assoziierte Carboanhydrase XII (CA XII) er-kennt und inhibiert. CA XII ist ein membranständiges Enzym, das auf einer Vielzahl hypoxischer Tumoren exprimiert ist und für die Homöostase des leicht alkalischen intrazellulären pH-Wertes vieler Tumorzellen entscheidend ist. Mit dem inhibitorischen Antikörper 6A10 konnte ich in dieser Arbeit zeigen, dass eine spezifische Hemmung der CA XII-Enzymaktivität zu einem ver-zögerten Wachstum dreidimensionaler Tumorzellverbände in vitro und in vivo führt. Bei den in-vivo-Versuchen konnte ich dabei das Wachstum von Luziferase-exprimierenden Tumoren in immundefekten NSG-Mäusen durch Biolumineszenz-basierte Bildgebung (BLI) über lange Zeiträume exakt verfolgen und quantifizieren. Mittels Fluoreszenz-basierter Bildgebung konnte ich zudem die spezifische Bindung eines 6A10-Infrarotfarbstoff-Konjugates an Tumorzellen in vivo visualisieren. Da es zuvor keinen spezifischen Inhibitor gegen die CA XII gab, waren dies die ersten Untersuchungen, die speziell die CA XII als Ziel-struktur behandelten und für die klinische Onkologie als relevantes Tumor-assoziiertes Antigen validieren konnten. In einem zweiten Teil meiner Arbeit ermittelte ich die Spezifität weiterer Tumor-reaktiver Antikörper, die aus Immunisierungen mit Onkosomen hervorgegangen sind. Diese Antikörper erkann-ten nativ gefaltete Antigene auf der Oberfläche von Tumorzellen und könnten zur Beantwortung verschiedener onkologischer Fragestellungen Verwendung finden. Neben dieser unspezi-fischen „reversen“ Immunisierungsmethode, verwendete ich Onkosomen erfolgreich auch zur gezielten Generierung von Antikörpern gegen ein definiertes membranständiges Protein, die humane Carboanhydrase IX. Die CA IX ist ein weiteres be-kanntes membranständiges Tumor-assoziiertes Antigen, das oft mit der Carboanhydrase XII auf invasiven soliden Tumoren ko-exprimiert ist. Damit konnte ich belegen, dass sich Mikrovesikel nicht nur für die Generierung neuartiger Tumor-reaktiver Anti-körper, sondern auch für die Entwicklung von Antikörpern gegen ein Molekül der Wahl eignen. Die Immunisierung mit nativ ge-falteten Proteinen im Kontext immunogener Mikrovesikel könnte sich zukünftig als Möglichkeit zur Generierung von Antikörpern erweisen, die mit klassischen Immunisierungsmethode nicht oder nur schwer zu erhalten sind.
Die Rolle des Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) bei der axonalen Regeneration im zentralen Nervensystem
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Jedes Jahr erleiden weltweit circa 22 Menschen pro eine Million Einwohner eine Querschnittslähmung, die bei den Betroffenen zu dauerhaften Behinderungen und erheblichen Einschränkungen im Alltag führt. Die schwerwiegenden Defizite nach einer Querschnittslähmung, darunter Lähmungen und chronischer Schmerz, sind darauf zurückzuführen, dass geschädigte Axone im Rückenmark kaum regenerieren und es auch nur in geringem Ausmaß zur funktionellen Reorganisation der noch erhaltenen Nervenverbindungen kommt. Im Unterschied zum peripheren Nervensystem, wo zerstörte Nervenfasern erfolgreich regenerieren, ist die axonale Regenerationskapazität des zentralen Nervensystems (ZNS) spärlich ausgeprägt. Zwar konnte durch intensive Forschung im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine Anzahl von „extrinsischen“ wachstumshemmenden Molekülen von Gliazellen und der extrazellulären Matrix des ZNS identifiziert werden. Es gibt jedoch zunehmend Hinweise darauf, dass zahlreiche dieser „extrinsischen“ Signale letztlich in „intrinsische“ Signalwege der Neuronen selbst einmünden um schließlich die Transkription neuronaler Gene zu verändern. Einer der interessantesten intrinsischen Regulatoren axonaler Regeneration ist der Transkriptionsfaktor ´Signal transducer and activator of transcription 3´ (STAT3). In dieser Arbeit habe ich mithilfe moderner In-vivo-Mikroskopie sowie viraler Gentherapie in Spinalganglien genetisch veränderter Mäuse zum ersten Mal die entscheidende Rolle von STAT3 in der intrinsischen Regulation axonaler Regeneration in vivo identifizieren können. So konnte nachgewiesen werden, dass die nur rudimentär ausgeprägte Regeneration der zentralen Fortsätze der Neuronen in den Spinalganglien mit einer fehlenden Induktion von STAT3 in den entsprechenden Ganglien einhergeht. Durch Überexpression von STAT3 mittels rekombinanter Adeno-assoziierter Viren in zervikalen Spinalganglien konnte zwei Tage nach Läsion das Auswachsen von Axonen sowie das Aussprießen von Kollateralen um mehr als das Vierfache gesteigert werden. Darüber hinaus konnte mittels repetitiver Multiphotonenmikroskopie einzelner fluoreszenzmarkierter Axone gezeigt werden, dass die Überexpression von STAT3 nur in der Frühphase (2-4 Tage) die axonale Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen konnte, nicht aber zu einem späteren Zeitpunkt (4-10 Tage) nach Läsion. Um die Hypothese zu überprüfen, dass die fehlende Aufrechterhaltung des axonalen Wachstums durch Kontakt der aussprossenden Axone mit einem zunehmend inhibitorischen ZNS-Milieu bedingt ist, wurde die Überexpression von STAT3 zusätzlich mit der Applikation von Chondroitinase ABC, einem Enzym, das die inhibitorischen Moleküle der glialen Narbe neutralisieren kann, kombiniert. Dabei konnte ich zeigen, dass das durchschnittliche Wachstum von Axonen um mehr als das Zweifache gesteigert werden konnte. Aus den Ergebnissen meiner Versuche konnte ich mehrere Schlussfolgerungen ziehen: Erstens konnte ich STAT3 als effektiven Initiator axonalen Wachstums nach Rückenmarksläsion identifizieren. Zweitens wurde nachgewiesen, dass STAT3 selektiv Wachstum in der frühen Phase reguliert, nicht jedoch zu späteren Zeitpunkten. Daraus folgt, dass das axonale Regenerationsprogramm aus mindestens zwei verschiedenen, molekular distinkten Phasen besteht. Mit STAT3 wurde zum ersten Mal ein phasenspezifischer Regulator der axonalen Regeneration entdeckt. Abschließend konnte gezeigt werden, dass synergistische Therapien - wie hier durch die Kombination von STAT3 und Chondroitinase ABC belegt wurde - axonales Wachstum zusätzlich verbessern. Die gewonnenen Einblicke in die Mechanismen axonaler Regeneration geben Grund zur Hoffnung, dass in der Zukunft effektive Kombinationstherapien für Querschnittsgelähmte entwickelt werden können.
Expression und Regulation der Cysteinprotease Cathepsin X in Prostatakarzinom-Zelllinien
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 14/19
Cysteinproteasen, zu denen zahlreiche Cathepsine zählen, spielen eine wichtige Rolle in (patho)physiologischen Prozessen, die mit Gewebedestruktion verbunden sind. In diesem Kontext wurden vor allem Cathepsin B extrazelluläre Funktionen bei der Tumorinvasion und -metastasierung zugeschrieben. Es häufen sich jedoch Hinweise darauf, dass auch Cathepsin X an invasiven Vorgängen beteiligt ist. Cathepsin X wird unter anderem in Zellen der Immunabwehr sowie in maligne entarteten Organzellen stark exprimiert. Eine erhöhte Expression des Enzyms wurde vor allem beim Prostatakarzinom beschrieben. Zu Beginn dieser Arbeit war jedoch wenig über die Mecha-nismen bekannt, die für diese Überexpression verantwortlich ist. Durch Stimulationsversuche konnte in einem Prostatakarzinom-Zellmodell (LNCaP) gezeigt werden, dass weder das Androgen Testosteron, welches essentiell für die Entwicklung eines Prostatakarzinoms ist, noch Proteine der extrazellulären Matrix (EZM) in der Lage sind, die intra- und extrazelluläre (Pro)Cathepsin X-Konzentration zu steigern. Ob Cathepsin X bei der Tumorinvasion eine maßgebliche Rolle spielt, war zu Beginn der vor-liegenden Arbeit ebenfalls weitgehend unbekannt. Deshalb wurde die Protease unter Anwen-dung der siRNA-Technik in Prostatakarzinomzellen (PC-3) herunter reguliert und die Zellen im Anschluss auf ihr Invasionsvermögen analysiert. Dabei konnte nach Niederregulation von (Pro)Cathepsin X eine signifikant verminderte Invasivität der Zellen beobachtet werden. Da dieses Enzym nur Carboxypeptidase-Aktivität besitzt, muss eine Beinflussung der Zellinvasivität durch direkte Degradation der EZM allerdings ausgeschlossen werden. Eine mögliche Wirkweise wäre, dass Procathepsin X über dessen RGD-Sequenz an Zelloberflächenrezeptoren bindet und durch Aktivierung von Signaltransduktionswegen die Invasionsfähigkeit der Zellen beeinflusst. In Versuchen mit humanem Plasma und konditio-niertem Zellmedium konnte gezeigt werden, dass Procathepsin X extrazellulär vorkommt und somit theoretisch RGD-abhängig an Adhäsionsmoleküle vom Integrin-Typ binden kann. Im Verlauf dieser Arbeit mehrten sich auch Hinweise darauf, dass Procathepsin X in der Lage ist an EZM- und Plasmaproteine zu binden. Experimente mit rekombinanten Komponenten zeigten eine eindeutige Interaktion mit dem EZM-Protein Fibronektin. Zudem scheint Pro-cathepsin X mit dem Serpin α1-Antitrypsin einen SDS-stabilen Komplex zu bilden. Die ent-sprechenden Bindungsstellen müssen in weiteren Versuchen identifiziert sowie die bio-logische Bedeutung dieser Interaktionen ermittelt werden.
Klinische Verlaufsstudie zur Enzymersatztherapie mit Alglucosidase alfa über 36 Monate bei Morbus Pompe im Erwachsenenalter
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 14/19
Die Stoffwechselkrankheit Morbus Pompe ist eine seltene autosomal-rezessiv vererbte, multisystemische lysosomale Speichererkrankung. Ursächlich für die Krankheit sind Mutationen im Gen GAA (Chromosom 17), das für das Enzym saure α-Glukosidase kodiert. Dieses Enzym setzt normalerweise Glukose aus Glykogen in Lysosomen frei. Ein Mangel dieses Enzyms, das bei Gesunden in allen Geweben aktiv ist, führt zu Strukturveränderungen in Muskulatur, Leber, Herzmuskel, Gefäßsystem und Nervensystem und damit zu einem breiten und heterogenen Spektrum an klinischen Symptomen. Die schwere juvenile Verlaufsform mit hypertropher Kardiomyopathie und ausgeprägter Muskelschwäche führt in den ersten beiden Lebensjahren zum Tod, die mildere adulte Form beginnt erst im Erwachsenenalter und führt zu progredienter Muskelschwäche und respiratorischer Insuffizienz. Die verschiedenen Verläufe sind abhängig von der verbleibenden Enzymaktivität. Unbehandelt verläuft die Erkrankung progredient in unterschiedlicher Schnelligkeit und Ausprägung. Seit 2006 kann der Morbus Pompe durch eine Enzymersatztherapie mit Alglucosidase-alfa behandelt werden. In einer offenen klinischen nicht-verblindeten Beobachtungsstudie wurde an 7 deutschen Zentren die Wirksamkeit und Verträglichkeit dieser Enzymersatztherapie über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht. An der Studie teilgenommen haben 38 adulte gesichterte Morbus Pompe Patienten mit variabler Ausprägung der Krankheit. Zur Verifizierung der Therapieauswirkung wurden die Patienten vor und nach jeweils 12 Monaten Enzymersatztherapie je 11 Untersuchungen unterzogen, die aus Muskelfunktions- und Kraftmessungen sowie Lungenfunktion, Serum-Kreatininkinase-Messung, einem Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität, einem Schmerzfragebogen und einer Bestimmung der Antikörpertiter bestanden. Bei den meisten Tests zeigten sich keine signifikanten Veränderungen im Verlauf der drei Jahre. Ausnahmen waren der 6-Minuten Geh-Test, der SF36 und die Serum-Kreatinkinase. Mit länger dauernder Therapie entwickeln nahezu alle Patienten Antikörper gegen das therapeutische Enzym, trotzdem zeigen die wenigsten anaphylaktische Reaktionen. Die klinischen Testergebnisse aus dieser 3-Jahres-Studie sowie auch die Ergebnisse anderer Studien deuten insgesamt auf eine Stabilisierung der neuromuskulären Funktion mit milden funktionellen Verbesserungen hin. Da der natürliche Verlauf progredient ist, ist eine Stabilisierung mit teilweiser Tendenz zur Verbesserung für die Patienten ein Therapieerfolg. Da diese Therapie lebenslang durchgeführt werden muss, sind weitere Studien über einen längeren Verlaufszeitraum nötig.
Klinische Verlaufsdokumentation der Enzymersatztherapie mit Alglucosidase alfa über ein Jahr bei 44 adulten Patienten mit Glykogenose Typ II
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Hintergrund: Die Glykogenose Typ II (Morbus Pompe) vom adulten Typ ist eine autosomal rezessiv vererbte, progressive, lysosomale Glykogenspeicherkrankheit, die durch den Mangel des lysosomalen Enzyms saure α-1,4-Glukosidase, durch Mutationen im Gen für dieses Enzym verursacht, geprägt ist. Klinisch ist sie charakterisiert durch eine Schwäche und Atrophie der Skelett- und Atemmuskulatur, resultierend in motorischer, v.a. Gehschwäche bis Rollstuhlpflichtigkeit und respiratorischer Einschränkung bis Insuffizienz. 2006 wurde das rekombinante humane Enzym alglucosidose alfa der Firma Genzyme zur Enzymersatztherapie (EET) für alle Formen des Morbus Pompe zugelassen. Methoden: In einer multizentrischen, offenen klinischen Beobachtungsstudie wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit der EET mit alglucosidase alfa in einem Patientenkollektiv von 44 adulten Morbus Pompe Patienten mit variablen Krankheitsausprägungen untersucht. Die zehn Untersuchungen bestanden aus einem Arm Function Test (AFT), dem Walton Gardner Medwin Scale (WGMS), den vier Timed Funktion Tests 10 Meter gehen, 4 Stufen Steigen, 6 Minuten Gehen und Aufstehen aus dem Liegen, der Erfassung des MRC-Summenscores, der Messung der Vitalkapazität in der Lungenfunktion, der Messung des CK-Serumlevels sowie dem selbstauszufüllenden Fragenbogen SF-36. Alle diese Tests wurden vor Beginn der EET sowie alle drei Monate und nach Abschluss eines Jahres der Therapie durchgeführt. Ergebnisse: Unter der EET kam es bei ca. 10 % der Patienten zu geringeren allergischen Reaktionen, die erfolgreich mit Antihistaminika und Kortikosteroiden behandelt werden konnten. Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Kein Patient brach die Therapie ab, kein Patient verstarb und kein Patient wurde neu beatmungspflichtig. Bei den meisten Tests zeigten sich keine signifikanten Veränderungen nach einem Jahr EET im Vergleich zur Anfangszeitpunkt. Ausnahmen waren das CK-Serumlevel, das sich signifikant in der Gesamtgruppe sowie besonders in der Untergruppe der Frauen verringerte, sowie die beiden Timed Funktion Tests Aufstehen aus dem Liegen und 6 Minuten Gehen, bei denen sich signifikant die Zeit verringerte bzw. die Gehstrecke verlängerte. Letzteres traf besonders auf eine Untergruppe von fünf gehfähigen Patienten zu, die während der EET auf einem Fahrradergometer trainierten. Fazit: Alglucosidase alfa stellt sich bisher als sichere Therapie für Patienten mit Glykogenose Typ II vom adulten Typ dar. Die klinischen Testergebnisse aus dieser 1-Jahres-Studie sowie aus anderen Studien deuten auf eine Stabilisierung der neuromuskulären Funktion mit milden funktionellen Verbesserungen, v.a. unter begleitendem Training, hin [Angelini et al., 2009; Van der Ploeg et al., 2010; Bembi et al., 2010]. Trotz der hohen Jahrestherapiekosten von ca. 500.000,- EUR sollte die EET bei Patienten mit gesicherter Glykogenose Typ II daher fortgeführt werden. Ausblick: In weiteren, länger angelegten Studien sind die langfristige Verträglichkeit sowie klinische Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum als ein bis zwei Jahre hinaus zu untersuchen. Außerdem ist die Rolle der Ernährung sowie des körperlichen Trainings unter EET bisher nicht bekannt. Ausblickend werden schließlich neue Therapieformen wie Chaperon-Therapie oder Gentherapie erforscht.
Neuroanatomische Identifizierung funktioneller Neurone im Nucleus abducens des Menschen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Der Nucleus abducens des Menschen besteht analog zum Rhesusaffen aus mindestens vier Neuronenpopulationen, den cholinergen Motoneuronen und den nicht cholinergen internukleären Neuronen und Paramediantrakt-Neurone. Da die Neuronengruppen unter-schiedliche histochemische Eigenschaften besitzen, lassen sie sich auf Basis immunhistochemischer Färbungen differenzieren. Die Gesamtpopulation der Motoneurone lässt sich durch die immunhistochemische Markie-rung der Cholin Acetyltransferase, einem Enzym, das nur in cholinergen Zellen vorkommt, visualisieren. Eine zusätzliche Doppelfärbung für perineuronale Netze demarkiert die Popula-tion der internukleären Neurone und PMT-Neurone, die nicht cholinerg sind und etwa 30-40% der Neurone repräsentieren. Motoneurone und internukleäre Neurone liegen innerhalb des Kerngebietes des Nucleus abducens vermengt, mit einer tendenziellen Lage der internukleären Neurone in den ventralen zwei Dritteln. Da die PMT-Neurone ähnliche histochemische Eigenschaften aufweisen, wie die internukleären Neurone, konnten sie in dieser Arbeit nicht weiter abgegrenzt werden und ihre genaue Lokalisation nicht bestimmt werden. Die Motoneurone des Menschen können in zwei molekular und morphologisch unterschiedli-che Populationen unterteilt werden, die Twitch und Non-Twitch Motoneurone. Sie lassen sich analog zum Rhesusaffen anhand kombinierter Immunfärbungen auf cholinerge Marker, die beide Populationen markieren und perineuronale Netze oder nicht phosphorylierte Neurofila-mente, differenzieren. Die Größe der Motoneuronpopulationen korreliert mit dem der Rhesus-affen und liegt in dem Verhältnis von 20% putative Non-Twitch zu 80% Twitch Motoneurone, quantitativ im ähnlichen Verhältnis von SIF- zu MIF-Muskelfasern. Im Menschen liegen die putativen Non-Twitch Motoneurone deutlicher als im Rhesusaffen diffus im Kerngebiet des Nucleus abducens verteilt, allerdings auch mit Betonung des medialen Abschnittes. Die Immunhistochemie markiert hierbei eine deutlich höhere Anzahl putativer Non-Twitch Moto-neurone innerhalb des Kerngebietes, als Trakt-Tracer Versuche am Rhesusaffen gezeigt haben. Dies könnte eine Konsequenz dessen sein, dass bei den distalen Tracer-Injektionen vor allem Non-Twitch Motoneurone der globalen Schicht markiert werden, durch die Färbung aber die gesamte Population der putativen Non-Twitch Motoneurone der globalen und der orbitalen Muskelschicht erfasst wird. Die Verschiedenheit der Twitch und der putativen Non-Twitch Motoneurone weisen auch im Menschen auf potentiell unterschiedliche Eigenschaften hin. In Zusammenschau mit dem Substrat ihrer Innervation, Twitch Motoneurone die SIF-Fasern und die Non-Twitch Moto-neurone die MIF-Fasern, liegt die Schlußfolgerung nahe, dass sie darüber unterschiedliche Einflüsse auf die Augenbewegungen haben könnten. Mit dem Nachweis beider Motoneuronenpopulationen im Menschen im Kontext neuerer Studien über die unmittelbare Nähe der Nervenendigungen der Non-Twitch Motoneurone zu den Palisadenendigungen, die als putative sensorische Organe gelten, wird das Konzept einer speziesübergreifenden dualen motorischen Innervation bekräftigt.
Regulation lysosomaler Cysteinproteasen durch extrazelluläre Matrixproteine in humanen mesenchymalen Stammzellen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Eine zunehmende Zahl von Daten aus der Fachliteratur weist immer deutlicher darauf hin, dass Tumor- und Stammzellen trotz aller funktionellen Unterschiede, wie beispielsweise der Destruktion von gesundem Gewebe bzw. Regeneration von zerstörtem Gewebe, offensichtlich wesentliche Gemeinsamkeiten aufzeigen, insbesondere hinsichtlich der molekularen Mechanismen, die z.B. den zellulären Prozessen Differenzierung/Transformation, Zellalterung, Apoptose und Migration/Invasion zugrunde liegen. Im Gegensatz zur Situation bei Tumorzellen ist die Rolle lysosomaler Cysteinproteasen in humanen mesenchymalen Stammzellen (hMSC) bei diesen Prozessen jedoch noch weitgehend unbekannt und sollte daher im Rahmen dieser Arbeit genauer definiert werden. So konnten wir erstmals nachweisen, dass lysosomale Cysteinproteasen sowohl in hMSC exprimiert als auch während deren Kultivierung sezerniert werden. Von den elf bekannten humanen lysosomalen Cystein¬proteasen (Cathepsine) wurden vor allem Cathepsin B und Cathepsin K durch extrazelluläre Matrix (EZM)-Proteine, insbesondere durch Vitronektin, in ihrer Expression beeinflusst und zeigten eine kontinuierliche Erhöhung der Expression im Verlauf von 21 Tagen. Eine vermehrte Sekretion nach Vitronektinstimulation wurde proteinche-misch bei Cathepsin B und X nachgewiesen. Im Gegensatz dazu hatten Stimulationen mit Kollagen I und Laminin keinen signifikanten Einfluss auf die Expression bzw. Freisetzung dieser Proteasen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Adhäsions-/Migrationsverhalten der hMSC durch EZM-Proteine vor allem über deren Wechselwirkung mit Adhäsionsmolekülen (Integrinen) beeinflusst wird. Zudem kann auch Procathepsin X in Abhängigkeit von Integrin αvβ3 an hMSC binden. Durch die Interaktionen der hMSC mit EZM-Proteinen sowie mit Procathepsin X wird eine Reihe von Signaltransduktionswegen, darunter der ERK-Signalweg, aktiviert. In Transmigrationsversuchen mit Cathepsin X-defizienten hMSC wurde zudem nachgewiesen, dass Procathepsin X – im Gegensatz zur Konstellation bei Tumorzellen – keine bedeutende Rolle bei der Migration der hMSC spielt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass gegen dieses Enzym gerichtete Tumortherapiestrategien nur geringe (oder gar keine) Auswirkungen auf Stammzell-Mobilisation/Migration haben. Die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen in vitro-Daten zeigen somit neue Erkenntnisse bezüglich der Regulation lysosomaler Cysteinproteasen durch extrazelluläre Matrixproteine in hMSC und stellen daher eine gute Basis für weitere in vitro- bzw. auch in vivo-Evaluierungen dar.
Interdisziplinäre Einsichten: Die vielen Gesichter der Demenz
Die Erforschung von Altersdemenz macht an der LMU große Fortschritte. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst von vier Wissenschaftlern. Professor Christian Haaß, Adolf-Butenandt-Institut, konnte die normale Funktion eines Alzheimerenzyms aufklären. Professor Jochen Herms gelang ein ähnlicher Funktionsnachwei bei dem zentralen Alzheimerprotein. Seine Kollegen am Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung, Privatdozentin Manuela Neumann und Professor Hans Kretzschmar, identifizierten dagegen in internationaler Kooperation das wichtigste Protein der Frontotemporalen Demenz – und eröffneten damit ein neues Gebiet der Neurodegenerationsforschung.
Entwicklung und Validierung eines kompetitiven Enzym-gekoppelten Immunadsorptionstests für den Nachweis von Antikörpern gegen Theileria annulata im Serum von Rindern
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/07
Sat, 13 Feb 2010 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11414/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11414/1/Renneker_Stefanie.pdf Renneker, Stefanie
Über die Rolle von Macrophage Migration Inhibitory Factor(MIF) bei der murinen Hauttumorgenese
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) ist ein 12,5 kDa großes Protein, das als Homotrimer in fast allen Körpergeweben konstitutionell exprimiert wird und proinflammatorische wie wachstumsregulierende Eigenschaften aufweist. Die experimentelle Datenlage über die Wirkmechanismen von MIF zeigen, dass MIF sowohl extrazelluläre Wirkung als Zytokin/Chemokin wie auch eine intrazelluläre Wirkung als Regulator von Ubiquitylierung und proteasomaler Aktivität oder als Enzym mit Tautomerase-Aktivität besitzt. Für alle Mechanismen ist ein Einfluss von MIF auf Wachstumsregulation beschrieben. Die Evidenz für MIF als Tautomerase ist allerdings schlecht belegt und es wird diskutiert, ob dies ein Artefakt oder ein Relikt aus evolutionären Vorformen von MIF ist. Ziel dieser Arbeit ist es, über genetisch modifizierte Mäuse, die entweder eine komplette Deletion des MIF-Gens (MIF Knock-Out-Maus) oder eine Punktmutation mit Verlust der Enzymaktivität tragen, die funktionelle Rolle von MIF bei der Hauttumorgenese zu bestimmen und zu testen, ob die Tautomerase-Aktivität von MIF von funktioneller Relevanz bei der Tumorgenese ist. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Abwesenheit von MIF in der murinen Haut während der chemischen One Stage-Karzinogenese mit Benzo[α]pyren zu verstärkter Tumorbildung führt. Der Verlust von Prolin 1 und damit der Tautomeraseaktivität alleine führt zu einem Phänotyp, welcher zwischen dem des Knock-Outs und dem des Wildtyps liegt. Dies weist daraufhin, dass Prolin 1 oder alternativ die Tautomeraseaktivität eine wichtige biologische Rolle für die Funktion von MIF bei der malignen Transformation von Keratinozyten spielt.
Referenzwerterstellung für die Simpson-Scheibchensummations-Methode und Untersuchung des Einflusses einer zusätzlich zu Pimobendan und Furosemid verabreichten Angiotensin-Converting-Enzym-Therapie auf die Entwicklung selektiver Ultraschallparameter bei Hu
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/07
Fri, 17 Jul 2009 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10390/
Einfluss des Paraoxonase-Phänotyps auf die Abbaugeschwindigkeit hochtoxischer Phosphoryloxime
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Die Fähigkeit der meisten aktiven Pyridinium-4-Aldoxime, wie Obidoxim und Trimedoxime, zur Reaktivierung phosphorylierter Acetylcholinesterase (AChE) ist noch nicht vollständig untersucht, da es zur unvermeidbaren Bildung von Phosphoryloximen (POX) kommt, diese sind ihrerseits extrem potente Inhibitoren der AChE. Vermutet wird das Vorliegen eines topochemischen Gleichgewichts am aktiven Zentrum, wobei das eben reaktivierte Enzym sofort durch POX wieder re-inhibiert wird. In der folgenden Arbeit wurden Dimethylphosphoryl-, Diethylphosphoryl- und Diisopropylphosphoryl-Obidoxime Verbindungen synthetisiert und isoliert. Ihre Hemmkonstanten gegenüber der AChE humaner Erythrozyten waren um den Faktor 2250, 480 und 600 höher, als die Entsprechenden von Paraoxon-methyl, Paraoxon-ethyl und Diisopropylfluorophosphat. Alle drei POX-Verbindungen wurden durch humane Paraoxonase 1 (PON1) hydrolysiert, dabei war das Alloenzym PON1 192Q um den Faktor 50 aktiver als PON1 192R. Das Verhältnis der Hydrolysegeschwindigkeiten mit Obidoxime als Produkt war 1:6:0,03 für die jeweiligen POX-Verbindungen. Die Geschwindigkeit des nicht-enzymatischen Zerfalls mit Obidoxime-Mononitril als Produkt war bei allen POX-Verbindungen ähnlich und zeigte eine hohe Temperaturabhängigkeit (Aktivierungsenergie 83 kJ/mol), während die enzymatische Hydrolyse weniger Energie benötigte (16 kJ/mol); aus diesem Grund wurde zur Bestimmung der POX-Hydrolase-Aktivität eine Reaktionstemperatur von 20 °C gewählt. Das Auftragen der POX-Hydrolase gegenüber der salz-stimulierten Paraoxonase-Aktivität zeigte besonders deutliche die Differenzierung der PON1 Q192R Alloenzyme. Eine Erklärung dafür könnte die abstoßende Wechselwirkung zwischen der Ladung des quarternären Stickstoffatoms des protonierten Argininrestes und dem bisquarternären POX liefern. Hieraus kann man schlussfolgern, dass der pharmakogenetisch relevante PON1 Q192R Polymorphismus eine weitere Ursache für die große Variabilität der Wirksamkeit Obidoxim-behandelter Patienten ist.
Evaluierung und Weiterentwicklung eines phänotypischen Resistenzassays der HIV-Protease
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Am Max von Pettenkofer-Institut wurde ein enzymkinetischer Assay der HIV-Protease entwickelt. Nach spezifischer Amplifikation des Genoms der HIV-Protease aus Blut infizierter Patienten wird das Enzym rekombinant exprimiert und seine Aktivität in Gegenwart verschiedener Inhibitorkonzentrationen mithilfe eines künstlichen Substrates in einem Fluoreszenzassay ermittelt. Ein Vergleich mit Wildtyprotease erlaubt die Berechnung anschaulicher Resistenzfaktoren. Insbesondere hinsichtlich Geschwindigkeit, Kosten und Spezifität stellt das System eine attraktive Alternative zu den bekannten Verfahren dar.
Evaluierung des Sandwich-Enzym-Immunassays Platelia® Aspergillus zur Aspergillose-Diagnostik bei Psittaziden
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
Der klinische Nutzen des Nachweises von Aspergillus-Galaktomannan im kommerziell erhältlichen Sandwich-ELISA Platelia® Aspergillus wurde in einer prospektiven Studie an 92 Graupapageien und Amazonen evaluiert. Das Patientengut wurde unter Heranziehen objektiver klinischer Kriterien in vier Gruppen abnehmender Erkrankungswahrscheinlichkeit („gesichert“, „wahrscheinlich“, „möglich“, „unwahrscheinlich“) eingeteilt. Serumproben der Papageien wurden im Platelia® Aspergillus auf zirkulierendes Galaktomannan untersucht. Die Auswertung der ermittelten Probenindices erfolgte vergleichend für abgestufte Schwellenwerte, um den derzeit vom Hersteller empfohlenen Cut-off-Index von >= 1,5 zu überprüfen. Die Untersuchung ergab folgende Patienteneinteilung: 16,3 % der Papageien wurden in die Gruppe klinisch gesicherte Aspergillose, 11 % in die Gruppe klinisch wahrscheinliche Aspergillose, 44,6 % in die Gruppe klinisch mögliche Aspergillose und 28,3 % in die Gruppe klinisch unwahrscheinliche Aspergillose eingestuft. Für den Platelia® Aspergillus wurde unter Annahme des derzeit gebräuchlichen Cut-off-Indexes von >= 1,5 eine Sensitivität und Spezifität von 26,7 % respektive 100 % ermittelt. Das Herabsetzen des Cut-off-Indexes auf >= 0,6 führte zu einer Erhöhung der Sensitivität auf 40 % (+ 13,3 %) bei einer gleich bleibenden Spezifität von 100 %. Die Ergebnisse des Platelia® Aspergillus sollten stets im Kontext mit der klinischen Diagnostik interpretiert werden. Schlußfolgernd aus dieser Studie ergibt sich die Empfehlung, für die Untersuchung von Psittaziden-Seren im Platelia® Aspergillus einen Cut-off-Index von >= 0,6 zugrundezulegen. Dies ermöglicht die Identifizierung möglichst vieler potenziell an Aspergillose erkrankter Papageien. Das weitere therapeutische und diagnostische Vorgehen richtet sich nach der ermittelten Erkrankungswahrscheinlichkeit des Vogelpatienten. Der Platelia® Aspergillus scheint für den Nachweis einer isoliert respiratorischen Aspergillose ungeeignet. Hohes Potenzial verspricht der Sandwich-ELISA als Indikator für invasive Aspergillosen. Die praktische Bedeutung des Platelia® Aspergillus wird in seiner Verwendung als Screening-Verfahren für Aspergillose bei Psittaziden gesehen.
Die Rolle von Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) bei der malignen Transformation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Um die Funktion von MIF als Tautomerase auf genetischer Basis zu analysieren, untersuchten wir die MIFpg Maus, welche durch Punktmutation von Prolin1 zu Glycin einen Komplettverlust der enzymatischen Aktivität von MIF aufweist. Der Phänotyp der MIF-Defizienz in Fibroblasten besteht in verstärkter Kontaktinhibition, einem Defekt bei der malignen Transformation. Um die These über MIF als Enzym zu testen, untersuchten wir Fibroblasten von P1G-mutanten Mäusen. Laut unseren in vivo Analysen besitzen mutierte MIFpg-MEFs keine enzymatische Aktivität mehr. Die MIFpg-Maus, welche ein Mutation des Prolin1 aufweist, jener Aminosäure, welche als katalytische Basis der Isomeraseaktivität gilt, zeigte, dass MIFpg-Fibroblasten zwar einen Verlust der enzymatischen Aktivität als Isomerase, jedoch keine Defekte in der Ras-vermittelten Transformation aufwiesen. Daraus folgernd beruht die biologische Aktivität von MIF nicht auf dessen Isomeraseaktivität. Die p53-/- Mäuse entwickelten früh Tumore, meist Lymphome und Osteosarkome, mit einer daraus resultierenden frühen Letalität der adulten Maus. Die meisten Effekte von MIF scheinen durch p53 vermittelt zu werden, denn in Mäusen, welche sowohl für MIF als auch für p53 defizient sind, verschwindet der in MIFko-Mäusen beobachtete Phänotyp der verzögerten Tumorentstehung. Auch der in unseren Experimenten fehlende Unterschied in der Überlebenszeit von DKO im Vergleich zu p53-/- MIFflox/flox Mäusen, unterstützt die Annahme, dass die meisten Effekte von MIF in der Tumorgenese in vivo über p53 stattfinden. Unsere Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die tumorregulierende Aktivität von MIF im Wesentlichen über Regulation der p53-Aktivität durch MIF auf dem C57Bl/6 Hintergrund erklärt ist. Zudem zeigen wir, dass diese Aktivität nicht durch die enzymatische Aktivität von MIF als Tautomerase erklärt ist.
Die molekulare Charakterisierung des Gendefektes bei PVDR I-Schweinen
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
In dieser Studie wurde der genetische Defekt der 25-Hydroxyvitamin D3 1α-Hydroxylase (CYP27B1) der PVDR I-Schweine beschrieben. Diese Tiere stellen ein gutes Modell für die Pseudo-Vitamin-D-Mangel-Rachitis Typ I (PVDR I) dar. Die 1α-Hydroxylase ist ein Enzym, dass 25(OH)D3 zu seiner hormonellen Form aktiviert. Wie bei der echten Vitamin-D-Defizienz resultiert die Unfähigkeit Vitamin D3 zu aktivieren in Symptomen der Rachitis. Diese Tiere zeigen niedriege 1,25(OH)2D3-Blutspiegel, hochgradige Hypocalcämie, rachitische Veränderung des Skeletts und erhöhte Parathormon-Blutwerte. Diese Störung trat als spontane Mutation in den 60iger Jahren bei einer Zuchtlinie in Hannover auf. Wir konnten eine Splice-Site-Mutation in der Splice-Donor-Site von Intron 6 (IVS6+1G>A) ausfindig machen. In der cDNA von renalen und nicht-renalen Geweben wurde eine Deletion von Exon 6 gefunden, die in einem Frameshift und in einem verfrühten Stop-Codon resultiert. Zudem analysierten wir die Promotor-Region und die genomische Organisation des porcinen 1α-Hydroxylase-Gens bei dem eine hohe Homologie zum humanen 1α-Hydoxylase-Gen festgestellt wurde. Darüber hinaus wurde die Expression in der Niere und verschiedenen nicht-renalen Geweben, wie der uterinen Cervix, Haut, Lymphknoten, Nebenniere und dem Colon, ermittelt. Da alle Gewebe dieselbe defekte 1α-Hydroxylase exprimieren, gehen wir davon aus, dass das Enzym in den PVDR I-Schweinen enzymatisch inaktiv ist. Die Information über die Punktmutation wurde für die Entwicklung einer neuen, PCR-basierten Genotypisierungsmethode genutzt. Durch die Mutation wurde eine einmalig vorkommende Restriktionsschnittstelle für Bpu10I ausgelöscht, was die Genotypisierung mittels Restriktions-Längen-Fragment-Polymorphismus (RFLP) erlaubte. Zusätzlich etablierten wir eine Amplifikations-Refraktär-Mutations-System-PCR (ARMS), um die Genotypisierung von homozygoten, heterozygoten und Wildtyp-Genotypen zu vereinfachen. Die Expressionsspiegel der 1α-Hydroxylase wurden in einigen Geweben mittels quantitativer PCR in Wildtyp- und homozygoten Tieren bestimmt. In der Niere war die Expression gegenüber den Wildtyp-Tieren signifikant reduziert, wobei in der Haut keine Unterschiede gefunden wurden. Die Aktivierung von Blut-Makrophagen, mit Hilfe von Interferon γ, bewirkte einen Anstieg der 1α-Hydroxylase-Expression. Die regulatorischen Unterschiede in renalen und nichtrenalen Geweben wurden diskutiert. Diese Ergebnisse erlauben es das PVDR I-Schwein als Tiermodell für die Pseudo-Vitamin-D-Mangel-Rachitis Typ I nutzen zu können, um Studien der Regulation des Vitamin-D-Metabolismus und des Calciumstoffwechsels beim Schwein durchführen zu können.
Die Endothelaktivierung nach Hypoxie und Reoxygenierung - Hemmstrategien in vitro
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Das Endothel dient im ruhenden Zustand dem Gefäß als Barriere, die jedoch durch lokale Schädigung wie Trauma, Entzündung oder Ischämie aufgelöst werden kann (Klinke, 1996; Ley, 1996). Dieses Phänomen wird auch im Zusammenhang mit der Reperfusion zuvor ischämischer Myokardareale als so genannter Reperfusionsschaden beobachtet (Jennings, 1985; Schurmann, 1997). Erst das aktivierte Endothel ermöglicht Prozesse wie das Rolling, Sticking und die Migration zuvor frei fließender PMN und Thrombozyten, die über eine Reihe von Adhäsionsmolekülen wie u.a. E-Selektin und ICAM-1 vermittelt werden (Adhäsionskaskade, Sluiter, 1993; Froese, 1994; Fuster, 1996). Vorausgehende Untersuchungen konnten zeigen, dass die Endothelaktivierung in zwei Phasen verläuft, einer akuten nach Sekunden bis Minuten (Typ I) und einer subakuten nach Stunden bis Tagen (Typ II, Pober, 1990; Ichikawa, 1997). Akute Mechanismen verwenden die Freisetzung bereits bestehender Mediatoren wie PAF, Leukotriene, H2O2 und posttranslationale Modifikationen, für die subakuten Effekte ist jedoch eine Neusynthese von Zytokinen und Adhäsionsmolekülen erforderlich (Nawroth, 1993; Kukielka, 1994). Dabei spielen Transkriptionsfaktoren wie NFκB eine bedeutende Rolle (Chen, 1998; Karin, 1999). In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst ein Zellkulturmodell mit neonatalen Rattenendothelzellen und humanen Umbilkalvenenzellen bzw. einer humanen Endothelzelllinie etabliert, womit auch Mechanismen der Hypoxie und Reoxygenierung (Reperfusionssituation) simuliert werden konnten (vgl. Material und Methoden 3.1 und 3.2). Eigens hergestellte HVJ-Liposomen (Dzau, 1996; Morishita, 1997) zeigten im Vergleich zu kommerziellen Reagenzien (Effectene, Qiagen) keine befriedigende Transfektionseffizienz, weshalb das Modell mit letzteren umgesetzt wurde (vgl. Ergebnisse 4.1 und 4.2). Nach Transfektion von Reportergenkonstrukten für ICAM-1 wurde die Expression dieser Adhäsionsmoleküle nach unterschiedlicher Zellstimulation beobachtet und mittels einer Renilla- bzw. Firefly-Luciferasemarkierung luminometrisch gemessen (vgl. Material und Methoden 3.3 und 3.7). Auf die Stimulation mit TNFα, PMN, Thrombozyten und/oder Hypoxie bzw. Reoxygenierung reagierten diejenigen ICAM-1-Reportergenkonstrukte in signifikantem Ausmaß, die eine entsprechende Bindungsdomäne für den Transkriptionsfaktor NFκB enthielten. Dort kam es regelmäßig zu einer Hochregulation der ICAM-1-Expression als Parameter einer Mehrsynthese dieser Adhäsionsmoleküle (vgl. Ergebnisse 4.3). Mittels Myeloperoxidase-Messungen (leukozytenspezifisches Enzym) konnten insbesondere adhärente PMN für diese Prozesse verantwortlich gemacht werden (vgl. Ergebnisse Abb. 4.10). Zur Beeinflussung dieser subakuten Endothelaktivierung wurden so genannte NFκB-Decoy-Oligodinukleotide eingesetzt (vgl. Material und Methoden 3.6), die teilweise die DNA-Bindungssequenz des intrazellulären NFκB-Komplex besetzten. Dadurch kam es zwar noch zu einer Translokation des NFκB-Komplex in den Zellkern, die konsekutive ICAM-1-Transkription und Proteinsynthese wurde jedoch verhindert (Tomita, 2003; Morishita, 2004). Diese NFκB-Decoy-ODN bewirkten nach Transfektion in zuvor mit TNFα, PMN, Thrombozyten und/oder Hypoxie bzw. Reoxygenierung aktivierte Endothelzellen eine signifikante Reduktion der ICAM-1 Reportergenexpression. Noch deutlichere Effekte wurden durch eine Veresterung der NFκB-Decoy-ODN (Phosphothioat als Proteinaseinhibitor) oder eine entsprechend frühere Transfektion (bis 48h vor Zellstimulation) gemessen (vgl. Ergebnisse 4.4). Der akuten Interaktion zwischen Endothel und PMN bzw. Thrombozyten wird im klinischen Alltag u.a. mit GpIIb/IIIa-Rezeptorantagonisten (Tirofiban und Abciximab) begegnet (Nigam, 2002; Schwarz, 2002). In unserem in vitro-Zellkulturmodell bewirkten diese Substanzen nach Endothelstimulation eine (in unterschiedlichem Ausmaß) verringerte Adhäsion von PMN und Thrombozyten am Endothel (vgl. Ergebnisse 4.5). Zudem zeigten sie überraschender Weise auch einen inhibitorischen Effekt auf die ICAM-1-Reportergenexpression und damit auf die subakute Endothelaktivierung (vgl. Ergebnisse 4.6). Abciximab war dabei Tirofiban und einem CD18-Antikörper (IB4) signifikant überlegen (vgl. Ergebnisse Abb. 4.19). Diese Daten legten die Überlegung nahe, beiden Strategien (Adhäsionshemmer vs. NFκB-Decoy-ODN) bezüglich ihres ICAM-1-inhibitorischen Potentials am Endothel zu vergleichen: in unseren Untersuchungen war die Transfektion von NFκB-Decoy-ODN der Gabe von Adhäsionshemmern (Abciximab, Tirofiban oder CD18-Antikörper) überlegen (vgl. Ergebnisse Abb. 4.20). Die Kombination beider Strategien (Adhäsionshemmer und NFκB-Decoy-ODN) zeigte geringe, zusätzliche, ICAM-1-inhibitorische Effekte (vgl. Ergebnisse Abb. 4.21). Die Applikation von Oligodinukleotiden wird inzwischen als eine viel versprechende Therapie insbesondere ischämiebedingter, kardiovaskulärer Erkrankungen gesehen: nach Transfektion von NFκB-Decoy-ODN wurden bislang bereits positive Effekte auf die Myokardfunktion (Sakaguchi, 2001), koronare Restenoserate (Rutanen, 2002) und den Myokardinfarkt selbst (Morishita, 1997) gezeigt. Eine aktuelle Patientenanwendung nach koronarer Stentimplantation (Jun-Ichi, 2004) ergab bei zusätzlicher Transfektion von NFκB-Decoy-ODN gegenüber dem konventionell versorgten Myokardareal geringere Restenoseraten.
Erste klinische Erfahrungen mit einem konfokal arbeitenden Instrument zur Quantifizierung von Linsentrübungen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Zielsetzung: Die vorliegende Studie sollte zeigen, wie sich gesunde Augenlinsen und Linsen mit klinisch manifesten Trübungen im Densitogramm des Confocal-Opacity-Meters (COM 2000) darstellen. Methodik: Untersucht wurden 125 Augen von 72 Probanden im Alter von 8 bis 88 Jahren. Ausgewählt wurden nicht voroperierte Augen mittels konventioneller Untersuchung an der Spaltlampe. Hier waren 42 der untersuchten Linsen klar, während 83 Linsen klinisch relevante Trübungen aufwiesen. Zum Vergleich wurden jeweils Scheimpflugaufnahmen mit einer Topcon SL 45b Scheimpflugkamera angefertigt. Ergebnisse: Die Kornea stellt sich in Scheimpflug- und konfokalen Densitogrammen als Peak dar, an den sich die streulichtarme Vorderkammer anschließt. Der Verlauf von Scheimpflugdensitogrammen der Linse ist bekannt und relativ leicht zu interpretieren. Die Grenzflächen zwischen den anatomischen Linsenstrukturen sind hier selbst bei klaren Linsen durch erhöhte Streuung identifizierbar. Im Gegensatz dazu korrelieren die Strukturen des konfokalen Densitogrammes nur wenig mit dem anatomischen Aufbau der Linse. Relativ sicher zuzuordnen sind jedoch stark ausgeprägte Maxima im Bereich der vorderen bzw. hinteren Kapsel. Auch bezüglich der klinisch relevanten Linsentrübungen unterscheiden sich Scheimpflug - und konfokale Densitogramme. Im Falle von reifen Katarakten im Bereich des Linsenkernes bestätigen Scheimpflugaufnahmen den aus Spaltlampenuntersuchungen gewonnenen Eindruck eines lokal 'undurchsichtigen' Areals. Demgegenüber ist der Linsenkern für die große Wellenlänge des konfokalen Instrumentes weitgehend transparent und innerhalb des Kernes und auch hinter dem Kern gelegene Strukturen bleiben erkennbar. Kortikale Trübungen manifestieren sich im konfokalen Densitrogramm durch zusätzliche Strukturierung der die Linse begrenzenden Hauptpeaks. Schlussfolgerung: Einerseits zeigt die komplexe Struktur der mit dem konfokalen Instrument aufgenommenen Densitogramme, dass sie eine Fülle von Informationen enthalten, andererseits sind die Messungen schwer zu interpretieren. Die Maxima der Streulichtintensität reflektieren vermutlich biochemische Vorgänge an Membran-, Enzym- oder Strukturptoteinen der Linse. Es ist denkbar, daß sich hier ganz neue Möglichkeiten biochemische Vorgänge der Linse in vivo zu untersuchen eröffnen. Es hätte den Rahmen der vorliegenden, orientierenden Studie gesprengt, die molekularen Strukturen zu identifizieren, die für den beobachteten Verlauf der Streulichtintensität verantwortlich sind. Die Interpretation des Trübungsverlaufes innerhalb der Linse muß deshalb weiterführenden Studien vorbehalten bleiben. Sie haben jedoch nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn zuvor technische Verbesserungen an der Kamera vorgenommen werden. Um reproduzierbare Messungen zu ermöglichen, wird eine Justiervorrichtung benötigt, die es erlaubt wiederholt Messungen am selben Ort der Linse durchzuführen. Die Verwendung eines Lasers mit variabler Wellenlänge als Lichtquelle ist Voraussetzung einem Verständnis der beobachteten Streulichtintensitäten näher zu kommen.
Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 in der gesunden Brustdrüse - Expression von Östrogen- und Progesteronrezeptoren in der gesunden Brustdrüse
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Ziel der vorliegenden Arbeit war es zu untersuchen, ob die Aktivität der 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 (ein Enzym, das die Umwandlung von Östradiol in Östron katalysiert) in gesunden Brusdrüsenepithelzellen der Frau menstruationszyklusabhängig variiert und ob orale Kontrazeptiva Änderungen hervorrufen. Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenasen repräsentieren eine Gruppe von mehreren Isoenzymen, welche vor allem Östrogene und Androgene umsetzen. 17ß-HSD 4, die als steroidumsetztendes Enzym identifiziert wurde, konnte immunhistochemisch in Drüsenepithelien und biochemisch generell im Brustgewebe nachgewiesen werden. Weiterhin wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Expression von Progesteron- und Östrogenrezeptoren in Brustdrüsengewebe und Verlauf des weiblichen Zyklus besteht und ob sich Unterschiede durch die Einnahme oraler Antikonzeption ergeben. Für unsere Studie untersuchten wir Brustdrüsengewebe von 47 prämenopausalen Frauen, die sich einer Mammareduktionsplastik unterzogen. Da wir postoperativ eine Zyklusananmese erhoben, konnten wir den Tag der Operation entweder der follikulären oder lutealen Menstruationszyklusphase zuordnen. Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 ließ sich immunhistochemisch mit zwei verschiedenen monoklonalen Antikörpern in den Gängen und Tubuloalveoli des normalen Brustdrüsenepithels nachweisen. Angefärbt haben sich zytoplasmatische granuläre Strukturen in Drüsenepithelzellen und in Myoepithelzellen. Wir stellten leicht unterschiedliche Tendenzen in der Signalstärke der Expression von 17ß-HSD 4 mit dem Menstruationszyklus fest. Auch bei Einnahme oraler Kontrazeptiva ergaben sich leicht unterschiedliche Tendenzen in der Signalstärke der Expression von 17ß-HSD 4. Man sah die Tendenz einer höheren 17ß-HSD 4 Färbe-Intensität in der follikulären Phase und die Einnahme oraler Kontrazeptiva bewirkte eine niedrigere 17ß-HSD 4 Färbe-Intensität in der lutealen und eine höhere in der follikulären Phase. Expressionsstudien mit mRNA ergaben keine Zyklusabhängigkeit der 17ß-HSD 4. Die Ergebnisse geben keine klare Aussage darüber, ob 17ß-HSD 4 primär mit dem Umsatz von Östrogenen betraut ist, oder ob die Hauptfunktionen in Fettsäure- und Gallensäuremetabolismus liegen, Funktionen, die das Enzym auch ausüben kann. Insgesamt war die Östrogen-und Progesteronrezeptorexpression in der follikulären Phase geringfügig höher als in der lutealen Phase. Es ergaben sich Unterschiede in der Expression von Östrogen- und Progesteronrezeptoren durch orale Antikonzeption. Frauen die die „Pille“ regelmäßig einnehmen, zeigten in beiden Phasen (luteal und follikulär) eine geringere Expression von Östrogen-und Progesteronrezeptoren als bei Frauen die keine Hormone einnehmen. Alle Unterschiede waren jedoch statistisch nicht signifikant.
Wirkung ionisierender Strahlung auf verschiedene Lungengewebe epithelialen Ursprungs
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
In der vorliegenden Arbeit sollte die Auswirkung unterschiedlicher Strahlendosen auf verschiedene Kultivierungsformen der Bronchialschleimhaut und eine Lungenkarzinomzelllinie untersucht werden. Untersuchungen zur Wirkung ionisierender Strahlen auf normales Bronchialepithel sind eher selten, obwohl die Affektion von tumorfreiem umgebendem Gewebe eine wichtige Rolle bezüglich der Nebenwirkungen einer Radiotherapie spielt. Gerade im palliativen Bereich, in dem die endoluminale Bestrahlung von Bronchus-Stenosen einen wichtigen Faktor für die Verbesserung der Lebensqualität darstellt, ist durch den engen Kontakt der Strahlenquelle zum gesunden Bronchialepithel eine Strahlenauswirkung gegeben. Die bisherige Datenlage legt eine relativ hohe Strahlentoleranz des Bronchialepithels nahe. Ob sich diese Ergebnisse bestätigen lassen, sollte anhand verschiedener Bronchial-Epithel-Kultivierungsformen untersucht werden. Primäres Ziel der Untersuchung war die Frage, ob die Art der Kultivierung einen Einfluss auf die Effektivität ionisierender Strahlen hat und ob Tumorzellen eine andere Reaktion zeigen. Die verwandten Modelle waren: - BEAS-2B Zelllinien - Primärkulturen aus Patientenmaterial - dreidimensionale Organkulturen - EPLC-32M1 Tumorzelllinien Als „handelsübliche“ Bronchialepithel-Zelllinie zur Monolayer-Kultivierung wurden die BEAS-2B-Zellen verwendet, hier handelt es sich um immortalisierte, humane bronchoepitheliale Zelllinie, die mit einem Adenovirus 12-SV40 Virus-Hybrid transfiziert war. Zwar sind viele Eigenschaften der normalen Bronchialschleimhaut in diesem Modell vorhanden, aber auch genetische Abweichungen wie Veränderungen des Chromosomensatzes sind beschrieben. Mit zunehmender Passagezahl können die Zellen auch eine kanzerogene Wirkung zeigen. Zum direkten Vergleich wurden Primärkulturen aus Patientenmaterial gewonnen, welche als Monolayer kultiviert wurden. Problematisch war hier die schwierige Kultivierbarkeit. Die dreidimensionalen Organkulturen stellen vom Aufbau her eine in vivo-nahe Kulturform dar. Zentrum der Organkultur ist ein bindegewebiger Kern, welcher von einem respiratorischen Epithel umgeben ist. Morphologisch ist das kultivierte Epithel nicht von dem in vivo zu unterscheiden. Als Tumormodell wurde eine EPLC-32M1 Zelllinie verwandt, die wie die BEAS-2B Linie und die Primärkulturen als Monolayer wachsen. Hier handelt es sich um eine squamöse Karzinom Zelllinie, deren Ursprungsgewebe ein Plattenepithelkarzinom der Lunge war. Die Ähnlichkeit zum Primärtumor ist nur noch gering ausgeprägt. Bekannterweise gehört das Plattenepithelkarzinom der Lunge zu den nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen, welche im Vergleich zu Kleinzellern nur eine geringe Strahlensensitivität aufweisen. Als Parameter für die Zellschädigung wurde die Lactatdehydrogenase verwandt, ein zytoplasmatisches Enzym, welches bei Zellmembranläsionen freigesetzt wird. Mit der LDH steht ein klinisch häufig eingesetzter, etablierter Parameter zu Detektion von Zellschäden zur Verfügung. Hier konnte eine Bestimmung im Kulturmedium erfolgen, wodurch Verlaufsbeobachtungen ohne Beeinflussung der Kulturen möglich waren. Ferner wurde die Zellzahlen nach Bestrahlung ermittelt, um eine Aussage über das Zellüberleben machen zu können. Zusammenfassung der Ergebnisse: - Die Organkulturen und Primärkulturen zeigten nach einer Latenz von 48 Stunden nach der Bestrahlung eine gesteigerte LDH-Aktivität, die hier gleichzeitig ihr Maximum erreichte. - Bei der BEAS-2B Linie kam es innerhalb der ersten 24 Stunden zu einem deutlichen LDH-Anstieg. - Tumorzellen zeigten ein gänzlich anderes Verlaufsmuster bezüglich der LDH. Hier kam es nach 3 Tagen zu einem kontinuierlichen Anstieg. - Die Zellzahlen im Organkulturmodell wiesen 4 Tage nach Bestrahlung keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsgruppen auf. - Bei den Primärkulturen und den BEAS-2B Zellen fand sich in den bestrahlten Gruppen eine signifikant, nicht dosisabhängig erniedrigte Zellzahl. - Im Tumorzell-Modell war dosisabhängig eine Zellzahlminderung in den bestrahlten Gruppen zu beobachten. Schlussfolgerungen: Sowohl vom LDH-Verhalten, als auch von den Ergebnissen der Zellzahlbestimmung zeigten sich die dreidimensionalen Organkulturen wenig anfällig für die Wirkung ionisierender Strahlen. Nachdem dieses Modell die in vivo-Situation gut wiederspiegelt, unterstützen die Ergebnisse die Daten, welche eine hohe Strahlentoleranz von Bronchialepithel nahe legen. Von den übrigen Kultivierungsformen scheinen die aus Patientenmaterial gewonnenen Primärkulturen die höchste Strahlenresistenz aufzuweisen, wahrscheinlich sind hierfür Zelleigenschaften verantwortlich, die in den gentechnisch veränderten Zelllinien nicht mehr in der Art und Weise ausgeprägt sind wie in vivo. So nehmen viele intrazelluläre Faktoren wie Zytokine, Wachstumsfaktoren, Proteinkinasen oder auch Onkogene Einfluss auf die Strahlensensibilität einer Zelle. Entscheidend scheint besonders der p53- Status zu sein. Am strahlensensitivsten zeigten sich die BEAS-2B und die EPLC-32M1 Linien. Das hängt womöglich mit der Veränderung des genetischen Materials durch die Immortalisationsprozesse und die im Vergleich höhere Proliferationsrate zusammen. Möglich ist auch eine erhöhte Strahlensensibilität aufgrund des im Vergleich zu den Organkulturen schwächer ausgeprägten Zell-Zell-Kontaktes, der fehlenden dreidimensionalen Struktur und dem geringeren Anteil differenzierter Zellen. Nicht außer Acht lassen darf man individuelle Einflüsse, welche womöglich in den von Patientenmaterial stammenden Kulturen eine Rolle spielen. Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass der dreidimensionale Aufbau und die hierarchische Struktur des Bronchialepithels maßgeblich die Strahlensensibilität beeinflussen. Monolayer sind zur Untersuchung von Strahlenfolgen in vivo nur sehr bedingt geeignet. Ausblick auf zukünftige Fragestellungen: Nachdem in der vorliegenden Arbeit nur eine Tumorzelllinie untersucht wurde, wäre es von Interesse, die Auswirkung ionisierender Strahlung auf verschiedene Lungenkarzinom- Zelllinien zu vergleichen, welche in vivo deutliche Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit aufweisen. Anbieten würde sich hier der Vergleich mit strahlensensiblen kleinzelligen Bronchialkarzinom. Möglicherweise kann auch hier eine dreidimensionale Kultivierung von Tumorzellen aus Patientenmaterial etabliert werden, um einen größeren Zell-Zell-Kontakt im Tumor-Modell zu ermöglichen. Auch wäre hier durch die fehlenden gentechnischen Veränderungen eine bessere Vergleichbarkeit mit der in vivo- Situation möglich. Auch die Untersuchung von Ko-Kulturen aus normaler Bronchialschleimhaut und verschiedenen Bronchialkarzinomzelllinien bietet die Möglichkeit, Auswirkungen von Interaktionen zwischen Normalgewebe und Tumorgewebe nach Einwirkung ionisierender Strahlen näher zu eruieren. Dieses Modell käme der Situation beim Patienten am nächsten. Interessant wäre in diesen Modellen auch die Überprüfung weiterer Zelltod-Parameter. So könnten hier verschiedene Apoptosemarker wie zum Beispiel die Nukleosomen im Überstand verschiedener Ko-Kulturmodelle bestimmt werden, um eine bessere Aussage über das Ausmaß der Zellschädigung zu erhalten. Im Kontext mit der Untersuchung von Nukleosomen scheint auch die Bestimmung von Calcium eine sinnvolle Ergänzung darzustellen. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, das Verhalten von Zellkulturen nach Bestrahlung, gerade hinsichtlich einer möglichen Resistenzbildung zu untersuchen.
Identifizierung und molekulare Charakterisierung mitochondrialer Signalpeptide der 3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylase
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Der isolierte 3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylase (MCC)-Mangel ist eine angeborene Störung im Abbau der Aminosäure Leucin. Die Erweiterung des Neugeborenen-Screenings (NGS) führte zu der Erkenntnis, dass der MCC-Mangel eine der häufigsten organischen Azidämien darstellt. Das klinische Bild ist sehr heterogen und eine Genotyp-Phänotyp Korrelation ist nicht möglich. Über die Prognose der im NGS identifizierten und bisher asymptomatischen Mutationsträger kann bisher keine Aussage gemacht werden. Das mitochondriale Enzym besteht aus einer α- und einer β-Untereinheit. In dieser Arbeit wurden die mitochondrialen Signalpeptide beider Untereinheiten identifiziert. Hierzu wurden Fusionsproteine aus Fragmenten der Untereinheiten mit dem fluoreszierenden Protein YFP generiert. Nach Expression in humanen Hautfibroblasten wurden Kolokalisationsstudien durchgeführt. Zunächst wurde experimentell bestätigt, dass jede Untereinheit ein mitochondriales aminoterminal lokalisiertes Signalpeptid besitzt. Für MCCα befindet sich dieses in den Aminosäuren 1-39, für MCCβ in den Aminosäuren 1-20. Beide Untereinheiten haben keine weiteren Importsignale. Somit sind die aminoterminalen Targetingsequenzen ausreichend und gleichzeitig notwendig, um einen mitochondrialen Import zu ermöglichen. In einer Western Blot Analyse konnte die Abspaltung der Signalpeptide beider Untereinheiten gezeigt werden. Durch Veränderung der positiv geladenen Aminosäuren wurden die strukturellen Erfordernisse der identifizierten Signalpeptide näher charakterisiert. Es wurden Argininreste gegen Glutamin in verschiedenen Kombinationen ausgetauscht. Eine Mutation der aminoterminalen vier Argininreste im Signalpeptid von MCCα führte zum Importverlust. Bei einer Mutation der in der Targetingsequenz vom Aminoterminus weiter entfernt liegenden zwei Argininreste fand ein Import statt. Bei Mutationen der Argininreste im Signalpeptid von MCCβ kam es regelhaft zu einem Importverlust. Damit wurde die Relevanz der positiv geladenen Aminosäuren für den Import der MCC-Untereinheiten belegt. Die Identifizierung der Signalpeptide stellt die Grundlage weiterer Funktionsuntersuchungen dar, da nur reife Proteine ohne Signalsequenz für prokaryontische Expressionsstudien verwendet werden können. Durch solche Untersuchungen könnten die Auswirkungen von Mutationen auf die Enzymfunktion besser verstanden werden. In diesem Zusammenhang können möglicherweise diejenigen Veränderungen in der Funktionsweise des Enzyms aufgeklärt werden, die eine klinische Symptomatik nach sich ziehen. Hierdurch könnte die bisher schwierige Beratungssituation betroffener Familien hinsichtlich Prognose und Therapie erheblich verbessert werden.
Charakterisierung der Zellen des Glomus Caroticum
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Zellen des Glomus caroticum der Ratte alle notwendigen Komponenten zur Biosynthese, Speicherung und Freisetzung von Dopamin und Histamin besitzen und diese Transmitter bei Hypoxie freisetzen können. Erstmals wurde hier Histamin als Transmitter im Glomus caroticum nachgewiesen: es wurde gezeigt, dass die Sensorzellen des Glomus caroticum das Histamin synthetisierende Enzym exprimieren. Die Speicherung von Histamin in Vesikeln erfolgt mit Hilfe eines vesikulären Monoamintransporters (VMAT2). Bisher bekannte immunhistochemische Ergebnisse über die Expression dieses Transportproteins in den Sensorzellen konnten bestätigt und mittels RT-PCR-Untersuchungen belegt werden. Ferner wurde nachgewiesen, dass die Sensorzellen auch über wichtige Komponenten des Exozytoseapparates verfügen. Darüber hinaus zeigten RT-PCR- Untersuchungen, dass im Glomus caroticum die mRNA der Histaminrezeptoren H1, H2 und H3 exprimiert wird. Die Menge an Histamin im Glomus caroticum wurde mittels Radioimmunoassay bestimmt. Im Glomus caroticum ist mehr Histamin enthalten als in anderen Geweben der Ratte, und die Menge an Histamin ist um ein Vielfaches größer als die Menge des im Glomus caroticum enthaltenen Dopamins. In vitro Experimente zeigten, dass die Freisetzung von Histamin aus dem Glomus caroticum durch Hypoxie verstärkt wird. Eine vermehrte Freisetzung bei Hypoxie konnte amperometrisch auch für Dopamin bestätigt werden. Es wurde hier zum ersten Mal beschrieben, dass ein Zelltyp zwei verschiedene Amine als Transmitter nutzt. Damit spielt sowohl Dopamin als auch Histamin eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle der Sauerstoffversorgung des Organismus und, aufgrund der Lage des Glomus caroticum, besonders des Gehirns. Mit dem Nachweis von Expression und Aktivität des limitierenden Enzyms für die Tetrahydrobiopterin-Synthese wurde gezeigt, dass das Glomus caroticum sämtliche für die Dopaminsynthese notwendigen Schritte selbst durchführen kann. Damit erfüllt das Glomus caroticum die notwendigen Eigenschaften für eine erfolgreiche Autotransplantation in das Striatum bei Morbus Parkinson.
Funktionelle Charakterisierung des IAP-verwandten, Ubiquitin-konjugierenden Enzyms BRUCE in vivo durch die phänotypische Analyse eines Maus-Knockout-Modells
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
BRUCE (BIR repeat-containing ubiquitin-conjugating enzyme) ist ein konserviertes, 528 kDa großes, peripheres Membranprotein des trans-Golgi-Netzwerks und ein strukturell neuartiges Ubiquitin-Konjugationsenzym (UBC) der Maus. Zusätzlich zu der am C-Terminus befindlichen UBC-Domäne enthält BRUCE im N-terminalen Bereich ein BIR (baculovirus inhibitor of apoptosis repeat)-Motiv, die charakteristische Domäne aller BIRPs (BIR-domain containing proteins). Die meisten dieser Proteine haben anti-apoptotische Eigenschaften und werden deshalb in der IAP (inhibitor of apoptosis proteins)-Familie zusammengefasst. Auch BRUCE konnte in vitro als Inhibitor apoptotischer Prozesse beschrieben werden. Um die Funktion von BRUCE in vivo zu untersuchen, wurde eine BRUCE-defiziente Mauslinie etabliert und im Rahmen dieser Arbeit phänotypisch charakterisiert. Die vollständige Inaktivierung des BRUCE-Gens führte zu einer Verzögerung des embryonalen Wachstums sowie zum perinatalen Tod der Knockout-Organismen. BRUCE wird in fast allen embryonalen Geweben exprimiert, deutlich sichtbare morphologische Veränderungen in Folge seiner Deletion traten jedoch hauptsächlich im extra-embryonalen Gewebe der Plazenta auf. Nach störungs-freier Initiierung der Organogenese zeigte sich mit zunehmender Reifung der Plazenta eine Verzögerung der Ausbildung des Labyrinthsystems sowie eine deutliche Reduktion der Spongiotrophoblast-Schicht. Dieses Entwicklungsdefizit kann Ursache einer stark eingeschränkten Effizienz der Nähr- und Sauerstoffversorgung des Embryos sein und sowohl zu Wachstumsretardierung als auch zu perinataler Letalität der transgenen Organismen führen. Die morphologischen Veränderungen im Gewebe wurden nicht, wie ursprünglich angenommen, durch eine erhöhte Apoptoserate der Zellen hervorgerufen. Stattdessen konnten in den defekten plazentalen Geweben drastische Veränderungen in Proliferationsverhalten und Differenzierungsstatus der Trophoblast-Zellen beobachtet werden. Die in dieser Arbeit beschriebenen Auswirkungen des BRUCE-Verlusts auf den Modellorganismus zeigen einerseits die essentielle Bedeutung von BRUCE für die Entwicklung sowie den funktionellen Erhalt der Plazenta und damit für die gesamte Embryonalentwicklung der Maus. Andererseits geben die Ergebnisse Hinweise darauf, dass dieses ungewöhnliche Enzym möglicherweise eine überlebensnotwendige regulative Funktion der Inhibition Apoptose-induzierter oder nicht-apoptotischer Caspase-Aktivität bei Proliferations- und/oder Differenzierungs-ereignissen bestimmter Zelltypen besitzt.
Biochemische Charakterisierung von Histon-Methyltransferasen aus Drosophila melanogaster
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
In der vorliegenden Arbeit wurden die beiden Histon-Methyltransferasen Su(var)3-9 und E(Z) aus Drosophila melanogaster charakterisiert. Die Histonmethylierung als Modifikation war schon länger bekannt gewesen, bis zum Jahr 2000 war jedoch vor allem die Acetylierung etwas genauer untersucht worden. Su(var)3-9 war die einzige bekannte Histon-Lysin-Methyltransferase, als diese Arbeit begonnen wurde. Zur Charakterisierung wurde das myc-getagte Enzym aus Drosophila-Kernextrakt durch Affinitätschromatographie aufgereinigt und zunächst die Substratspezifität festgestellt. Wie das humane Enzym Suv39H1 methyliert es ebenfalls spezifisch H3-K9 (Lysin 9 im Histon H3). Das aus den Kernextrakten aufgereinigte Enzym besitzt aber auch die Fähigkeit, ein an H3-K9 präacetyliertes Substrat zu methylieren. Die Vermutung, dass Su(var)3-9 mit einer Histondeacetylase assoziiert ist, konnte durch Verwendung von TSA als HDAC-Inhibitor bestätigt werden. Es stellte sich heraus, dass HDAC1 (Rpd3) mit Su(var)3-9 assoziiert ist. Um das Enzym besser untersuchen zu können, wurde es als Volllängenprotein und als Deletionsmutante in E. coli exprimiert. Die Aufreinigung des rekombinanten Enzyms sowie seine Lagerbedingungen wurden optimiert. Das Volllängenprotein Su(var)3-9 liegt – wie durch Gelfiltration festgestellt - als Dimer vor, die Interaktion mit sich selbst ist über den N-Terminus vermittelt. Su(var)3-9 bindet an sein eigenes, bereits methyliertes Substrat. Dies wurde an Peptiden untersucht, die den ersten 20 Aminosäuren des Histons H3 entsprechen, und entweder an Lysin 9 dimethyliert oder unmodifiziert waren. Die Interaktion mit dem methylierten Substrat ist auf die Chromodomäne von Su(var)3-9 zurückzuführen, ist jedoch schwächer als die Wechselwirkung von HP1 mit methyliertem H3-K9. Des weiteren wurde eine Drosophila-Zelllinie stabil mit Su(var)3-9 transfiziert. Das überexprimierte Protein ist jedoch nur schwach aktiv. Die Tatsachen, dass Su(var)3-9 mit HDAC1 interagiert sowie mit seinem eigenen Substrat assoziiert, ermöglichen die Aufstellung von Hypothesen über die bis jetzt kaum erhellte Ausbreitung von Heterochromatin in euchromatische Bereiche. Durch die Wechselwirkung mit der Deacetylase könnte Su(var)3-9 auch in aktiv transkribierte Bereiche vordringen und diese methylieren. Die Acetylierung, Zeichen für aktive Transkription, würde durch die Methylierung ersetzt werden. Die Interaktion mit seinem umgesetzten Substrat könnte verhindern, dass das Enzym sich nach der Reaktion entfernt, vielmehr könnte Su(var)3-9 entlang eines DNA-Stranges sukzessive alle Nukleosomen methylieren. Die darauffolgende Bindung von HP1 an methyliertes H3-K9 könnte den heterochromatischen Charakter des Chromatins verstärken und für längere Zeit festlegen. Aus Drosophila-Kernextrakten gelang es weiterhin, den E(Z)/ESC-Komplex über Säulenchromatographie aufzureinigen. Dieser enthält neben E(Z), ESC, p55 und Rpd3 auch Su(z)12. E(Z), ESC und Su(z)12 gehören der Polycomb-Gruppe an. Deren Funktion ist die dauerhafte Repression der homöotischen Gene. Sie spielen daher eine wichtige Rolle im „Zellgedächtnis“ während der frühen Entwicklung von Drosophila. Es konnte gezeigt werden, dass der E(Z)/ESC-Komplex Lysin 9 sowie Lysin 27 im Histon H3 methyliert. Außerdem wurde in vitro ein Teilkomplex aus rekombinantem E(Z), p55 und ESC rekonstituiert, der das Histon H3 methylieren kann. Ein Teilkomplex, der E(Z) mit mutierter SET-Domäne enthält, ist nicht in der Lage, H3 zu methylieren. Die Vorhersage, dass E(Z) aufgrund seiner SET-Domäne eine Methyltransferase sein müsse, konnte durch vorliegende Untersuchungen bestätigt werden. Polycomb ist ein weiteres Protein aus der Polycomb-Gruppe. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass dieses Protein spezifisch an das Histon H3 bindet, das an K27 trimethyliert ist. Polycomb besitzt wie HP1 eine Chromodomäne. Aus den vorliegenden Daten kann folgendes Modell aufgestellt werden: Nach der Methylierung von H3-K9 sowie H3-K27 durch den E(Z)/ESC-Komplex in homöotischen Genen, die schon abgeschaltet sind und weiterhin reprimiert werden müssen, bindet Polycomb an dieses Methylierungsmuster. Polycomb befindet sich in einem großen Komplex mit weiteren Polycomb-Gruppen-Proteinen. Die Bindung dieses Komplexes an Chromatin könnte ein denkbarer Mechanismus sein, wie die dauerhafte Repression der homöotischen Gene vermittelt wird. Um den E(Z)/ESC-Komplex genauer untersuchen zu können, wurden Viren für das Baculosystem hergestellt, so dass eine Einzel- oder auch Coexpression der Proteine möglich ist. Die Aktivität von E(Z), das im Baculosystem exprimiert wurde, ist nicht besonders hoch. Es bindet unter den in dieser Arbeit verwendeten Bedingungen weder an DNA, noch an Histone noch an H3-Peptide, die methyliert sind. Innerhalb des E(Z)/ESC-Komplexes bindet E(Z) an p55, Rpd3, ESC sowie Su(z)12. Su(z)12 interagiert mit p55, Rpd3 und E(Z). Die weiteren Interaktionen werden am besten durch eine bildliche Darstellung (siehe Abb. 86) vermittelt. In einem Luciferase-Assay wurde eine repressive Wirkung von E(Z) festgestellt. Dieses Experiment bedarf allerdings eines aktivierten Systems. Ferner muss durch Mutationsanalysen sichergestellt werden, dass die repressive Wirkung auf die Methyltransferase-Aktivität von E(Z) zurückzuführen ist. Kürzlich wurde entdeckt, dass E(Z) sowie Su(z)12 in verschiedenen Tumoren überexprimiert sind. Noch ist weder deren Funktion in den Tumorzellen klar, noch weiss man, ob die Überexpression der Grund oder eine Folge der Tumorbildung ist, noch kennt man alle Zielgene, die durch eine Überexpression von E(Z) und Su(z)12 beeinflusst werden. In nächster Zeit sind hier Einsichten in die Wirkungsweise von E(Z), Su(z)12 und anderen Polycomb-Gruppen-Proteinen zu erwarten.
Chromophorbindung und Photochemie der α-Untereinheit des Phycoerythrocyanins aus Mastigocladus laminosus
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Die α-Untereinheit des Phycoerythrocyanins ist ein Chromoprotein, das eine Rolle bei der Photosynthese von Mastigocladus laminosus, einem Cyanobakterium, spielt. Dieses Protein besitzt einen seltenen Gallenfarbstoff als Chromophor, der nie in freier Form gefunden werden konnte. Daneben ist das Chromoprotein zu einer ausgeprägten reversiblen Photochemie fähig, die der Photochemie des Phytochroms ähnelt. Es konnte ein Rekonstitutionssystem etabliert werden, mit dessen Hilfe die Chromophorbindung aufgeklärt werden konnte. Für die korrekte Bindung des Chromophors ist dabei neben dem Apoprotein und einem Gallenfarbstoff ein neuartiges Enzym, eine sog. Lyase-Isomerase notwendig. Anhand von Rekonstitutionen mit chemisch modifizierten Chromophoren konnte mit Hilfe molekularbiologischer, spektroskopischer und chromatographischer Methoden auch ein Modell für den Mechanismus der Photochemie des Chromoproteins entwickelt werden.
Die außergewöhnliche Diversität der der Proteolipide in Archaea: Multimere und monomere Rotoren mit sechs bis dreizehn Ionenbindestellen in A1AO-ATPasen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Zusammenfassung 1. Das für das Proteolipid aus Methanocaldococcus jannaschii kodierende Gen atpK wurde in E. coli DH5alpha und in dem Minizell-Produzenten E. coli DK6 exprimiert. Das Genprodukt wurde durch radioaktive Markierung nachgewiesen. 2. Aus den Membranen der thermophilen, hydrogenotrophen methanogenen Archaea M. jannaschii, Methanothermobacter thermautotrophicus, Methanothermobacter marburgensis sowie aus den Membranen des mesophilen, methylotrophen methanogenen Archäons Methanosarcina mazei Gö1 wurden mit Chloroform/Methanol die Proteolipide der A1AO-ATPasen und die MtrD-Untereinheiten der Methyltetrahydromethanopterin:CoenzymM-methyl-transferase extrahiert. Die einzelnen Peptide wurden mittels N-terminaler Sequenzierung identifiziert. 3. Durch MALDI-TOF-Analyse wurde die molekulare Masse des maturen Proteolipids aus M. jannaschii zu 21316 Da und 21183 Da (Methionin-freie Form) bestimmt. Zusammen mit der Gensequenz konnte daraus gefolgert werden, daß es sich um eine triplizierte Form des bakteriellen 8-kDa Proteolipids handelt, also 3 Haarnadel-Domänen ausweist. Die ionentranslozierenden Carboxylate sind nur in Haarnadel 2 und 3 konserviert. Bei einer angenommenen Anzahl von 24 Helices im c-Oligomer bedeutet das, daß ein Ionen/ATP-Verhältnis von 2,7 für die Synthese von ATP ausreichen würde. 4. Die Proteolipide aus M. thermautotrophicus und M. marburgensis besitzen duplizierte Proteolipide. Die aktiven Carboxylat-Reste sind im Gegensatz zu den bisher bekannten duplizierten Proteolipiden der V1VO-ATPasen in beiden Haarnadeln konserviert. 5. Die archäellen A1AO-ATPasen-Operone der Pyrococcen enthalten ebenfalls Gene, die für duplizierte Proteolipide kodieren. Allerdings sind die für die Ionentranslokation essentiellen Carboxylat-Reste wie in den Proteolipiden der V-Typ-ATPasen nur in der zweiten Haarnadel vorhanden. Die Abtrennung der A1AO- und V1VO-ATPasen muß daher vor der Entwicklung der Eukaryonten erfolgt sein. 6. Sequenzanalysen haben gezeigt, daß das Proteolipid-Gen aus Methanopyrus kandleri dreizehnmal so groß wie das aus Bakterien ist. Es kodiert für ein Protein mit 13 Haarnadel-Domänen. Die Ionenbindstelle ist in jeder Haarnadel konserviert. 7. Alle heute bekannten Formen der Proteolipide der V- und F-ATPasen waren schon in den Archaea enthalten. Die Vielfalt an Proteolipid-Größen und -Formen der archäellen ATPasen läßt vermuten, daß sie ein Reservoir an Möglichkeiten darstellen, aus denen die V1VO- und F1FO-ATPasen gespeist wurden. 8. Durch Sequenzvergleich mit den Na+-translozierenden Proteolipiden der bakteriellen F1FO-ATPasen wurde auch in den Proteolipiden der A1AO-ATPasen ein Na+-Bindemotiv identifiziert. Es lautet: P/S/T-XXX-Q/E (Motiv I in Helix eins), ET/S (Motiv II in Helix zwei). 9. Aus Membranen von Sulfolobus acidocaldarius und M. jannaschii wurden durch Chloroform/Methanol Lipide extrahiert, anschließend wurde aus diesen Lipiden Liposomen hergestellt, in die die A1AO-ATPase aus M. jannaschii rekonstituiert wurde. Die Synthese von ATP konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. 10. Die ATPase-Gene ahaE, ahaC, ahaF, ahaA, ahaB, ahaD und ahaG wurden in den Fusionsvektor pMal kloniert und in Escherichia coli exprimiert. Die Fusionsproteine wurden aus dem Zellextrakt isoliert und zur Immunisierung von Kanninchen eingesetzt. Die erhaltenen Antiseren gegen die ATPase-Untereinheiten AhaA, AhaB, AhaC und AhaE waren spezifisch und wurden für die Analysen dieser Arbeit eingesetzt. 11. Das für die gesamte A1AO-ATPase kodierende Operon ahaHIKECFABDG des methanogenen Archäons Methanosarcina mazei Gö1 wurde in den Expressionsvektor pVSBAD2 hinter den ara-Promotor kloniert. Das Konstrukt wurde pRT1 genannt. 12. Die auf pRT1 lokalisierten Gene wurden heterolog in E. coli DK8 exprimiert. Die A1AO-ATPase war in E. coli membran-assoziiert und funktionell. Die spezifische ATPase-Aktivität an Membranen von E. coli DK8 betrug 150 mU/mg Protein. 13. DCCD und der für archäelle ATPasen spezifische Inhibitor DES hemmten das Enzym. Die I50-Wert betrugen 0,5 mM/mg Protein, beziehungsweise 200 nmol/mg Protein. 14. Die Synthese von AhaA, AhaB, AhaC, AhaE, AhaH, AhaK, und zum ersten Mal auch des gesamten AhaI, konnten nachgewiesen werden. Gegen AhaF, AhaD und AhaG lagen keine funktionellen Antikörper vor.
Biosynthese des Metallzentrums von [NiFe]-Hydrogenasen aus E. coli
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
In dieser Arbeit wurden drei Aspekte der Reifung der Hydrogenasen in E. coli näher untersucht: 1. Eine Deletion im carAB-Locus führt zum Verlust der Synthese aktiver Hydrogenasen in E. coli. Die Aktivität kann wiederhergestellt werden, wenn der Stamm mit einem carAB-tragenden Plasmid transformiert oder wenn er in Anwesenheit von Citrullin angezogen wird. Da der carAB-Locus für das Enzym der Carbamoylphosphat-Synthese kodiert und Citrullin in der Zelle in Carbamoylphosphats umgewandelt werden kann, ist Carbamoylphosphat die Ausgangssubstanz für die Synthese der Liganden des Metallzentrums. Aufgrund seiner Struktur wurden Reaktionsmechanismen postuliert, über die es in CN- und/oder CO-Einheiten umgewandelt werden kann. 2. Dem HypF-Protein konnte die biochemische Funktion einer Carbamoylphosphat-Phosphatase zugeschrieben werden, zusätzlich besitzt es eine an die Anwesenheit von Carbamoylphosphat gekoppelte ATP-hydrolysierenden Aktivität. Die ATP-Hydrolyse durch HypF führt zur Bildung von AMP und PPi und sie geht parallel mit der Ausbildung eines adenylierten Reaktionsintermediats wie über die Pyrophosphat-ATP-Austausch-Reaktion gezeigt wurde. Beim adenylierten Intermediat handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Carbamoyl-Adenylat. Es wird postuliert, dass dieses Substrat vom HypE-Protein zur Bildung des CN-Liganden durch einen Wasserentzug über eine PurM-ähnliche Reaktion verwendet wird. Durch spezifische Mutagenisierung konnten HypF-Varianten konstruiert werden, die zur Bildung aktiver Hydrogenasen unfähig waren. Die drei strukturell auffälligsten Motive des HypF-Proteins (Acylphosphat-Phosphatase-, Zink-Finger- und O-Carbamoyl-Transferase-Motiv) sind wichtig für die optimale Reifung der Hydrogenasen. Diese in vivo Unfähigkeit der Mutanten aktive Hydrogenasen zu synthetisieren geht mit dem Verlust der Carbamoylphosphat-Phosphatase einher. 3. Die kristallographische Analyse des HybD-Proteins als Beispiel einer spezifisch an der Hydrogenasen-Reifung beteiligten Protease, zeigte die Anwesenheit einer essentiellen Metallbindetasche, an deren Ausbildung Glu, Asp und His beteiligt sind und die in einer Peptidbindungsfurche liegt. Die Metalltasche fungiert spezifisch als Nickelerkennungsstelle in der Prozessierung, da nur Nickel-enthaltendes Apo-Protein prozessiert werden kann
Molekulare, physiologische und biochemische Charakterisierung der Genfamilie für 4-Cumarat:Coenzym A Ligase aus Sojabohne (Glycine max L.)
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Die 4-Cumarat:Coenzym A Ligase (4CL) ist ein Enzym des allgemeinen Phenylpropanstoffwechsels, das aktivierte Hydroxyzimtsäure-Ester zur Synthese spezifischer Phenylpropanoide bereitstellt. In vielen Pflanzen kommen strukturell und funktionell sehr ähnliche 4CL-Isoformen vor, weshalb diesem Enzym dort nur eine beschränkte regulatorische Funktion bei der Verteilung der unterschiedlich substituierten Zimtsäurederivate für nachfolgende Synthesen zugesprochen wird. Durch Isolierung der cDNA der von Knobloch und Hahlbrock (1975) partiell gereinigten Ligase 1 und der Vervollständigung der kodierenden Sequenz der Gm4CL4 konnte mit großer Wahrscheinlichkeit die Genfamilie der Sojabohne-4CLs komplettiert werden. Mit der cDNA der Gm4CL1 war außerdem erstmals eine 4CL-Sequenz verfügbar, die für eine Sinapinsäure-umsetzende 4CL kodiert. Zusammen mit den bereits beschriebenen 4CL-Isoenzymen 2 und 3 (Uhlmann und Ebel, 1993; Möllers, 1997) existieren in Sojabohne somit mindestens vier 4CL-Isoformen. Die unterschiedlichen Substratspezifitäten der rekombinanten Proteine, die Fähigkeit, die gesamte Gruppe der pflanzlichen Hxdroxyzimtsäuren zu aktivieren und die differentielle Synthese der Gm4CL-Isoformen nach Elicitor-Behandlung von Sojabohnezellkulturen bzw. Infektion von Sojabohnekeimlingen weisen auf eine bedeutende regulatorische Funktion der 4CL hinsichtlich der Bereitstellung unterschiedlich substituierter Zimtsäurederivate zur Synthese spezifische Phenylpropanoide in Sojabohne hin. Dabei scheinen Gm4CL1 und Gm4CL2 vor allem an der Synthese von Phenylpropanoiden beteiligt zu sein, die für Wachstum und Entwicklung der Pflanzen benötigt werden, während Gm4CL3 und Gm4CL4 aktivierte Zimtsäuren bereitstellen, die aufgrund von Umweltveränderungen benötigt werden. Die 4CL wird mit Acyl-CoA Ligasen, Peptidsynthetasen und Luciferase zur Familie der AMP-bindenden Proteine zusammengefaßt. Diesen Enzymen ist nicht nur der Mechanismus der AMP-Aktivierung gemeinsam, sondern sie besitzen auch Ähnlichkeiten in ihren Proteinstrukturen. Durch Bildung von Hybridenzymen zwischen Gm4CL1 und Gm4CL3 konnte der zentrale Sequenzbereich der 4CL als Substratspezifität-determinierende Region ermittelt werden. Mit Hilfe der Informationen, die von der Kristallstruktur der Phenylalaninaktivierenden Untereinheit der Gramicidin-S-Synthetase gewonnen wurden, konnten vier mögliche Substratbindemotive der 4CL identifiziert werden. Innerhalb eines dieser Motive unterscheidet sich die Gm4CL1 von allen anderen bisher klonierten 4CLs durch den Verlust eines Aminosäurerestes, wodurch die Gm4CL1 in der Lage ist, hochsubstituierte Zimsäurederivate zu aktivieren. Wird der entsprechende Aminosäurerest der Gm4CL2 (Gm4CL2dV345) und Gm4CL3 (Gm4CL3dV367) entfernt, können beide Deletionsmutanten Sinapinsäure umsetzen. Außerdem ist Gm4CL3dV367 in der Lage, 3,4-Dimethoxyzimtsäure zu aktivieren und zeigt eine deutlich erhöhte Affinität gegenüber Ferulasäure. Durch das Entfernen einer einzigen Aminosäure können somit hochsubstituierte Zimtsäurederivate umgesetzt werden. Die Möglichkeit, die Substratspezifität dieses zentralen Enzymes des Phenylpropanstoffwechsels zu modifizieren, eröffnet die Herstellung transgener Pflanzen mit gewünschtem Phenylpropanoid-Profil.
Curdlanase, ein extrazelluläres hefelytisches Enzym von Streptomyceten
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Wed, 24 Apr 2002 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/642/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/642/1/Bauer_Norbert.pdf Bauer, Norbert ddc:570, ddc:500, Fakultät für Biologie
Isolierung, Identifizierung und Partialsynthese von Pflanzeninhaltsstoffen aus Croton flavens L.
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Aus fünf Sträuchern des Croton flavens L. von Barbados wurden insgesamt zwölf Verbindungen mit Hilfe von chromatographischen Methoden isoliert, wovon vier neue Naturstoffe darstellen. Die Strukturen wurden aufgeklärt anhand ihrer UV-, IR- und Massenspektren, sowie vor allem anhand der 1H-, 13C-, DEPT-, APT-, HH-COSY-, NOE-, HMQC- und HMBC-NMR-Spektren. Elf Substanzen gehören der Stoffklasse der Alkaloide an. Ein Tetrahydroprotoberberin-Grundgerüst besitzen Scoulerin (1) und Coreximin (2). Die beiden Substanzen unterscheiden sich nur in der Anordnung einer Hydroxygruppe. Bei der Biosynthese aus Retikulin wird durch das "Berberine Bridge Enzym“ die N-Methylgruppe zur Cyclisierung oxidiert. Dies ist erst der zweite Bericht, dass Tetrahydroprotoberberine aus einer Croton-Spezies isoliert wurden. Fünf weitere Verbindungen gehören der Stoffklasse der Morphinandienone an. Aus drei Sträuchern wurde das (R)-konfigurierte Salutaridin (3a) isoliert. Die phytochemischen Untersuchungen von zwei weiteren Sträuchern haben dagegen ergeben, dass sowohl Salutaridin (3a) als auch sein Spiegelbild-Isomer Sinoacutin (3b) vorkommen. Das Enantiomerengemisch hat den Namen Salutarin (3). Die Besonderheit liegt nun darin, dass in ein und derselben Pflanze von einem Naturstoff beide Enantiomere gebildet werden. Dieses Phänomen ist im Pflanzen- bzw. Tierreich sehr selten. Für die Untersuchung des Enantiomerenüberschusses von Salutaridin, der je nach Strauch und Jahreszeit zwischen 1 und 100% schwankt, wurde eine HPLC-Methode mit chiraler Säule (Chiralcel OD-R, 20:80 Acetonitril – 0.2 M Natriumperchlorat-Puffer pH 2) entwickelt. Ein weiterer Inhaltsstoff ist das N-Demethylderivat Norsinoacutin (5). Diese Verbindung ist nur in Sträuchern zu finden, die enantiomerenreines Salutaridin (3a) und nicht das Enantiomerengemisch Salutarin (3) enthalten. Es liegt der Schluss nahe, dass diese Pflanzen ein Enzym besitzen, das selektiv und quantitativ das (S)- konfigurierte Sinoacutin N-demethylieren kann. Norsinoacutin, Salutaridin und Salutarin entstehen durch ortho-para-oxidative Kupplung der Biosynthesevorstufe Retikulin. In seltenen Fällen findet auch eine para-para-oxidative Kupplung statt und es entstehen in 2,3-Position disubstituierte Morphinandienone. Zu dieser Verbindungsklasse gehören O-Methylflavinantin (4) und Flavinantin (6), die sich nur in einer Hydroxy- bzw. Methoxygruppe in 3-Position unterscheiden. Aus einem der Sträucher wurde neben dem Hauptalkaloid Salutarin (3) auch dessen N-Oxid (10) isoliert. Diese Verbindung liegt ebenfalls als Enantiomerengemisch vor und lässt sich durch die entwickelte HPLC-Methode mit einer chiralen Säule auftrennen. In diesem Strauch wurde außerdem ein neuer Naturstoff gefunden. Es gelang die Strukturaufklärung des Phenanthrens Crotoflavol (11). Dies ist der erste Bericht über das Vorkommen eines Phenanthrens in Croton-Spezies. Darüber hinaus konnten drei weitere neue Naturstoffe isoliert und identifiziert werden. In einem der Sträucher liegen Morphinandienon-Dimere vor. Durch oxidative 1,1‘-Kupplung von zwei Salutaridin-Molekülen entstehen die beiden Rotamere Saludimerin A und B (7 und 8), welche auf Grund der eingeschränkten Rotation entlang der Biarylachse unterschiedliche spektroskopische Eigenschaften aufweisen. Die absolute Konfiguration konnte durch aufwendige CD- und ROESY-Studien aufgeklärt werden. Das dritte Dimer Salsinodimerin (9) enthält eine Salutaridin- und eine Norsinoacutin-Einheit. Mit diesen drei Verbindungen konnten zum ersten Mal CC- verknüpfte Morphinandienon-Dimere aus Pflanzen isoliert werden. Zum Strukturbeweis wurden Partialsynthesen durchgeführt. Dabei sind besonders die oxidativen Kupplungen zu den Dimeren hervorzuheben. Milde Oxidation von enantiomerenreinem Salutaridin (3a) mit Silbernitrat-Lösung in Ethanol lieferte Saludimerin A (7). Andererseits erhält man bei der Oxidation eines Gemisches aus Salutaridin und Norsinoacutin (5) mit Kaliumhexacyanoferrat(III) die dimeren Alkaloide Saludimerin B (8) und Salsinodimerin (9). Aus dem Enantiomerengemisch Salutarin (3) wurde mit Diazomethan der OMethylether hergestellt, welcher das gleiche Molekulargewicht hat wie die isolierte Verbindung O-Methylflavinantin (4). Es konnte dadurch gezeigt werden, dass OMethylflavinantin in 2,3-Position disubstituiert sein muss, wohingegen das synthetische O-Methylsalutarin in 3,4-Position die Methoxygruppen trägt. Ebenfalls aus Salutarin wurde mit Chlorameisensäure-2,2,2-trichlorethylester das NNorderivat zugänglich. Mittels chiraler HPLC-Methode konnte das Enantiomerengemisch Norsalutaridin und Norsinoacutin aufgetrennt werden. Es konnte gezeigt werden, dass die isolierte Verbindung 5 enantiomerenreines Norsinoacutin ist. Aus den fünf untersuchten Sträuchern konnten sowohl (R)-konfiguriertes Salutaridin (3a) als auch das Enantiomerengemisch Salutarin (3) isoliert werden. Mittels Razematspaltung über Kristallisation diastereomerer Salze konnte Salutaridin enantiomerenrein erhalten werden. Das (S)-konfigurierte Sinoacutin (3b) war dadurch aber nicht zugänglich. Daher wurde aus Norsinoacutin (5) durch NMethylierung mit Formaldehyd und dem Reduktionsmittel Natriumcyanoborhydrid das linksdrehende Enantiomer Sinoacutin synthetisiert. Salutaridin ist eine wichtige Vorstufe bei der Biosynthese von Thebain, Codein und Morphin. Es wurden daher die Stereochemie, die Biosynthese und die pharmakologischen Eigenschaften dieser Substanz näher beleuchtet. Wie schon beschrieben, konnte sowohl enantiomerenreines Salutaridin (3a), als auch das Enantiomerengemisch Salutarin (3) isoliert werden. Nur Salutaridin wird in Thebain, Codein und Morphin umgewandelt. Eine Zwischenstufe ist dabei Salutaridinol. Dieses wichtige Intermediat wurde partialsynthetisch aus Salutarin durch Reduktion der Dienon-Funktion zum Alkohol erhalten. Dabei entstehen zwei epimere Alkohole, die sich gut trennen lassen. Nur Salutaridinol und nicht 7-epi-Salutaridinol wird bei der Biosynthese weiter verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass in Croton flavens L. keiner dieser Alkohole vorliegt und damit das notwendige Enzymsystem für den Reduktionsschritt fehlen muss.
Heterologe Überexpression, Reinigung, biochemische Charakterisierung und Untersuchungen zur Struktur der A1 ATPase aus Methanosarcina mazei Gö1
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
1.Die A1-ATPase-Gene ahaE, ahaC, ahaF, ahaA, ahaB, ahaD und ahaG wurden in den Fusionsvektor pMal-c2 kloniert und in Escherichia coli exprimiert.Die Fusionsproteine wurden aus dem Zellextrakt isoliert und zur Immunisierung von Kaninchen eingesetzt.Die spezifischen Antiseren gegen die A1-ATPase- Untereinheiten AhaA,AhaB,AhaC,AhaE und AhaF wurden für die Studien dieser Arbeit eingesetzt. 2.Die für die hydrophile Domäne der A1-ATPase kodierenden Gene ahaE, ahaC, ahaF, ahaA, ahaB, ahaD und ahaG des methanogenen Archäons Methanosarcina mazei Gö1 wurden in den Überexpressionsvektor pGEM-4Z hinter die lac und T7-Promotoren kloniert.Dieses Konstrukt wurde pTL2 genannt.pTL2 enthält zusätzlich 162 Bp stromaufwärts von ahaE 3.Die auf pTL2 lokalisierten Gene wurden heterolog in E. coli DK8 exprimiert und die A1-ATPase funktionell synthetisiert.Die spezifische ATPase-Aktivität im zellfreien Extrakt von E. coli DK8 (pSÖ1)betrug 186 mU/mg Protein.Die Synthese der A1-ATPase-Untereinheiten AhaA,AhaB,AhaC und AhaF konnte nachgewiesen werden.AhaE und AhaG konnten nicht detektiert werden. 4.Die A1-ATPase wurde aus dem Zellextrakt von E. coli DK8 (pTL2)über Ultra- zentrifugation,Ammoniumsulfatfällung,Gelfiltration an BioPrep SE 1000/17, Ionenaustauschchromatographie an BioScale DEAE und einer zweiten Gelfiltration an Sephacryl S-300 HR bis zur apparenten Homogenität gereinigt. 5.Das gereinigte Enzym wies eine molekulare Masse von 355 kDa auf und setzte sich aus 5 verschiedenen Untereinheiten zusammen.Die einzelnen Untereinheiten AhaA (65 kDa),AhaB (55 kDa),AhaC (41 kDa),AhaD (28 kDa)und AhaF (9 kDa)wurden mittels N-terminaler Sequenzierung identifiziert und wiesen im ATPase-Komplex eine Stöchiometrie von A3B3CDF auf.AhaE und AhaG waren nicht im Komplex enthalten. 6.Der ATPase-Testpuffer wurde für die heterolog exprimierte A1-ATPase optimiert (50 mM MES-HCl,40 mM Na-Acetat,30 mM NaHSO3,8 mM MgSO4,4 mM ATP,pH 5,2).Na-Acetat und Sulfit stimulieren die A1-A7.Die gereinigte A1-ATPase aus M. mazei Gö1 hydrolysierte Mg-ATP (im Verhältnis 2:1)als bevorzugtes Substrat mit einem V von 13 ± 3 U/mg Protein und einem K von 1,3 ± 0,3 mM für ATP. 8.DES,Hexestrol und Dienestrol wurden als spezifische Inhibitoren der archäellen A1-ATPase identifiziert.Die I Werte dieser Hemmstoffe betrugen 5 µmol Hexestrol/mg Protein,3 µmol DES/mg Protein und 6 µmol Dienestrol/mg Protein. 9.Quervernetzungsexperimente konnten belegen,dass die Kopien der Untereinheit AhaA in direkter Nachbarschaft zueinander stehen.Dies trifft auch für die Kopien der Untereinheit AhaB und für die Untereinheiten AhaA und AhaB untereinander zu.Zudem konnte eine direkte Nachbarschaft der Untereinheiten AhaA und AhaD festgestellt werden. 10.Die A1-ATPase besitzt eine dreifache Achsensymmetrie.Der Kopfteil der A1-ATPase ist hexagonal geformt und setzt sich aus sechs peripheren und einer zentralen Masse zusammen. 11.Die über Röntgenkleinwinkelstreuung ermittelten Dimensionen der A1-ATPase sind:Gesamtlänge =17,8 nm,Länge Kopfteil =9,4 nm,Stiellänge =8,4 nm, Stieldurchmesser =6 nm,Kopfdurchmesser (variabel,abhängig vom Substrat)= 10,06 nm,Kopfradius (variabel,abhängig vom Substrat)=5,03 nm. TPase,wohingegen sich alkoholische Lösungsmittel die ATPase-Aktivität hemmten.
Molekulare Analyse der mRNA-Expression von Plasma-Prokallikrein
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Plasma-Kallikrein (PK) ist eine Serinprotease, die als inaktives Zymogen Plasma- Prokallikrein (PPK) in der Leber gebildet und in den Blutstrom sezerniert wird. Dort erfolgt die Konvertierung zum aktiven Enzym im Kontaktphasen-System der Blutgerinnung. Neben der Funktion im Kontakt-System spielt diese Protease sowohl in der Fibrinolyse als auch im Kallikrein-Kinin-System eine zentrale Rolle. Neuere Arbeiten haben gezeigt, dass PPKmRNA auch außerhalb der Leber exprimiert wird. Daraus ist zu schließen, dass dort ebenfalls PPK-Protein gebildet wird und dass diesem extrahepatischen, gewebeständigen PPK bzw. PK spezielle lokale Funktionen zukommen. Dieser Befund bildet die Grundlage dieser Dissertation. Mit dem langfristigen Ziel die physiologische und pathophysiologische Rolle des extrahepatisch gebildeten PPK aufzuklären, sollte in dieser Arbeit zunächst mittels einer quantitativen PCR-Technik (TaqMan) untersucht werden, in welchem Umfang PPK-mRNA und die mRNAs der übrigen Komponenten des Kontaktphasen-Systems in humanen Zellen bzw. Geweben exprimiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse sollte im zweiten Teil der Arbeit untersucht werden, ob bzw. inwieweit das PPK-Gen gewebespezifisch reguliert werden kann. Hierzu sollten die regulatorisch bedeutsamen Regionen des PPK-Gens charakterisiert werden. Mittels der TaqMan-Technologie konnte die PPK-mRNA-Expression in allen untersuchten humanen Geweben quantifiziert werden. In neun Geweben liegt die mRNA-Expression im Vergleich zur Leber zwischen 1 % und 68 % und in sechs Geweben zwischen 0,1 % und 1 %. Diese Ergebnisse sprechen für eine ubiquitäre, aber teils sehr unterschiedliche Expression der PPK-mRNA in humanen Geweben. Die mRNAs von hochmolekularem Kininogen (HK), niedermolekularem Kininogen (LK), Faktor XI (FXI) und Faktor XII (FXII) werden dagegen nur in wenigen Geweben exprimiert. Die Transkripte von HK, LK und FXI findet man außerhalb der Leber nur noch in Nierengewebe in signifikanter Menge, während FXII-mRNA nahezu ausschließlich in der Leber synthetisiert wird. Ein gemeinsames Merkmal aller Transkripte ist, dass sie in Lebergewebe am stärksten expimiert werden. Zellstimulationsversuche mit HepG2-Zellen ergaben, dass die PPK-mRNA-Synthese mittels Lipopolysacchariden (LPS) kurzfristig induziert werden kann, was für eine wesentliche Funktion von PPK bzw. PK bei Entzündungsreaktionen spricht. Im Gegensatz hierzu bewirkt Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) eine Herabregulation der PPK-Transkription. Untersuchungen zur Stabilität der mRNAs von PPK und dem Haushaltsgen GAPDH mit den Transkriptionsinhibitoren Actinomycin D, α-Amanitin und DRB zeigten, dass die mRNAAbbaurate in HepG2-Zellen vom jeweils eingesetzten Transkriptionsinhibitor abhängt. Bei allen Transkriptionsinhibitoren wurde das PPK-Transkript im Vergleich zu GAPDH deutlich schneller (Faktor 3-5) abgebaut. Dies weist darauf hin, dass die PPK-mRNA-Spiegel in den Zellen durch ständige Neusynthese aufrechterhalten werden, um eine kontinuierliche Produktion von PPK zu gewährleisten. Mittels der RLM-RACE Methode wurden in Leber-, Pankreas-, Nieren- und Testisgewebe die PPK-Transkriptionsstartpunkte (TS) identifiziert. Während in der Leber und im Pankreas nur TSs in Exon 1 des PPK-Gens benutzt werden, findet man in Nieren- und Testisgewebe TSs sowohl in der upstream-Region als auch in Intron 1. Weiterhin wurden in Nierengewebe drei am 5´-Ende verkürzte PPK-Transkripte detektiert, die aufgrund dieser Deletion keine Signalpeptid- Sequenz enthalten und dadurch eine intrazelluläre Lokalisation der entsprechenden PPK-Isoform bedingen. Die Consensussequenz-Analyse für die Transkriptionsinitiation zeigt, dass jedem experimentell ermittelten Transkriptionsstart eine TATA-Box oder/und ein Initiator-Element assoziiert ist. Außerdem konnte durch die RLM-RACE-Analysen die Existenz eines weiteren untranslatierten Exons im 5´-Bereich des PPK-Gens ausgeschlossen werden. Unter Anwendung der Genome Walker Technik wurde die Promotorregion (P-1729) stromaufwärts von Exon 1 kloniert und mittels Reportergen-Studien analysiert. In HepG2-Zellen zeigt dieses Gensegment eindeutig transkriptionsaktivierende Kapazität. Durch die Generierung von neun Verkürzungsvarianten konnten der Core-Promotor (-158 bis +22), Enhancerbereiche (-1675 bis -1494) und Silencerregionen (-1304 bis -674) charakterisiert werden. Die Transkriptionsfaktoren-Analyse ergab, dass bei der Regulation durch die P-1729 Region neben ubiquitär exprimierten auch streng gewebespezifische Transkriptionsfaktoren eine zentrale Rolle spielen. Reportergen-Untersuchungen des Intron-1-Bereichs in HEK 293-Zellen zeigten, dass auch diese Region des PPK-Gens transkriptionsaktivierende Kapazität besitzt. Ebenso zeigt aber auch der P-1729 Bereich in HEK 293-Zellen Promotoraktivität. Somit können innerhalb eines Zelltyps beide Promotorbereiche funktionell aktiv sein, wodurch eine alternative Regulation der PPK-Transkription ermöglicht wird.
Na + -translozierende rotatorische Membranproteinkomplexe aus dem anaeroben Bakterium Acetobacterium woodii: Vergleichende molekulare und biochemische Analyse des Flagellums und der F1FO-ATPase
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
1. Aus chromosomaler DNA von A. woodii wurde durch heterologe Starteroligonukleotide ein Bereich des Flagellingens mittels PCR amplifiziert. Durch die Verwendung dieses DNA-Fragmentes als Sonde wurden weitere 6 kBp an chromosomaler DNA von A. woodii kloniert, sequenziert und analysiert. 2. Innerhalb dieses klonierten DNA-Abschnittes wurden zwei partielle und fünf vollständige offene Leserahmen lokalisiert, die jeweils über eine Shine-Dalgarno-Sequenz verfügten und größer als 300 Bp waren. Durch Sequenzvergleiche ließ sich das Flagellingen (fliC) identifizieren. Stromaufwärts von fliC wurden offene Leserahmen (flgL, flgK) gefunden, die für die Haken-assoziierten Proteine 1 und 3 des A. woodii-Flagellums kodieren, sowie ein Leserahmen (orfA) dessen abgeleitetes Produkt keine Ähnlichkeit keinem bekannten Protein ähnlich ist. Durch die Expression von orfA in Minizellen von E. coli DK6 wurde aber gezeigt, daß orfA für ein Protein kodiert. Stromabwärts vom Flagellingen wurden keine Flagellengene identifiziert. Die abgeleiteten Produkte, der hier lokalisierten ORFs orfB und orfC zeigten keine Ähnlichkeiten zu in Datenbanken hinterlegten Proteinsequenzen. Am 3'-Ende des klonierten DNA-Abschnittes war ein partieller ORF (orfD) vorhanden, dessen abgeleitete Aminosäuresequenz große Ähnlichkeiten zu dNTP-Zucker modifizierenden Enzymen aufwies. 3. Aus Sphäroplasten von A. woodii wurden durch Solubilisierung, differentielle Zentrifugation und eine CsCl-Dichtegradientenzentrifugation ganze Flagellen inklusive des Haken-Basalkörper- Komplexes gereinigt. Durch die Analyse der Präparation in der SDS-PAGE wurden neben dem Flagellin sechs weitere Proteine als Bestandteil der Flagellen identifiziert. 4. Durch die elektronenmikroskopische Analyse der Haken-Basalkörper-Komplexe der Na + -abhängigen Flagellen von A. woodii konnte gezeigt werden, daß diese aus einem Haken, Stab und einem MS-Ring aufgebaut sind. Unterhalb des MS-Rings waren weitere Strukturen vorhanden. Diese Struktur entspricht den aus den H + -abhängigen Flagellen der Gram-positiven Organismen bekannten Strukturen. Durch die Gefrierbruchmethode konnten in der Cytoplasmamembran von A. woodii im elektronenmikroskopischen Bild Partikelringe nachgewiesen werden. Diese entsprechen in Struktur und Größe den Mot-Komplexen der H + -abhängigen Flagellen aus E. coli.5. Zur Analyse der Untereinheitenzusammensetzung der Na + -F1FO-ATPase von A. woodii wurden Antiseren gegen die Untereinheiten a, b, c1, c2/c3 und β generiert. Hierzu wurden die Untereinheiten a, b, c und β als MalE-Fusionen in E. coli produziert und gereinigt. Die Untereinheit c2/c3 wurde durch Chloroform:Methanol-Extraktion aus der Cytoplasmamembran von A. woodii angereichert und durch Elektroelution aus einer SDS-PAGE gereinigt. 6. Durch die Analyse der Cytoplasma- und Membranfraktion mit den fünf Antiseren ließen sich die Untereinheiten a, b, c1, c2/c3 und ˜ in der Cytoplasmamembran nachweisen. 7. Die Na + -F1FO-ATPase von A. woodii wurde durch Blue-Native-PAGE aus der Membranfraktion isoliert. Durch die Auftrennung der ATPase in ihre Untereinheiten und deren aminoterminale Sequenzierung wurden die Untereinheiten a, b, c2/c3, α , β γ,δ und ε identifiziert. 8. Durch immunologische Methoden wurde die Untereinheit c1, das in F1FO-ATPasen einmalige 16-kDa-Proteolipid, als Untereinheit der Na + -F1FO-ATPase von A. woodii erkannt. Die Na + -F1FO- ATPase von A. woodii ist die erste F1FO-ATPase mit einem Heterooligomer aus 8- und 16-kDa-Proteolipiden. 9. Die Untereinheit c1 wurde in A. woodii unabhängig vom Substrat und der Na + -Konzentration produziert. Allerdings wurden Hinweise auf eine erhöhte Expression des gesamten atp-Operons in Methanol-gezogenen-Zellen erhalten. 10. Ein Verfahren zur Reinigung der Na + -F1FO-ATPase unter Erhalt ihrer Untereinheitenstruktur wurde entwickelt. Die Na + -F1FO-ATPase wurde aus der Membranfraktion von A. woodii solubilisiert und durch Gelfiltration über Sephacryl S-400 und eine Glycerin-Dichtegradientenzentrifugation gereinigt. Das gereinigte Enzym besaß alle neun Untereinheiten. Die spezifische Aktivität der gereinigten ATPase betrug 7 U mg Protein -1 und seine molekulare Masse 600 kDa.
Entwicklung einer High-Throughput-Sequenzierungsmethode für die Proteomanalytik
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Ziel dieser Arbeit sollte die Entwicklung einer automatisierten, hochparallelen und nachweis-starken Sequenzierungsmethode für Proteine im Rahmen der Proteomanalytik sein. Zur Kon-zeption der Methodik sollte dabei mit der sogenannten Leitersequenzierung eine Kopplung aus enzymatischem Aminosäureabbau und MALDI-Massenspektrometrie zum Einsatz kom-men. Die experimentellen Grundparameter für die Leitersequenzierung im Bezug auf die nasschemischen Sequenzierungsschritte und die massenspektrometrischen Messung wurden dabei im ersten Teil der Arbeit zunächst manuell ausgearbeitet. Im zweiten Abschnitt wurden dann die Möglichkeiten einer Automatisierung der so erarbeiteten Methode zur Leitersequen-zierung auf verschiedenen Ebenen evaluiert. Da der enzymatische Abbau eines Gesamtproteins durch dessen intrinsische Eigenschaften wie Sekundärstruktur, Tertiärstruktur (Zugänglichkeit der Proteintermini für die Exopepti-dase) oder Lösungsverhalten erschwert ist, wurden die Sequenzierungsprotokolle der Leiter-sequenzierung für proteolytisch erzeugte, RP-HPLC-gereinigte Spaltfragmente von Proteinen optimiert. Zudem besitzt die MALDI-MS, wie auch andere gängige massenspektrometrische Verfahren, im Massenbereich über ca. 5-10 kDa eine zu geringe Auflösung und Genauigkeit, um eine eindeutige Zuordnung der Massendifferenzen in den Leiterpeptidspektren zu den durch Exopeptidase abgespaltenen Aminosäure zu erlauben. Bei Versuchen mit verschiede-nen Endopeptidasen stellte sich – entgegen theoretischen Erwartungen – heraus, dass vor allem auch Proteinspaltungen mit Endoproteinase GluC (im Phosphatpuffer) und Chymotrypsin, neben Spaltungen mit Endoproteinase LysC, gute Voraussetzungen für die nachfolgende enzymatische Sequenzierung liefern. Mit den Proteinfragmenten aus Spaltungen der Endoproteinasen GluC (im Phosphatpuffer) und Chymotrypsin wurden bei den enzymatischen Sequenzierungen die höchsten Sequenzabdeckungen erzielt. In der technischen Ausführung wurden alle Experimente im Hinblick auf eine Sequenzierung direkt auf dem Target (on-target) optimiert. Geringfügige Anpassungen der erarbeiteten Methoden erlaubten jedoch auch eine Sequenzierung von Peptiden, die zuvor auf PVDF-Membran (Immobilon PSQ) aufgetragen wurden. Ein relativ kontrollierter und reproduzierba-rer Abbau war in einem Temperaturbereich von ca. 25-35°C möglich. Die enzymatischen Sequenzierungen erfolgten ausschließlich mit kommerziell erhältlichen Exopeptidasepräpara-tionen. Eine zusätzliche Aufreinigung der eingesetzten Enzyme erwies sich als nicht notwen-dig. Um eine einfache Interpretation der massenspektrometrischen Resultate zu gewährleisten, wurden nur Monopeptidylpeptidasen eingesetzt. Für C-terminale Sequenzierungen wurden mit CPY, CPP, CPW, CPA und CPB Carboxypeptidasen unterschiedlicher Spezifität einzeln und in verschiedenen Kombinationen untersucht. Von der N-terminal Seite aus wurden Sequenzierungen mit APM, LAP, API und AAP durchgeführt. Eine Betrachtung der Sequen-zierungen zeigt dabei, dass zumeist nur aus kombinierten Resultaten der Anwendung verschiedener Carboxy- beziehungsweise Aminopeptidasen eine ausreichende Sequenzinfor-mation erhalten werden kann. C-terminal ist der Anteil sequenzliefernder Fragmente bei der Verwendung von CPY, sowie bei den sequenziellen Peptidasenkombinationen sb(CP-I) und den Peptidasenmischungen pb(CP) mit maximal 42% am höchsten. Hier treten auch vermehrt längere Teilsequenzen mit bis zu 12 AS auf. N-terminal hebt sich APM als Einzelpeptidase mit überdurchschnittlich guten Sequenzresultaten gegenüber den anderen Aminopeptidasen ab. Bis zu 34% der getes-teten Peptide liefern allein schon mit diesem Enzym eine Sequenzinformation. Zudem wurden längere Teilsequenzen mit bis zu 9 AS im Vergleich zu anderen Aminopeptidasen häufiger erhalten. Sequenzierungen mit Aminopeptidasenmischungen bei N-terminaler Sequenzierung brachten im Gegensatz zu Carboxypeptidasenmischungen bei C-terminaler Sequenzierung kaum deutliche Vorteile. Auch sehr lange Sequenzabschnitte mit bis zu 16 AS N-terminal und bis zu 25 AS C-terminal wurden in Einzelfällen erhalten. C- und N-terminal am häufigsten wurden jedoch aus den Leiterspektren Teilsequenzen mit bis zu 6 AS erhalten (85% aller sequenzliefernden Proteinfragmente). Der größte Teil der Sequenzabdeckung stammt mit 70% aus Teilsequenzen mit 3-9 AS. Unter dem Hauptaspekt einer möglichen Steigerung der Sequenzinformation bei den Leiter-sequenzierung wurden unterschiedliche Peptidderivatisierungen untersucht. Die gezielte N-terminale Modifizierungen brachte in vielen Fällen durch die resultierende Massenverschie-bung des derivatisierten Peptids einen Gewinn an C-terminaler Sequenzinformation. Gegen-über entsprechend nicht-modifizierten Peptiden konnten durch die Massenverschiebung auch Leiterpeptide beobachtet werden, die sonst mit Signalen der MALDI-Matrix interferieren. Bei Modifikationsreagenzien, die eine fixierte positive Ladung oder ein ausgedehntes, delokali-siertes Elektronensystem ins Peptid einbrachten, wie z.B. Sulforhodamin B oder FMOC-NHS wurde dabei zusätzlich auch eine sehr gute Response im Massenspektrum beobachtet. Die Empfindlichkeiten lagen selbst bei der Sequenzierung der Rohprodukte solcher Derivate im unteren fmol-Bereich. Das charakteristische Isotopenmuster Brom-haltiger Peptidderivate erlaubte weiterhin ein stark vereinfachtes Auslesen der Leitersequenz aus dem Massenspekt-rum. Während die Leitersequenzierung allgemein keine Unterscheidung der isobaren Aminosäuren Leucin und Isoleucin erlaubt, gelang die Unterscheidung der ebenfalls isobaren Aminosäuren Lysin und Glutamin nach einer schnellen und selektiven Acetylierung des Lysins mit anschließender C-terminaler Sequenzierung.Im Hinblick auf die Analyse post-translationaler Modifikationen wurden insbesondere Phosphorylierungen eingehender untersucht. Dabei war sowohl bei der N-terminalen, als auch bei der C-terminalen Leitersequenzierung ein enzymatischer Abbau der phosphorylierten Aminosäuren zu beobachten und damit die entsprechende Phosphorylierungsstelle schnell und eindeutig zu identifizieren. Die N-terminale Sequenzierung mit APM lieferte die besten Resultate und ermöglichte sowohl den Abbau von Phosphotyrosin wie auch Phosphoserin, während der C-terminale Abbau sich auf Phosphotyrosin beschränkt zeigte. Aus der Summe der erhaltenen Resultate (Sequenzen) folgt, dass die Leitersequenzierung unter den gegebenen Voraussetzungen – insbesondere der limitierenden Verfügbarkeit zusätzlicher Exopeptidasen mit ergänzenden Spaltungsspezifitäten – im wesentlichen als Instrument zur schnellen Generierung kurzer Sequenztags geeignet ist. Auf diesem Gebiet stellt die erarbeitete Leitersequenzierung im Vergleich zur Edman-Sequenzierung eine wesentlich schnellere Alternative dar. Im Gegensatz zu rein massenspektrometrischen Sequenzierungen ist die Interpretation der Sequenzen im Massenspektrum stark vereinfacht und daher zumeist eindeutig. Die Empfindlichkeit der Methode ist stark von der untersuchten Peptidsequenz abhängig. Generelle Werte für die Empfindlichkeit lassen sich somit nicht angeben, die Resultate lassen jedoch für eine Peptidausgangsmenge im oberen fmol-Bereich (1000-500fmol) eine Leitersequenzierung ausnahmslos möglich erscheinen. Die Ergebnisse von Verdünnungsreihen zeigen zudem, dass auch nach Sequenzierung von Peptidmengen im mittleren bis unteren fmol-Bereich (50-10fmol) ein Auslesen der Peptidsequenz aus dem Massenspektrum zumeist möglich ist. Zum Erreichen solcher Empfindlichkeiten ist die weit-gehende Minimierung von Suppressionseffekten und damit die Verwendung von DHB als MALDI-Matrix eine notwendige Voraussetzung. Eine Evaluierungsstudie mit vier verschiedenen Proteinen führt zum Schluss, dass die Metho-dik auch für die de novo Sequenzierung unbekannter Proteine ein hohes Potential birgt. Die ermittelte Sequenzabdeckung der überlappenden Spaltfragmente lag bei maximal 80%. Im Bereich prolinhaltiger Sequenzabschnitte fehlen Überlappungen dabei am häufigsten, da auf Seiten der N-terminalen Sequenzierung geeignete Exopeptidasen zu Spaltung der Iminbindung nicht verfügbar waren. Zur Herstellung von Oligonucleotidsequenzen, die dann als Hybridisierungssonden in der Nucleinsäureanalytik eingesetzt werden, ist die Länge der erhaltenen Sequenzabschnitte jedoch in fast allen Fällen ausreichend. Die Methoden „MALDI-LS 1.42s“ für die Probenpräparation mit dem Pipettierroboter MultiPROBE II, sowie „multiprobe_5“ für die MALDI-MS Messung mittels AutoXecute auf dem Bruker Reflex III Massenspektrometer, erlauben eine Umsetzung der manuell ausgear-beiteten Methodik auf ein vollständig automatisiertes System. Eine Excel-Tabellenvorlage, die in konvertierter Form von beiden beteiligten Geräten gelesen werden kann, ermöglicht eine zentrale und einfache Dateneingabe für die Proben. Diese Art der Dateneingabe erlaubt im Zusammenspiel mit dem ausgearbeitetem Automatisierungspro-gramm eine vollkommen flexible, individuelle Behandlung der einzelnen Proben. Die erfor-derliche „Ortspräzision“ bei der Abgabe der Flüssigleiten auf dem MALDI-Target konnte durch eine entsprechenden ausgelegte Performance-Datei für den Pipettiervorgang erreicht werden. Querkontaminationen beim Pipettieren wurden durch organische Spülschritte in der Methode eliminiert. In der Summe lieferten die auf dem automatischen Pipettiersystem mit der Methode MALDI-LS 1.42s präparierten Proben im Massenspektrum vergleichbare Abbauspektren und somit auch die gleiche Sequenzinformation, wie entsprechend manuell präparierte Proben. Bei den automatischen MALDI-MS Messungen war eine Anpassung der Parameter insbeson-dere aufgrund der bevorzugten Verwendung der DHB-Matrix notwendig. Ein erhöhter Aceto-nitrilgehalt von 50% im Lösungsmittel der DHB sorgte für eine Verbesserung der Präparation im Bezug auf die automatische AutoXecute Messung. Mit speziellen Rasterkoordinaten, die bei der Laserabtastung der einzelnen Probenspots auf die besonderen Kristallisationseigen-schaften der DHB-Matrix zugeschnitten wurden, konnten gute Ergebnisse erzielt werden. Vorteile zeigten die DHB-Präparationen, im Vergleich zu CHCA-Präparationen, in der Toleranz gegenüber geringfügigen Mengen von Puffersalzen, wie sie bei der enzymatischen Sequenzierung üblich sind. Die Toleranzschwelle für den Abbruch der automatischen Messung musste jedoch bei den enzymatisch sequenzierten Proben und Verwendung von DHB-Matrix im Vergleich zu Messungen salzfreier Peptidproben in CHCA-Matrix erhöht werden, was im Durchschnitt zu etwas längeren Messzeiten führte. Die in dieser Arbeit weiterentwickelten Methoden zur enzymatischen on-target Sequenzie-rung von Peptiden erlauben somit, in Verbindung mit den beschriebenen Hard- und Software-komponenten zur automatischen Probenpräparation und MALDI-MS Messung, deren Einsatz für eine schnelle Sequenzierung in der Proteinanalytik. Zusätzliche Verbesserungen könnten jedoch, bei entsprechender Verfügbarkeit, noch durch Exopeptidasen mit ergänzender Spaltungsspezifität (z.B. X-Pro Aminopeptidase, EC 3.4.11.9) erzielt werden. Auf Seiten der Automatisierung ergäben sich durch die ausschließliche Ver-wendung eines 96er oder 384er Mikrotiterplattenformat auf allen Geräten (Pipettierrobot und MALDI-MS) deutliche Vereinfachungen in der Methode, bei gleichzeitig noch höherem Probendurchsatz.
Herstellung von monoklonalen Antikörpern gegen die Cuabhängige dissimilatorische Nitritreduktase
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Ziel dieser Arbeit war es ein serologisches Testystem für die Beantwortung ökologischer Fragestellungen zur Denitrifikation zu etablieren. Für den in situ-Nachweis der Expression des denitrifizierenden Enzymsystems in Bakterien wurden spezifische monoklonale Antikörper gegen die Cu-haltige dissimilatorische Nitritreduktase (Cu-dNIR) entwickelt. Die für die Produktion der Antikörper benötigte Cu-dNIR wurde mit Hilfe zweier Ansätze präpariert. Der erste Ansatz, die Kombination verschiedener Säulenchromatografien und Reinigung über eine Polyacrylamid-Matrix, erlaubte das Enzym aus einem Bodenisolat von Ochrobactrum anthropi mit einer Ausbeute von 2,5 µg/g Zellen (Feuchtgewicht) zu gewinnen. In einem zweiten Ansatz wurde die Cu-dNIR aus Alcaligenes faecalis S6 nach Fusion mit einem 6 x His-tag in E. coli exprimiert und anschließend über eine spezifische Affinitätsmatrix aufgereinigt. Hiermit konnte eine Ausbeute von 4,5 mg/l [2,25 mg/g Zellen (Feuchtgewicht)] Bakterienkultur gewonnen werden. Mit der Cu-dNIR der beiden Präparationsansätze wurden Mäuse immunisiert und nach drei Zellfusionen 41 verschiedene Hybridomalinien etabliert, deren sezernierte Antikörper in einem ersten Screening im Chemolumineszenz-ELISA mit der für die Immunisierung benutzten CudNIR reagierten. Hieraus wurden über weitere Screeningschritte im Western-Blot zwei Antikörper zur genaueren Charakterisierung ausgewählt: Ein sehr spezifischer Antikörper (mAkdNIR1a), der ausschließlich die zur Immunisierung eingesetzte Cu-dNIR aus Ochrobactrum anthropi 1a erkennt; und ein zweiter Antikörper (mAkdNIR29) mit einem breiteren Reaktionsspektrum für Cu-dNIRs aus Bakterien unterschiedlicher phylogenetischer Herkunft. Beide Antikörper zeigten keine Kreuzreaktionen mit alternativen dissimilatorischen Nitritreduktasen des cd1-bzw. Sirohäm-Typs aus Pseudomonas aeruginosa bzw. E. coli. Die im Chemolumineszenz-ELISA bestimmte Sensitivität für mAkdNIR1a liegt bei 2 ng Cu-dNIR. Mit mAkdNIR29 konnte rekombinante Cu-dNIR bis 5 ng nachgewiesen werden. Mit dem Antikörper mAkdNIR29 konnte eine Differenzierung zwischen Reinkulturen von Alcaligenes faecalis S6, die unter denitrifizierenden bzw. nicht denitrifizierenden Bedingungen gewachsen waren, im Western Blot gezeigt werden. Weiterhin wurde der zeitliche Verlauf der Expression von Cu-dNIR in Ochrobactrum anthropi nach Shift vom aeroben in anaerobes Milieu mittels Immunofluoreszenz mit makdNIR29 auf Einzelzellniveau verfolgt. Das Maximum der Expression wurde nach 7 h erreicht. Der Verlauf der Expressionsstärke folgt der Zunahme der N2O-Produktion pro Zeiteinheit bezogen auf die Zellzahl. Die Expressionsrate der Cu-dNIR ist am stärksten während der exponentiellen Wachstumsphase. Die beiden anti-dNIR-Antikörper konnten in Kombination mit Epifluoreszenz-und Laserscanning- Mikroskopie erfolgreich zur in situ-Detektion der Expression von Cu-dNIR durch Immunofluoreszenz in Reinkulturen und Umweltproben eingesetzt werden. Der Antikörper mAkdNIR1a wurde wegen seiner Spezifität zum Nachweis von Cu-dNIR-induzierten Bakterien an Wurzeln von Weizenpflänzchen eingesetzt, die zuvor mit Ochrobactrum anthropi inokuliert worden waren. Mit dem Antikörper mAkdNIR29 wurden Cu-dNIR-induzierte Bakterien in Klärschlammproben aus zwei verschiedenen Kläranlagen detektiert. Ein Protokoll zur simultanen Markierung von denitrifizierenden Zellen von Ochrobactrum anthropi 1a mit dem Antikörper mAkdNIR1a und einer rRNS-gerichteten Oligonukleotidsonde wurde entwickelt. Immunofluoreszenzmarkierungen mit mAkdNIR29 ermöglichten die Trennung von Cu-dNIRinduzierten und Cu-dNIR-nicht-induzierten Zellen von O. anthropi mittels Durchflusszytometrie in zwei klar abgegrenzte Populationen.
Adressierung und Strukturierung von Biomolekülen auf der Nanometer-Skala
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/05
Im Rahmen dieser Arbeit werden Nanostrukturen aus biologischen Molekülen untersucht, sowie neue Methoden zur Strukturierung biologischer Systeme im nanoskaligen Bereich entwickelt und vorgestellt. Neben selbstorganisierten und enzymatischen Prozessen, wie sie bei der Strukturbildung biologischer Systeme eine wesentliche Rolle spielen, wird insbesondere auch eine neuartige Methode der gerichteten enzymatischen Hydrolyse biologischer Membranen, die eine gezielte Strukturierung im Nanometerbereich ermöglicht, vorgestellt. Vor dem Hintergrund, daß die Natur mit Polynucleinsäuren extrem vielseitige, universell einsetzbare und chemisch sowie molekularbiologisch sehr gut handhabbare molekulare Bausteine für den selbstorganisierten Aufbau hochintegrierter Nanoarchitekturen zur Verfügung stellt, werden ferner die grundlegenden Mechanismen und Kräfte der molekularen Erkennung bei der DNA-Basenpaarung sowie die mechanische Stabilität der DNA- Doppelhelix untersucht. - Durch kraftmikroskopische Untersuchungen an einer binären Mischung aus Dipalmitoyl- Phosphatidylcholin (DPPC) und Diarachidoyl-Phosphatidylcholin (DAPC) konnte erstmals die laterale Struktur von binären Lipidmischungen in Lipiddoppelschichten direkt bestimmt werden. Es konnte gezeigt werden, daß diese biologisch wichtigen Lipide in Lipiddoppelschichten spontan Domänen mit einer chrakteristischen Größe von etwa 10 nm bilden. Ein Vergleich der Ergebnisse der kraftmikroskopischen Untersuchungen mit denen von Neutronendiffraktionsexperimenten zeigte eine hervorragende Übereinstimmung der mit diesen beiden komplementären Techniken bestimmten mittleren Domänenabstände. - Untersuchungen des enzymatischen Abbaus von Lipidmembranen durch das lipolytische Enzym Phospholipase A2 (PLA2) erlaubten erstmals Einblicke in die Aktivität dieser Enzyme auf der Einzelmolekülebene. Es konnte gezeigt werden, daß die Enzymaktivität stark von den physikalischen Eigenschaften der Membran abhängig ist und daß Membranen in der Gel-Phase ausschließlich von Membrandefekten her und entlang der Hauptachsen des Molekülkristalls hydrolysiert werden, während die Hydrolyse flüssigkristalliner Membranen im wesentlichen isotrop verläuft. Die am freien Enzym gewonnenen Erkenntnisse konnten dann in einem nächsten Schritt zur Entwicklung einer neuartigen gerichteten Hydrolyse von Lipidmembranen genutzt werden, bei der mit der Spitze eines Rasterkraftmikroskops gezielt Defekte in kristallin gepackten Membranen induziert werden, und die Membranen dann durch das Enzym an Stellen mit diesen künstlichen Packungsdefekten hydrolysiert wird. Auf diese Weise konnten künstliche Strukturen in festkörpergestützten Membranen mit minimalen Strukturdurchmessern von bis zu 10 nm erzeugt werden. - Mit Hilfe von kraftspektroskopischen Untersuchungen an einzelnen DNA-Molekülen konnte erstmals ein neuartiger kraftinduzierter Schmelzübergang, der je nach Kraftladungsrate, Umgebungsbedingungen und DNA-Sequenz und Topologie zwischen einigen Piconewton (pN) und etwa 300 pN stattfindet, nachgewiesen werden. Durch Variation von Kraftladungsrate, Ionenstärke, Umgebungstemperatur und DNA-Sequenz konnte gezeigt werden, daß die mechanische Energie die unter Gleichgewichtsbedingungen bis zum kraftinduzierten Schmelzen in der DNA-Doppelhelix deponiert werden kann, hervorragend mit der freien Basenpaarungsenthalpie ∆Gbp der entsprechenden DNA- Sequenz unter den jeweiligen Umgebungsbedingungen übereinstimmt. Es konnte gezeigt werden, daß sich mit Hilfe der Temperaturabhängigkeit der mechanischen Stabilität von DNA die thermodynamischen Größen ∆Hbp und ∆Sbp von DNA direkt aus Kraftexperimenten an einzelnen Molekülen bestimmen lassen. Schließlich konnten die Basenpaarungskräfte von DNA erstmals sequenzspezifisch bestimmt werden. Die zum reißverschlußartigen Aufbrechen einer GC-Basenpaarung nötigen Kräfte betragen demnach 20±3 pN, die zum Aufbrechen einer AT-Basenpaarung nötigen Kräfte 9±3 pN. Auch hier konnte eine sehr gute Übereinstimmung der zum Aufbrechen der Basenpaarungen nötigen mechanischen Energie mit der freien Basenpaarungsenthalpie ∆Gbp festgestellt werden.