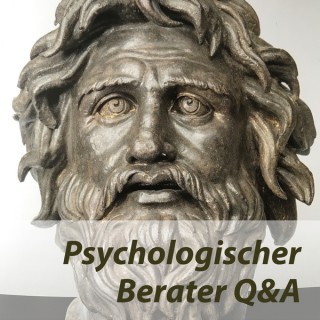Podcasts about substanzklassen
- 9PODCASTS
- 9EPISODES
- 29mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 13, 2023LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about substanzklassen
Chronisch-entzündliche Darmerkrankung und Osteoporose - die Entzündung gut im Griff, aber lauert etwas im Hintergrund. Für die Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stehen mittlerweile eine Vielzahl an Optionen und Substanzklassen zur Verfügung. Ziel der Therapie ist es immer, Patientinnen und Patienten in eine stabile Remission zu bringen. Aktuell gibt es keine Richtlinien, wie Patienten mit Osteoporose oder mit Risikofaktoren für eine Osteoporose behandelt werden sollen. Dieser Podcast bietet einen interdisziplinären Blick auf das Screening von Risikopatienten und auf die Behandlung. Christoph Österreicher spricht mit Dr. Alexander Eser vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und Prim. Dr. Peter Peichl vom Evangelischen Krankenhaus in Wien. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.
In dieser Podcastfolge geht es um Ditane und Gepante - zwei Substanzklassen, die in der Pipeline stehen und in den USA bereits zur Migränetherapie zugelassen sind. Info: Diese Podcastfolge dient nur zur Wissensvermittlung. Der Inhalt hat den Stand von April 2022. Viel Freude beim Zuhören : ) Warteliste "Calm Soul Studio": https://bit.ly/3rLCIS2 Weiterführende Links:Swiss Medical Forum (2019): https://medicalforum.ch/de/detail/doi/smf.2019.03431 Gelbe Liste (2022): https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/gepante Meine Links:Instagram: @unwetterimkopf Facebook-Gruppe: Unwetter im Kopf - der Migräne Austausch Blog: https://sabrinawolf.de
Aus Abhängigkeit kann eine Erkrankung entstehen, die entweder psychische oder physische Ausprägung findet oder beides zugleich und Behandlung durch einen Arzt erfahren muß. Es gibt die verschiedensten Substanzklassen, die eine Abhängigkeit verursachen können. Dazu gehören Alkohol, Opiate, Cannabis, Benzodiazepin, Barbiturate, Analgetika, Kokain, Stimulanzien, Halluzinogene, Nikotin, Flüchtige Lösungsmittel. Es geht immer darum ein negatives Erleben zu dämpfen oder einfach zu ertragen. Hat sich eine psychotrope Substanz einmal als wirkungsvoll erwiesen, dann besteht die Gefahr, immer wieder darauf zuzugreifen. Es gibt aber auch nicht stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen wie Pyromanie, Kleptomanie und krankhaftes Glücksspiel. Ein weites und schwieriges Feld, aber hier wird über Erkrankungen gesprochen.
#92 Körper, Geist und Seele im Einklang. Wie du die Pflanzenkraft für dich nutzen kannst, im speziellen der Hanfpflanze.
Manchmal reichen unsere eigenen Ressourcen nicht mehr aus, um uns aus einem Tief herauszuziehen. Der Mensch ist nicht alleine. Er ist wie alle Lebewesen und Pflanzen ein Teil des Ganzen, der Natur. *** Ohne Natur und ohne Pflanzen wären wir nicht lebensfähig! Abgesehen von den essentiellen Nährstoffen, lese auch mein Mikronährstoff ABC Teil 1 und 2 (), verfügen unsere Zellen über gewisse Rezeptoren, an diese genau Stoffe aus der Natur passen und ihre Wirkungen auslösen können. *** So wie beruhigende Wirkungen von Melisse, Lavendel, Baldrian, Passionsblume und auch der Hanfpflanze. Diese Cannabinoid Rezeptoren wirken direkt auf unser Stresszentrum. Einer der Hauptursache aller Erkrankungen ist Stress. Also ist es naheliegend, uns die Kraft der Natur zu nutzen zu machen. *** In der modernen Medizin hat es sich etabliert, gewisse Substanzklassen aus der Pflanze zu isolieren und diese synthetisch nachzubauen. In vielen Therapieformen ist es wichtig, denn so können mit kontrollierten Konzentrationen gewisse Nebenwirkungsrisiken minimiert werden. Persönlich finde ich es aber sehr schade, dass die natürlichen Pflanzen so immer mehr in den Hintergrund verdrängt werden. *** Ich möchte mit dieser neuen Podcastepisode, dass dein Vertrauen in die Pflanzenkraft wieder hergestellt wird und du dich wieder mehr für natürliche Arzneien entscheidest. Es gibt kein „entweder oder“, sondern auch Wege zur Ganzheit durch eine Kombination der modernen und der traditionellen Medizin, wie das Dr. Gerhard Kögler formuliert. Im Speziellen möchte ich, aufgrund der großen Nachfrage und Verunsicherung genauer auf die Hanfpflanze und ihre Wirkungen eingehen. Außerdem erfährst du in dieser Folge: Was ist die traditionelle Medizin? Was können wir heute anwenden? Welche Änderungen gibt es im österreichischen Gesetz bzgl. der Hanfpflanze. Warum ist die Qualität der Hanfpflanze so wichtig? Was ist THC und CBD? Welche Produkte kann ich dir empfehlen? Die österreichische Firma Hanfama bietet dir in ihrem Webshop 10% mit dem Rabattcode „Hanf2019“ bis 31. August an!! Hier findest du den Link zur Bestellung: Oder auch bei mir in der Apotheke an der Wien:. Wenn dir diese Podcastepisode gefallen hat und du dich mehr mit Naturmedizin befassen möchtest, kannst du dich hier über mein Webinar informieren: Ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir auch eine positive Rezension auf ITunes hinterlässt. Herzlichen Dank! Viel Freude & Achtsamkeit! Deine Caro
Therapieversagen unter Einsatz des ersten HIV-Fusionsinhibitors, T-20
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Für die Therapie der HIV-Infektion stehen verschiedene Substanzklassen zur Verfügung. T-20 (Handelsname Fuzeon®) ist ein Fusionsinhibitor, der in seinem Aufbau einem Teil des Hüllproteins von HIV-1 entspricht. Die Hülle von HIV-1 wird von mehreren gp120-gp41-Komplexen durchsetzt, welche Trimere bilden und durch nicht-kovalente Bindungen assoziiert sind. Die Ektodomäne von gp41 besteht aus vier wichtigen Strukturen: einem hydrophoben, glycinreichen Fusionspeptid, einer N-terminalen stabartigen α-Helix (Heptad repeat 1), einem Verbindungsstück mit cysteinreichem Loop (zwischen HR1 und HR 2) und einer zweiten C-terminalen α-Helix (Heptad repeat 2). Die Fusion wird u. a. durch Konformationsänderungen im gp120-gp41-Komplex und innerhalb eines gp41 ermöglicht. Als Inhibitor der räumlichen Umstrukturierung von HIV-1-gp41 agiert T-20 durch spezifische extra-zelluläre Bindung an gp41. Dadurch wird die Fusion zwischen viraler Zellmembran und Zielzelle blockiert und das Eindringen der viralen RNA in die Zielzelle verhindert. Die T-20-Resistenz wurde zunächst dem GIV-Motiv im N-terminalen Teil von gp41 zugeschrieben. Auch C-terminale Mutationen betreffend wurden resistenzsteigernde Effekte beschrieben. Ziel dieser Arbeit war die Erforschung C-terminaler Mutationen als Antwort auf N-terminale Aminosäureänderungen und ihre Darstellung in einem Proteinmodell. Entgegen den Erwartungen lagen die beobachteten Mutationen in HR2 oftmals den HR1-Mutationen nicht gegenüber, sondern waren häufig sogar an der Außenseite der Helix lokalisiert. Neben Mutationen, die auf intra-gp41-Ebene eine Rolle spielen, spricht dies für das Vorhandensein von inter-gp41-Beziehungen.
In-vitro Testung neuer HIV-Replikationsinhibitoren im Vergleich mit etablierten Substanzen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, neue HIV-Replikationsinhibitoren in vitro auf Virusreplikationshemmung und eventuell vorhandene Toxizität zu testen. Die hier untersuchten Protease- und REV-Inhibitoren sind eine neue Generation von HIV-Replikationsinhibitoren. Sie sind teilweise durch das SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment) -Verfahren hergestellte Moleküle, die vorher selektierte Aptamere von den definierten Bindungsstellen verdrängen konnten. Der Rest der neuen Inhibitoren sind anderweitig ins Visier geratene Verbindungen wie Nandrolon und Uvaol, bei denen ebenfalls sogenannte “small molecules“ eine Rolle spielen. Diese beiden Inhibitoren fungieren hier als Nicht-Substratanaloge Protease-Inhibitoren. Eine eindeutige Wirksamkeit auf die Senkung der Viruslast unter den neuen HIV-Replikationsinhibitoren zeigte Nandrolon, ein Protease-Inhibitor, bei HIV-1/O und minimal besser bei HIV-1/M. Bei den REV-Inhibitoren ließ sich fast bei allen Konzentrationen Toxizität nachweisen und somit auch keine eindeutig belegbare Wirkung auf die Senkung der RT-Aktivität. Von den bekannten Nukleosidischen und Nicht-Nukleosidischen RT-Inhibitoren wirkten AZT (Azidothymidin), DDI (Dideoxyinosin) und NVP (Nevirapin) eher im frühen Anteil des HIV-Replikationszyklus. Obwohl der Versuchsaufbau bei chronisch infizierten Zellen den fortgeschrittenen Teil des Replikationszyklus darstellte, zeigte sich bei DDC eine statistisch eindeutige Viruslastsenkung und eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Bei den anderen bekannten RT-Inhibitoren zeigte sich wie erwartet keine Wirkung auf die Viruslast bei chronisch infizierten HUT-78 Zellen. Bei frisch infizierten Zellen, die den frühen Anteil des HIV-Replikationszyklus darstellen, zeigten alle in diesem Ansatz untersuchten RT-Inhibitoren (AZT, DDI und NVP) eine Wirkung. Den langsamsten Viruslastanstieg und somit die beste Wirksamkeit zeigte AZT im Gegensatz zu DDI und NVP. Zusammenfassend konnte die Wirksamkeit eines neuen Protease-Inhibitors (Nandrolon) sowohl bei HIV-1/M als auch bei HIV-1/O und ein unerwarteter Wirkungszeitpunkt von DDC bei chronisch infizierten Zellen gezeigt werden. Problematisch stellte sich die Toxizität der Rev-Inhibitoren bei höheren Konzentrationen dar. Allerdings könnten feinere Abstufungen der Konzentrationen einer besseren und exakteren Eingrenzung der Toxizität dienen. Weitere Untersuchungen für Nandrolon oder die entsprechenden, neuen Inhibitorenklassen konnten infolge einer Neuausrichtung des Forschungsschwerpunktes der Firma NASCACELL im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden. Auch in Zukunft ist die Erforschung neuer Substanzen und Substanzklassen wichtig, da mit Resistenzen der HI-Viren nach absehbarer Zeit und somit konsekutivem Therapieversagen gerechnet werden muss.
Organophosphorchalkogenide
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Die vorliegende Dissertation stellt die Ergebnisse der Untersuchungen auf zwei Themengebieten vor: Synthese und Struktur neuer Organophosphor-Chalkogen-Verbindungen ausgehend von speziellen Dichlorphosphanen RPCl2 durch Kondensation mit Natriumchalkogeniden Na2Chx (x = 1,2; Ch = S, Se, Te) einerseits sowie erstmalige Untersuchungen zur Synthese und Struktur kationischer Phosphor-Chalkogen-Polycyclen andererseits. Als Edukte wurden Dichlorphosphane mit besonderen sterischen, elektronischen oder mobilen Eigenschaften der organischen Substituenten verwendet. Es gelang für neun solche Dichlorphosphane mit zum Teil sehr unterschiedlichen Eigenschaften Synthesen zu optimieren oder neu zu entwickeln. Erstmals wurden Aroxy- und Alkoxydichlorphosphane sowie das Trifluormethyldichlorphosphan strukturell durch Röntgenbeugung an Einkristallen untersucht. Mit den neun Dichlorphosphanen wurden systematische Untersuchungen der Kondensationsreaktionen mit Natriumchalkogeniden, insbesondere mit Natriumseleniden und -telluriden, durchgeführt. Dabei wurde eine ganze Reihe neuer Verbindungen in den quasibinären Systemen RP/Se und RP/Te identifiziert und charakterisiert. Es konnten die ersten Kristallstrukturen von Triselenatriphosphinanen (RP)3Se3, die erste Struktur eines Telluratriphosphetans (AdP)3Te und die erste Kristallstruktur eines durch eine Se4-Brücke verbundenen Selenodiphosphatdiesters erhalten werden. Eine Vielzahl weiterer neuer Verbindungen wurde NMR-spektroskopisch identifiziert und charakterisiert, darunter viele neue P/Te-Heterocyclen wie z.B. Ditelluradiphosphetane, Tritelluratriphosphinane und Ditelluratriphospholane. Bei den Selenophosphonatanionen konnten von vielen Substanzklassen neue Vertreter erstmals strukturell untersucht werden. So wurden mehrere Strukturen der Natriumsalze von Triselenophosphonatanionen und Selenodiphosphonatanionen mit einer Diselenidbrücke untersucht. Es werden das erste strukturell untersuchte Triphosphonat und Triselenoxodiphosphonat ebenso vorgestellt wie drei neue Natriumsalze von Diselenophosphatestern. Das zweite Forschungsgebiet bestand aus systematischen Untersuchungen der Synthese und Struktur von Organophosphor- Chalkogen-Kationen. Untersucht wurde die direkte Alkylierung der Phosphorchalkogenide P4S3 und P4Se3 mit Alkyl- oder Arylhalogeniden, welche zu neue Kationen RP4Chx + (x = 3, 4, 5) führten. Diese Kationen wurden durch Heterokern-NMR-Spektroskopie identifiziert und ihre Struktur in Lösung aufgeklärt. Von dem zu α-P4S5 isolobalen Kation AdP4S4+ konnte ein Röntgenbeugungsexperiment an Einkristallen des Tetrachloroaluminatsalzes durchgeführt werden. Ebenso wurde das erste P/Se/C-Kation P3Se3CH2+ röntgenographisch und NMR-spektroskopisch untersucht. Der Höhepunkt der Arbeit ist die Synthese, Strukturbestimmung durch Röntgenbeugung an Einkristallen und die vollständige 31P- und 77Se-NMR-spektroskopische Charakterisierung des ersten binären Phosphor-Chalkogen-Kations [P3Se4+][AlCl4−] überhaupt, welches Nortricyclenstruktur besitzt.
Effektivität des PROSIT-Interventionsprogramms in Bezug auf die Blutglukoseeinstellung bei Typ 2-diabetischen Patienten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Das 1993 initiierte PROSIT®-Projekt ist das erste Disease-Management-Programm für Diabetes in Deutschland. Es hat sich eine gute Versorgung der Patienten mit Diabetes mellitus und die Aufnahme des Screenings auf Mikroalbumin im Urin in die Regelversorgung von diabetischen Patienten zum Ziel gesetzt. Des weiteren setzt sich PROSIT® für den Aufbau dauerhafter Behandlungsstrukturen für die Patientenversorgung ein, um so zur Verringerung diabetesbedingter Folgeerkrankungen beizutragen. Ziel der vorliegenden longitudinalen Analyse war, die Effekte des PROSIT®-Projekts auf die Blutglukoseeinstellung bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 zu untersuchen und die Effektivität eines solchen Disease-Management-Programms in der Diabetesversorgung zu belegen. Dazu wurden Daten aus der PROSIT®-Datenbank des Zeitraums 01/1997 bis 09/2001 herangezogen und 2 Patientenkohorten gebildet, die sich durch Einschlusszeitpunkt (Kohorte 1: 01/97-12/98, Kohorte 2: 01/99-09/01) und Beobachtungsdauer unterscheiden. Im analysierten Beobachtungszeitraum ist ein hochsignifikanter Rückgang des HbA1c-Mittelwerts von 7,6 % bzw. 7,5 % auf 7,1 % in den beiden untersuchten Kohorten zu verzeichnen. Der Anteil der Patienten im HbA1c-Zielbereich (≤ 65 Jahre: HbA1c ≤ 6%, > 65 Jahre: HbA1c ≤ 7%) steigt von 32,3 % bzw. 28,2 % auf 34,1 % bzw. 36,5 % und gleichzeitig sinkt der Anteil der Patienten im HbA1c-Risikobereich (HbA1c > 8,5%) von 28,1 % bzw. 17,7 % auf 12,9 % bzw. 8,8 %. Bei der Analyse der Diabetestherapie zeigt sich in beiden Kohorten eine kontinuierliche Zunahme der Insulintherapie mit ansteigender Häufigkeit der intensivierten Insulintherapie. Zur Therapie mit oralen Antidiabetika werden vermehrt neuere Substanzklassen wie Meglitinide und Insulinsensitizer eingesetzt, denen in neueren Studien gute Wirksamkeit bei niedriger Nebenwirkungsrate bescheinigt wird. Die Gesamtheit der in dieser Arbeit durchgeführten Analysen zeigt, dass durch strukturierte und evaluierte Intervention, wie sie im PROSIT®-Projekt erfolgt, bei Patienten mit Diabetes eine deutliche Verbesserung der Blutglukoseeinstellung erreicht werden kann. Es ist jedoch anzumerken, dass in vielen Fällen noch unzureichend auf schlechte HbA1c-Werte reagiert wird und eine weitere Therapieintensivierung gemäß den ausgesprochenen Therapie-empfehlungen vorgenommen werden sollte. Daher sind in Zukunft weitere Anstrengungen nötig, um die Versorgung der Patienten mit Diabetes zu optimieren.
Nucleophile Reaktivität von Diazoverbindungen und stabilisierten Carbanionen
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Eine über einen Reaktivitätsbereich von 24 Zehnerpotenzen sich erstreckende Serie von Referenzelektrophilen (Benzhydrylkationen und Chinonmethiden) wurde genutzt, um die nucleophile Reaktivität unterschiedlicher Substanzklassen zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurde die Kinetik der Reaktionen von Benzhydrylkationen mit Diazoverbindungen photometrisch in Dichlormethan untersucht. In analoger Weise wurden die Reaktionen von Benzhydrylkationen mit hochstabilisierten Carbanionen in Wasser durchgeführt. Es handelte sich dabei um Carbanionen, die alle durch zwei Acyl-, Ester-, Cyano- oder durch eine Nitrogruppe stabilisiert waren. Die Nucleophilieparameter N und die Steigungsparameter s dieser Nucleophile wurden aus der Linearen-Freien-Energie Beziehung log k(20 °C) = s(E + N) abgeleitet und mit der Nucleophilie anderer n- und p-Systeme verglichen. Es stellte sich heraus, dass sich die nucleophilen Reaktivitäten von Diazoverbindungen über mehr als zehn logarithmische Einheiten erstrecken. Die wenig reaktiven Verbindungen besitzen eine ähnliche Nucleophilie wie Styrol während die nucleophilsten Diazoverbindungen Enaminen entsprechen. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist der elektrophile Angriff am Diazo-Kohlenstoff wobei Diazonium-Ionen entstehen die rasch Stickstoff abspalten. Während die Acyl- und Ester-substituierten Carbanionen in Wasser ungefähr drei Größenordnungen weniger reaktiv sind als in DMSO, besitzt das Anion von Malonsäuredinitril in beiden Lösungsmitteln ähnliche Reaktivität. Die Nitro-substituierten Carbanionen zeigen ein grundlegend anderes Verhalten. Es zeigte sich, dass die rein aliphatischen Nitro-substituierten Carbanionen in DMSO 8 bis 10 Einheiten reaktiver sind als in Wasser, wohingegen sich die Arylsubstituierten Verbindungen in den beiden Lösungsmitteln nur um 3 bis 6 Einheiten unterscheiden. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Carbanionen in Wasser wurde nur eine sehr mäßige Korrelation der Nucleophilieparameter N (Reaktivität) mit den pKa-Werten (Basizität) der jeweiligen korrespondierenden CH-Säuren gefunden.