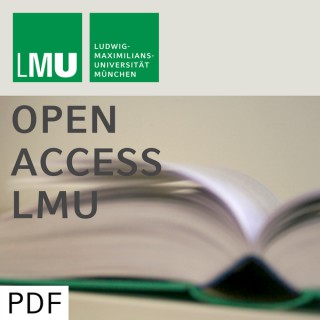Podcasts about repressor
- 11PODCASTS
- 12EPISODES
- 56mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jan 12, 2023LATEST
POPULARITY
Latest news about repressor
- A transcriptional repressor HVA regulates vascular bundle formation through auxin transport in Arabidopsis stem Wiley: New Phytologist: Table of Contents - Jul 17, 2024
- [ASAP] Discovery of Clinically Used Octenidine as <italic toggle="yes">NRAS</italic> Repressor That Effectively Inhibits <italic toggle="yes">NRAS</italic>-Mutant Melanoma Journal of Medicinal Chemistry: Latest Articles (ACS Publications) - Mar 24, 2023
- [ASAP] Conformational Change of Transcription Factors from Search to Specific Binding: A <italic toggle="yes">lac</italic> Repressor Case Study The Journal of Physical Chemistry B: Latest Articles (ACS Publications) - Nov 23, 2022
- Mutations in BCOR, a co-repressor of CRX/OTX2, are associated with early-onset retinal degeneration | Science Advances AAAS: Science Advances: Table of Contents - Sep 7, 2022
Latest podcast episodes about repressor
The psychosis risk factor RBM12 encodes a novel repressor of GPCR/cAMP signal transduction
Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2023.01.12.523776v1?rss=1 Authors: Semesta, K. M., Garces, A., Tsvetanova, N. G. Abstract: RBM12 is a high-penetrance risk factor for familial schizophrenia and psychosis, yet its precise cellular functions and the pathways to which it belongs are not known. We utilize two complementary models, HEK293 cells and human iPSC-derived neurons, and delineate RBM12 as a novel repressor of the G protein-coupled receptor/cyclic AMP/protein kinase A (GPCR/cAMP/PKA) signaling axis. We establish that loss of RBM12 leads to hyperactive cAMP production and increased PKA activity as well as altered neuronal transcriptional responses to GPCR stimulation. Notably, the cAMP and transcriptional signaling steps are subject to discrete RBM12-dependent regulation. We further demonstrate that the two RBM12 truncating variants linked to familial psychosis impact this interplay, as the mutants fail to rescue GPCR/cAMP signaling hyperactivity in cells depleted of RBM12. Lastly, we present a mechanism underlying the impaired signaling phenotypes. In agreement with its activity as an RNA-binding protein, loss of RBM12 leads to altered gene expression, including that of multiple effectors of established significance within the receptor pathway. Specifically, the abundance of adenylyl cyclases, phosphodiesterase isoforms, and PKA regulatory and catalytic subunits is impacted by RBM12 depletion. We note that these expression changes are fully consistent with the entire gamut of hyperactive signaling outputs. In summary, the current study identifies a previously unappreciated role for RBM12 in the context of the GPCR/cAMP pathway that could be explored further as a tentative molecular mechanism underlying the functions of this factor in neuronal physiology and pathophysiology. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info Podcast created by Paper Player, LLC
Membrane Biochemistry 85. EBV latent membrane protein induction of haemopoietic proliferative disease and Id repressor protein transcriptionally mediated terminal differentiation.DJGPhD.30.11.22.
References Stem Cell Reviews and Reports volume 17, pages 1486–1499 (2021) BMC Cancer. 2008 Dec 19;8:379 Curr Top Microbiol Immunol. 2015;391:119-49. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/dr-daniel-j-guerra/message
The transcriptional repressor Opi1 modulates the DNA Damage Response by downregulation of inositol pyrophosphates in Saccharomyces cerevisiae
Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2022.11.04.515212v1?rss=1 Authors: Panessa, G. M., Pires, M. R., Pires, R. R., Jekabson, R., Tsuchida, E. T., de Souza-Pinto, N. C., da Cunha, F. M., Cussiol, J. R. R. Abstract: Inositol is a six-carbon sugar that functions as a precursor for signaling molecules such as phosphoinositides and inositol polyphosphates, which are involved in the regulation of important biological processes such as energy metabolism, environmental stress response, phosphate signaling, among others. Given its role in a myriad of signaling pathways, regulation of inositol synthesis is essential for cellular homeostasis. In budding yeast, transcription of genes involved in inositol metabolism is regulated by the transcriptional repressor Opi1, which repress transcription of genes containing cis-acting inositol-sensitive upstream activation sequences (UASINO). Upon genotoxic stress, cells activate the DNA Damage Response (DDR) to coordinate DNA repair and cell cycle progression. It has been proposed that inositol containing molecules might act as modulators of the DDR, but evidences are still scarce. Herein, we report that opi1 cells fail to downregulate the inositol phosphate pathway leading to sensitivity to genotoxins and replication defects. Moreover, cells lacking Opi1 show decreased gamma-H2A levels which might indicate that Opi1 contributes to the activation of the DDR kinases Mec1/Tel1 (ATR/ATM in mammals). Importantly, we show that deletion of the inositol pyrophosphate kinase Kcs1 (IP6K1/2/3 in mammals), which leads to inhibition of inositol pyrophosphate synthesis, rescues the MMS sensitivity and replication defects of opi1 cells. Further, overexpression of Kcs1 recapitulates the MMS sensitivity of cells lacking Opi1. Therefore, we propose that cells must downregulate inositol pyrophosphate synthesis during replication stress in order to trigger an effective DNA Damage Response. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info Podcast created by Paper Player, LLC
Notícias - Johnny Coroa R.I.P. World of Metal Online Festival - novas confirmações: A Nameless Dread, Astralium, Autopsya, Dispyt, Dislepsia, Morbid Death e Rageful Extreme Sound Online Festival - 05 de Fevereiro - Invoke, Inhuman Architects, Sepulchral Voice, Corpse Grinder, Crashkill, Válvera, Svartland Horde, Malicious Culebra, Repressor, Carniça, Mostal Ways, Gutted Souls Novo vídeo dos Vëlla, Accept Cancelamento dos concertos de Vëlla e Gaerea Confirmações bombásticas para o Amplifest - Amenra, Oranssi Pazuzu, Wolves In The Throne Room entre outros Phil Spector R.I.P. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sugestões da semana Lex Thunder Votar nas presidenciais Fernando Ferreira "The Haunting of Bly Manor da Netflix Sugestões Playlist Heavy Metalcast Lex Thunder - Miss Lava - "Fourth Dimension" Fernando Ferreira - Paradise Lost - "Embers Fire" Sugestão para Playlist Heavy Metalcast Zen Therion - "Siren Of The Woods" Produzido e apresentado por Lex Thunder e Fernando Ferreira Editado pelo Senhor Podcast
"Multiplex" rheostat positions cluster around allosterically critical regions of the lactose repressor protein
Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2020.11.17.386979v1?rss=1 Authors: Bantis, L. E., Parente, D. J., Fenton, A. W., Swint-Kruse, L. Abstract: Amino acid variation at "rheostat" positions provides opportunity to modulate various aspects of protein function - such as binding affinity or allosteric coupling - across a wide range. Previously a subclass of "multiplex" rheostat positions was identified at which substitutions simultaneously modulated more than one functional parameter. Using the Miller laboratory's dataset of ~4000 variants of lactose repressor protein (LacI), we compared the structural properties of multiplex rheostat positions with (i) "single" rheostat positions that modulate only one functional parameter, (ii) "toggle" positions that follow textbook substitution rules, and (iii) "neutral" positions that tolerate any substitution without changing function. The combined rheostat classes comprised >40% of LacI positions, more than either toggle or neutral positions. Single rheostat positions were broadly distributed over the structure. Multiplex rheostat positions structurally overlapped with positions involved in allosteric regulation. When their phenotypic outcomes were interpreted within a thermodynamic framework, functional changes at multiplex positions were uncorrelated. This suggests that substitutions lead to complex changes in the underlying molecular biophysics. Bivariable and multivariable analyses of evolutionary signals within multiple sequence alignments could not differentiate single and multiplex rheostat positions. Phylogenetic analyses - such as ConSurf - could distinguish rheostats from toggle and neutral positions. Multivariable analyses could also identify a subset of neutral positions with high probability. Taken together, these results suggest that detailed understanding of the underlying molecular biophysics, likely including protein dynamics, will be required to discriminate single and multiplex rheostat positions from each other and to predict substitution outcomes at these sites. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info
António Bernardo da Costa Cabral (1803-1889). Nascido numa família de lavradores. Acusado de enriquecer à custa da política, repressor da revolta da Maria da Fonte, reformador do Estado.
Untersuchungen zur Rolle der Rezeptortyrosinkinasen FLT3, DDR1 und DDR2 in der akuten myeloischen Leukämie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Die akute myeloische Leukämie (AML) ist aus genetischer Sicht eine sehr heterogene Erkrankung. Rezeptortyrosinkinasen (RTKs) wie FLT3 sind in der Leukämogenese von zentraler Bedeutung. Durch Mutationen aktivierte RTKs sind allerdings alleine nicht in der Lage eine AML zu induzieren. Die Kooperation mit anderen Mutationen ist hierfür notwendig. Zu den am häufigsten gemeinsam auftretenden Mutationen in der AML gehören NPM1- und FLT3-ITD- (internal tandem duplication) Mutationen. Klinische Daten zeigen, dass eine FLT3-ITD die gute Prognose von NPM1-mutierten (NPM1c+) Patienten in Abhängigkeit des FLT3-ITD-mRNA-Levels in negativer Weise beeinflusst. Dies lässt auf ein pathogenes Zusammenwirken beider Genmutationen in der AML schließen, welches im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde. Dazu wurde basierend auf der humanen AML-Zelllinie OCI-AML3 mittels stabiler, lentiviraler Transduktion das erste zelluläre Modellsystem etabliert, das die relevanten Genotypen (NPM1c+/FLT3-ITD; NPM1c+/FLT3-WT) sowie unterschiedliche Verhältnisse von FLT3-ITD zu FLT3-WT (ITD/WT) im NPM1-mutierten Hintergrund modelliert. Zunächst wurde die NPM1-Mutation sowie die Funktionalität des FLT3-WT- und FLT3-ITD-Rezeptors in den nativen und transgenen Zellen bestätigt. Mit Hilfe des Zellmodells konnte gezeigt werden, dass Zellen, die beide Mutationen tragen, in vitro wie auch in vivo einen Wachstumsvorteil besitzen. Dieser vergrößerte sich zudem mit zunehmendem ITD/WT-Verhältnis. Ab einem bestimmten ITD/WT-Verhältnis konnte dieser Wachstumsvorteil in vitro mit einem FLT3-Inhibitor über eine gewisse Dauer gehemmt werden. Diese Ergebnisse könnten auf ein Zusammenwirken der beiden Mutationen bei der Leukämogenese hinweisen und eine Ursache für die schlechteren Überlebenskurven von Patienten mit beiden Mutationen und zunehmender FLT3-ITD-Last darstellen. Der insgesamt jedoch nur schwach ausgeprägte Phänotyp des etablierten Zellmodells erfordert zum eindeutigen Nachweis der funktionellen Interaktion von NPM1- und FLT3-ITD Mutationen ein alternatives Modellsystem. In diesem Zellmodell zeigten Zellen, die den FLT3-WT-Rezeptor überexprimierten, ebenfalls einen schwachen Wachstumsvorteil gegenüber nativen Zellen mit endogener FLT3-WT-Expression. Neben aktivierenden FLT3-Mutationen wie einer ITD, führen auch hohe FLT3-WT-Expressionslevel zur konstitutiven Aktivierung der FLT3-Kinase und verschlechtern die Prognose der Patienten. Deshalb wurde in dieser Arbeit mit der Untersuchung der transkriptionellen Regulation von FLT3, als mögliche Ursache hoher FLT3-WT-Expressionslevel, begonnen. In silico wurden im proximalen FLT3-Promotor Bindestellen für die hämatopoetischen Transkriptionsfaktoren (TF) PAX5 und MYB identifiziert. Mit Hilfe des Dual-Luciferase® Reporter Assay Systems wurden PAX5 als schwacher Repressor und MYB als Aktivator des Flt3-Promotors bestätigt. Auch der Transkriptionsfaktor CEBPA verhielt sich auf gleiche Weise als Aktivator der Flt3-Promotoraktivität. Eine Punktmutation im CEBPA-Gen, die aus zwei AML-Fällen bekannt ist, führte zu einer erhöhten Flt3-Promotoraktivität. Die Identifizierung weiterer mutierter, FLT3-regulierender TF und ihre Korrelation mit der FLT3-Expression sollen zukünftig tiefere Einblicke in die transkriptionelle Regulierung von FLT3 als Ursache der FLT3-Überexpression in AML-Patienten gewähren. Für eine Reihe von in AML-Patienten gefundenen Mutationen ist deren Rolle in der Pathogenese der AML noch unbekannt. Dazu gehören Mutationen in den Rezeptortyrosinkinasen DDR1 und DDR2. In der vorliegenden Arbeit wurden DDR1- und DDR2-Mutationen stabil in Ba/F3 Zellen und transient in HEK-293T Zellen exprimiert, um ihr transformierendes Potential zu untersuchen und diese funktionell zu charakterisieren. Transgene, DDR1- und DDR2-exprimierende Ba/F3 Zellen zeigten keinen transformierenden Phänotyp. Weitere Untersuchungen zeigten eine konstitutive Phosphorylierung der extrazellulären DDR2-Mutanten (G222R, M291I) in HEK-293T Zellen und eine Adhäsion von Ba/F3 Zellen mit wildtypischem sowie mutiertem DDR1-Rezeptor in Anwesenheit des DDR-Liganden Kollagen. DDR1- und DDR2-Rezeptoren sind bisher vor allem in soliden Tumoren untersucht. Weitere funktionelle Analysen sind notwendig, um ihren Stellenwert bei der Entstehung von AML zu erfassen. Diese Arbeit zeigt, dass Rezeptortyrosinkinasen in der Leukämogenese auf unterschiedliche Weise eine wesentliche Rolle spielen können. Da Rezeptortyrosinkinasen zudem wichtige Zielmoleküle für therapeutische Ansätze darstellen, sind sie von besonderer Bedeutung.
Blind Spot Radio Show 229 | Mark Anxious & Dr Hoffmann
Dr Hoffmann: 01. Hector Oaks – Random Fear Generator (Original Mix) / Par Recordings 02. Mr Jones – BAR (Bas Mooy Mix 2) / The Public Stand 03. PVS – Arsenal (Original Mix) / M_Rec Ltd 04. Empty Room – Coin (Ricardo Garduno Remix) / Amazon Records 05. David Meiser – Distress (Original Mix) / Pareto Park 06. Herz Bass – IX12 (Hans Bouffmyhre Remix) / Deadcert 07. Vegim – Lecker (Original Mix) 08. Miss Sunshine – Ground Loop / Decoy Records 09. NX1 – EOD1 / NX1 10. Gabeen – Untitled 11. Uron - Solar Wind (Original Mix) / Refluxed Records 12. Gabeen & Dr Hoffmann – Crunchy Bones (Michael Schwarz Remix) / Crunch Control 13. R. Cooper – CR.0X (Original Mix) / TMM Records 14. Peat Noise – Cyanogen (Hiab Remix) / Switch Off Records 15. The 4matter – Turgescent (Sutter Cane Remix) / Armatura Records Mark Anxious: DJ Set Performed and Mixed LIVE on the Allen & Heath Xone DB4. 01. Mark Anxious 'Intro' 02. Drumcell 'Disturbance' (Tommy Four Seven Remix) 03. Measure Divide 'Aux' 04. Exor Goticz 'Stiletto' (Original Mix) 05. Reeko 'Passage' 06. Reeko 'Passage 2' 07. Exium 'Wolf Rayet' 08. Drumcell 'Disturbance' (Pfirter Remix) 09. Brian Burger 'Warhammer' (The Horrorist Remix) 10. Excluded 'Absurdity' (Original Mix) 11. Michael Schwarz 'Numb' (Cortechs Remix) 12. Repressor 'On The Floor' (Bjoern Torwellen Remix) 13. Modal Bank Fixon Dig-It 'Resolution' (Modal Bank Fiction Dig-It Remix) 14. Krämer and Niereich feat Marc Arcadipane 'We Have Arrived 2013' (Section 1 Mix) 15. Mark Anxious 'Outro' This show is syndicated & distributed exclusively by Syndicast. If you are a radio station interested in airing the show or would like to distribute your podcast / radio show please register here: https://syndicast.co.uk/distribution/registration
Quantitative comparison of DNA detection by GFP-lac repressor tagging, fluorescence in situ hybridization and immunostaining
Background: GFP-fusion proteins and immunostaining are methods broadly applied to investigate the three-dimensional organization of cells and cell nuclei, the latter often studied in addition by fluorescence in situ hybridization (FISH). Direct comparisons of these detection methods are scarce, however. Results: We provide a quantitative comparison of all three approaches. We make use of a cell line that contains a transgene array of lac operator repeats which are detected by GFP-lac repressor fusion proteins. Thus we can detect the same structure in individual cells by GFP fluorescence, by antibodies against GFP and by FISH with a probe against the transgene array. Anti-GFP antibody detection was repeated after FISH. Our results show that while all four signals obtained from a transgene array generally showed qualitative and quantitative similarity, they also differed in details. Conclusion: Each of the tested methods revealed particular strengths and weaknesses, which should be considered when interpreting respective experimental results. Despite the required denaturation step, FISH signals in structurally preserved cells show a surprising similarity to signals generated before denaturation.
Die genomische Organisation und transkriptionelle Regulation des Transkriptionskorepressors Nab2
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Nab2 ist in Melanomen und Melanomzelllinien im Vergleich zu Melanozyten und benignen Nävi stark überexprimiert. Durch Stimulation mit Wachstumsfaktoren oder Phorbolester kann Nab2 außerdem in allen Geweben und Zelllinien transient induziert werden. Die Expressionskinetik folgt dabei der eines delayed early response-Gens. Das Nab2-Protein ist ein transkriptioneller Korepressor der für die Wachstums- und Differenzierungsregulation wichtigen Zinkfinger-Transkriptionsfaktoren Egr1, Egr2 und Egr3. Das sind immediate early response-Gene, die durch die selben Stimuli induziert werden wie Nab2. Nach Stimulation wird die Expression von Egr deswegen grundsätzlich von einem Anstieg der Nab2-Expression gefolgt. Nab2 ist deswegen wahrscheinlich der wichtigste Repressor der Egr-Aktivität und verhindert eine übermäßige Stimulation von Egr-Zielgenen. Ziel dieser Arbeit war es, die regulatorischen DNS-Abschnitte des Nab2-Gens zu isolieren und genau zu charakterisieren. Am Nab2-Promotor sollten dann die Ursachen für die Überexpression im Melanom untersucht und der Mechanismus der Nab2-Induktion nach Stimulation identifiziert werden. Dazu wurde die genomische Nab2-DNS in einer humanen DNS-Bibliothek durch DNS-Hybridisierung identifiziert und daraus isoliert. So konnte ein 7.391 bp langes DNS-Fragment kloniert werden, das 1.845 bp der 5´-untranslatierten Region sowie die gesamte, aus 7 Exons aufgebaute proteinkodierende Nab2-Sequenz enthält. Durch in silico Analysen der 5´-untranslatierten Region konnten eine putative Promotorregion von Position -705 bis -82 (+1 = Adenin des Startkodons), eine CpG Insel von Position -876 bis +82 aber keine klassischen Kernpromotorelemente wie eine TATA-Box oder ein Inr-Element identifiziert werden. Der Nab2-Promotor gehört deshalb zur Klasse der TATA- und Inr-losen CpG-Insel-Promotoren. Durch eine Kombination aus EST- und cDNS-Kartierungen sowie Primerextensionsversuchen konnte ein sehr großes Transkriptionsstartareal identifiziert werden, das sich von Position -366 bis -96 erstreckt. Um funktionelle Studien mit der 5´-untranslatierten Nab2-Region durchzuführen wurden 17 verschiedene 5´-verkürzte Abschnitte daraus in Luziferase-Reportervektoren kloniert und deren transkriptionelle Aktivität in verschiedenen Zelllinien untersucht. Für das Erreichen der maximalen Promotoraktivität (ca. dem 400fachen der Aktivität des Leervektors) war der Sequenzabschnitt stromabwärts von Position -679 ausreichend. Ab Position -58 war dann keine Promotoraktivität mehr detektierbar. Der Nab2-Promotor erstreckt sich also von Position -679 bis -58. Der Kernpromotor konnte aufgrund der Lokalisation der Transkriptionsstartpunkte (-366 bis -96) und des 3´-Endes des Promotors (-58) zwischen Position -366 und -58 eingegrenzt werden. Die sehr hohe Aktivität des gesamten Nab2-Promotors wird durch die aktivierende Region von Position -679 bis -263 hervorgerufen. Durch diesen DNS-Abschnitt steigt die Aktivität vom 15- bis 30fachen auf das ca. 400fache der Aktivität des Leervektors. In dieser positiven regulatorischen Region konnten 10 putative Sp1-Bindestellen identifiziert werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Aktivitätszuwachs beitragen. Um die Ursache der Überexpression von Nab2 in Melanomzelllinien zu Untersuchen, wurde die Aktivität der Nab2-Reporterkonstrukte in Melanomzelllinien, die Nab2 überexprimieren, und in Karzinomzelllinien, die nur wenig Nab2 exprimieren, verglichen. Die Reporterkonstukte zeigten jedoch in Melanom- und Karzinomzelllinien ungefähr die gleiche Aktivität. Die Ursache für die Überexpression in Melanomzelllininen konnte durch diese Versuche nicht identifiziert werden. Schließlich wurde die Aktivität der Reporterkonstrukte in unstimulierten und PMA stimulierten Zellen verglichen. Durch die PMA-Stimulation stieg die Aktivität des Nab2-Promotors auf das ca. 3fache der Basalaktivität an. Die gesteigerte Nab2-Expression nach Stimulation wird demnach auf der Transkriptionsebene reguliert. Anhand der Verkürzungskonstrukte konnte ein 19 bp langer DNS-Abschnitt zwischen Position -232 und -213 identifiziert werden, der diesen Anstieg der Promotoraktivität nach Stimulation hervorruft. In diesem Abschnitt liegen je eine Egr1- und Sp1-Bindestelle, die sich teilweise überlappen. Bei Kotransfektion eines Egr1-Expressionsvektors mit den Nab2-Reporterkonstrukten konnte ein Aktivitätsanstieg vergleichbarer Größenordnung wie durch PMA-Stimulation beobachtet werden. Wurde die Egr1-Bindestelle an Position -222 durch Mutation inaktiviert, so nahm die Induzierbarkeit des Nab2-Promotors durch PMA um 35-50% und durch Egr1-Kotransfektion um 64-73% ab. Diese Daten zeigen, dass Egr1 alleine in der Lage ist, den Nab2-Promotor maximal zu aktivieren und dass dieser Effekt vorwiegend über die Egr1-Bindestelle an Position -222 vermittelt wird. Weil der Promotor aber nach der Inaktivierung der Egr1-Bindestelle an Position -222 noch durch PMA und durch Egr1-Kotransfektion aktivierbar ist, sind weitere Egr1-Bindestellen und womöglich noch andere Transkriptionsfaktoren an der Aktivierung beteiligt. Diese Daten zeigen, dass der Transkriptionsfaktor Egr1 seinen eigenen Korepressor Nab2 induziert. Funktionell liegt also ein negativer Rückkoppelungs-Mechanismus vor, der eine überschießende Egr1-Aktivität verhindert.
Identifizierung und Charakterisierung neuer Interaktoren des von Hippel-Lindau Tumorsuppressors
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Die Inaktivierung des von Hippel-Lindau (VHL) Tumorsuppressors spielt eine Rolle in der Entstehung von verschiedenen gut- und bösartigen Tumoren mit hoher Gewebespezifität. Als substraterkennende Untereinheit des CBCVHL Ubiquitin Ligase Komplexes steuert VHL den sauerstoffabhängigen Abbau des Transkriptionsfaktors HIF1/2α. HIF1/2α aktiviert die Transkription einer Vielzahl von Faktoren, die für den Energiehaushalt der Zelle und die Blutgefäßneubildung von entscheidender Bedeutung sind. Die Akkumulation von HIF1/2α führt zu deren konstitutiver Expression und fördert somit das Wachstum von Tumoren durch eine verbesserte Nährstoffversorgung. Der sauerstoffabhängige Mechanismus der HIF-Erkennung wird durch die Aktivität einer neuen Familie von Prolylhydroxylasen reguliert, die möglicherweise ihrerseits eine Reihe von zellulären Substraten haben. Trotz der guten Korrelation zwischen bestimmten, den HIF-Abbau beeinflussenden VHL-Mutationen und dem Auftreten von verschiedenen Krankheitssubtypen sind noch nicht alle Phänotypen im Zusammenhang mit VHL erklärbar. Vor allem die Identifizierung neuer Substrate für den CBCVHL Komplex ist für ein umfassendes Verständnis der VHL-Krankheit von Interesse. In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Methoden zur Identifizierung neuer Substrate von VHL angewendet. Durch Affinitätschromatographie mit einem rekombinanten Komplex aus VHL, Elongin B und Elongin C (VCB) konnte Daxx als neuer Interaktor von VHL identifiziert werden. Daxx bindet Elongin B/C-unabhängig an VHL, und seine Stabilität wird nicht durch VHL reguliert. Zudem bildet Daxx einen Komplex mit dem VHL-Substrat HIF1α. Dies weist auf eine mögliche Funktion von VHL neben seiner Rolle als Ubiquitin Ligase hin, z.B. in der Regulation von Daxx als transkriptionellem Repressor. In einem funktionalisierten „TwoHybrid“-Screen konnte der Mechanismus der HIF-Regulation in S. cerevisiae rekonstituiert werden. Dies ermöglichte die Identifizierung weiterer potentieller VHL-Substrate, unter anderem Diacylglycerol Kinase iota (DGKι). DGKι weist zwei Erkennungsmotive für Prolylhydroxylasen auf und wird in Gehirn und Retina exprimiert. In diesem Organen kommt es bei VHL-Patienten zur Entstehung von Hämangioblastomen. DGKι wird in vivo ubiquityliert und bindet sowohl an VHL, als auch an zwei der drei bekannten Prolylhydroxylasen. Mit Mutanten von DGKι konnte allerdings gezeigt werden, dass Bindung und Ubiquitylierung nicht über den gleichen Mechanismus erfolgen wie bei HIF1α. Möglicherweise spielen Ubiquitylierung und VHL-Bindung getrennte Rollen in unterschiedlichen zellulären Prozessen. Es wird zunehmend deutlicher, dass VHL nicht nur eine Komponente des CBCVHL Komplexes bildet, sondern weitere Funktionen in der Zelle erfüllt. VHL spielt eine Rolle in der Assemblierung der Fibronektinmatrix, der Regulation von Mikrotubulistabilität und –dynamik und der Transkriptionskontrolle. Eine weitere Charakterisierung des nicht-degradativen Einflusses von VHL auf die in dieser Arbeit beschriebenen Bindungspartner ist nötig, um die zelluläre Wirkungsweise von VHL vollständig zu verstehen.
Untersuchungen zur Rolle des HIV-1-Tat-Proteins in der AIDS-assoziierten Vaskulopathie
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Bei Patienten, die mit dem humanen Immundefizienzvirus-1 (HIV-1) infiziert sind, kommt es häufig zu krankhaften Veränderungen des Endothels, die zu einer Fehlfunktion des Gefäßsystems führen. Klinischer Ausdruck dieser als acquired immune deficiency syndrome (AIDS)-assoziierten Vaskulopathie bezeichneten Veränderungen sind Schädigungen des Aortenendothels, die mit einer erhöhten Adhäsion mononukleärer Zellen an das Endothel einhergehen, Defekte der Blut-Hirn-Schranke, die zur Entstehung von Demenz beitragen, sowie das Kaposi-Sarkom (KS), das durch eine sehr starke Extravasation von T-Zellen und Monozyten gekennzeichnet ist. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass das regulatorische HIV-1-Tat-Protein und das inflammatorische Zytokin TNF-a synergistisch die Adhäsion der promonozytären Zelllinie U937 und von PBMZ an humane mikrovaskuläre Endothelzellen (HMVEZ) erhöht. Die adhäsionsfördernde Wirkung wurde selektiv bei HIV-1-Tat beobachtet, andere virale Proteine des HIV-1, wie Negativfaktor (Nef) und das Glykoprotein gp41, hatten keinen Einfluss auf die Adhäsion. Anhand zellspezifischer Marker wurde gezeigt, dass HIV-1-Tat in periphere mononukleäre Blutzellen (PBMZ) spezifisch die Adhäsion von Monozyten und T-Zellen erhöhte, jedoch nicht von B-Zellen. Intravital-mikroskopische Untersuchungen an der Maus bestätigten in vivo, dass HIV-1-Tat und TNF-a synergistisch die Adhäsion von Leukozyten an das Endothel erhöhten. HIV-1-Tat reguliert die Expression einer großen Anzahl zellulärer Gene. Diese Fehlregulation durch HIV-1-Tat könnte an der Enstehung der AIDS-assoziierten Vaskulopathie beteiligt sein. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird die parakrine Wirkung von HIV-1-Tat auf die Genexpression in Monozyten mittels der suppressed subtractive hybridization (SSH)-Methode untersucht. Hierbei wurde O-linked N-Acetylglucosamine-transferase (OGT) als Gen identifiziert, dessen Expression durch HIV-1-Tat unterdrückt wird. Bisher ist bekannt, dass OGT ein Repressor der basalen Transkription und der SP-1-regulierten Transkription ist. Die Expression von OGT wurde sowohl auf mRNA-Ebene als auch auf Protein-Ebene durch HIV-1-Tat und VEGF121 gehemmt, wobei die Regulierung über den VEGF-Rezeptor Flt-1 vermittelt wurde. Weitere Faktoren wie inflammatorische Zytokine (TNF-a, IL-1b, IFN-g und IL-2), angiogene Wachstumsfaktoren (bFGF und VEGF165) und Chemokine (IL-8, MIP-1a, IP-10, MCP-1 und SDF-1a) hatten keine hemmende Wirkung auf die OGT-Expression. Die schnelle Abnahme von intrazellulärem OGT-Protein wurde weder durch lysosomale Proteasen noch durch Proteasen des Proteasoms verursacht. Expressionsstudien an PBMZ von fünf verschiedenen Probanden zeigten, dass bei zwei Probanden die OGT-Konzentration durch HIV-1-Tat zunahm, bei zweien nahm sie ab und bei einer Person gab es keine Veränderung. Diese Ergebnisse belegen, dass HIV-1-Tat entscheidend an der Entstehung der AIDS-assoziierten Vaskulopathie, insbesondere von KS, beteiligt sein könnte. Die Repression von OGT durch HIV-1-Tat könnte die weitreichende Wirkung des HIV-1-Tat-Proteins auf zelluläre und virale Gene erklären.