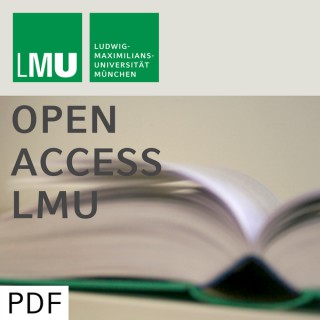Podcasts about die konzentrationen
- 7PODCASTS
- 8EPISODES
- AVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jul 18, 2015LATEST
POPULARITY
Best podcasts about die konzentrationen
Latest podcast episodes about die konzentrationen
Auswirkung präanalytischer Einflussgrößen auf die Konzentrationen ausgewählter Stoffwechselhormone - sowie Einfluss von Alter und Fastendauer auf spezifische Stoffwechselhormone bei der Ratte
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Die biochemische Analyse von Hormonen wird durch drei Variablen beeinflusst – die präanalytischen, analytischen und postanalytischen Variabilität. Bezüglich der analytischen und biologischen Variabilität wurden für Nager schon zahlreiche Arbeiten veröffentlicht, jedoch ist die Präanalytik in der Untersuchung von Blutproben von Ratten, in Bezug auf die Hormonanalytik, bislang kaum beachtet worden. Deswegen wurden in dieser Arbeit einige Aspekte der Präanalytik bei der Hormonmessung in Ratten genauer untersucht; auch um Anhaltspunkte zu geben, in wie weit vorbehandelte Blutproben von Ratten zur Messung unterschiedlicher Hormone genutzt werden können und wie sich die Verwendung unterschiedlicher Probenmaterialien, als auch Einfrier-Auftau-Zyklen, auf die Messergebnisse verschiedener Stoffwechselhormone auswirken können. In Bezug auf die biologische Variabilität wurde der Einfluss von Alter und Fasten auf ausgewählte Stoffwechselhormone bei der Ratte genauer untersucht. Ziel dieser Arbeit war es, in Analyseprozessen insbesondere auf den Faktor „Präanalytik“ einzugehen und aufzuzeigen, in welchem Ausmaß Ergebnisse in der Messung von Hormonen mittels Immunassays beeinflusst werden können. Im Vergleich zu reinem Serum waren die gemessenen Konzentrationen von IGF-I (+9,2%, p
Stressbestimmung bei Katzen mit Flohbefall
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Nach einer zwölftägigen Adaption an die Einzelhaltung wurden sechs der 12 Katzen der Versuchsgruppe an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 100 Flöhe aufgesetzt. Es wurden Blutproben entnommen und ein rotes und ein weißes Blutbild, sowie der Hämatokrit und der Hämoglobingehalt bestimmt. Die Konzentrationen von Cortisol, Cortison und Corticosteron im Blut wurden durch HPLC bestimmt. Kot der Katzen wurde täglich gesammelt und die Konzentration von 11-Oxoätiocholanolon mittels kompetitivem EIA gemessen. Ebenso wurden die Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceae-, die Clostridien-, die Anaerobier- und die Aerobierzahl im Kot bestimmt. Das Verhalten wurde auf Videobänder aufgezeichnet. Es wurden je eine 2-stündige Ruhe- und Aktivitätsphase analysiert.
Einfluss einer Isoflurananästhesie im Vergleich zu einer Kombinationsanästhesie mit Xylazin, Ketamin und Isofluran auf die Konzentrationen ausgewählter Immunparameter im Blut von Kälbern mit und ohne chirurgischen Eingriff
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/07
Aus zahlreichen humanmedizinischen Studien ist bekannt, dass eine Anästhesie und ein chirurgischer Eingriff zur Beeinträchtigung des Immunsystems mit Komplikationen wie Wundheilungsstörungen, schweren Allgemeininfektionen oder gar zum Tod des Patienten führen können. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde untersucht, inwiefern zwei unterschiedliche Anästhesieverfahren einerseits alleine durch eine direkte Anästhetikaeinwirkung (Gruppen ohne chirurgischen Eingriff) und andererseits in Kombination mit einem chirurgischen Eingriff (Gruppen mit einer Nabelexstirpation) ausgewählte Immunzellkonzentrationen bei Kälbern beeinflussen. Verglichen wurde eine reine Inhalationsanästhesie mit Isofluran (INH) mit einer kombinierten Anästhesie mit einer Xylazin-Ketamin-Einleitung und Aufrechterhaltung mit Isofluran (KOM). Insgesamt wurden 24 Anästhesien durchgeführt, jeweils sechs in den Gruppen mit (INHc, KOMc) und ohne chirurgischen Eingriff (INHo, KOMo). Die Zuordnung zu einer Anästhesieform wurde per Losverfahren entschieden. Die Anästhesien wurden an insgesamt 20 Kälbern der Rasse Deutsches Fleckvieh durchgeführt. Es handelte sich um 16 männliche und 4 weibliche Tiere, mit einem durchschnittlichen Gewicht von 81,0 ± 19,6 kg. Im Schnitt waren die Kälber 51,9 ± 22,8 Tage alt. 24 Stunden vor der OP/Anästhesie erhielten alle Kälber Meloxicam (0,5 mg/kg KGW s.c.) und zusätzlich ab diesem Zeitpunkt für fünf Tage das Antiinfektivum Cefquinomsulfat (1 mg/kg KGW s.c.) verabreicht. Einen Tag vor der Anästhesie, am Morgen vor der Anästhesie (OP-Tag), sowie ein, drei und acht Tage postoperativ wurde den Kälbern eine Blutprobe entnommen, daraus die Gesamtleukozytenzahl (WBC), der Absolutwert und die Prozentwerte der Granulozyten bestimmt und die Leukozyten isoliert. Die Lymphozytensubpopulationen CD4+ und CD8+ T-Zellen sowie die Monozyten wurden mit fluoreszenzmarkierten Antikörpern markiert und im Durchflusszytometer gemessen. Bei den Leukozytenkonzentrationen war ein Anstieg der Konzentrationen bei INHc auffällig, wohingegen es bei INHo zum Absinken der Konzentrationen kam. Diese Unterschiede waren bereits am Morgen des OP-Tages vor der Anästhesie und dann am dritten postoperativen Tag statistisch signifkant. In den beiden chirurgisch versorgten Gruppen lagen die Leukozytenkonzentrationen acht Tage postoperativ über den Ausgangswerten, wohingegen sie bei den Kontrollgruppen unterhalb der Ausgangskonzentrationen blieben, jedoch ohne statistisch signifikante Unterschiede. INHo wies auch bei den Lymphozyten geringere Konzentrationen als in den anderen drei Gruppen auf. Es kam aber bei der Untersuchung der Lymphozytenkonzentrationen zwischen den Gruppen zu keinen statistisch signifikanten Unterschieden. Der Vergleich der CD4+ T-Zellkonzentrationen lieferte sowohl beim Vergleich INHc und KOMc als auch bei Untersuchung von INHo und KOMo einen Tag postoperativ statistisch signifikante Unterschiede mit deutlich geringeren Werten bei Einsatz einer reinen Inhalationsanästhesie. Bei den beiden OP-Gruppen war dieser signifikante Unterschied auch am achten postoperativen Tag feststellbar und zeigte sich auch bei den CD8+ T-Zellkonzentrationen. Zwischen den beiden Kontrollgruppen bestand bereits am Morgen des OP-Tages vor der Anästhesie ein statistisch signifikanter Unterschied bei den CD4+ T-Zellen. Ein ähnliches Bild zeigte sich im Vergleich der beiden OP-Gruppen bei den CD8+ T-Zellen. Bei den CD8+ T-Zellen kam es auch am achten postoperativen Tag bei INHc und KOMc zu einem statistisch signifikanten Unterschied. Auch der Vergleich des Verlaufs der CD4+ T-Zellkonzentrationen über alle Probenzeitpunkte hinweg erbrachte einen signifikanten Unterschied zwischen Inhalationsanästhesie und kombinierter Anästhesie mit deutlich höheren Konzentrationen nach einer kombinierten Anästhesie. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die beiden Gruppen mit einer Isoflurananästhesie bereits am ersten Probentag vor jeglicher Manipulation geringere Werte aufwiesen als die Gruppen mit einer kombinierten Anästhesie. Die Monozyten zeigten Anstiege der Konzentrationen bei INHc und KOMc sowie bei KOMo. Bei INHo hingegen kam es zum stetigen Absinken der Konzentrationen. Hier ergab sich an allen postoperativen Probentagen ein signifikanter Unterschied zu KOMo und am dritten postoperativen Tag auch im Vergleich zur INHc-Gruppe. Bei den neutrophilen Granulozyten kam es ab dem OP-/Narkose-Tag in der INHc-Gruppe zum Anstieg der Konzentrationen. In den anderen drei Gruppen hingegen verhielten sie sich genau umgekehrt und sanken ab. Daraus ergaben sich innerhalb der Inhalationsgruppe am OP-Tag, sowie am ersten und dritten postoperativen Tag und beim Vergleich der chirurgisch versorgten Gruppen am dritten postoperativen Tag statistisch signifikante Unterschiede. Hinsichtlich des Einflusses der Anästhetika auf die Immunzellen (Leukozyten, Lymphozyten, CD4+ T-Zellen, CD8+ T-Zellen, Monozyten) nehmen wir an, dass unsere Ergebnisse dafür sprechen, dass Isofluran alleine einen direkten hemmenden Effekt auf die Immunzellen besitzt, wohingegen es unter einem chirurgischen Eingriff zu einer Aktivierung der Immunabwehr und Aufhebung der negativen Isofluranwirkung kommt. Ketamin scheint einen, mitunter erst verspätet eintretenden, indirekt aktivierenden Effekt auf die Immunzellen zu haben, indem es zu einem Kortisolanstieg führt, der wiederum, nach anfänglicher Suppression, ca. 24 Stunden später eine Immunsystemaktivierung nach sich zieht. Lediglich auf die Neutrophilenchemotaxis wird Ketamin eine negative Wirkung zugeschrieben und erklärt möglicherweise das Absinken der Granulozytenkonzentrationen bei KOMc und KOMo. Aufgrund des Ergebnisses, dass nur wenige signifikante Unterschiede in den OP-Gruppen INHc und KOMc gefunden wurden, sowie der Tatsache, dass wir keine postoperativen Komplikationen in Form von Wundheilungsstörungen beobachteten, gehen wir davon aus, dass die beiden getesteten Anästhesieverfahren das Immunsystem von Kälbern bei einer Nabelbruchoperation nicht in klinisch relevanter Weise nachteilig beeinflussen.
Beziehungen zwischen peripartal gemessenen Fettsäurekonzentrationen im Blut und postpartalen Gebärmuttererkrankungen bei Milchkühen
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/07
Ziel der vorliegenden Studie war die quantitative und qualitative Bestimmung der Gesamtfettsäuren in bovinen Serumproben sowie die Darstellung der Konzentrationsverläufe der einzelnen Fettsäuren während des peripartalen Zeitraums. Des Weiteren sollte festgestellt werden, ob zwischen Kühen, die postpartal an einer Gebärmutterentzündung erkranken, und gesunden Tieren Unterschiede in den Konzentrationen einzelner Fettsäuren bzw. Fettsäuregruppen vorliegen. Die in dieser Studie verwendeten Serumproben stammen von 50 Kühen eines Milcherzeugerbetriebes in Brandenburg. Von den ausgewählten Tieren zeigten 25 Tiere während des Untersuchungszeitraums Symptome einer klinischen Gebärmutterentzündung (puerperale Metritis, klinische Metritis, klinische Endometritis oder Pyometra) und wurden demnach als uteruskrank eingestuft. Die anderen 25 Tiere wiesen keine gesundheitlichen Störungen auf und wurden als uterusgesund eingestuft. Von jedem Tier wurden während des Zeitraums 17 Tage vor bis 28 Tage nach der Kalbung sechs bzw. sieben Serumproben gewonnen. Für die quantitative und qualitative Analyse der Gesamtfettsäuren in den Serumproben wurden die Fettsäuren zu Fettsäuremethylestern (FAME) derivatisiert. Die Probenanalyse wurde mit einem Gaschromatographie/Massenspektrometrie-System (GC/MS-System) durchgeführt. Außerdem wurden die Konzentrationen der freien Fettsäuren (NEFA) in den Serumproben mittels Enzym-Test bestimmt. Sowohl vor wie auch nach der Kalbung konnten bei verschiedenen Fettsäuren Konzentrationsunterschiede zwischen uterusgesunden und uteruskranken Tieren festgestellt werden. Die Konzentrationen der gesättigten Fettsäuren Octadecansäure (C18:0) und Tetradecansäure (C14:0) zeigten in beiden Tiergruppen nach der Kalbung einen leichten Anstieg, wobei die Werte der gesunden Kühe ab dem elften Tag p.p. signifikant höher lagen als bei erkrankten Kühen (P
Raumluftklimatische Untersuchung im Kabinenexpress bei Reisetauben
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
Zur Beurteilung der raumluftklimatischen Verhältnisse in einem sog. Kabinenexpress für Reisetauben wurden von Juli bis September 2006 auf zehn Flügen die Parameter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Kohlenstoffdioxid kontinuierlich aufgezeichnet. Die Konzentrationen von Ammoniak, Staub, Gesamtkeimzahl und Zahl der coliformen Keime wurden sowohl im unbesetzten Fahrzeug als auch kurz vor Auflass der Tauben ermittelt. Ziel dieser Arbeit war es, anhand der beschriebenen Parameter eine Beurteilung der Tierschutzgerechtheit während der Verweildauer der Reisetauben im Kabinenexpress zu treffen.
Haben die Konzentrationen von Interleukin 6, Procalcitonin und CRP bei Intensivpatienten während des ersten Fieberanstieges eine prognostische Bedeutung?
Serum levels of interleukin 6 (IL-6), procalcitonin (PCT), and C-reactive protein (CRP) were measured in 38 critically ill patients immediately after an increase in body temperature above 38.3 degrees C. Ten healthy controls were also included for comparison. The onset of fever was accompanied by elevated circulating levels of all the 3 markers in comparison to healthy control subjects. However, only IL-6 levels were significantly higher (p
Nachweis von Candida-Spezies und Bestimmung der Zytokine Interleukin-1 beta, Interleukin-1ra, Interleukin-4, Interleukin-6, Interleukin-8, Interleukin-10 und Interleukin-12 im Vaginalsekret und im Serum bei Schwangeren in Relation zum Gestationsalter
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Fragestellung: Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Assoziation zwischen einer Kolonisierung der Vagina mit Candida spp. und den Konzentrationen von vaginalen Interleukinen IL-1 beta, IL-1ra, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 und IL-12 in Relation zur Schwangerschaftsperiode zu beschreiben. Studiendesign: Diese prospektive longitudinale Beobachtungsstudie wurde in der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des Universitätsklinikum Großhadern von März 2002 bis Oktober 2004 durchgeführt. Das Studienkollektiv bestand aus 134 Frauen mit Einlingsschwangerschaften. Alle Frauen wurden zwischen der 6. und 16. Schwangerschaftswoche (SSW) rekrutiert und zwischen der 24. und 28. sowie der 35. und 38. SSW nachuntersucht. Die entsprechenden Vaginalabstriche wurden mittels einer kulturellen Anzüchtung und PCR-Amplifizierung auf Candida spp. getestet. Mittels ELISA wurden im Vaginallavage und im Serum Zytokine IL-1 beta, IL-1ra, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 und IL-12 gemessen. Zusätzlich wurde das jeweilige IL-1ra:IL-1 beta Verhältnis berechnet. Darüber hinaus wurden anamnestische Daten und die Ergebnisse von mikrobiologischen Untersuchungen erhoben. In die Endauswertung wurden die Daten von 98 Frauen mit vollständigen Ergebnissen und ohne lost to follow up aufgenommen. Für die statistische Analyse wurden der t-Test für unverbundene Stichproben, der Mann-Whitney U Tests für unverbundene Stichproben und der Vorzeichen-Rangtests von Wilcoxon für verbundene Stichproben verwendet. Ergebnisse: Wir isolierten Candida spp. in 18 (18,3%) Fällen im 1. Trimester, in 25 (25,5%) Fällen im 2. Trimester und in 30 (30,6%) Fällen im 3. Trimester mittels einer kulturellen Anzüchtung bzw. in 25 (25,5%) Fällen im 1. Trimester, in 33 (33,7%) Fällen im 2. Trimester und in 41 (41,8%) Fällen im 3. Trimester mittels PCR-Amplifizierung. Dabei wurden C. albicans und C. glabrata identifiziert. Die Konzentrationen von IL-1 im Vaginallavage waren im 1. und 3. Trimester (p= 0,0002, p=0,0005) in der Candidagruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Im Serum konnten signifikante Unterschiede nur im 2. Trimester festgestellt werden, wo die Werte in der Kontrollgruppe höher lagen (p=0,036). In den Konzentrationen von IL-1ra wurden keine signifikanten Unterschiede im Vaginallavage sowie im Serum festgestellt, mit Ausnahme vom 1. Trimester, wo die Werte in der Candidagruppe höher lagen (p=0,0047). Das IL-1ra: IL-1 beta Verhältnis im Vaginallavage war jedoch in der Gruppe ohne Candida-Kolonisierung im Vergleich mit der Candidagruppe in allen drei Untersuchungszeitpunkten signifikant höher. Im Serum wurde kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt. Eine signifikante Erhöhung der IL-4-Konzentrationen wurde im 2. und 3. Trimester im Vaginallavage in der Candidagruppe nachgewiesen (p=0,049, p=0,041). IL-6 war im 1. und 3. Trimester signifikant höher im Vaginallavage in der Candidagruppe (p=0,024, p=0,0053). Die Konzentrationen von IL-8 im Vaginallavage waren in der Candidagruppe in allen Untersuchungszeitpunkten signifikant höher als in der Kontrollgruppe. IL-10 war im 3. Trimester im Vaginallavage in der Candidagruppe signifikant höher. Im Serum ergab sich kein signifikanter Unterschied in den Konzentrationen von IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 sowie IL-12 zwischen den beiden Gruppen. Ebenfalls konnten keine Unterschiede zwischen den Gruppen in den Konzentrationen von IL-12 im Vaginallavage festgestellt werden. Im Laufe der Schwangerschaft stieg die Konzentration von IL-1 beta und IL-8 in der Candidagruppe zum 3. Trimester, was in der Kontrollgruppe nicht beobachtet wurde. Schlussfolgerungen: Die steigende Prävalenz der Besiedlung der Vagina mit Candida spp. im Verlauf der Schwangerschaft kann aufgrund der Ergebnisse dieser Studie folgendermaßen erklärt werden: Einerseits spielen für die Schwangerschaft typische Veränderungen im Scheidenmilieau eine große Rolle. Andererseits begünstigen die Veränderungen der lokalen Immunantwort die Entstehung der Kolonisierung mit Candida spp. Die Erhöhung von IL-4 und IL-6 zeigt, dass in Anwesenheit von Candida spp. die Th-2 Immunantwort aktiviert wird. Dies trägt auch zu einer Suppression der lokalen zellvermittelten Immunität bei. Aufgrund signifikant höherer Werte von IL-1 beta und IL-8 im Vaginallavage in der Candidagruppe kann die frühzeitige Reifung der Zervix und dementsprechend eine Frühgeburt nicht ausgeschlossen werden. Die Erhöhung der IL-10 in der Candidagruppe und die Tatsache niedriger IL-12-Konzentrationen weist auf eine Senkung der natürlichen Immunabwehr in der Vagina und ein lokales Immundefizit während der Schwangerschaft hin. Unsere Ergebnisse bestätigen auch, dass es wichtig ist, das IL-1ra:IL-1 beta Verhältnis zu bestimmen, da bei einer erhöhten Produktion von IL-1 beta oder einer supprimierten Synthese von IL-1ra eine Kolonisierung der Scheide mit Candida spp. begünstigt wird.
Die Einnahme niedrig dosierter Omega-3 Fettsäuren und die Genexpression und Proteinbildung von PDGF, MCP-1 und VEGF
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
In der Pathogenese, Progression und den akuten Ereignissen der Atherosklerose haben die Wachstumsfaktoren VEGF und PDGF und das Chemokin MCP-1 große Bedeutung. Durch Veränderung der Ausbildung dieser Proteine könnte der Lauf der durch Atherosklerose bedingten Erkrankungen positiv beeinflusst werden. Untersuchungen von Medikamenten oder Nahrungsbestandteilen die einen Einfluss auf die Genexpression dieser Proteine haben sind somit von großer Bedeutung. In dieser Arbeit wurde der Einfluss von diätetisch zugeführten, niedrig dosierten w-3 Fettsäuren auf die Serumspiegel von VEGF, PDGF-AB und MCP-1 und die Expression und Proteinbildung von MCP-1 und PDGF unter dem Einfluss von alleiniger Adhärenzstimulation oder Zugabe von verschiedenen gängigen Stimulanzien in mononukleären Zellen untersucht. In der Atherogenese spielen mononukleäre Zellen eine zentrale Rolle. Da w-3 Fettsäuren einen positiven Effekt in den durch Atherosklerose bedingten Krankheiten haben und vorausgegangene Studien sehr hohe, in der Praxis nicht mögliche Dosierungen gewählt wurden, ist eine Studie zu deren Einfluss, in niedriger, jedoch wirksamer Dosierung, auf die Expression von VEGF, PDGF-AB und MCP-1 von großer Bedeutung. Dafür wurde ein randomisierte, doppelblinde, Placebo kontrollierte Interventionsstudie an 14 männlichen gesunden Freiwilligen durchgeführt. Die Probanden der Verumgruppe erhielten zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung für sechs Wochen täglich 3g und dann für weitere sechs Wochen 1,5g w-3 Fettsäuren. Die anfängliche hohe Dosierung wurde gewählt um eine Aufsättigung mit w-3 Fettsäuren zu erreichen. Die Probanden der Placebogruppe erhielten entsprechend Placebokapseln die in ihrem Fettsäurenprofil der westlichen Ernährung angepasst waren. Die Expressionsänderungen der genannten Proteine wurden in den Zellstimulationen auf der Genomebene mittels der etablierten 3n-rT-PCR als auch auf der Proteinebene mittels ELISA gemessen. Aufgrund von o.g. methodischen Problemen waren diese Ergebnisse jedoch angesichts der großen Mühen leider nicht verwertbar. Die Konzentrationen von VEGF, PDGF-AB und MCP-1 im Serum der Probanden wurden mittels ELISA gemessen. Hier zeigten sich deutliche interindividuelle Schwankungen. Die Konzentration von VEGF im Serum der Probanden der Verumgruppe senkte sich nach 3 Monaten durchschnittlich um 54±18% gegenüber den Ausgangswerten. Die Konzentration von VEGF im Serum der Placebogruppe änderte sich im Durchschnitt nicht, jedoch schwankten die Werte. Die Konzentration von PDGF-AB senkte sich im Serum der Verumgruppe nach 3 Monaten durchschnittlich um 57±20%. Die Konzentration von PDGF-AB veränderte sich in der Placebogruppe über den Untersuchungszeitraum nicht relevant. In der Verumgruppe senkte sich die Konzentration von MCP-1 im Serum der Probanden nach 3 Monaten im Durchschnitt um 43±17%. In der Placebogruppe war keine nennenswerte Veränderung vorhanden. Diese Ergebnisse waren statistisch relevant. Bei gesunden Probanden beeinflussen niedrig dosierte w-3 Fettsäuren die Regulation von VEGF, PDGF-AB und MCP-1. Somit wird die antiatherosklerotische Wirkung von w-3 Fettsäuren über die Beeinflussung der Genexpression und Proteinbildung proatherogener Faktoren auch in niedrigen Dosierungen bestätigt. Ein Einfluss von w-3 Fettsäuren auf VEGF wurde hier erstmals beim Menschen beschrieben.