Podcasts about kontrazeptiva
- 17PODCASTS
- 17EPISODES
- 46mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jun 20, 2023LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about kontrazeptiva
Viele Menschen zieht es nach der langen Pandemiezeit in die Ferne. Frauen, die mit oralen Kontrazeptiva verhüten, müssen dann wissen, wie sich die Zeitverschiebung auf die Einnahme auswirkt. Apothekerin und DAS PTA MAGAZIN-Chefredakteurin Julia Pflegel hat dazu im Podcast PTA FUNK unseren Autor Christopher Waxenegger befragt. (16:54 Min) https://www.das-pta-magazin.de/news/podcast-pta-funk-karenzzeit-und-kondome-3387767.html
Verhütung um jeden Preis - Was Pille & Co für die Umwelt bedeuten
Seit Jahrzehnten verhüten Frauen mit hormonellen Kontrazeptiva, Männer mit Kondomen. Zeit, einmal genauer hinzuschauen: Was für Folgen haben diese Mittel für die Umwelt? Sind Hormone im Abwasser eigentlich abbaubar? Wie umweltfreundlich ist eigentlich die Herstellung von Kondomen? Wir gehen diesen Fragen im heutigen Podcast auf den Grund. Mit Musik von Bette Midler: From a distance
Frauensache: In dieser gynäkologischen Praxis ist der Name Programm
Die Gynäkologie ist eine Frauendomäne. Patientinnen werden meistens betreut von weiblichen MFA, Hebammen und Ärztinnen. „Da ist manchmal ein bisschen viel Östrogen auf einem Haufen“, findet Dr. Vanessa Gies aus Frankfurt. Die Gynäkologin wünscht sich mehr männliche Kollegen in ihrem Fach. Ob sie die beiden Hosts Sascha und Sebastian überzeugen kann, die Fachrichtung zu wechseln? Das Schöne an ihrem Job: Vanessa hat viel mit Gesunden zu tun. Krebsvorsorge, Schwangerschaft und Verhütung sind die dominierenden Themen im Alltag. Und genau darum geht es in dieser DocTales-Folge. Wie nehmen Praxen und Patientinnen das geänderte Zervixkarzinom-Screening wahr? Ist es ein Problem, wenn werdende Eltern jeden Baby-Ultraschall mit dem Smartphone filmen wollen? Und was hat es mit dem Hormon-Bashing bei Kontrazeptiva auf sich? In der Rubrik Quick and Nerdy beantwortet Vanessa darüber hinaus die Frage aller Fragen in der Gynäkologie: Kreißsaal oder Hausgeburt? Die Antwort könnt ihr euch vielleicht denken ... Viel Spaß beim Reinhören! Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Zur Folgen-Übersicht: medical-tribune.de/doctales
#004 - Menstruationszyklus & Training mit Laura-Sophie Usinger
Der weibliche Menstruationszyklus kann enormen Einfluss auf verschiedenste körperliche Funktionen haben - auch auf die Leistungsfähigkeit! In dieser Episode spreche ich mit Laura-Sophie Usinger über alles, was man zu diesem Thema wissen sollte: - Was verändert sich im Laufe des Zyklus? - Was beeinflusst die Physiologie bzw. Leistungsfähigkeit? - Welche Bedeutung hat der Zyklus für die Gesundheit? - Welchen Einfluss haben orale Kontrazeptiva? - Wie kann man nach dem Zyklus trainieren? Link zum Videopodcast auf YouTube. Obwohl der Großteil sportwissenschaftlicher Studien auf Männern (18 bis 35 Jahre) beruht, werden Frauen sowie der Einfluss des Menstruationszyklus in den letzten Jahren immer häufiger im Kontext von #training erforscht. Laura hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit zyklusbasiertem Training beschäftigt und lässt ihr Wissen über den Zyklus auch im #coaching ihrer Athletinnen einfließen. Laura's Coaching Website 0:00:00 Intro 0:02:36 Vorstellung Laura 0:06:35 Sportlicher Hintergrund 0:14:55 Kölle Alaaf! 0:15:22 Speed Meet 0:19:11 Franka Frei 0:20:36 Endokrines System 0:24:03 Hormone und Phasen 0:26:59 PMS 0:28:22 Leistungsfähigkeit im Zyklus 0:32:48 Verletzungsanfälligkeit 0:36:06 orale Kontrazeptiva (Pille) 0:37:45 Menopause 0:39:12 Zyklusstörungen 0:41:22 Menstrual Categorisation System 0:42:39 Hintergrund: KISS-Peptin 0:45:04 RED-S 0:48:48 Körperbilder 0:56:32 Essstörungen 0:58:41 Estradiol, Estrone, Estriol 0:59:52 Verantwortung als Trainer:in 1:02:07 Energieverfügbarkeit 1:08:44 Energie im Tagesverlauf 1:12:21 Frauen im Sport 1:13:29 Büttenrede 1:15:12 Repräsentation von Frauen 1:23:34 Studie Uni Gießen 1:29:21 Studienergebnisse 1:34:34 Individualisierung 1:36:30 Take-aways 1:39:01 Meta-Analysen 1:41:15 Zwischenfazit 1:42:40 Zyklusgesteuertes Training 1:45:34 Zyklusgesteuerte Ernährung 1:47:31 Messbarmachung 1:51:42 Elite Athletinnen 1:54:43 OCs & Performance 1:57:29 Forschungslücken 2:00:52 Abschlusstipps 2:02:44 Abmoderation 2:03:45 Outro
Wir können uns glücklich schätzen in einem Zeitalter zu leben, in dem innerhalb von wenigen Monaten Impfungen entwickelt werden, genetische Erkrankungen wie die Spinale Muskelatrophie effektiv behandelt werden können und Frauen zwischen fast 20 verschiedenen Verhütungsmitteln die freie Wahl haben. Von der sogenannten Anti-Baby-Pille, zu verschiedenen Spiralen, Vaginalringen, Depotpräparaten, die unter die Haut gesetzt werden, bis zu Pflastern, die transdermal ihre Wirkung entfalten und natürlich etlichen mechanischen Kontrazeptiva wie dem Diaphragma oder Vaginalschwämmen. Auf der anderen Seite sind wir seit der erstmaligen Serienproduktion des Kondoms um das Jahr 1870 immer noch nicht viel weiter was die Verhütung angeht für Männer*. Warum das so schwierig ist, bzw welche Medikamente vielleicht doch schon in der entwicklerischen Pipeline stecken und was sich ändern muss damit da doch noch mehr Auswahl dazu kommt, das klären wir in diesem Podcast. * alle spermienproduzierenden Menschen Alle Quellen und weiterführende Informationen findet ihr unter www.heileweltpodcast.com Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne an heile.welt@posteo.de Ansonsten bleibt ihr auf dem Laufenden mit einem Abo auf facebook, instagram oder twitter unter @heileweltpodcast
Erkältungsmedikamente und frei verkäufliche Pharmaka zur Fiebersenkung und Schmerzlinderung können deinen Blutdruck bedeutsam erhöhen! Selbst großflächig aufgetragen Salben sind da nicht ausgenommen!
Gerade bei chronischen Erkrankungen werden Wirkstoffgruppen wie Antibiotika, Cholesterinsenker, ACE-Hemmer, Protonenpumpenhemmer oder auch orale Kontrazeptiva häufig eingesetzt. Viele Medikamente ziehen einen gravierenden Mikronährstoffmangel nach sich. Was kann man tun und wie kann man einem Mikronährstoffmangel entgegenwirken? Das und vieles mehr erfährt ihr im Podcast.
Verhütung: Soll ich noch die Pille nehmen? Mit Dr. Lisa-Maria Wallwiener
Wie finde ich die passende Verhütungsmethode? Kann ich die Pille wirklich bedenkenlos “einwerfen”? Für wen ist sie gut, wer sollte sie meiden? Und wie kann ich verhüten, wenn ich keine Hormone nehmen will? Was taugen Apps, die meine fruchtbaren Tage bestimmen sollen? Was ist ein normaler Zyklus - und gibt es so etwas überhaupt? Darüber spricht Dr. Yael Adler mit der Gynäkologin und Fruchtbarkeits-Expertin Dr. Lisa-Maria Wallwiener vom Klinikum rechts der Isar. Dr. Wallwiener arbeitet seit Jahren als gynäkologische Endokrinologin und forscht zur natürlichen Familienplanung (NFP). In dieser Folge von „Ist das noch gesund?“ sprechen Dr. Adler und Dr. Wallwiener auch über die Fragen: · Welche Nebenwirkungen hat die Pille? · Macht die Pille dick? · Ist Sex ohne Pille anders als mit Pille? · Steigert die Pille das Brustkrebs-Risiko? · Gegen welche Krankheiten hilft die Pille? · Für wen kann die Hormonspirale eine Alternative sein? · Wie verhütet man mit Hormon-Implantaten? · Verhüten mit Kupferkette, Kupferball oder Kupferspirale - wie geht das? Weitere Informationen Informationen der Techniker · Der Pillenreport – ein Statusbericht zu oralen Kontrazeptiva: https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/arzneimittel-medizinische-hintergruende/pille/pillenreport-2015-2066660 · https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/arzneimittel-medizinische-hintergruende/pille-2068084 · https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/brustkrebs/tk-plus-bei-brustkrebs/dmp-news/hormonelle-verhuetung-brustkrebsrisiko-2042630 Verhüten nach dem Zykluskalender? Im Podcast sprechen Dr. Wallwiener und Dr. Adler über die wissenschaftlich validierte Sensiplan-Methode für die natürliche Familienplanung (NFP). Hier gibt es weitere Informationen: · https://www.sensiplan-im-netz.de/ · https://sektion-natuerliche-fertilitaet.de/ · „Natürlich und sicher - Das Praxisbuch. Familienplanung mit Sensiplan.“ Herausgegeben von der Arbeitsgruppe NFP. ISBN: 9783432106922, https://bit.ly/Sensiplan-Buch Es gibt einige NFP-Apps, die sich an der Sensiplan-Methode orientieren, z.B.: · https://www.mynfp.de · https://www.ladycycle.com/de/ · https://neome.me Wie im Podcast besprochen, sind diese Apps nicht als Medizinprodukte zugelassen – die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung. Diese Liste stellt auch keine Empfehlung der Techniker Krankenkasse dar, sie dient nur der Information unserer Hörerinnen und Hörer. Insgesamt rät die Fachgesellschaft DGGEF zur Vorsicht bei der Nutzung von Zyklus-Apps: https://www.dggef.de/2018/11/09/zyklus_apps/ Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.sexualaufklaerung.de/ BZgA-Informationen für Jugendliche: https://www.loveline.de/
Zurück zum Thema | Warum gibt es kaum Verhütungsmittel für Männer?
Seit 50 Jahren wird geforscht und trotzdem gibt es noch immer kein Verhütungsmittel für Männer, was den Kontrazeptiva für Frauen ansatzweise das Wasser reichen kann. Woran liegt das?Der Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/zurueck-zum-thema-verhuetung
Warum gibt es kaum Verhütungsmittel für Männer?
Seit 50 Jahren wird geforscht und trotzdem gibt es noch immer kein Verhütungsmittel für Männer, was den Kontrazeptiva für Frauen ansatzweise das Wasser reichen kann. Woran liegt das?Der Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/zurueck-zum-thema-verhuetung
Warum gibt es keine Pille für den Mann? Suche nach einer (feministisch-materialistischen) Antwort.
Während Frauen auf eine Vielzahl moderner, d.h. reversibler Methoden zur Kontrazeption zurückgreifen können, gibt es für Männer auch fast 60 Jahre nach dem Marktgang der Antibabypille kein einziges derartiges Mittel. Erblickte Feminismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der „Antibabypille“ zunächst die Möglichkeit, dass Frauen über ihren Körper und ihre Biographie selber bestimmen, klagte kurz nach dem Marktgang in den 60ern an die feministische Frauen- und Gesundheitsbewegung, dass Frauen nun die Hauptverantwortung für die Verhütung tragen - in finanzieller, zeitlicher und vor allem gesundheitlicher Hinsicht. Der radikale Feminismus beantwortete die Frage, warum es keine Pille für den Mann gibt, mit dem Androzentrismus der Wissenschaft, gegenwärtig wird sie in den Diskussionen um weibliche „Pillenmüdigkeit“ erneut aufgeworfen. Tatsächlich wird an neuen männlichen Kontrazeptiva bereits seit den 70er Jahren geforscht und reproduktionsmedizinische Studien erbrachten verschiedentlich den Beweis, das hormonelle Verhütung beim Mann wirksam ist. Forschungen konzentrieren sich dabei nicht allein auf die zum medialen und kulturellen Symbol avancierte „Pille für den Mann“. Auch an Implantaten, Gels, Spritzen, reversiblen Vasektomien und Ventilen, hormonellen wie nicht-hormonellen Methoden wird mitunter seit Jahrzehnten geforscht. Zur Marktreife brachte es allerdings keiner dieser Ansätze. Wenn auch nicht länger aufrechterhalten werden kann, dass Verhütung natürlicherweise Frauensache sei, scheint sich die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Verhütungspraxis aus der Verfügbarkeit entsprechender Mittel zu ergeben. Der Vortrag begibt sich auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum es keine Pille für den Mann oder Vergleichbares gibt. Mit „dem Patriarchat“ oder „der Pharmaindustrie“ sind zwar die üblichen Schuldigen schnell an der Hand, der Verweis auf sie beantwortet die Frage aber noch nicht. Ein Blick auf die Diskurse um „Pille für den Mann“ und Co. zeigt, dass auch Männer sich der Ungerechtigkeit der geschlechtlichen Aufgabenverteilung in der Verhütung durchaus bewusst sind, dass sie jedoch eine Nebenwirkung ganz besonders fürchten: den Verlust von Männlichkeit. Die Entwicklung neuer Kontrazeptiva für Hodenträger ist aber allenfalls notwendige, keine hinreichende Bedingung reproduktiver Geschlechtergerechtigkeit. Denn die Überwindung der Angst vor ihrem Verlust schlägt nur allzu schnell um in den Beweis von Männlichkeit und die Bedeutung von Verhütung erschöpft sich nicht in Fürsorge oder Partnerschaftlichkeit, sondern kann ebenso Distanz, Autonomie und Kontrolle implizieren. Ist die Assoziation der „Pille für den Mann“ mit sexueller Revolution ist daher vorschnell? Referent: Fabian Hennig (Geschlechterforschung, Berlin/Basel) Fabian Hennig lebt als Geschlechterforscher und freier Autor in Berlin. In seinem Promotionsprojekt analysiert er die Transformation von Männlichkeit im Diskurs um moderne männliche Kontrazeptiva. Für die Jungle World schrieb er zum sogenannten „Lebensschutz“, „The Handmaids Tale“, „Liebesschlössern“ und „Der junge Karl Marx“. In Outsidethebox und materializing feminism publizierte er zur materialistischen Kritik an Diskurstheorie, New Materialism und Posthumanismus. Location @soyya. Instagram soyya_room telegram channel (t.me/soyya_info) Diese Verantaltung wird unterstützt vom StAVV (https://www.facebook.com/euer.stavv/)
PE 120 - AUSWIRKUNGEN DER ANTI-BABYPILLE AUF DEINEN KÖRPER - Interview mit Dr. Jolene Brighten (auf Englisch)
Vordergründig wird “die Pille” als hormonelle Verhütungsmethode eingenommen um stellt damit eine der aktuell sichersten Kontrazeptiva dar. Die Pille wird aber zusätzlich aus vielen unterschiedlichen Gründen verschrieben, beispielsweise starke Regelschmerzen, Akne, etc. Viele Frauen und Mädchen nehmen die Pille über Jahre ein und nehmen diese nicht als ein umfassend wirksames Medikament, was den gesamten Körper und auch unsere mentale Gesundheit beeinflussen kann, wahr. Dr. Jolene Brighten, führende Expertin für das Post-Pill-Syndrom, hormonelle Verhütung und ihre Auswirkung auf Frauengesundheit, Ärztin für Naturheilkunde, Autorin und Speakerin erklärt dir in diesem Experteninterview, wie die Pille im Zusammenhang mit deinem Stoffwechsel, deiner Schilddrüse und Darmgesundheit steht. Du erfährst in dieser Podcastepisode: wie die Pille auf die verschiedenen Hormone in deinem Körper wirkt wie die Einnahme der Pille mit deiner Schilddrüsenfunktion zusammenhängt welche Nährstoffe besonders wichtig sind während der Einnahme der Pille und warum diese im allgemeinen schlechter aufgenommen werden wie dein Mikrobiom und deine Darmgesundheit durch die Pille beeinträchtigt sein können auf was du achten solltest, wenn du die Pille einnimmst was das Post-Pill-Syndrom ist Das Interview ist auf Englisch. Du findest auf meinem Blog die gesamte Mitschrift des interviews zum Nachlesen: Alle Informationen zu meinem Gast:Dr. Brighten’s Website: www.drbrighten.com Gift for Your Audience: https://drbrighten.com/pbcsdiet Book Bonuses: www.beyondthepillbook.com
Effekte von oralen Kontrazeptiva auf die schlafbezogene deklarative Gedächtniskonsolidierung gesunder Probandinnen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
Thu, 9 Oct 2014 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/17518/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/17518/1/Potyka_Alina.pdf Potyka, Alina
Effekte oraler Kontrazeptiva auf die prozedurale Gedächtniskonsolidierung während eines Nachmittagsschlafs
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 16/19
Thu, 10 Apr 2014 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/16920/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/16920/1/Baeurle_Anna.pdf Bäurle, Anna
Die Wirkung von Chlormadinonacetat auf humane Melanozyten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Die Einnahme oraler Kontrazeptiva kann zu unerwünschten Pigmentveränderungen an der Haut, auch Melasma genannt, führen. Histologische Kennzeichen von Melasma sind eine epidermale Hyperpigmentierung, ein Anstieg melanogener Enzyme und ein Anstieg der Melanozytenzahl. Pathophysiologisch bedeutsam ist, dass Melanozyten sowohl Östrogen- als auch Progesteron-Rezeptoren besitzen. Für die Entstehung des Melasma durch Kontrazeptiva werden vor allem die erhöhten Östrogen-Spiegel im Serum der Patientinnen verantwortlich gemacht. Orale Kontrazeptiva enthalten in der Regel eine Kombination aus synthetischen Derivaten der natürlichen weiblichen Geschlechtshormone, nämlich aus einem Östrogen (Ethinylestradiol) und einem Gestagen (Progesteron bzw. synthetische Gestagene). Bei der retrospektiven Auswertung einer Zulassungsstudie eines oralen Kontrazeptivums mit den Inhaltsstoffen Ethinylestradiol und Chlormadinonacetat wurde die Beobachtung gemacht, dass unter Anwenderinnen des Studienpräparates die Prävalenz von Melasma deutlich geringer war als unter Einnahme anderer Kontrazeptiva vor Studienbeginn. Da sich die Kontrazeptiva untereinander nicht im Östrogen-, aber im Gestagen-Anteil unterscheiden, wurde vermutet, dass Chlormadinonacetat im Gegensatz zu anderen Gestagenen eine hemmende Wirkung auf die Östrogen-vermittelte Entstehung von Melasma haben könnte. Um diese Hypothese experimentell zu untermauern, wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht, wie sich humane Melanozyten in vitro unter Stimulation mit Östrogen und Gestagenen verhalten. Hierfür wurden primäre Melanozyten aus menschlichen Hautgeweben unterschiedlicher Spender isoliert und in Kultur gebracht. Die Melanozytenkulturen wurden unterschiedlichen Konzentrationen von Ethinylestradiol und Progesteron beziehungsweise Chlormadinonacetat ausgesetzt. Die Zellvitalität wurde mittels eines fluorimetrischen Assays ausgewertet und die Pigmentbildungsaktivität mit Hilfe eines 3H-Tyrosin-Assays bestimmt. Darüber hinaus wurden die Melanozyten in einigen Versuchsreihen zusätzlich mit ultraviolettem Licht aus dem UVA- und UVB-Bereich bestrahlt, da das Auftreten von Melasma vornehmlich in sonnenexponierten Hautarealen beobachtet wird. Es konnte gezeigt werden, dass Östrogen mit spenderabhängigen Unterschieden eine wachstumsstimulierende und eine pigmentbildungsfördernde Wirkung auf Melanozyten hatte. Sowohl Progesteron als auch Chlormadinonacetat hemmten die wachstumsstimulierenden Effekte von Östrogen, während sie keinen Einfluss auf die Pigmentbildungsaktivität hatten. Daraus ließ sich schlussfolgern, dass Chlormadinonacetat möglicherweise durch Hemmung der Proliferation den Melanozyten-aktivierenden Einflüssen von Östrogen entgegenwirkt, was in der Praxis mit einer geringeren Inzidenz von Kontrazeptiva-assoziierten Pigmentveränderungen einhergeht. Dies würde wiederum bedeuten, dass der Gestagen-Anteil in einem oralen Kontrazeptivum entscheidend ist für die Häufigkeit des Auftretens von Melasma.
Einfluss von Ausdauertraining und niedrig dosierten oralen Kontrazeptiva auf Parameter von Knochenmasse, -dichte und –geometrie junger Frauen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Tue, 12 Jun 2007 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/7006/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/7006/1/Kirchbichler_Alexander.pdf Kirchbichler, Alexander
Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 in der gesunden Brustdrüse - Expression von Östrogen- und Progesteronrezeptoren in der gesunden Brustdrüse
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Ziel der vorliegenden Arbeit war es zu untersuchen, ob die Aktivität der 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 (ein Enzym, das die Umwandlung von Östradiol in Östron katalysiert) in gesunden Brusdrüsenepithelzellen der Frau menstruationszyklusabhängig variiert und ob orale Kontrazeptiva Änderungen hervorrufen. Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenasen repräsentieren eine Gruppe von mehreren Isoenzymen, welche vor allem Östrogene und Androgene umsetzen. 17ß-HSD 4, die als steroidumsetztendes Enzym identifiziert wurde, konnte immunhistochemisch in Drüsenepithelien und biochemisch generell im Brustgewebe nachgewiesen werden. Weiterhin wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Expression von Progesteron- und Östrogenrezeptoren in Brustdrüsengewebe und Verlauf des weiblichen Zyklus besteht und ob sich Unterschiede durch die Einnahme oraler Antikonzeption ergeben. Für unsere Studie untersuchten wir Brustdrüsengewebe von 47 prämenopausalen Frauen, die sich einer Mammareduktionsplastik unterzogen. Da wir postoperativ eine Zyklusananmese erhoben, konnten wir den Tag der Operation entweder der follikulären oder lutealen Menstruationszyklusphase zuordnen. Die 17ß-Hydroxysteroiddehydrogenase 4 ließ sich immunhistochemisch mit zwei verschiedenen monoklonalen Antikörpern in den Gängen und Tubuloalveoli des normalen Brustdrüsenepithels nachweisen. Angefärbt haben sich zytoplasmatische granuläre Strukturen in Drüsenepithelzellen und in Myoepithelzellen. Wir stellten leicht unterschiedliche Tendenzen in der Signalstärke der Expression von 17ß-HSD 4 mit dem Menstruationszyklus fest. Auch bei Einnahme oraler Kontrazeptiva ergaben sich leicht unterschiedliche Tendenzen in der Signalstärke der Expression von 17ß-HSD 4. Man sah die Tendenz einer höheren 17ß-HSD 4 Färbe-Intensität in der follikulären Phase und die Einnahme oraler Kontrazeptiva bewirkte eine niedrigere 17ß-HSD 4 Färbe-Intensität in der lutealen und eine höhere in der follikulären Phase. Expressionsstudien mit mRNA ergaben keine Zyklusabhängigkeit der 17ß-HSD 4. Die Ergebnisse geben keine klare Aussage darüber, ob 17ß-HSD 4 primär mit dem Umsatz von Östrogenen betraut ist, oder ob die Hauptfunktionen in Fettsäure- und Gallensäuremetabolismus liegen, Funktionen, die das Enzym auch ausüben kann. Insgesamt war die Östrogen-und Progesteronrezeptorexpression in der follikulären Phase geringfügig höher als in der lutealen Phase. Es ergaben sich Unterschiede in der Expression von Östrogen- und Progesteronrezeptoren durch orale Antikonzeption. Frauen die die „Pille“ regelmäßig einnehmen, zeigten in beiden Phasen (luteal und follikulär) eine geringere Expression von Östrogen-und Progesteronrezeptoren als bei Frauen die keine Hormone einnehmen. Alle Unterschiede waren jedoch statistisch nicht signifikant.


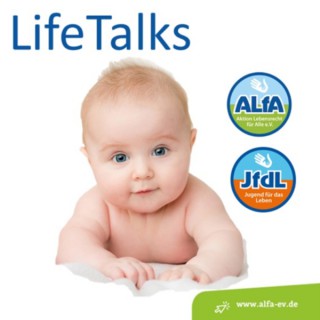








![Interventionistische Linke [iL*] Podcast](https://ivyfm.s3.amazonaws.com/i320/937665.jpg)








