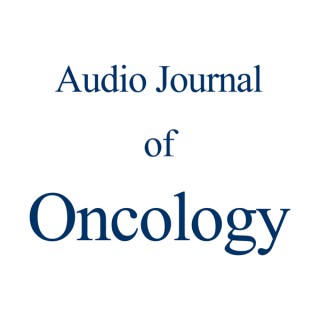Podcasts about spiral ct
- 9PODCASTS
- 14EPISODES
- 30mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Aug 18, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about spiral ct
Latest podcast episodes about spiral ct
Intelligent Medicine Radio for August 16, Part 1: Could overuse of CT scans cause 100,000 extra cancers?
As natural thyroid ban looms, thyroid sufferers gird for battle with regulators; Rapid weight loss, muscle wasting—what to do? Could overuse of CT scans cause 100,000 extra cancers in the U.S.? Martha's Vineyard, Nantucket residents afflicted with tick-borne meat allergy; Beyond Meat headed for Chapter 11 bankruptcy; Searching for the causes of low iron.
Volume CT Lung Cancer Screening Cuts Cancer Deaths 24 Per Cent
Second Study Confirms Lung Cancer CT Screening Cuts Deaths NETHERLANDS—Erasmus University Medical Center, Rotterdam—Research published in the New England Journal of Medicine has confirmed the viability of computed tomographic (CT) screening for detecting cases of lung cancer early in high-risk …Harry J. de Koning MD PhD
Assessing Radiation Risks with Low-Dose Spiral CT for Lung Cancer Screening
Robert J. McCunney, MD, MPH, and David C. Christiani, MD, MPH, FCCP, are interviewed by CHEST Podcast Editor, D. Kyle Hogarth, MD, FCCP, as they discuss the many issues posed by the increasing use of low-dose spriral CT (LDCT) in lung cancer screening. The focus is on McCunney and Li's article in this month's issue of CHEST, comparing 20- to 30-year exposure to LDCT with that of nuclear workers and atomic bomb survivors. The conversation covers many topics, including level of exposure, the problem of false positives, machine calibration, and appropriate candidates for LDCT.
Validität der sonografischen Kontrollen nach initialer Spiral-CT bei polytraumatisierten Patienten mit abdomineller Verletzung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Thu, 12 May 2011 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/13095/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/13095/1/Mayer_Hannelore.pdf Mayer, Hannelore
Darstellung der normalen knöchernen Gelenkanatomie mittels eines C-Bogen mit optionaler 3D-Bildgebung (ISO-C3D) im Vergleich zur SPIRAL-CT
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Die gegenwärtige Routine in der Versorgung von unfallchirurgischen und orthopädischen Patienten beinhaltet das konventionelle Röntgen in zwei Ebenen, gegebenenfalls eine genaue Schnittbilddiagnostik mittels CT. Die intraoperative Kontrolle erfolgt meist anhand der Durchleuchtung mit einem konventionellen C-Bogen. Die dreidimensionale intraoperative Darstellung war bisher routinemäßig nicht möglich und nur an den sehr wenigen Krankenhäusern mit mobilen oder im OP installierten CT verfügbar. Dies gilt auch für die Navigation, die sich lediglich auf die präoperativen CT-Daten stützte. Mit dem ISO-C3D ist nun erstmals ein Gerät verfügbar, das intraoperativ dreidimensionale Schnittbilder einfach und schnell erzeugen kann. Die voliegende Studie konnte zeigen, dass, die von dem ISO-C3D generierten Schnittbilder an den Gelenken der Extremitäten und an der Halswirbelsäule den Ansprüchen der modernen Radiologie im Bezug auf Bildqualität, Bildrauschen, Kortikalisdarstellung und Gelenkpräsentation genügen. In diesem Bereich kann der ISO-C3D als volleinsetzbares mobiles CT-Gerät angesehen werden. Diese Aussage gilt auch im Bezug auf die Navigation, bei der er die Möglichkeit bietet, die Datensätze ständig während einer Operation zu aktualisieren. Im Bereich des Rumpfes verschlechtert sich die Bildqualität des ISO-C3Ddeutlich. Aber der Informationsgehalt der Schnittbilder des ISO-C3D reicht aus, um die Lage von eingebrachtem Osteosynthesematerial sicher zu beurteilen. Die Datensätze sind ebenfalls geeignet, um Navigationssysteme zu unterstützen und somit die operative Genauigkeit zu steigern. Der ISO-C3D ist ein Gerät, das schnell, mobil und bei geringen Kosten, im Vergleich zu einer CT, dreidimensionale Hochkontrastschnittbilde erstellen kann, die im Bereich der Extremitäten voll aussagekräftig sind. Darüber hinaus kann er auch im Bereich des Rumpfes für verschiedene Anforderungen ausreichende Bildinformation liefern.
Mehrzeilen-Spiral-Computertomographie in hochauflösender Darstellung und in Niedrig-Dosis-Technik zur Detektion von konventionell nicht erfassbaren Lungeninfiltraten bei immunsupprimierten Patienten mit FUO
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Die Bedeutung der HR-Spiral-CT für die Diagnostik von Lungeninfiltraten bei FUO ist nach heutigem Kenntnisstand unumstritten (158). Oftmals wurden die exzellente Treffsicherheit und die Überlegenheit gegenüber konkurrierenden Verfahren bestätigt. Insbesondere im Vergleich zur konventionellen Röntgenaufnahme können mit der CT pneumonische Infiltrate frühzeitiger und somit auch in einem geringeren Schweregrad erkannt werden. Dies gilt gerade auch für abwehrgeschwächte Patienten (44, 45, 46, 99, 112, 115), da in dieser Gruppe von Erkrankten eine frühzeitige und auch erregeradaptierte Behandlung von vitaler Bedeutung ist (48, 159). Trotz der unbestrittenen diagnostischen Vorteile gilt die verhältnismäßig hohe Strahlenexposition als großer Nachteil der Spiral-CT. Die CT verursacht trotz eines relativ geringen Anteils von 3-4% an der Gesamtzahl der radiologischen Untersuchungen einen erheblichen Prozentsatz der radiologisch-diagnostischen Strahlenexposition (ca. 40 % der kollektiven Dosis aller Röntgenuntersuchungen) (33). Dieser Sachverhalt wiegt besonders im hier untersuchten Krankengut schwer, weil die Patienten verhältnismäßig jung sind (Mittelwert 47,3 Jahre) und infolge des langen Verlaufes ihrer Krankheit u. U. wiederholt untersucht werden müssen. Daher ist es notwendig, diese Untersuchungstechnik auf eine mögliche Optimierung im Sinne von Dosisminimierung hinsichtlich des Strahlenschutzes zu untersuchen. Die Lunge bietet sich aufgrund ihrer Eigenschaft als „Hochkontrastorgan“ besonders für deutliche Dosiseinsparungen an (126). In dieser Studie wurde unter Verwendung eines modifizierten Aufnahmemodus untersucht, ob die CT des Thorax mit reduzierter Strahlendosis die gleiche diagnostische Information erzielt wie die CT-Untersuchung mit Standarddosis. Gleichzeitig wurde die Auswirkung der Dosisreduktion auf die Bildqualität untersucht. Ausserdem erfolgte ein Vergleich mit der als infiltratunverdächtig beurteilten Thoraxübersichtsaufnahme in zwei Ebenen, um deren Wertigkeit neu zu überprüfen. Dazu wurden 90 Patienten, bei denen im Rahmen einer antitumorösen Therapie eine Neutropenie und Fieber unklarer Genese (FUO) aufgetreten war, konsekutiv untersucht. Es wurden insgesamt 270 Untersuchungen durchgeführt. Diese bestanden aus 1. 90 Thoraxübersichtsaufnahmen 2. 90 Mehrzeilen-Spiral-Computertomographien in hochauflösender Technik (Standard-Dosis-CT = SDCT, 120 mAs, 120 kV, 4x1 mm Kollimation, pitch 6, rekonstruierte Schichtdicke 1 mm, Inkrement 0,6 mm) und 3. 90 Mehrzeilen-Spiral-Computertomographien in Ultra-Niedrig-Dosis-Technik (UND-CT, 10 mAs, 120 kV, 4x2,5 mm Kollimation, pitch 6, rekonstruierte Schichtdicke 3 mm, Inkrement 2 mm). Jeder einzelne Patient erhielt alle drei genannten bildgebenden Verfahren. Die berechnete effektive Strahlendosis lag bei der Standard-Dosis-CT-Untersuchung bei 5,3 mSv (Männer) und 8,3 mSv (Frauen), bei dem hier vorgestellten Ultra-Niedrig-Dosis-CT Verfahren bei 0,4 mSv (Männer) und 0,6 mSv (Frauen). Dies entsprach einer Dosisreduktion um 92,8%. Die effektive Dosis der Thoraxübersichtsaufnahme in 2 Ebenen lag mit 0,25 mSv (p.a. 0,10 mSv, lat. 0,15 mSv) nur geringfügig unter derer der Ultra-Niedrig-Dosis-CT-Untersuchung. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Punkt 1 (Thoraxübersichtsaufnahme in 2 Ebenen) und Punkt 2 (Spiral-CT im hochauflösenden Modus (Standard)) die Untersuchungen beinhalteten, die der Patient bei genannter klinischer Studie „routinemässig“ erhielt, lediglich Punkt 3 (Spiral-CT in Ultra-Niedrig-Dosis-Technik) war die zusätzliche Untersuchung und damit die Dosis, die dem Patienten im Rahmen dieser Studie appliziert wurde. Die Studie wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz, vom bayerischen Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik und von der lokalen Ethikkommission (Projekt Nr. 085/01) genehmigt. Im Rahmen der Studie wurden die anonymisierten Aufnahmen durch zwei Befunder im Konsens und geblindet hinsichtlich Anamnese, Dosis, sowie der Diagnose der Routinebefundung in zufälliger Reihenfolge unter dem Aspekt der diagnostischen Aussagekraft, sowie der Bildqualität, beurteilt. Hinsichtlich der Aussagekraft wurden die für eine Entzündung stark indikativen CT-morphologischen Bewertungskriterien Konsolidierung, milchglasartige Dichteanhebung, Kaverne, Erguss und Bronchiektasien gewählt (44, 47, 48, 115, 171). Die Bildgüte wurde anhand Atem-, sowie Pulsationsartefakten und Rauschen beurteilt. Bezüglich des Bildeindruckes zeigte sich, dass der Rauschanteil der UND-CT-Aufnahmen um den Faktor 3,8 höher lag. Ungeachtet dessen ergab die Auswertung, dass die Erkennbarkeit der im Rahmen von Lungeninfiltraten auftretenden CT-Zeichen durch die Dosisreduktion nicht signifikant eingeschränkt wurde (p= 0,69 bei einem Signifikanzniveau von p< 0,05). Als weiterer Vorteil zeigte sich eine weitaus geringere Beeinflussung der Bildgüte durch Atemartefakte, da durch die dickeren Schichten des UND-CTs die Zeitspanne, in der der Patient den Atem anhalten muss, durchschnittlich um 20 Sekunden kürzer ist. Die Erkennbarkeit von Lungeninfiltraten in der konventionellen Röntgenübersicht war unbefriedigend. Dies drückte sich durch einen hochsignifikanten Unterschied (p=0,000 bei einem Hochsignifikanzniveau von p< 0,001) zwischen Übersichtsaufnahme und den CT-Sequenzen aus. Trotz der Tatsache, dass alle Übersichtsaufnahmen als nicht infiltratverdächtig beurteilt wurden, zeigten doch 70,0% (SD-CT) bzw. 67,8% (UND-CT) der Patienten in den CT-Bildserien Befunde, die mit Lungeninfiltraten vereinbar waren. Lediglich in einem Prozentsatz von 30,0% (SD-CT) bzw. 32,2% (UND-CT) bestätigte sich die mittels konventioneller Übersicht erhobene Diagnose (keine Hinweise für eine pulmonale Ursache des FUO) auch tatsächlich in den CT-Untersuchungen. Diese Studie erbrachte den Nachweis, dass in der Durchführung thorakaler Computertomographien zur Detektion konventionell nicht erfassbarer pulmonaler Infiltrate bei Immunsupprimierten mit FUO sehr geringe effektive Strahlendosen ausreichen. Lediglich eine geringfügig höhere Dosis, welche üblicherweise für eine konventionelle Übersichtsröntgenaufnahme benötigt wird, reichte aus, um die gesuchten Pathologien zuverlässig zu diagnostizieren. Die konventionelle Thoraxübersichtsaufnahme bietet im Gegensatz hierzu keine zufriedenstellende Sicherheit. Diese Methode ermöglicht nun fortan, den wichtigsten Nachteil der Spiral-CT - die verhältnismäßig hohe Dosisbelastung - zu beseitigen. Deshalb empfehlen wir aus strahlenhygienischen Gründen den konsequenten Einsatz des vorgestellten Untersuchungsprotokolls in Ultra-Niedrig-Dosis-Technik. Dies resultiert in einer Änderung im Ablauf des Diagnostikalgorithmus der deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie.
Evaluation von mediastinalen und hilären Lymphknoten mit der Multidetektor-Spiral-CT
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Computertomographische Untersuchungsmethoden, die Magnetresonanztomographie und die Positronen-Emissionstomographie ( = CT, MRT, PET) sind heute, neben der Ultraschalltechnik, die wichtigsten nicht-invasiven bildgebenden Verfahren, die der medizinischen Diagnostik zur Verfügung stehen. Es handelt sich bei allen CT-Verfahren im Grunde um sog. Schnittbildverfahren, die zum Aufbau von für den Untersucher diagnostisch verwertbaren Bildern, einen Computer bzw. zusätzlich noch nuklearmedizinische Methoden verwenden, um pathologische Morphologien und Funktionen zu detektieren. Dabei kann bei der CT und der MRT durch die Applikation geeigneter Kontrastmittel der Informationswert in vielen Fällen noch gesteigert werden. Für den Patienten besteht jedoch bei einer CT- oder PET-Untersuchung ein gravierender Nachteil: die damit verbundene Strahlenbelastung. Deshalb werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um durch eine Verbesserung der Methodik insbesondere zwei Ziele zu erreichen: einerseits eine Verringerung der Strahlenbelastung des Patienten, andererseits Verbesserung bei der Auflösung im Rahmen der Darstellung feingeweblicher Strukturen. Eine solche Verbesserung der Auflösung, die zu einer Verbesserung der diagnostischen Aussage beitragen kann, hat für den Patienten enorme, insbesondere therapeutische Konsequenzen, z. B. im Rahmen des Staging, bei Verdacht auf das Vorliegen einer malignen Erkrankung. In der vorliegenden Arbeit sollte deshalb untersucht werden, ob geeignete Möglichkeiten bestehen, ohne den Wert der Diagnose an sich zu schmälern, durch die Verwendung primär dickerer Schichten im Rahmen einer Spiral-CT-Untersuchung die Sensitivität bei der Untersuchung feingeweblicher Strukturen zu behalten und dadurch die Strahlenbelastung für den Patienten, sowie den zeitlichen Aufwand bei der Interpretation der Ergebnisse für den Untersucher zu verringern. Diese Untersuchungen wurden an Lymphknoten bei Spiral-CT-Aufnahmen des Thorax durchgeführt. Diesen Lymphknoten wird enorme Bedeutung im Rahmen des Staging maligner Erkrankungen, vor allem beim Staging des Bronchial-Karzinoms, aber auch der anderen Malignome des Brust- und Bauchraums, sowie deren Metastasen, zugeschrieben, insbesondere bei der Erfassung des für die Wahl der Therapie so wichtigen N0-Stadiums. In die Studie wurde ein Kollektiv von 97 Patienten (59 Männer, 38 Frauen; Altersverteilung von 9 bis 88 Jahren) aufgenommen und nach den vorliegenden Verdachtsdiagnosen in Gruppen mit malignen bzw. nicht-malignen Erkrankungen eingeteilt. Dabei wurde ihnen eine kontrastmittelunterstützte Multidetektor-Spiral-CT-Untersuchungen des Thorax durchgeführt, wobei die Untersuchungen klinisch indiziert wurden. Bei den Patienten mit malignen Erkrankungen wurden 4 Gruppen gebildet, jeweils mit abnehmender Häufigkeit (Lymphome/Leukämien, Bronchial-Karzinom, Mamma-Karzinom, sonstige Krebserkrankungen). Bei den „benignen“ Krankheitsbildern dominierten als Ursache Infektionen, sonstige externe Noxen und Krankheiten, bei denen ein allergen-bedingtes Grundleiden überwiegte. Fünf Schichtdicken, mit 1 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm und 20 mm, wurden evaluiert und miteinander verglichen. Als nominale Schichtdicke wurde die Schichtdicke mit 1 mm gewählt und die restlichen aus dieser rekonstruiert. Das Ergebnis dieser Studie ergab, dass es völlig ausreichend ist, eine 3 mm-Schichtdicke zu verwenden, was statistisch gesichert werden konnte. Die Statistik hat nämlich gezeigt, dass in Bezug auf die Beurteilung von mediastinalen Lymphknoten, was ihre Anzahl und Größe angeht, kein signifikanter Unterschied zwischen den Schichtdicken mit 1 mm und mit 3 mm besteht. Bei diesen Schichtdicken war auch der diagnostische Aussagewert bei der Bewertung des N0-Stadiums am größten (d. h. Lymphknotengröße < 1 cm). Im Gegensatz dazu zeigten die übrigen evaluierten Schichtdicken (5 mm, 10 mm und 20 mm) einen deutlichen Signifikanzunterschied untereinander und jeweils zu den Schichtdicken 1 mm und 3 mm.
Bewertung der globalen linksventrikulären Funktion: Vergleich der Mehrschicht-Spiral-CT mit der Angiokardiographie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Bewertung der globalen linksventrikulären Funktion (ESV, EDV, EF und SV)mittels EKG-gegateter ehrschicht-Spiral-Computertomographie (MSCT) unter Anwendung von vier verschiedenen Berechnungsverfahren, im Vergleich mit der Berechnung der linksventrikulären Funktion mittels Angiokardiographie.
Dosisermittlung und Beurteilung der Bildqualität beim Einsatz des ISO-C-3D am Hüftgelenk und an der Lendenwirbelsäule im Vergleich zur Spiral-CT
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
In dieser experimentellen Arbeit wurde die Strahlenbelastung in Zusammenschau mit der Bildqualität des neuen C-Bogens Siremobil ISO-C-3D evaluiert. Mit Hilfe eines Alderson-Phantoms wurden die Organ- und Effektivdosen ermittelt und mit der CT verglichen. Anhand von Leichenpräparaten wurde analog den Dosismessungen die Bildqualität beurteilt. Die Patientendosen des ISO-C-3D liegen in der Größenordnung einer Spiral-CT. Besonders zu berücksichtigen sind die Im Vergleich zur CT hohe Streustrahlung und Gonadendosen bei Untersuchungen beispielsweise der LWS, in der die Gonaden nicht direkt im Strahlengang liegen. Dadurch entsteht durch die Streustrahlung eine höhere Effektivdosis als in der CT. Deshalb sollte die Indikation zur Anwendung des ISO-C-3D streng gestellt werden. Der Vorschlag, mit dosisreduzierenden Protokollen die Patienten zu entlasten, wird sich aufgrund der begrenzten Bildqualität nicht durchsetzten. Die Bildgebung mittels des Standard-Protokolls des ISO-C-3D reicht für intraoperative Zwecke, z.B. Stellungskontrolle von Osteosynthesematerial, völlig aus. Zur praeoperativen Diagnostik wird allerdings die CT weiterhin Methode der 1. Wahl sein und vom ISO-C-3D nicht abgelöst werden, weil auch dem Standardprotokoll des ISO-C-3D Grenzen gesetzt sind.
Früherkennung des Bronchialkarzinoms mit der Niedrig-Dosis-Spiral-CT: Einfluss der Strahlendosisreduktion auf die Volumetrie pulmonaler Rundherde
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Die Niedrigdosis-Spiral-Computertomographie (CT) stellt eine vielversprechende Methode zur Früherkennung des Bronchialkarzinoms dar. Bei geringem Strahlenrisiko für den Screening-Teilnehmer können Rundherde ab einem Durchmesser von etwa 2-3 cm mit hoher Sensitivität detektiert werden. Die frühzeitige Erkennung malignitätsverdächtigen Wachstums kleiner pulmonaler Rundherde setzt allerdings eine hohe Meßgenauigkeit der Volumetrie voraus. In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welchen Einfluß eine Reduktion der Strahlendosis auf die Präzision und Reproduzierbarkeit der Volumetrie hat. Hierzu wurden volumetrische Messungen an kleinen pulmonalen Rundherden (Durchmesser zwischen 2,7 und 12,6 mm) am Phantom (n=120) als auch in vivo (n=39) durchgeführt. Die Strahlendosisreduktion erfolgte bei den Messungen am Phantom durch Röhrenstromreduktion und wurde bei den In-vivo-Messungen durch Verrauschung der CT-Rohdaten simuliert (Standard: 120 mAs, simulierte Röhrenströme zwischen 77 mAs und 3 mAs). Es wurde gezeigt, daß sich die bei erniedrigter Dosis gemessenen Volumina von denen bei Standarddosis (Röhrenstrom 120 mAs) gemessenen Volumina im Mittel um weniger als 5% unterscheiden. Bei 18 mAs (entsprechend einer Strahlendosisreduktion um 85%) betrug die maximale volumetrische Abweichung 20%. Unterhalb von 18 mAs nahmen sowohl die Erkennbarkeit als auch die Präzision der Volumetrie deutlich ab. Der relative volumetrische Meßfehler vergrößerte sich unabhängig von der Strahlendosis mit abnehmendem Durchmesser des Rundherdes sowie zunehmender Abweichung von der Kugelgestalt, ebenso bei Rundherden an Stellen innerhalb der Lunge mit erhöhtem Bildrauschen (z.B. dorsales Lungendrittel). Die Ergebnisse der Arbeit sprechen dafür, daß oberhalb eines kritischen Röhrenstromes von etwa 18 mAs eine Volumenverdopplung kleiner pulmonaler Rundherde zuverlässig mit der Niedrig-Dosis-CT nachgewiesen werden kann. Dies entspricht einer Dosiseinsparung von etwa 85%. Da bei reduzierter Strahlendosis im Mittel kleinere Volumina (Bias bei 18 mAs ca. - 3%) gemessen werden, sollten Verlaufskontrollen stets bei gleicher Strahlendosis durchgeführt werden.
Manganverstärkte Niederfeld-MRT bei 0,2 Tesla versus Spiral–CT–Arterioportographie zur Detektion maligner fokaler Leberläsionen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Ziel: Prospektive Evaluation des Stellenwertes der MnDPDP-verstärkten MRT am offenen Niederfeldgerät im Nachweis fokaler maligner Leberläsionen im Vergleich zur Spiral CT-Arterioportograhie (CTAP). Material und Methode: Im Rahmen einer Phase III Studie konnten zunächst insgesamt 27 konsekutive Patienten in die Studie eingeschlossen werden. 7 Patienten erfüllten im weiteren Verlauf nicht alle Einschlusskriterien und kamen nicht zur Auswertung. Bei allen Patienten wurde in einem Abstand von maximal 1 Woche eine native und eine manganverstärkte (MnDPDP) MRT der Leber bei 0,2 Tesla Feldstärke (Siemens Magnetom Open) sowie eine DSA mit unmittelbar folgender Spiral-CTAP (Siemens Somatom Plus 4) durchgeführt. Die Gesamtzahl und die nach Größe (a) < 1 cm, b) 1-2 cm und c) > 2 cm) aufgeschlüsselte Anzahl der gefundenen Läsionen wurde verglichen. Bei der statistischen Auswertung kam der Vorzeichentest mit einem Signifikanzniveau von p < 0,05 zur Anwendung. Ergebnisse: In der CTAP konnten wir insgesamt 114 Läsionen, in der nativen MRT 62 Läsionen und in der MRT nach MnDPDP-Gabe 69 Läsionen nachweisen. Der Unterschied war signifikant für die Gesamtzahl der Läsionen, für die Läsionsgröße b und für die zusammengefassten Läsionsgrößen a und b. Für die native und manganverstärkte MRT ergab sich kein signifikanter Unterschied. Schlussfolgerung: Mangafodipir sollte dem Einsatz an Hochfeldgeräten vorbehalten bleiben, da ein zuverlässiger Ausschluss bzw. Nachweis fokaler maligner Leberläsionen bei niedriger Feldstärke nicht zu erwarten ist.
Diagnostik fokaler Leberläsionen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Anhand von 466 Patienten, die im Zeitraum 2/96 bis 3/96 eine SPIO gestütze MRT-Untersuchung der Leber erhalten haben, wurde die diagnostische Leistungsfähigkeit der MRT und SPIO-MRT mit dem korrespondierenden biphasischen Spiral-CT verglichen. Dabei ergaben sich insbesondere bezüglich der Lebermetastasendiagnostik folgende Sensivitäten: CT 74,4%, native MRT 88,9%, SPIO-MRT 86,5%, Zusammenschau von MRT und SPIO-MRT 85,9%; und Spezifitäten: CT 49,6%, native MRT 62,8%, SPIO-MRT 62,5%, Zusammenschau von MRT und SPIO-MRT 62,0%. Die MRT zeigt sich der Spiral-CT also überlegen, zwischen MRT und SPIO-MRT ergab sich jedoch kein signifikanter Unterschied. Bei unserer Studie standen den Auswertern keinerlei klinische Hintergrundinformationen zur Verfügung, um jede Beeinflussung zu vermeiden. Die Diagnose konnte also nur aufgrund von Kontrastphänomenen allein gestellt werden, was zur exakten Läsionszuordnug in der MRT allein wohl doch nicht ausreicht. Die quantitative Auswertung der Signal zu Rausch-Verhältnisse für die MRT-Aufnahmen vor und nach SPIO-Gabe ergab einen signifikanten Signalabfall des normalen Lebergewebes nach Kontrastmittelapplikation, bei nicht signifikanter Änderung der Signalintensität der Läsionen, was zu einer deutlichen Zunahme des Leber-Läsions-Kontrastes vor allem auf T2-Aufhahmen führt.
Vergleich der Identifikation hepatischer, perihepatischer sowie abdomineller Gefäße: Computertomogaphie versus Digitale Subtraktionsangiographie (DSA)
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Es wurde untersucht, ob in der klinische Routine Information aus axialen CT-Bildern die konventionelle Angiographie ersetzen kann. Die Identifikation hepatischer, perihepatischer sowie abdomineller Gefäße war in der biphasisch kontrastverstärkten Spiral-CT und der DSA unterschiedlich. Die Qualität der Gefäßdarstellung war bei den Arterien in der Angiographie besser als in der Computertomogaphie und dies um so mehr, je kleiner die Gefäße waren. Bei den Venen war die Identifikation der Gefäße in der CT wesentlich besser als in der Angiographie. Für die kleinen intrahepatischen Arterien (A.hepatica dex. und –sin.) und für die großen Venen (V.portae, die V.lienalis und die V.mesenterica sup.) war der Unterschied zwischen Computertomographie und Angiographie nach McNemar signifikant (p
Vergleich der Niedrigdosis-Spiral-Computertomographie mit der konventionellen Spiral-Computertomographie in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Die Bedeutung der nativen Spiral-CT für die Diagnostik akuter Flankenschmerzen und speziell für die Detektion von Harnleitersteinen ist nach heutigem Kenntnisstand unbestritten. Vielfach wurden die exzellente Treffsicherheit und die differentialdiagnostischen Fähigkeiten dieser Methode bestätigt. Die Überlegenheit gegenüber den konkurrierenden Verfahren ist eindeutig. Trotz der unbestrittenen diagnostischen Vorteile gilt die verhältnismäßig hohe Strahlenexposition als bedeutender Nachteil der Spiral-CT. Dieser Sachverhalt wiegt schwer, weil die betroffenen Patienten vergleichsweise jung sind und infolge des chronischen Verlaufs des Harnsteinleidens wiederholt untersucht werden müssen. Aus diesem Grund, gibt es seit geraumer Zeit Bestrebungen, Untersuchungs-Protokolle für die Spiral-CT zu entwickeln, die mit einer minimalen Strahlenbelastung auskommen. Selbstverständlich müssen bei einem Niedrigdosis-Verfahren eine hohe Bildqualität und letztendlich eine den Standard-Protokollen mit konventioneller Dosisbelastung ebenbürtige diagnostische Aussagesicherheit gewährleistet werden. Für die native Spiral-CT der ableitenden Harnwege gibt es diesbezüglich bisher kaum Erfahrungen. Das Niedrigdosis-Verfahren wird bevorzugt zur Beurteilung von anatomischen Regionen mit ausgeprägten Unterschieden im Detailkontrast der einzelnen Strukturen eingesetzt. Eine besonders geeignete Indikation ist demnach der Nachweis von Harnleiterkonkrementen. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Überprüfung eines eigens entwickelten Niedrigdosis-Protokolls zur Abklärung akuter Flankenschmerzen unter dem speziellen Gesichtspunkt der Aussagesicherheit des Harnstein-Nachweises. Zum besseren Verständnis dieser Fragestellung werden die Grundzüge der Spiral-CT und des Niedrigdosis-Verfahrens dargelegt. In der hier vorgelegten Studie wurde ein Kollektiv von 109 Patienten mit akuten Flankenschmerzen mit einer nativen Spiral-CT nach dem Niedrigdosis-Protokoll untersucht. In 80 Fällen (73%) lag ein akutes Harnsteinleiden vor. Die Prävalenz der Urolithiasis ist bei diesen Patienten vergleichsweise hoch. In anderen Studien zur Überprüfung des diagnostischen Stellenwerts der nativen Spiral-CT liegt sie in einem Bereich von 39%-69% (26, 59, 54, 89, 100). Dies liegt daran, dass es sich hier um ein hochselektiertes Kollektiv handelt, da die Indikation zur Durchführung der nativen Spiral-CT ausschließlich von Urologen unter dem Aspekt Urolithiasis gestellt wurde. Mit dem hier vorgestellten Niedrigdosis-Verfahren wird pro Untersuchungsgang eine Reduktion der effektiven Dosisbelastung des Patienten auf ein Drittel bzw. ein Viertel der sonst gebräuchlichen konventionellen CT-Protokolle erzielt. Der diagnostische Stellenwert des Niedrigdosis-Verfahrens wurde anhand einer Beurteilung der Sensitivität und Spezifität für den Nachweis von Harnleitersteinen bestimmt. Daher wurden für einen direkten Vergleich entsprechende Ergebnisse bewährter Standard-Protokolle mit konventioneller Dosis herangezogen. Es zeigt sich, dass die diagnostische Aussagesicherheit der nativen Spiral-CT nach dem Niedrigdosis-Verfahren bei der Beurteilung durch einen erfahrenen Untersucher im Bereich des für etablierte Standard-Protokolle üblichen Niveaus liegt. Die native Spiral-CT ist auch im Niedrigdosis-Protokoll ein hervorragendes Verfahren zur primären Untersuchung von Patienten mit akuten Flankenschmerzen. Für diese Methode konnte eine hohe Aussagesicherheit für den Nachweis von Harnleitersteinen und weitere nicht steinassoziierte pathologische Prozesse nachgewiesen werden. Der entscheidende Gewinn ist die erhebliche Reduktion der effektiven Dosisbelastung. Mit dieser Methode gelingt es, den wichtigsten Nachteil der konventionellen nativen Spiral-CT - die verhältnismäßig hohe Dosisbelastung - zu beseitigen. Die weitere Verbreitung dieses Verfahrens ist wünschenswert. Dies gilt insbesondere auch unter dem Aspekt der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Methode. Sie ermöglicht eine Beschleunigung der Diagnostik und somit ein zügiges Einleiten der erforderlichen Therapie.