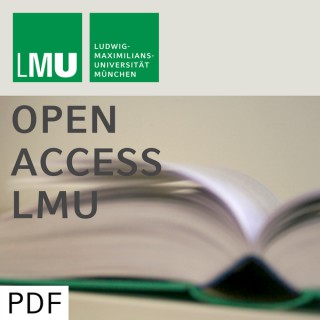Podcasts about cd40l
- 18PODCASTS
- 20EPISODES
- 11mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Jul 15, 2025LATEST

POPULARITY
Best podcasts about cd40l
Latest news about cd40l
- CD8+ T cell–derived CD40L mediates noncanonical cytotoxicity in CD40-expressing cancer cells | Science Advances AAAS: Science Advances: Table of Contents - May 21, 2025
- Eledon Pharmaceuticals Announces Use of Tegoprubart as Key Component of Immunosuppression Regimen in its Second Transplant of a Genetically Modified Pig Kidney into a Human Drugs.com - Clinical Trials - Feb 7, 2025
- Switching off autoimmunity | Science Science Magazine - Aug 22, 2024
- MS Med Nearly Eliminates Disease Activity on MRI Medscape Medical News - Jun 5, 2024
- Eledon’s Antibody Aids First Gene-Edited, Pig-to-Human Kidney Transplant BioSpace - Biotech News - Mar 22, 2024
- Frexalimab Has Favorable Effect on Relapsing Multiple Sclerosis Drugs.com - News for Health Professionals - Feb 14, 2024
- Increased intraocular inflammation in retinal vein occlusion is independent of circulating immune mediators and is involved in retinal oedema Frontiers in Neuroscience | New and Recent Articles - Jul 24, 2023
- Association between inflammatory biomarkers and cognitive aging PLOS ONE - Sep 9, 2022
Latest podcast episodes about cd40l
In this episode, we're joined by Dr. Dana DiRenzo to explore groundbreaking developments in the treatment of Sjögren's Disease. For the first time, therapies like BAFF blockade, CD40 ligand inhibitors, and FcRn antagonists appear poised to change the course of the disease—moving beyond symptom management to potential disease modification. We delve into the underlying science, current clinical trials, and tackle the big question: how early is early enough to begin treatment? Dr. DiRenzo also shares her expert perspective on holistic symptom management through what she calls the "4 Pillars of Health," offering practical strategies for improving quality of life for those living with Sjögren's.
#56. Ting som nevnes i denne episoden: aktivering av T- og B-celler. Effektorceller versus hukommelsesceller. Th1 vs Th2 vs Th17 vs. follikulære T-hjelpeceller. CD40 og CD40 ligand (CD40L). Antistoffproduserende celler (plasmablaster og plasmaceller). Opsonisering. Antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC). Komplementmediert cytotoksisitet (CDC).Tredje sesong er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Tonix Pharmaceuticals and Makana partner to advance research with Anti-Rejection therapy
Tonix Pharmaceuticals Holdings has announced a groundbreaking collaborative research agreement with Makana Therapeutics, aiming to explore the potential of TNX-1500, Tonix's anti-CD40L monoclonal antibody candidate, in advancing the field of xenotransplantation—the transplantation of animal-derived organs into human patients. In an interview with Steve Darling from Proactive, Tonix CEO Dr. Seth Lederman shared details of the preclinical partnership, which will evaluate TNX-1500 in combination with Makana's proprietary human-compatible organs and cells, derived from genetically engineered pigs. The collaboration will initially focus on kidney, heart, and islet cell transplant models, with the broader objective of developing new treatment options for patients suffering from organ failure. The preclinical studies are designed to generate data to support a future Investigational New Drug (IND) application to the U.S. Food and Drug Administration, with the goal of enabling compassionate use of xenotransplantation therapies in patients who have no alternative treatment options. Makana's approach centers around genetically engineered pigs that have been modified to lack swine leukocyte antigen (SLA), a key driver of immune rejection. These animals demonstrate enhanced compatibility with human biology and offer several potential advantages over competing technologies, including high fertility rates, increased litter sizes, and robust health profiles—key factors that support scalability and commercial viability in global markets. TNX-1500 is a next-generation anti-CD40L monoclonal antibody designed to modulate immune response while minimizing the risk of thrombosis—a common side effect associated with earlier anti-CD40L agents. The drug candidate holds promise in preventing organ transplant rejection, making it an ideal component of xenotransplantation protocols. #proactiveinvestors #tonixpharmaceuticalsholdingcorp #nasdaq #tnxp #Biotech #MPOXVaccine #Smallpox #TNX801 #VaccineDevelopment #ClinicalTrials #PharmaceuticalNews #MedicalResearch #WHO #GlobalHealth #InfectiousDiseases #Biopharma #ProactiveInvestors
Disrupting NKG2A:HLA-E Interactions for Enhanced Anti-Cancer Immunity
BUFFALO, NY- August 21, 2024 – A new #editorial was #published in Oncotarget's Volume 15 on July 17, 2024, entitled, “Strategies to disrupt NKG2A:HLA-E interactions for improved anti-cancer immunity.” Two studies using CRISPR screens in cancer cells identified HLA-E as a critical negative regulator of NK cell interactions with cancer cells. Consistent with this, IFNγ signaling was associated with NK cell resistance due to increased STAT1 activation and enhanced HLA-E expression. This effect is also evident in the murine homolog of HLA-E, Qa-1b, which was upregulated by inflammatory signals across all cell types tested. In addition to inflammatory signals, researchers Jack G. Fisher, Lara V. Graham, and Matthew D. Blunt from Clinical and Experimental Sciences, Faculty of Medicine at the University of Southampton, UK, recently demonstrated that surface expression of HLA-E is increased by lymph node-associated signals IL-4 and CD40L on primary chronic lymphocytic leukaemia (CLL) cells. Additionally, two recent studies have shown that HLA-E can protect circulating tumor cells from NK cell lysis via NKG2A, suggesting that targeting the NKG2A axis could be a promising strategy for preventing metastasis in solid tumors. “In conclusion, there is strong preclinical evidence that disruption of NKG2A interactions with HLA-E can stimulate both NK cell and cytotoxic T cell effector functions against cancer.” DOI - https://doi.org/10.18632/oncotarget.28610 Correspondence to - Matthew D. Blunt - m.d.blunt@soton.ac.uk Video short - https://www.youtube.com/watch?v=iQREIa-RToU Sign up for free Altmetric alerts about this article - https://oncotarget.altmetric.com/details/email_updates?id=10.18632%2Foncotarget.28610 Subscribe for free publication alerts from Oncotarget - https://www.oncotarget.com/subscribe/ Keywords - cancer, Natural killer (NK) cells, immunotherapy, NKG2A, immune checkpoint blockade, HLA-E About Oncotarget Oncotarget (a primarily oncology-focused, peer-reviewed, open access journal) aims to maximize research impact through insightful peer-review; eliminate borders between specialties by linking different fields of oncology, cancer research and biomedical sciences; and foster application of basic and clinical science. Oncotarget is indexed and archived by PubMed/Medline, PubMed Central, Scopus, EMBASE, META (Chan Zuckerberg Initiative) (2018-2022), and Dimensions (Digital Science). To learn more about Oncotarget, please visit https://www.oncotarget.com and connect with us: Facebook - https://www.facebook.com/Oncotarget/ X - https://twitter.com/oncotarget Instagram - https://www.instagram.com/oncotargetjrnl/ YouTube - https://www.youtube.com/@OncotargetJournal LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/oncotarget Pinterest - https://www.pinterest.com/oncotarget/ Reddit - https://www.reddit.com/user/Oncotarget/ Spotify - https://open.spotify.com/show/0gRwT6BqYWJzxzmjPJwtVh MEDIA@IMPACTJOURNALS.COM
Biotech Breakthroughs: Advancements in MS Treatment, Cancer Detection, and Targeted Therapies
Good morning from Pharma and Biotech Daily, the podcast that gives you only what's important to hear in the Pharma and Biotech world. French drugmaker Sanofi has announced positive results from a Phase II trial of its experimental drug frexalimab in relapsing multiple sclerosis (MS). The trial, published in the New England Journal of Medicine, showed that frexalimab significantly slowed disease activity in patients with relapsing MS. The drug targets a protein called CD40L, which is involved in the activation of immune cells that attack the protective covering of nerve fibers in patients with MS. Sanofi plans to continue clinical testing of frexalimab and aims for peak annual sales of $5 billion for the drug.In other news, biopharma companies Catalent, Aurinia, and Sandoz have recently announced staff cuts. Biospace is tracking these layoffs and providing updates on the latest industry developments.Moving on to funding news, biotech company Freenome has raised $254 million in a fundraising round led by Roche. Freenome is developing blood-based tests for cancer detection and aims to advance its tests as pivotal readouts approach. Another biotech company, Firefly Bio, has emerged from stealth mode with $94 million in Series A funding. Firefly Bio is focused on developing antibody-drug conjugates and protein degraders for targeted cancer therapies.Lastly, Bristol Myers Squibb is leading the future of protein degradation with its three-pronged approach to developing targeted protein degraders. The company aims to design next-generation degraders that can attack disease targets with precision and agility.These developments highlight the progress being made in the biopharma industry in areas such as multiple sclerosis treatment, cancer detection, targeted cancer therapies, and protein degradation.
Dendritic cell vaccination combined with CTLA4 blockade
Dr Kris Thielemans (Medical School of the VUB, Brussels, Belgium) talks to ecancertv the 1st Immunotherapy of Cancer Conference ( ITOC ) in Munich. Electroporation of dendritic cells (DC) with mRNA allows the loading of these cells with tumour antigens and the functional modification of a cellular vaccine. To this goal, the team provided three different molecular adjuvants to immature, monocyte derived DCs through electroporation with mRNA coding for CD40L, CD70 and caTLR4 or so-called TriMix mRNA. At Vrije Universiteit, Brussels, clinical trials in pretreated advanced melanoma patients are being performed. These patients are treated with TriMixDC-MEL, a mixture of TriMix-DC co-electroporated with mRNA encoding a fusion of DC-LAMP and 4 different melanoma associated antigens (gp100, tyrosinase, MAGE-C2 or MAGE-A3). In a pilot clinical trial, 24x106 TriMixDC-MEL cells were administrated solely by the intradermal (ID) route. Subsequently, a phase IB was conducted to investigate the safety of administrating TriMixDC-MEL by the intravenous (IV) and ID-route. ID administration of TriMixDC-MEL was found to be feasible, safe, effectively stimulating CD8 T-cell responses, but did not result in objective tumour responses. In contrast, the combined ID/IV administration is associated with distinct but manageable side-effects and has seemingly superior clinical activity as compared to DC administered solely ID in patients with pretreated advanced melanoma. The team investigated the safety and activity of TriMixDC-MEL combined with ipilimumab. This phase II study of TriMixDC-MEL ID/IV in combination with ipilimumab demonstrates anti-melanoma activity in over 50% of the patients with therapy resistant advanced melanoma.
CD40-CD40L: Linking pancreatic, adipose tissue and vascular inflammation in type 2 diabetes and its complications
Numerous epidemiological studies have consistently demonstrated the strong association between type 2 diabetes mellitus (T2DM) and an increased risk to develop cardiovascular disease. The pathogenesis of T2DM and its complications are characterized by pancreatic, adipose tissue and vascular inflammation. CD40 and CD40L, members of the tumour necrosis factor (receptor) TNF(R) family, are well known for their role in immunity and inflammation. Here we give an overview on the role of CD40-CD40L interactions in the pathogenesis of T2DM with a special focus on pancreatic, adipose tissue and vascular inflammation. In addition, we explore the role of soluble CD40L (sCD40L) as a potential biomarker for the development of cardiovascular disease in T2DM subjects. Finally, the therapeutic potential of CD40-CD40L inhibition in T2DM is highlighted.
hTERT, CD23 und CD229 als Tumorantigene bei der B-CLL
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/06
Eine kritische Vorraussetzung für eine effektive Krebstherapie stellt die Identifizierung von Tumor-spezifischen oder Tumor-assoziierten Antigenen (TAAs) dar. Diese Antigene sollten Peptidsequenzen besitzen, die an MHC-Moleküle binden. Auch sollten diese von Tumorzellen prozessiert und auf MHC-Molekülen präsentiert werden. Ein weiteres TAA-Kriterium stellt die Überexpression im Tumor dar, was eine Erkennung durch T-Zellen ermöglicht und folglich eine Tumor-spezifische Immunantwort nach sich ziehen soll. Bei der B-chronischen lymphatischen Leukämie (B-CLL) wurden bislang nur wenige Tumorantigene identifiziert, die als potentielle Zielstrukturen für eine Generierung einer spezifischen T-Zellantwort in Frage kommen. Daher sind die Bestrebungen groß, neue B CLL-assoziierte Antigene zu identifizieren. In dieser Arbeit wurden die Moleküle hTERT, CD23 und CD229 hinsichtlich ihrer Möglichkeiten untersucht, als TAAs bei der B-CLL zu fungieren. Die katalytische Untereinheit der humanen Telomerase Reverse Transkripase (hTERT), stellt ein universelles Tumorantigen dar, das in einer Vielzahl verschiedener Krebstypen, einschließlich hämatopoetischer Erkrankungen, exprimiert wird, jedoch nicht oder nur in geringem Maße bei adulten, gesunden, differenzierten Zellen detektierbar ist. Der humane Niedrig-Affinitätsrezeptor für IgE, auch bekannt als CD23, ist auf verschiedenen hämatopoetischen Zellen zu finden. Bei der B-CLL wird CD23 konstitutiv exprimiert und atypisch auf den malignen B-Zellen reguliert im Vergleich zu normalen B-Lymphozyten. Dies hat eine starke Überexpression des Moleküls zur Folge. Das Humane Ly9 oder CD229, das Homolog zum murinen Ly9, ist ein Mitglied der SLAM- (signaling lymphocyte activation molecule) Familie, die Singnalrezeptoren repräsentieren. CD229 interagiert mit Antigen-spezifischen Rezeptoren und vermittelt so die Zelladhäsion zwischen Lymphozyten und anderen Zellen. Die Überexpression von CD229 auf hämatopoetischen Zellen wurde in einer Publikation beschrieben, die gezeigt hat, dass 12/15 B-CLL Patienten positiv für das Molekül waren. Ein Merkmal eines Tumorantigens/TAAs stellt die Überexpression in einem Tumor im Vergleich zum Normalgewebe dar. Alle drei Antigene wurden bezüglich ihres Expressionsprofils untersucht, und es konnte eine eindeutige Überexpression verglichen mit normalen Zellen nachgewiesen werden (RT-PCR, FACS-Analysen). Die Immunogenität und MHC-Restriktion (hier HLA-A0201) der ausgewählten Peptide wurde mit Hilfe in vitro generierter zytotoxischer T-Zellen (CTLs) von gesunden Spendern gezeigt, die Antigen-spezifisch durch Stimulation mit autologen, Peptid-beladenen Dendritischen Zellen (DCs) expandiert wurden. Die endogene Prozessierung und Präsentation der potentiellen Tumorantigene, genauer der verschiedenen hTERT-, CD23- und CD229-entstammenden Peptide, konnte mit Hilfe Antigen-spezifischer CTLs von gesunden Spendern nachgewiesen werden, da diese spezifisch die HLA-A0201+ B-Zell-abstammende Zelllinie Ramos, HLA-A0201+ naive B-CLL Zellen und Peptid-beladene T2-Zellen in MHC-I-restringierter Weise erkannten (IFN-γ-ELISPOT Assays, [Cr51]-release Assay). Diese Experimente lassen auf eine natürliche Prozessierung und Präsentation der hTERT-, CD23- und CD229-entstammenden Peptide via HLA-A0201 auf den B-CLL Zellen schließen. Des Weiteren konnten autologe hTERT-, CD23- and CD229-spezifische T-Zellen von B-CLL Patienten in Gegenwart von autologen CD40L-aktivierten B CLL Zellen und interessanterweise auch durch autologe, naive, maligne B-Zellen expandiert werden, die einen deutlichen Anti-leukämischen Effekt zeigten (IFN-γ-ELISPOT Assays, Dimerfärbungen). Ein möglicher Grund für die Generierung einer T-Zellantwort mit autologen naiven B-CLL Zellen als Stimulatoren scheinen das von den B-CLL Zellen vermittelte Mikromilieu (Zytokinprofil) darzustellen. Anhand der Quantität und Qualität der erzielten CTL-Reaktivitäten gegen die drei unterschiedlichen Moleküle zeigte sich, dass vor allem die Oberflächenmoleküle CD229 und CD23 als neue TAAs bei der B-CLL geeignet scheinen. hTERT ist ebenfalls in der Lage, eine Antigen-spezifische T-Zellreaktion zu induzieren, jedoch mit geringerer Effizienz. Zusammenfassend konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass CD229 und CD23 natürlich prozessiert und als TAAs bei der B-CLL präsentiert werden, die die Expansion autologer Tumor-spezifischer T-Zellen erlauben. Daher stellen sie geeignete Zielstrukturen für T-Zellbasierte, immuntherapeutische Strategien und ein Immunmonitoring bei dieser hämatologischen Erkrankung dar. Für hTERT gilt dies jedoch nur bedingt.
Induktion Epstein-Barr Virus-spezifischer Immunantworten durch Exosomen und Virus-like Particles
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/06
EBV ist ein Herpesvirus, welches in über 90% aller Erwachsenen nachgewiesen werden kann und in den wenigsten Fällen Beschwerden verursacht. Unter bestimmten Umständen kann es aber zur Ausbildung einer Infektiösen Mononukleosekommen und auch an der Entstehung einer Reihe von Krebserkrankungen, allenvoran die PTLD (posttransplant lymphoproliferative disease), das Burkitt- und das Hodgkin-Lymphom, ist EBV ursächlich beteiligt. Trotz zahlreicher Bemühungen und einiger vielversprechender Ansätze ist bis heute kein wirksamer Impfstoff gegen das Epstein-Barr Virus vorhanden. Im Bereich Exosomen als Mittel zur Induktion von Immunantworten wird seit gut 10 Jahren geforscht und ihre Wirksamkeit konnte bereits in klinischen Studien zur Behandlung mehrerer Krebsarten getestet werden. In dieser Doktorarbeit wurden HEK 293-Zellen und ein auf diesen Zellen basierendes Verpackungssystem für virale Vektoren auf ihre Eignung hin untersucht, rekombinante Exosomen und Virus-like-Particles (VLPs) zu produzieren, welche eventuell als DNA-freies Vakzin gegen EBV eingesetzt werden könnten. In EBV-positiven Verpackungszelllinien konnte durch Induktion des lytischen EBV-Zyklus die Freisetzung DNA-freier VLPs erreicht werden. Genau wie Exosomen aus 293-Zellen, die zuvor mit Expressionsplasmiden für EBV-Antigene transfiziert worden waren, konnten sie aus dem Zellkulturmedium aufgereinigt werden. Ihr großes immunogenes Potential zeigte sich bei der Reaktivierung von EBV-spezifischen TZellklonen und Gedächtnis-T-Zellen aus PBMCs, wo bereits geringe Mengen für eine Stimulation ausreichten. Zu der hohen Effizienz der Partikel trug ihr Tropismus bei, der auf virale Glykoproteine, vor allem gp350, zurückzuführen war. Die Partikel besaßen dadurch eine Affinität zu B-Zellen, über die effizient die Präsentation der Exosomen und Virus-like-Particles erfolgte. Auch in in vivo-Versuchen, bei denen mit dem hu-PBMC-Rag-Mausmodell und dem MHV-68-Mausmodell gearbeitet wurde, konnten durch Immunisierung mit Exosomen bzw. Virus-like-Particles virusspezifische humorale wie zelluläre Imunantworten ausgelöst werden. In Stimulationsexperimenten von malignen Zellen aus Patienten mit chronisch lymphatischer B-Zellleukämie (B-CLL) konnte ich weiterhin zeigen, dass Exosomen und VLPs auch als Überträger funktioneller Moleküle wie den CD40L, einem Mitglied der Tumor-Nekrose-Faktor-Familie, fungieren können. Dieser bewirkte in den sonst nicht immunogenen und deshalb vom Immunsystem nicht erkannten CLL-Zellen eine verstärkte Expression kostimulatorischer, Adhäsions- und apoptoseassoziierter Moleküle. Auf diese Weise war es möglich, autologe Tumor- und EBV-spezifische T-Zellen zu reaktivieren. Exosomen und Virus-like-Particles könnten deshalb bei der Behandlung der B-CLL eine vielversprechende Alternative zur Gentherapie darstellen.
Untersuchungen zum Einfluss der Zytokine CD40L, IL-6 und IL-10 auf die terminale Differenzierung der B-Lymphozyten des Haushuhns
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/07
Sat, 13 Feb 2010 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11242/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11242/1/Schumacher_Magdalena.pdf Schumacher, Magdalena
Etablierung der RCAS-Gentransfertechnologie zur Durchführung funktionell-genomischer Studien beim Haushuhn
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/07
Introduction of the RCAS retroviral gene transfer technology for functional genomic studies in the chicken The recently sequenced chicken genome now allows the identification of so far unknown genes. Some of them may play a potential role in the regulation of the immune system. In future studies roles of these genes have to be analyzed. At this in vitro studies will be used firstly. But in vivo functions of those genes will have to be described in the end. Therefore techniques for a fast and efficient over expression and knock down of candidate genes have to be established. Goal of this work was to prove the applicability of the RCAS retroviral vector system, which has been developed in the 1980s. This highly efficient system is based on a replication competent Rous Sarkoma-Virus and has already been used in cell and developmental biology studies in the chicken. However studies on its application after hatch haven´t been performed so far, despite its particular relevance for studies on the chicken immune system as it is widely immature at the time of hatch. In the first part of this work, a green fluorescent protein (GFP) expressing vector was constructed. An influence of the chicken line on the susceptibility of chicken embryo fibroblasts was detected in flow cytometric analyses. A possible reason could be the presence of endogenous retroviruses in less susceptible chicken lines leading to receptor interference. In accordance with this observation in in vivo tests retrovirus free chickens showed more homogenous plasma titers of RCAS based protein than a commercial chicken line. As GFP expression was predominantly seen in endothelial cells, the RCAS technology can be considered as particularly eligible for the expression of soluble proteins. Additionally viral protein was demonstrated to be expressed in bursal cells and heart muscle. For further characterization of the RCAS system vectors for the expression of the cytokine chBAFF or a soluble chBAFF receptor construct (huBCMA-Fc) were used. Plasma expression of biologically active cytokine was detectable throughout the entire experiment (two months). RCAS(BP)A-chBAFF-Flag transduced birds showed in comparison to controls significantly increased B cell frequencies in the spleen as well as enhanced plasma antibody titers. On the other hand animals expressing the soluble receptor huBCMA-Fc showed a significant reduction of splenic B cell frequency and an inhibited development of the bursa of fabricius. These findings correspond to the data obtained in studies with recombinant proteins. In the second part of this work the experiences with the RCAS technology were used to evaluate the function of the CD40/CD40L system as a second cytokine system. A soluble chCD40-huFc fusion protein was constructed as a functional inhibitor for CD40/CD40L interaction. In vitro tests showed that chCD40-huFc was able to bind a soluble chCD40L fusion protein. In vivo the RCAS based expression of chCD40-huFc caused a reduction of the blood B cell frequency and the bursa weight. Possibly the functional inhibition of the CD40/CD40L system decreases the number of B cells emigrating from the bursal medulla. Unlike in humans with a defect in the CD40L gene in chickens expressing chCD40-huFc the plasma IgM titer was not increased. However plasma titers of IgA and IgG were decreased, comparably with humans and mice with CD40L defects. The RCAS gene transfer technology was proved in two different model systems as an excellent system for analyses of cytokine functions in the chicken. Furthermore this system could also be used for functional analyses of growth factors and hormones.
Rolle von T-Zellen bei Ischämie-Reperfusion der Leber
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Die protektive Wirkung von Immunsuppressiva auf den hepatischen I/R-Schaden deutet darauf hin, dass T-Zellen bei diesem alloantigen-unabhängigen Ereignis eine Rolle spielen. Die Mechanismen der Aktivierung bzw. der mikrovaskulären Rekrutierung von CD4+ T-Zellen bei alloantigen-unabhängiger I/R der Leber sind jedoch weitgehend ungeklärt. Ziele der vorliegenden Arbeit waren daher (1) die Rekrutierung von T-Zell-Subopulationen in den postischämischen hepatischen Mikrogefäßen in vivo zu untersuchen, (2) die Mechanismen einer Interaktion von CD4+ T-Zellen und Thrombozyten während hepatischer I/R zu analysieren, (3) die Rolle von CD4+ T-Zellen an der Ausbildung des hepatischen I/R-Schadens zu beurteilen, (4) zu untersuchen, ob die postischämische Rekrutierung von CD4+ T-Zellen MHC Klasse II-abhängig stattfindet und (5) zu analysieren, ob CD4+ T-Zellen während hepatischer I/R mit Kupffer-Zellen interagieren. In der vorliegenden Studie konnte erstmals in vivo der Typ, die mikrovaskuläre Lokalisation und die Kinetik der Lymphozyten-Endothelzell-Interaktion während hepatischer I/R intravitalmikroskopisch charakterisiert werden. So konnte gezeigt werden, dass insbesondere CD4+ T-Zellen, und nicht CD8+ T-Zellen, während I/R in der hepatischen Mikrozirkulation akkumulieren. Diese Akkumulation tritt hauptsächlich in den Sinusoiden auf, nur zu einem geringeren Teil in den postsinusoidalen Venolen. Bereits nach 30-minütiger Reperfusion ist gegenüber der schein-operierten Gruppe eine signifikante Zunahme der Anzahl akkumulierter CD4+ T-Zellen in den Mikrogefäßen der Leber zu beobachten, die Anzahl emigrierter CD4+ T-Zellen nimmt im Verlauf der Reperfusionszeit signifikant zu. Im Rahmen der Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass CD4+ T-Zellen an der Ausbildung des hepatischen I/R-Schadens beteiligt sind. Über CD40L- und CD28-abhängige Signalwege ist die postischämische Akkumulation von Thrombozyten und Leukozyten in der hepatischen Mikrozirkulation von CD4+ T-Zellen abhängig. Darüber hinaus wird die Ausbildung des mikrovaskulären Schadens, gemessen anhand des sinusoidalen Perfusionsdefizites, sowie die Ausbildung des hepatozellulären Schadens, gemessen anhand der hepatischen Transaminasen, CD40L- und CD28-abhängig über CD4+ T-Zellen mediiert. Mittels simultaner Visualisierung zweier Zellpopulationen in vivo konnte in dieser Dissertations¬schrift erstmals nachgewiesen werden, dass CD4+ T-Zellen und Thrombozyten während hepatischer I/R kolokalisieren. Unter Verwendung P-Selektin- und CD40L-defizienter Mäuse konnte in vivo nachgewiesen werden, dass eine feste Adhärenz zwischen Thrombozyten und CD4+ T-Zellen über P-Selektin und PSGL-1 vermittelt wird, während die kostimulatorischen Moleküle CD40 und CD40L eine reziproke Aktivierung unter Thrombozyten und CD4+ T-Zellen bedingen. In einem weiteren Abschnitt dieser Studie konnte unter Verwendung von blockierenden Antikörpern schließlich erstmals in vivo gezeigt werden, dass die im Rahmen der hepatischen I/R stattfindende Aktivierung von CD4+ T-Zellen MHC-Klasse II-unabhängig abläuft. Schließlich wurde in einem weiteren Abschnitt dieser Dissertationsschrift erstmals in vivo nachgewiesen, dass eine reziproke Aktivierung von Kupffer-Zellen und CD4+ T-Zellen während hepatischer I/R vorliegt. Die Anzahl postischämisch akkumulierter CD4+ T-Zellen ist nicht nur nach vollständiger Depletion von Kupffer-Zellen, sondern auch nach selektiver Unterbindung der Signalwege über TNF-α und IL-6 sowie des Abfangens freier Sauerstoffradikaler signifikant vermindert. Vice versa konnte hier Anhand der Untersuchung der Phagozytoseaktivität von Kupffer Zellen mittels Latex-Beads gezeigt werden, dass CD4+ T-Zellen die Aktivität von Kupffer-Zellen beeinflussen. Weitergehende Untersuchungen zur reziproken Aktivierung von Kupffer-Zellen und CD4+ T-Zellen konnten unter Verwendung von Durchflusszytometrie zeigen, dass proinflammatorische Mediatoren wie TNF-α und IL-6, vornehmlich freigesetzt durch Kupffer-Zellen während hepatischer I/R, nicht nur direkt aktivierend auf CD4+ T-Zellen wirken, sondern auch sinusoidale Endothelzellen aktivieren können. Eine Aktivierung der sinusoidalen Endothelzellen mit entsprechender Alteration der Expression von Adhäsionsmolekülen, wie z.B. ICAM-1, VCAM-1 und VAP-1 stellt wiederum einen pathophysiologischen Mechanismus dar, der mit einer konsekutiven Verstärkung der Akkumulation von CD4+ T-Zellen nach I/R verbunden ist. Zusammenfassend weisen diese in vivo Daten darauf hin, dass hepatische I/R die Akkumulation und Emigration von CD4+ T-Zellen, jedoch nicht von CD8+ T-Zellen induziert. Adhärente CD4+ T-Zellen sind in Sinusoiden mit Thrombozyten kolokalisiert; dies lässt eine gegenseitige Aktivierung beider Zelltypen durch direkten Zellkontakt oder über die Aktivierung des Endothels vermuten. Eine CD4 T-Zell-Defizienz geht mit einer Verminderung der postischämischen Thrombozytenakkumulation und mit einer Reduktion des mikrovaskulären I/R-Schadens einher. Die postischämische Rekrutierung von CD4+ T-Zellen in hepatischen Mikrogefäßen wird durch Kupffer-Zellen, wahrscheinlich über die Freisetzung von Sauerstoffradikalen, TNF-α und IL-6, vermittelt.
Charakterisierung des CD40-CD40L-Systems als wichtiger Regulator der B-Zellfunktion des Haushuhns
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
Die B-Zellentwicklung der Vögel zeigt im Vergleich zu Maus und Mensch grundsätzliche Unterschiede. Davon ausgehend konnte in neuerer Zeit auch für die meisten Haustierspezies gezeigt werden, dass sie für die Reifung ihrer B-Zellen darmassoziiertes lymphatisches Gewebe (GALT) verwenden. Da Hühner-B-Zellen in einem einzigartigen GALT-Organ, der Bursa fabricii reifen, stellt das Huhn ein exzellentes Modell dar, um die zugrunde liegenden Mechanismen der B-Zellreifung zu studieren. Zahlreiche Mausmodelle zeigen, dass TNF-TNF-R- Familienmitglieder wichtige Regulatoren der B-Zellreifung und –funktion darstellen. Um die Struktur und die Funktion des CD40-CD40L-Systems im Huhn zu untersuchen, wurde zuerst das CD40-Expressionsmuster auf hämatopoetischen Zellen und verschiedenen Zellinien mittels durchflusszytometrischer Untersuchungen unter Verwendung des monoklonalen Antikörpers AV79 analysiert. Alle B-Zellen aus Blut, Milz, Zäkaltonsillen und der Bursa exprimierten das CD40-Antigen. Im Gegensatz dazu konnte CD40 nur auf einer Subpopulation der T-Zellen gefunden werden. Bei der Analyse von Zellinien konnten sowohl eine B-Zellinie als auch eine T-Zellinie sowie embryonale Fibroblasten als CD40+ Zellen identifiziert werden. Um die funktionelle Rolle von CD40 im B-Zellsystem zu studieren, wurden B-Zellen aus Bursa, Milz und Zäkaltonsillen mit einem rekombinanten CD40L-Konstrukt stimuliert. Die Zugabe von rChCD40L verlängerte die Lebensspanne von B-Zellen signifikant und induzierte sowohl eine Proliferation der B-Zellen als auch einen Klassenwechsel der Immunglobuline. Die Aktivierung der B-Zellen durch rChCD40L führt zu einer verstärkten Expression von MHCII-Molekülen sowie zur Sekretion von IL-6. Zusätzlich konnten durch rChCD40L erstmals Langzeitkulturen primärer Hühner-B-Zellen etabliert werden. In diesen Langzeitkulturen war rChCD40L in der Lage, die antigenspezifischen Antikörpertiter in in vitro-Kulturen von Milz-B-Zellen immunisierter Tiere signifikant zu erhöhen. Ausgehend von diesen Daten kann auf eine essentielle Rolle des CD40-CD40L-Systems in der Entwicklung und der Funktion der B-Zellen in einem nicht zu den Säugetieren gehörenden Wirbeltier geschlossen werden. Somit stellt das CD40-CD40L-System ein phylogenetisch konserviertes System dar. Darüber hinaus bietet die Etablierung von Langzeitkulturen primärer Hühner-B-Zellen ein neues Werkzeug für Studien zur Wirt-Pathogen-Interaktion.
Charakterisierung des Extracellular Matrix Metalloproteinase Inducer (EMMPRIN/CD147) auf Thrombozyten und Untersuchung zur funktionellen Relevanz bei der Arteriosklerose
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
Der „Extracellular Matrix Metalloproteinase Inducer“ EMMPRIN ist bisher im Wesentlichen bekannt aus der Tumorpathologie; er induziert in umliegenden Fibroblasten eine Aktivierung der Matrix Metalloproteinasen (MMPs). Die Beteiligung von EMMPRIN am arteriosklerotischen Geschehen konnte in früheren Untersuchungen durch den Nachweis der EMMPRIN-Expression in verschiedenen kardiovaskulären Zellen wie Monozyten, Endothelzellen und glatten Muskelzellen in der arteriosklerotischen Plaque erbracht werden. Diese Arbeit beschreibt erstmals das Vorkommen von EMMPRIN auf Thrombozyten. Der Rezeptor wird im offenen kanalikulären System von ruhenden Thrombozyten gespeichert und aktivierungsabhängig an der Zelloberfläche exprimiert. Für die Untersuchungen zur funktionellen Relevanz von EMMPRIN auf den Thrombozyten und für weiterführende in vivo-Versuche beschreibt die vorliegende Arbeit die Generierung muriner Thrombozyten, welche mittels retroviralem Gentransfers eine Überexpression von EMMPRIN an der Zelloberfläche aufweisen. Die siRNA-Technologie wurde eingesetzt, um die EMMPRIN-Synthese der koinkubierten Monozyten zu hemmen. Eine funktionelle Relevanz von EMMPRIN bei zellulären Interaktionen konnte nachgewiesen werden. So führt die Wechselwirkung der Thrombozyten untereinander EMMPRIN-vermittelt zu einer Aktivierung der Zellen mit weiterer Expression von Adhäsionsmolekülen wie P-Selektin und CD40L. Die Interaktion der Thrombozyten mit Monozyten führt EMMPRIN-vermittelt zu einer vermehrten Aktivität der monozytären MMP-9. Bei der Wechselwirkung zwischen Thrombozyten und Monozyten aktiviert EMMPRIN außerdem den Transkriptionsfaktor NF-kappaB über den klassischen Weg und induziert dadurch eine vermehrte Sekretion des proinflammatorischen Interleukin 6. EMMPRIN könnte somit ein neuer therapeutischer Angriffspunkt sein für die Identifikation rupturgefährdeter Plaques. Deren Progression könnte durch eine pharmakologische Hemmung von EMMPRIN möglicherweise reduziert werden.
Generation of clinical grade dendritic cells with capacity to produce biologically active IL-12p70
Background: For optimal T cell activation it is desirable that dendritic cells (DCs) display peptides within MHC molecules as signal 1, costimulatory molecules as signal 2 and, in addition, produce IL-12p70 as signal 3. IL-12p70 polarizes T cell responses towards CD4(+) T helper 1 cells, which then support the development of CD8(+) cytotoxic T lymphocytes. We therefore developed new maturation cocktails allowing DCs to produce biologically active IL-12p70 for large-scale cancer vaccine development. Methods: After elutriation of leukapheresis products in a closed bag system, enriched monocytes were cultured with GM-CSF and IL-4 for six days to generate immature DCs that were then matured with cocktails, containing cytokines, interferon-gamma, prostaglandin E2, and a ligand for Toll-like receptor 8, with or without poly (I: C). Results: Mature DCs expressed appropriate maturation markers and the lymph node homing chemokine receptor, CCR7. They retained full maturity after culture for two days without maturation cocktails and following cryopreservation. TLR ligand stimulation induced DCs capable of secreting IL-12p70 in primary cultures and after one day of coculture with CD40L-expressing fibroblasts, mimicking an encounter with T cells. DCs matured with our new cocktails containing TLR8 ligand, with or without poly (I: C), induced alloresponses and stimulated virus-specific T cells after peptide-pulsing. DCs matured in cocktails containing TLR8 ligand without poly (I: C) could also be loaded with RNA as a source of antigen, whereas DCs matured in cocktails containing poly (I: C) were unable to express proteins following RNA transfer by electroporation. Conclusion: Our new maturation cocktails allowed easy DC harvesting, stable maturation and substantial recoveries of mature DCs after cryopreservation. Our procedure for generating DCs is easily adaptable for GMP-compliance and yields IL-12p70-secreting DCs suitable for development of cancer vaccines using peptides or RNA as sources of immunizing antigens.
Einfluss der Aktivierung dendritischer Zellen auf die Immunantwort in vitro
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Im Angesicht der augenscheinlichen Insuffizienz vorhandener Optionen in der Behandlung des metastasierten Pankreaskarzinoms stellt die Immuntherapie mit dendritischen Zellen einen möglichen neuen Therapieansatz dar. Bei einer Vielzahl von Malignomen wird diese Art der Therapie experimentell bereits klinisch getestet, bisher jedoch nicht mit ausreichendem Erfolg. Ziel dieser Arbeit war es, zu eruieren, welchen Einfluss der Modus der Aktivierung dendritischer Zellen auf eine gegen Pankreaskarzinomzellen gerichtete Immunantwort besitzt. Dabei sollten Wege identifiziert werden, eine aus dendritischen Zellen bestehenden Vakzine durch eine effektive Stimulation der enthaltenen Zellen möglichst potent in der Induktion dieser Immunantwort zu machen. Zu diesem Zwecke wurden von Monozyten abgeleitete dendritische Zellen mit dem Überstand apoptotischer Tumorzellen eines duktalen Pankreaskarzinoms inkubiert und dann nach verschiedenen Schemata stimuliert. Die Potenz der dendritischen Zellen wurde eruiert über die Expression von Reifemarkern und kostimulatorischen Molekülen, die Zytokinproduktion und die Induktion von Aktivierungsmarkern auf T-Zellen sowie der CTL-getragenen spezifischen Immunantwort gegen Pankreaskarzinomzellen in einer halbautologen Kokultur von dendritischen Zellen und naiven T-Zellen. Zur Stimulation der dendritischen Zellen kamen ATP mit TNFalpha und die Kombination von IL-1beta, IL-6, TNFalpha und PGE2 mit und ohne die Zugabe von CD40-Ligand, einem zellgebundenen, DC-aktivierenden Oberflächenmolekül, zur Anwendung. Die kombinierte Anwendung von CD40L und proinflammatorischen Mediatoren (TNFalpha, IL-6, IL-1beta und PGE2 bzw. ATP plus TNFalpha) besaß, verglichen mit der getrennten Anwendung dieser Stimuli, einen synergischen Effekt bei der Aktivierung dendritischer Zellen. So stimulierte Zellen zeigten eine hohe Expression von Aktivierungsmarkern und des Zytokinrezeptors CCR7, induzierten effektiv ein Th1-gerichtetes Zytokinmillieu und eine CTL-vermittelte spezifische Immunantwort gegen Pankreaskarzinomzellen. Die Zugabe von CD40-Ligand 12 h nach der Stimulation der dendritischen Zellen mit ATP und TNFalpha bzw. der Kombination von IL-1beta, IL-6, TNFalpha und PGE2 erwies sich dabei als optimal. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass die Art der Stimulation der dendritischen Zellen im Rahmen der Immuntherapie des duktalen Pankreaskarzinoms einen wesentlichen Einflussfaktor in Bezug auf die Potenz der verwendeten Vakzine darstellt. Geht man von einer Übertragbarkeit dieser in-vitro-Daten auf das menschliche Immunsystem aus, so kann mit Hilfe einer optimalen Aktivierung dendritischer Zellen die Effektivität einer Vakzine wesentlich gesteigert werden.
Gentransfer in primäre B-CLL-Zellen mittels EBV abgeleiteter Genvektoren
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Die chronische lymphatische Leukämie ist die häufigste Leukämie im Erwachsenenalter in den westlichen Ländern. Erkenntnisse der letzten Jahre haben das Spektrum verfügbarer Therapien deutlich erweitert, kurativ ist bisher nur die allogene Knochenmarkstransplantation. Im Blut der betroffenen Patienten treten die Zellen des malignen Klons in Kontakt mit autologen Immuneffektorzellen. Gentherapeutische Strategien basierend auf dem Transfer immunstimulatorischer Moleküle eröffnen deshalb neue Perspektiven für die Therapie der B-CLL. In der vorliegenden Arbeit wird erstmals die Eignung eines Helfervirus-freien EBV-Genvektorsystems für den Gentransfer in primäre B-CLL-Zellen beschrieben. Durch Optimierung der Vektorverpackung für ein eGFP kodierendes Plasmid konnte gezeigt werden, dass sich mit Hilfe einer Helfervirus-freien Verpackungszelline infektiöse Titer bis zu 2 x 106 infektiöse Partikel/ml generieren lassen. Das untersuchte Vektorsystem eignet sich für einen effizienten Gentransfer in primäre B-CLL-Zellen. Auf eine CD40L-Stimulation, wie sie zur Verbesserung der Transfereffizienz von Adenoviren zur Anwendung kommt, kann dabei verzichtet werden. Der Gentransfer lässt sich mit Hilfe eines monokonalen Antikörpers gegen CD21 weitgehend neutralisieren. In Kontrollexperimenten mit Überständen aus der Verpackung TR-deletierter Genvektorplasmide sinkt die Gentransferrate auf Werte nahe der Nachweisgrenze. Nach Verpackung des therapeutischen Moleküls CD40L sinkt die Transfereffizienz gegenüber dem eGFP kodierenden Genvektor und vermehrt unspezifische Effekte werden beobachtet. Zu den charakteristischen Eigenschaften EBV abgeleiteter Genvektoren zählen ein Tropismus für B-Lymphozyten und eine grosse Verpackungskapazität, die den Transfer von Gensequenzen bis zu einer Grösse von 160 kb erlaubt. Als essentielle EBV-Elemente enthalten die Genvektoren nur die Verpackungssignale TR und den lytischen Replikationsorigin oriLyt. Zukünfte Entwicklungen des Vektorsystems haben zum Ziel das Risiko von Rekombinationsereignissen zu reduzieren, die zur Freisetzung replikationsfähiger Virusmutanten oder potentiell onkogener viraler Gene führen könnten.
Plättchenassoziierter Tissue Factor als schnell aktivierbarer, intravaskulärer Starter des menschlichen Gerinnungssystems
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Der Tissue Factor (TF) der Gefäßwand gilt heute als der wichtigste Starter der menschlichen Blutgerinnung. Es wird davon ausgegangen, dass die Lokalisation von TF innerhalb der Gefäßwand unter physiologischen Verhältnissen eine strikte Trennung von den plasmatischen Gerinnungsfaktoren gewährleistet, so dass es unter physiologischen Bedingungen nur nach Wegfallen der endothelialen Barriere zur Bildung des TF/VIIa-Komplexes und dort zur Auslösung der Blutgerinnung kommt. Nach der bisherigen Lehrmeinung stellen Monozyten die einzigen bekannten Blutzellen dar, die nach Langzeitstimulationsbedingungen in der Lage sind, TF zu synthetisieren und zu exprimieren. Der monozytäre TF spielt vor allem bei der Pathogenese der Sepsis und der damit assoziierten Disseminierten Intravasalen Gerinnung (DIC) eine wichtige Rolle. In der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass TF bereits nach einer fünf minütigen Stimulation von Vollblut mit fibrillärem Kollagen in Monozyten-Plättchen-Komplexen und Neutrophilen-Plättchen-Komplexen gemessen wurde. Die TF Präsentation in den Leukozyten-Plättchen-Komplexen war streng abhängig von der vorhandenen Plättchenzahl. Mit Hilfe von Vollblutgerinnungsmodellen und prokoagulatorischen Assays konnte gezeigt werden, dass der schnell präsentierte Tissue Factor funktionell aktiv war und somit die Fibrinbildung auslöste. Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigten, dass das TF Antigen auf der Oberfläche von Plättchen vorhanden war, die sich in Konjugaten mit Leukozyten befanden. Um die Frage nach dem Ursprung dieses intravaskulären TF zu klären, wurden Monozyten, Neutrophile Granulozyten und Plättchen auf ihren Gehalt an TF Protein mit einem Double-Sandwich-ELISA untersucht. Dabei konnte nur in den Plättchen TF Antigen nachgewiesen werden. Weitergehende Untersuchungen zeigten, dass TF in der Tat in den a-Granula und dem „open cannanicular system“ der Plättchen lokalisiert ist. In den Plättchen und in deren Vorläuferzellen war keine m-RNA für TF vorhanden. So bleibt die letztendliche Quelle des intravaskulären TF bis auf weiteres ungeklärt. Durch Hemmung von Adhäsionsproteinen, die die Interaktion von Plättchen mit Leukozyten vermitteln, wie P-Selektin und CD40L, konnte die TF-Präsentation in den Plättchen-Leukozyten-Komplexen inhibiert werden. Daher ist davon auszugehen, dass mehrere Adhäsionsproteine an dem Prozess der Präsentation von intravaskulärem TF beteiligt sind. Ein aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit abgeleitetes Modell der Aktivierung des intravaskulären TF geht davon aus, dass in dem zwischen Leukozyten und Plättchen entstandenen Microenvironment ein von dem Plasma weitgehend unabhängiger Raum entsteht. In diesem Microenvironment wird möglicherweise der von den aktivierten Plättchen sezernierte TFPI durch die leukozytenassoziierte Elastase sowie weitere Proteasen und reaktive Sauerstoffspezies inaktiviert. TF kann damit zusammen mit FVIIa und FXa die Gerinnung starten. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die gesamte Blutgerinnung auf der Oberfläche von Plättchen stattfinden kann. Der intravaskuläre TF spielt vermutlicherweise eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gerinnung innerhalb des lumenwärts wachsenden Thrombus. Somit kann die Fibrinbildung gezielt dort aktiviert werden, wo sie benötigt wird, um den Thrombus zu stabilisieren. Das Vorhandensein eines schnell aktivierbaren, intra-vaskulären Tissue Factor Systems stellt ein neues Konzept dar, um sowohl den physiologischen als auch den pathologischen Gerinnungsstart besser zu verstehen.
Reduced CD40L expression on ex vivo activated CD4+T-lymphocytes from patients with excellent renal allograft function measured with a rapid whole blood flow cytometry procedure
Background: The CD40-CD40L (CD154) costimulatory pathway plays a critical role in the pathogenesis of kidney allograft rejection. In renal transplant biopsies, CD4+ CD40L+ graft-infiltrating cells were detected during chronic rejection in contrast to acute rejection episodes. Using a rapid noninvasive FACS procedure, we were able to demonstrate CD40L upregulation in peripheral blood of patients with chronic renal allograft dysfunction. Materials and Methods: Whole blood from recipients of renal allografts was stimulated with PMA and ion-omycin and measured by flow cytometry. Patients were assigned to three groups based on transplant function. Group 1: 26 patients with excellent renal transplant function; group 2: 28 patients with impaired transplant function; group 3: 14 patients with chronic allograft dysfunction and group 4: 8 healthy controls. Results: The median percentage +/-SEM of CD4+/ CD40L+ cells stimulated ex vivo at 10 ng/ml PMA was as follows: group 1: 28.3 +/- 4.1%; group 2: 18.4 +/- 2.4%; group 3: 50.1 +/- 5.0% and group 4: 40.4 +/- 3.4%. Subdivisions of groups 2 and 3 resulted in different CD40L expression patterns. Patients with increased serum creatinine since the initial phase after transplantation ( groups 2a and 3a) revealed a higher percentage of CD4+ CD40L+ cells than patients showing a gradual increase over time ( groups 2b and 3b). Consequently, patients of group 3a exhibited a significantly reduced transplant function compared with those of group 3b. Conclusion: After PMA + ionomycin stimulation, patients with excellent kidney graft function displayed significantly reduced expression of CD40L surface molecules on CD4+ cells early after transplantation. Those with a chronic dysfunction of the renal graft showed significantly more CD4+ cells expressing CD40L compared to the other transplanted groups. These results demonstrate that the percentage of CD4+ CD40L+ cells stimulated ex vivo in peripheral blood may be a valuable marker for chronic allograft nephropathy. Copyright (C) 2004 S. Karger AG, Basel.
Untersuchung der Einflüsse auf die Regulation des Zelloberflächenmoleküles CD40L
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Thu, 5 Jun 2003 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/1055/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/1055/1/Rehklau_Jutta.pdf Rehklau, Jutta ddc:610, ddc:600, Medizin