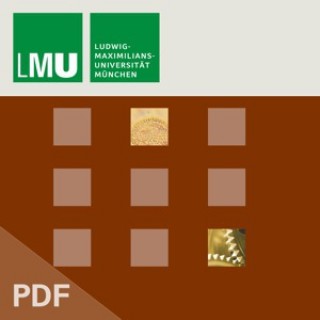Podcasts about haunerschen kinderspital
- 16PODCASTS
- 20EPISODES
- 33mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 25, 2022LATEST
POPULARITY
Best podcasts about haunerschen kinderspital
Latest podcast episodes about haunerschen kinderspital
Keine Antikörper trotz Impfung: Was das für Multiple-Sklerose-Kranke bedeutet / Keine Impfpflicht gegen Corona: Der Bundestag hat entschieden / Cannabis-Legalisierung - Wo eine Psychiaterin die Gefahren sieht / Gegen Pflegekräftemangel: Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz / Umwandlungsanspruch - Pflegesachleistungen in zusätzliche Betreuungsleistungen umwandeln / Fiebersäfte, Krebsmedikamente, Schlaganfallakutmittel: Zum Stand der Lieferengpässe / Versorgung in den Krankenhäusern: Kommission präsentiert Vorschläge / Isolation und Depression: Folgen des Besuchsverbots in psychiatrischen Kliniken / Hilfe für kranke ukrainische Kinder - Besuch im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München / Sterbehilfe: Wie sieht autonome Freiverantwortlichkeit aus? - Mit Prof. Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat / Die Neue Norm - Barrierefreiheit - Über neue Gesetze und gesellschaftliches Umdenken / Weniger Herz-Tabletten? Die richtige Dosierung von Medikamenten bei Hitze / Auf Herz und Nieren - Wie man Nierenleiden erkennt und warum das für's Herz wichtig ist. Mit Prof. Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie Uniklinikum Würzburg / Darmkrebs: Fortschritte in der Therapie / Mein Darm von innen: Wie die Darmkrebs-Vorsorge abläuft / Dry January - Was es bringt, einen Monat keinen Alkohol zu trinken?
Zahl der Atemwegserkrankungen steigt: Mediziner verzeichnen besonders viele RSV-Erkrankungen
Jetzt Ende November erwischt es nicht nur Erwachsene, sondern gerade auch viele Kinder mit Husten und Schnupfen. Aktuell verzeichnen Mediziner besonders viele RSV-Erkrankungen, unser Kollege Johannes Roßteuscher berichtet hierzu.Mira Barthelmann zudem mit dem Blick auf Bayern: Welche Folgen hat die Infektionswelle für unsere Kliniken?Professor Johannes Hübner ist Leiter der pädiatrischen Infektiologie am Haunerschen Kinderspital in München. Stefan Einöder hat mit ihm gesprochen.
Hilfe für kranke ukrainische Kinder - Besuch im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München / Medizinische Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine - Vor Ort und in Bayern / Die einrichtungsbezogene Impfpflicht: Wie wird sie jetzt umgesetzt? / Allgemeine Impfpflicht: Debatte im Bundestag / Warum der Rücken sitzen nicht mag: Was hilft gegen die Schmerzen?
Das Gesundheitssystem benachteiligt Kinder - Wir reden über Veränderungen.
Gemeinsam mit der Care-for-Rare Foundation, dem Deutschen Kinderhilfswerk und der Stiftung Kindergesundheit fordern wir eine konsequentere Umsetzung des Kinderrechts auf Gesundheit (Art. 24 UN-Kinderrechtskonvention). Über die Missstände im Gesundheitssystem und darüber, was getan werden muss, sprach Bundesvorstandsmitglied Joachim Türk mit seinen Gästen Prof. Dr. Berthold Koletzko, Kinder- und Jugendarzt am Haunerschen Kinderspital der Universität München und Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit, und Birgit Pammé, Fachbereichsleitung Kindesentwicklung am Therapiezentrum des Kinderschutzbundes Essen, im Salon der Kinderrechte.
Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie
Prof. Johannes Hübner ist Leiter der pädiatrischen Infektiologe am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München. Er beschreibt, wie der aktuelle Stand der Wissenschaft zu Sars-CoV-2-Infektionen bei Kindern ist. Verursacht Omikton schwere Krankheitsverläufe bei Kindern? Gibt es Long Covid bei Kindern? Ist regelmäßigen Testen von Kindern zielführend? Wie sinnvoll sind Masken an den Schulen? Sie erreichen Prof. Stöhr und die Redaktion unter corona@newdaymedia.de
Kinderimpfung gegen Covid 19 - Für wen ist sie jetzt sinnvoll?
Die STIKO empfiehlt, jetzt auch jüngere Kinder mit Vorerkrankungen gegen Covid 19 zu impfen. Professor Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München erklärt, welche Vorerkrankungen im Fokus stehen, wie hoch das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf bei Kindern ist und wie der Impfstoff dosiert wird.
In Deutschland sind viele Kinderkliniken noch rückständig. Dabei benötigen Kinder auch adäquate sozialpsychologische Betreuung, wenn sie krank sind. Im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München gibt es deswegen nun eine Child-Life-Specialist-Einheit. Die Leiterin erklärt im Gespräch, was die Klinik anders macht.
Vorsichtige Schulöffnung: Wie soll es mit Kindern und Jugendlichen weitergehen?
Manche Schüler werden im Freistaat ab heute wieder unterrichtet. Aber was ist mit allen anderen? Was brauchen kleinere Kinder, um unbeschadet durch diese Zeit zu kommen? Moderation: Stephanie Heinzeller / Gäste: Kinderarzt Prof. Christoph Klein, Direktor der Kinderklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München sowie Andrea Schwarz, Erzieherin in der BR-Kindertagesstätte Fünkchen
Unerhörte Kinder (Teil 3) – Das Kind als Forschungsgegenstand in der Moderne
Center for Advanced Studies (CAS) Research Focus Concept Pediatrics (LMU)
Die Sorge, Kinder zu verwöhnen oder Opfer ihres manipulativen Verhaltens zu werden, ist unter Eltern deutlich verbreiteter als die Angst davor, zu streng mit Kindern zu sein bzw. zu viele Erwartungen an sie zu richten. Neuere Untersuchungen aus der Bindungsforschung führen diesen erstaunlichen Befund auf ein Erziehungsideal zurück, das in wirkmächtigen Ratgebern seinen Ausdruck finde. Hier ist einerseits auf das Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haarer zu verweisen, das als eines der erfolgreichsten Publikationen zur Pädagogik im Dritten Reich noch bis in die 1980er Jahre Neuauflagen erleben sollte. Aber auch bis heute viel rezipierte Bestseller wie das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen gehorchen diesem Ideal, dem eine spezifische Auffassung von Kindern als potentiellen Tyrannen zugrunde liegt. | Ein Gespräch mit PD Dr. Karl Heinz Brisch (Leiter der Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie im Dr. von Haunerschen Kinderspital), Prof. Dr. Burcu Dogramaci (Leiterin des Instituts für Kunstgeschichte an der LMU) und Prof. Dr. Miriam Gebhardt (Historikerin, Journalistin und Buchautorin). | Moderation: Dr. Werner Bartens (Süddeutsche Zeitung)
SIDS-Prävention und Betreuung von Risikokindern mit Heimmonitor in der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital in den Jahren 2005 bis 2010
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 14/19
Thu, 25 Oct 2012 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/15055/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/15055/1/Salimi-Palum_Shahed.pdf Salimi-Palum, Shahed
Ärztinnen und Ärzte am Dr. von Haunerschen Kinderspital, die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung wurden
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 14/19
Biografische Darstellung der Lebenswege jüdischer Kinderärzte, die am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München tätig waren und Opfer nationalsozialistischer Verfolgung wurden
Lungenkrebs gehört zu den häufi gsten Todesursachen weltweit. Genetisch bedingte Lungenkrankheiten führen häufig schon bei Kindern zum Tod. Mit innovativen Methoden der Gentherapie und zielgerichteter Applikation von Medikamenten arbeiten Lungenforscher am Dr. von Haunerschen Kinderspital darauf hin, effizientere Therapiemethoden zu entwickeln.
Übergewicht und Fettleibigkeit entwickeln sich in den westlichen Gesellschaften zur Epidemie. Zunehmend sind auch Kinder und Jugendliche betroffen. Professor Berthold Koletzko vom Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU geht in seiner Forschung dem Zusammenhang zwischen frühkindlicher Ernährung und Übergewicht nach. Im Rahmen mehrerer Programme bietet er betroffenen Kindern auch Hilfe zur Selbsthilfe.
Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Das von der Europäischen Union finanzierte Projekt GABRIEL soll nun die genetischen und umweltbedingten Ursachen des Leidens aufdecken. Co-Koordinatorin der internationalen Kooperation ist Professor Erika von Mutius. Ihr Kollege vom Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU, Privatdozent Dr. Michael Kabesch, war federführend an einer Studie beteiligt, in deren Rahmen ein Asthma auslösendes Gen identifiziert wurde.
Psychosoziale Anpassung, Lebensqualität und Bewältigungsverhalten bei chronisch kranken Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Hintergrund. Neben der physischen Beeinträchtigung sind chronische Erkrankungen auch mit potenziellen psychischen Belastungsfaktoren verbunden. Bei chronisch kranken Kindern und Jugendlichen können nicht selten psychosoziale Anpassungsschwie-rigkeiten und eine Beeinträchtigung der Lebensqualität beobachtet werden. Ebenso stellt die chronische Erkrankung ihres Kindes auch für die Eltern der Patienten eine Be-lastungsquelle dar, die es im familiären Alltag zu bewältigen gilt. Ziele der Untersuchung. In der vorliegenden Untersuchung wurde ein Vergleich von jungen Patienten mit Diabetes mellitus, dem adrenogenitalem Syndrom (AGS) und dem Zustand nach Mangelgeburtlichkeit (SGA) und ihren Eltern vorgenommen, um folgende zentrale Forschungsfragen zu beantworten: Unterscheiden sich Kinder und Jugendliche, die unter diesen verschiedenen chronischen Krankheiten leiden, im Hinblick auf ihre psychosoziale Anpassung, ihre Bewältigungsstrategien und ihre Lebensqualität? Können Unterschiede der Patienteneltern bezüglich der genannten Variablen gefunden werden? Zudem wurden Alter und Geschlecht der Patienten als Einflussvariablen berücksichtigt. Stichprobe. Zur Beantwortung dieser Fragen nahmen 114 Kinder und Jugendliche, die am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München in Behandlung waren, und deren Eltern an einer Fragebogenuntersuchung teil. Die Stichprobe setzte sich zusammen aus 38 Familien mit einem an Typ 1 Diabetes mellitus erkrankten Kind, 37 Familien von Kindern und Jugendlichen mit adrenogenitalem Syndrom und 39 Familien mit einem Kind mit der Diagnose SGA. Instrumente. Die wesentlichen Konstrukte wurden in der Patientenstichprobe erfasst mit dem Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-D; Klasen, Woerner, Rothenberger & Goodman, 2003), dem Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung (SSKJ 3-8; Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein-Heßling, 2006), dem Stressverar-beitungsfragebogen für Kinder und Jugendliche (SVF-KJ; Hampel, Petermann & Dickow, 2001) und dem Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (ILK; Mattejat & Remschmidt 2006). Für die Eltern kamen das Ulmer Lebensqualitäts-Inventar für Eltern chronisch kranker Kinder (ULQIE; Goldbeck & Storck, 2002), der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ; Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler, 2000) sowie der Fragebogen zur elterlichen Bewältigung (CHIP; McCubbin, McCubbin, Cauble & Goldbeck, 2001) zum Einsatz. Methode und Ergebnisse. Mit Hilfe varianzanalytischer Verfahren konnten u. a. folgen-de bedeutsamste Ergebnisse gefunden werden: Die Patienten der drei Diagnosegruppen unterschieden sich nicht signifikant im Hinblick auf ihre psychosoziale Anpassung. Was das Stresserleben und die Bewältigung betraf, so hatten die Diabetespatienten ein höheres soziales Unterstützungsbedürfnis und mehr emotionale Probleme angegeben als die AGS-Patienten. Die AGS-Patienten hatten insgesamt das günstigste Bewältigungs-verhalten gezeigt und waren gedanklich weniger belastet als die Kinder und Jugendli-chen mit SGA. Insgesamt lagen die Patienten jedoch weder im Hinblick auf ihre Stressbewältigungsfä-higkeiten, noch im Hinblick auf ihre Lebensqualität im klinisch auffälligen Bereich. In der Elternstichprobe hatten die Eltern der Diabetespatienten die stärkste Beeinträch-tigung angegeben. Die Mütter waren über alle Diagnosegruppen hinweg stärker belastet und stärker in die Krankheitsbewältigung involviert als die Väter. Schlussfolgerungen. Aus den Ergebnissen ließ sich schlussfolgern, dass eine chronische Erkrankung die psychosoziale Anpassung der Kinder und Jugendlichen nicht zwangs-läufig beeinträchtigt, dass sie jedoch einen zusätzlichen Stressfaktor darstellt. Daher sind die Förderung von Kompetenzerwartungen und Bewältigungsstrategien sowie so-ziale Unterstützung bedeutsam, um die Krankheit zusätzlich zu den alterstypischen Entwicklungsaufgaben adäquat bewältigen zu können. Dabei ist die Berücksichtigung der ganzen Familie entscheidend.
Bronchoalveoläre Lavage im Kindesalter
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Im Rahmen dieser Arbeit wurden alle von 1997 bis 2002 durchgeführten brochoalveolären Lavagen (BAL) im Dr. von Haunerschen Kinderspital ausgewertet. Es wurde ein Überblick über die Patienten gewonnen, die eine BAL bekommen hatten und Unterschiede in der Zytologie bei verschiedenen Krankheitsgruppen herausgearbeitet. Hierbei zeigte sich, dass anhand der Anzahl der Makrophagen keine Unterscheidung zwischen den Unterkategorien möglich ist. Unterschiede im relativen Anteils der eosinophilen, neutrophilen Granulozyten und der Lymphozyten fanden sich zwischen verschiedenen Unterkategorien. Die Neutrophilen und Eosinophilen weisen eine positive Korrelation zueinander auf. Unabhängig hiervon sind die Lymphozyten. Die neutrophilen Granulozyten sind sowohl absolut als auch relativ bei einem Teil der Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich erhöht. Die Unterkategorie Pneumonie weist die höchsten Werte an Granulozyten auf. Obwohl dieser Befund primär plausibel ist, gibt es keine Vergleichswerte in der Literatur, da die Zellprofile von Kindern mit Pneumonie bisher noch nicht beschrieben wurden. Die Prozentzahl der Lymphozyten ist in der Unterkategorie chronische Bronchitis gegenüber der Kontrollgruppe erhöht. Aufgrund des marginalen Unterschieds erscheint dies aber klinisch wenig relevant. In den Unterkategorien Asthma und chronische Bronchitis sind in der 1. Fraktion tendenziell höhere Werte für Neutrophile als im Pool der Lavage vorhanden. Inwieweit Eosinophile bei Asthmatikern erhöht sind, ist nicht unumstritten. In dieser Untersuchung sind die Eosinophilen in den Unterkategorien Asthma und chronische Bronchitis nur gering, aber statistisch signifikant erhöht. Die Unterkategorien Asthma und chronische Bronchitis unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zellprofile in der BAL nicht signifikant voneinander. In dieser Gruppe ist ein Anstieg der Eosinophilen mit dem Alter auffällig. Die Weiterverarbeitung der BALF kann einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Zytologie haben. Daher sollte die BAL und auch die Aufarbeitung und Auswertung standardisiert nach den Richtlinien der ERS Task force durchgeführt werden, um vergleichbare Werte zu erhalten. Obwohl mit der BAL selektiv Erreger aus der Lunge isoliert werden können, ist in der Pädiatrie der Stellenwert bei Infiltraten nicht klar. Eine frühzeitigere Indikationsstellung könnte mehr Informationen liefern, eine quantitative mikrobiologische Analyse ist essentiell. Bei interstitiellen Lungenerkrankungen stellt die BAL ein wichtiges diagnostisches Werkzeug dar. Die Bedeutung ist im Einzelfall unterschiedlich. Dies wurde an einigen ausgewählten Patienten mit selteneren pulmonologischen Erkrankungen exemplarisch gezeigt.
Rekonstruktion von Organ- und Effektivdosen bei konventionellen Röntgenuntersuchungen am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München mit einer Berechnung neuer Konversionsfaktoren für die pädiatrische Radiologie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Seit 1976 werden in der Abteilung Radiologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München die bei sämtlichen Röntgenuntersuchungen anfallenden Röntgenexpositionsparameter in elektronischen Datenbanksystemen archiviert. Anhand von etwa 220.000 Röntgenuntersuchungen von etwa 100.000 Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen aus den Jahren von 1976 bis 2003 erfolgte neben einer Darstellung von Röntgenuntersuchungsäufigkeiten und klinischen Indikationen die Rekonstruktion von Einfall-, Organ- und Effektivdosen zur Quantifizierung der Patientenexposition in der Pädiatrischen Radiologie. Für über 95% der erfaßten Fälle wurde anhand des in der Arbeit entwickelten PÄDOS-Algorithmus unter der Berücksichtigung der 28 häufigsten Röntgenuntersuchungstechniken der Pädiatrischen Radiologie eine Rekonstruktion der Organ- und Effektivdosen nach dem Konversionsfaktoren-Konzept durchgeführt. Hierzu wurden mit Hilfe des vom Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety (STUK) zur Verfügung gestellten PC-Programms PCXMC neue Konversionsfaktoren für die am Dr. von Haunerschen Kinderspital angewandten Röntgenexpositionstechniken durch Monte-Carlo-Simulation an mathematischen MIRD-Phantomen der Altersstufen 0, 1, 5, 10, 15 und 30 Jahre errechnet. Die Einfall-, Organ- und Effektivdosen für die in der Pädiatrischen Radiologie häufig durchgeführten Röntgenuntersuchungen des Schädels, des Thorax und des Abdomens sowie - stellvertretend für die Durchleuchtungsuntersuchungen - für die Mictionscysturethrographie wurden in ihrer Abhängigkeit vom Untersuchungszeitraum und vom Lebensalter der Patienten graphisch und tabellarisch detailliert dargestellt und zu den Referenzdosiswerten des Bundesamtes für Strahlenschutz aus dem Jahr 2003 in Bezug gesetzt. Darüberhinaus wurden kumulative und kollektive Organ- und Effektivdosen für etwa 100.000 Patienten bestimmt und ihre Abhängigkeit von der Röntgenuntersuchungstechnik, vom Untersuchungszeitraum und vom Lebensalter der Patienten untersucht. Abschließend wurden die in der Arbeit ermittelten Einfalldosen für die Röntgenuntersuchungen des Schädels, des Thorax und des Abdomens sowie für die Mictionscysturethrographie in einer kleinen Literaturstudie den in den letzten Jahrzehnten in der internationalen Literatur publizierten Dosiswerten gegenübergestellt. Insgesamt zeigte sich, daß eine dramatische Reduktion des Dosisbedarfs bei den meisten Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungsuntersuchungen erzielt werden konnte.
Untersuchungen über die normale Konstellation der Kupfer- und Coeruloplasmin-Konzentrationen im Serum des Menschen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Kupfer im Serum des Menschen lässt sich zwei Kompartimenten zuordnen: dem Coeruloplasmin-Kupferkompartiment, welches das meiste Kupfer des Serums gebunden an das Cuproprotein Coeruloplasmin enthält, und dem Nicht-Coeruloplasmin-Kupferkompartiment, dem alles übrige Kupfer gebunden vorwiegend an Albumin und Aminosäuren zugerechnet wird. Über die Kupfermengen in den beiden Kompartimenten gibt es sehr widersprüchliche Meinungen. So werden die Zahl der Kupferatome im Cpl-Molekül mit 6 bis 8 und der Anteil des nichtCplCu am gesamten Serumkupfer mit 1 bis 40% angegeben. Von einzelnen Untersuchergruppen durchgeführte Berechnungen und Messungen haben jedoch ergeben, dass das Cpl-Molekül sechs Kupferbindungsstellen besitzt, die unter normalen Bedingungen immer besetzt sind, und dass mit hochempfindlichen Nachweismethoden selbst geringe Kupfermengen wie 0,1 µmol/l in coeruloplasminfreien Seren nicht gefunden werden. Wegen dieser widersprüchlichen Angaben ist eine sinnvolle Bewertung von Cu- und Cpl-Messungen bei Patienten nicht möglich. Es gibt zwar jeweils Normbereiche für Cu und für Cpl im Serum. Diese erlauben jedoch lediglich eine getrennte Einstufung der Messwerte beider Faktoren und lassen die Abhängigkeit der Cu- von der Cpl-Konzentration unberücksichtigt. Störungen im Kupferhaushalt bleiben deshalb häufig unerkannt. In dieser Arbeit wird versucht, die Gründe für die widersprüchlichen Angaben in der Literatur aufzudecken, in dem nach Gesetzmäßigkeiten zwischen den Konzentrationen von Cu und Cpl im Serum von gesunden Menschen und von Patienten mit verschiedenen Erkrankungen gesucht wird. Denn erst wenn die Gesetzmäßigkeiten bekannt sind, können normale und pathologische Verhältnisse von Cu und Cpl im Serum des Menschen von einander abgegrenzt und Störungen im Kupferhaushalt aufgedeckt werden. Überprüft werden in dieser Arbeit die folgenden drei Hypothesen. Hypothese I: „Nahezu das gesamte Cu des Serums ist Cpl gebunden“ oder „Unter normalen Bedingungen lassen sich im Serum des Menschen keine signifikanten Konzentrationen von nichtCplCu nachweisen.“ Hypothese II: „Die Cu- und Cpl- Konzentrationen im Serum des Menschen stehen in einem festen, positiven linearen Verhältnis zueinander.“ Hypothese III: „Das Coeruloplasminmolekül im Serum des Menschen enthält konstant sechs Atome Kupfer.“ Dem Dokumentationszentrum für Kupfervergiftungen im Dr. von Haunerschen Kinderspital wurden von fünf Klinisch-chemischen Instituten in fünf Städten Deutschlands Serien (Datensätze) von Cu- und Cpl-Messwerten aus den Jahren 1988 bis 2004 für weitere Berechnungen überlassen. Aus den Datensätzen wurden in dieser Arbeit alle Parallelmessungen von Cu und Cpl in jeweils ein und derselben Serumprobe (sog. CuundCpl-Messungen) mit Hilfe der linearen Regressionsanalyse (OSL) untersucht und entsprechend der Formel „Y = a + b * X“ die Mittelwerte für „a“ = intercept = (hier:) das nichtCplCu und für „b“ = Steigung der Regressionsgeraden = (hier:) der Cu/Cpl-Koeffizient = Zahl Cu-Atome pro Cpl-Molekül berechnet. Die Regressionsformel lautet dann: „Cu = nichtCplCu + Cu/Cpl-Koeffizient * Cpl“; das Produkt „Cu/Cpl-Koeffizient * Cpl“ repräsentiert das CplCu. Analysiert wurden insgesamt 1239 CuundCpl-Messwertepaare. Das aus methodischer Sicht wichtigste Ergebnis der Untersuchung war, dass eine gemeinsame Analyse aller Datensätze zu nicht plausiblen Ergebnissen führt, weil – bei nahezu identischen mittleren Messwerten für Cu – die mittleren Cpl-Messwerte der einzelnen Institute, aber auch ein und desselben Institutes aus verschiedenen Jahren erheblich von einander abweichen. Diese offensichtlich systematische Abweichung der Cpl-Messungen hatte zur Folge, dass sich für die Datensätze unterschiedliche Cu/Cpl-Koeffizienten und damit unterschiedliche Zahlen von Cu-Atomen pro Cpl-Molekül errechneten. Getrennte Regressionsanalysen der Datensätze ergaben dann übereinstimmend für die überwiegende Zahl (mehr als 90%) der Messungen in den Seren keine statistisch signifikanten Cu-Konzentrationen im nichtCplCu-Kompartiment (mittlere Konzentrationen unter 0,2 µmol/l) und für die einzelnen Datensätze (also für jedes Labor für bestimmte Zeitabschnitte) konstante Cu/Cpl-Koeffizienten zwischen 6,0 und 8,8. Bei einer mittleren GesCu-Konzentrationen von ca. 20 µmol/l im Serum errechnet sich somit für das nichtCplCu ein Anteil von weniger 1%. Das Ergebnis bestätigt die Hypothese I dieser Arbeit und die Mittelung von Evans et al. (1989) die bei direkten Messungen in Seren von Menschen kein nichtCplCu (untere Nachweisgrenze: 0,1 µmol/l) nachweisen konnten. Die für jedes Labor (und für bestimmte Zeitperioden) als Konstante zu errechnenden Cu/Cpl-Koeffizienten (Bestätigung der Hypothese II dieser Arbeit) weisen daraufhin, dass die Cpl-Messmethoden nicht ausreichend standardisiert und ihre Ergebnisse deshalb nicht geeignet sind, die Hypothese III dieser Arbeit zu überprüfen: nur in einem der fünf Datensätze konnte der erwartete Cu/Cpl-Koeffizient von 6 gefunden werden. Im Verlauf der Untersuchungen dieser Arbeit erwies sich die Ermittlung des Cu/Cpl-Koeffizienten mittels Regressionsanalyse (OLS) als immer dann nicht möglich ist, wenn sich unter den CuundCpl-Messwertepaaren stark abweichende Messungen, wie solche mit einem Kupferüberschuss, befanden. Die Arbeit zeigt jedoch Verfahren auf, wie diese Messungen im Datensatz erkannt und entfernt werden können. Ein solches Vorgehen erwies sich jedoch als überflüssig, weil sich herausstellte, dass der nach Berechnung des Cu/Cpl-Quotienten für alle Serumproben eines Datensatzes ermittelte Median der Quotienten (MedianCu/Cpl-Q) immer nahezu identisch ist mit dem zugehörigen Cu/Cpl-Koeffizienten. Der MedianCu/Cpl-Q kann in praxi in jedem Labor z. B. täglich oder wöchentlich anhand von Routinemessungen bei Patienten ermittelt und dann anstelle des Cu/Cpl-Koeffizienten verwendet werden. Ist der Cu/Cpl-Koeffizient oder der (hier als gleichwertig gefundene) Median der Cu/Cpl-Quotienten eines Laboratoriums bekannt, lässt sich aus den Messwerten Cu und Cpl der CuSOLL-Wert der Probe ermitteln und ein Überschuss an Cu, wie er z.B. bei Patienten mit Morbus Wilson oder mit einer Kupfervergiftung vorkommt, ermitteln. Die entsprechenden Formeln lauten: „deltaCu = CuIST- Cu/Cpl-Koeff. * CplIST“ bzw. „deltaCu = CuIST- MedianCu/Cpl-Q * CplIST“. Auf diese Weise lässt sich eine „echte“ Hypercuprämie (die hypercupraemia vera), die auf ein Missverhältnis zwischen Cu und Cpl im Serum hinweist, unterscheiden von der einfachen Hypercuprämie (der hypercupraemia simplex), die immer dann auftritt, wenn Cpl im Serum z.B. bei entzündlichen oder malignen Prozessen oder unter hormonellem Einfluss bei Schwangerschaft oder Antikonzeption, erhöht ist. Ausblick: Die in dieser Arbeit ermittelten Gesetzmäßigkeiten zwischen den Konzentrationen von Cu und Cpl im Serum gesunder und kranker Menschen erlaubt eine gezielte Suche nach Patienten/Krankheiten mit Störungen im Kupferhaushalt; sie ermöglicht insbesondere eine quantitative Bestimmung des Kupferüberschusses im Serum von Menschen mit Morbus Wilson und den Kupfervergiftungen als einen zur Diagnose führenden Befund.
Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in stationärer pädiatrischer Behandlung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Wir haben ein Fragebogenscreening zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München mit Hilfe des von Goodman entwickelten SDQ-Fragebogens durchgeführt. Dabei haben wir bei Kindern in stationärer pädiatrischer Behandlung eine Verdoppelung des Risikos von Verhaltensauffälligkeiten im Vergleich zur Kontrollgruppe gefunden. Ferner wurde ein im deutschen Sprachraum erstmals eingesetzter Fragebogen zur Erfassung von Bindungsstörungen mitverteilt. Es zeigte sich, dass der SDQ-Fragebogen nicht dazu geeignet ist Bindungsstörungen mitzuerfassen. 12 stationäre Kinder fielen in beiden Fragebögen mit auffälligen Werten auf und könnten eine Hochrisikogruppe darstellen. Dieser erste Hinweis muss jedoch noch durch weitere Arbeiten evaluiert werden.
Doppelt negative T-Lymphozyten, löslicher FAS Rezeptor und löslicher FAS Ligand bei Kindern mit häufigen Infektionen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Es wurden 29 Patienten untersucht, die sich wegen häufigen Infektionen im Dr. von Haunerschen Kinderspital vorstellten. Hierbei wurde die prozentuale Verteilung von CD4-, CD8-positiven und doppelt negativen T-Lymphozyten bestimmt. Ebenfalls bestimmt wurden die Plasmaspiegel der Plasmaproteine sFas und sFasL. Der prozentuale Anteil an DN-T-Zellen lag signifikant über dem der gesunden Kontrollen bei gleichzeitig erniedrigten CD8 positiven Zellen. Es wird angenommen, dass aktivierte T-Lymphozyten über die Zwischenstufe der DN-T-Lymphozyten in Apoptose übergehen, daher könnten diese Befunde Zeichen einer vermehrten Lymphozytenaktivierung von CD8 positiven Zellen sein. Desweiteren fanden sich in dieser Arbeit Hinweise für eine in der Literatur vorbeschriebene Abhängigkeit von sFas und DN-T-Lymphozyten. Hier jedoch korrelierten niedrige sFas Spiegel mit einem höherem Anteil an DN-T-Lymphozyten, während in der Literatur nach Injektion von sFas bei Mäusen eine Erhöhung von DN-T-Lymphozyten gefunden wurde. Ein Interpretationsversuch der in dieser Arbeit gewonnenen Daten lautet, dass der Körper durch eine Erniedrigung des Spiegels von apoptosehemmenden sFas einen Anstieg des Anteils an DN-T-Zellen nicht noch begünstigen will.