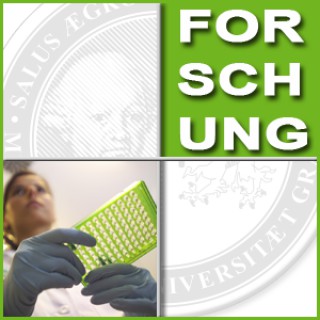Podcasts about zelltyp
- 19PODCASTS
- 20EPISODES
- 22mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Sep 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about zelltyp
Latest podcast episodes about zelltyp
60 - Mitochondrien: Dein Energiegeheimnis oder dein stiller Killer?
In dieser Episode von 'One and a Half Therapists' diskutieren Michael Kern und Patrick Dempt die zentrale Rolle der Mitochondrien in unserem Körper. Sie erklären, wie diese kleinen Kraftwerke für die Energieproduktion verantwortlich sind und welche Auswirkungen ihre Funktionsfähigkeit auf unsere Gesundheit hat. Die beiden Therapeuten beleuchten die Bedeutung eines gesunden Lebensstils für die Mitochondrien und geben wertvolle Tipps zur Verbesserung der mitochondrialen Gesundheit.Keywords Mitochondrien, Gesundheit, Energieproduktion, Lebensstil, Langlebigkeit, Stoffwechsel, ATP, neurodegenerative Erkrankungen, Wärmeproduktion, oxidativer Stress, Gesundheit, Mitochondrien, Bewegung, Ernährung, Autophagie, Energieproduktion, Lebensstil, Fasten, Zellregeneration, FitnessTakeawaysMitochondrien sind entscheidend für die Energieproduktion im Körper.Ein Verlust an Mitochondrien kann zu neurodegenerativen Erkrankungen führen.Die Anzahl der Mitochondrien variiert je nach Zelltyp.Energieproduktion erfolgt über ATP, das aus Glukose und Fettsäuren gewonnen wird.Ein schleichender Energiemangel kann über Jahre entstehen.Wärmeproduktion im Körper ist ebenfalls von Mitochondrien abhängig.Lebensstilfaktoren wie Stress und Ernährung beeinflussen die Mitochondrien.Die Neubildung von Mitochondrien kann durch einen gesunden Lebensstil gefördert werden.Langfristige Gesundheit hängt von der Pflege der Mitochondrien ab.Energieprobleme können der Ursprung vieler Krankheiten sein. Viele Menschen nehmen ihre gesundheitlichen Probleme nicht wahr.Es ist wichtig, die eigene Gesundheit aktiv zu hinterfragen.Bewegung ist entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit.Energie muss produziert werden, um aktiv zu bleiben.Autophagie kann durch Fasten gefördert werden.Gesunde Ernährung unterstützt die Mitochondrienfunktion.Fett ist eine bessere Energiequelle als Zucker.Schlaf hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit.Kälte- und Hitzetherapien können die Gesundheit fördern.Mitochondrien sind entscheidend für die Bekämpfung von Krankheiten.Chapters00:00 Einführung in die Mitochondrien02:57 Die Bedeutung der Mitochondrien für die Gesundheit05:52 Energieproduktion und ihre Auswirkungen09:05 Energie und Lebensqualität12:11 Einfluss des Lebensstils auf Mitochondrien15:11 Langfristige Gesundheit und Mitochondrienpflege16:37 Die Wahrnehmung von Normalität und Gesundheit19:16 Energieproduktion und Bewegung21:17 Autophagie und Zellregeneration25:44 Ernährung und Mitochondrien28:25 Praktische Tipps zur MitochondrienpflegeUnser Omega-3 Produkt in Therapie und Training:https://eqology.com/de/__s5b5da4s__/our-productsMit dem Therapeuten-Code 101095065 könnt ihr uns unterstützen!Lust auf mehr? Dann Abonniere unseren Podcast und bleibe am Puls der neuesten Gesundheitstrends!**Folge uns auch auf Social Media:**Homepages: www.kernxund.de - www.patrick-dempt.deInstagram: @kernxund - @patrickdempt_personaltrainingYoutube: @KERNXUND ONE AND A HALF THERAPISTSInformativ - Inspirierend - Unwiderstehlich Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Was Data und mRNA-Forschung gemeinsam haben – mit Michael W.
In dieser Podcastfolge von MY DATA IS BETTER THAN YOURS spricht Jonas Rashedi mit Michael T. Wolfinger. Michael ist theoretischer Biochemiker und als Naturwissenschaftler nicht nur an der Uni Wien, sondern auch im Consulting-Bereich tätig. Er beschäftigt sich mit einem komplexen Thema: Dem Design von mRNA-Impfstoffen. Dafür haben Jonas und Michael, die sich übrigens in einem Urlaub über ihre Töchter kennengelernt haben, eine schöne Analogie entwickelt, und zwar das Grillen, was sie in der Folge ausführlich erklären. Doch dieses Grillen kann immer weiter optimiert werden, genauso wie das Designen der mRNA und auch das Thema Data Science, das Jonas in diesen Vergleich mit einbezieht. Er ist sich sicher: Data kann von der Wissenschaft noch richtig viel lernen! Schließlich gibt es viele Ähnlichkeiten: Michael's Ziel ist es, die RNA so zu designen, dass die Proteine, welche die Immunantwort auslösen, in einem bestimmten Zelltyp den Proteinload maximieren, um eine möglichst gute Immunantwort zu erhalten. So ist es auch beim Marketing: Hier versuchen wir die richtig designte Nachricht zur richtigen Nachricht so zu versenden, dass sie auch gelesen und auf sie reagiert wird. Die beiden diskutieren noch ein weiteres Problem, das in der Wirtschaftswelt vorliegt, in der Wissenschaft aber völlig normal ist: Sich Zeit zu nehmen, um komplexe Themen zu erforschen. Dabei muss im Hinterkopf gehalten werden, dass viele Projekte mit negativen Rückschlägen einhergehen. Jedoch gibt Michael das Beispiel, dass die Unternehmen, welche in der Pandemie die Impfstoffe auf den Markt brachten und dadurch viel Geld verdienten, schon vorher genau diese Forschung betrieben haben. Zum LinkedIn-Profil von Michael: https://www.linkedin.com/in/michaelwolfinger/ Zur Webseite von Michael Wolfinger Consulting: https://michaelwolfinger.com Zur Webseite von Jonas: https://www.jonas-rashedi.de Zum LinkedIn-Profil von Jonas: https://www.linkedin.com/in/jonasrashedi/ Zum Newsletter von Jonas: https://share-eu1.hsforms.com/1m5SesP8QStuLDLjrJAnZXAfcb4n Zum Dachsteinkönig: https://www.dachsteinkoenig.at
Cuberg: Doppelte Lebensdauer von Lithium-Metall-Zellen
Lithium-Metall-Zellen haben deutlich höhere Energiedichten als gängige Lithium-Ionen-Batterien. Die US-Firma Cuberg, die seit März 2021 dem schwedischen Hersteller Northvolt gehört, setzt auf diesen Zelltyp. Neue unabhängige Tests bestätigen, dass Cuberg die Zyklenfestigkeit seit 2020 stark verbessern konnte. Mehr auf energyload.eu >>> https://energyload.eu/stromspeicher/forschung/cuberg/
BiOfunk (44): Medizin der Zukunft - Über die Herstellung von Stammzellen
Pluripotente Stammzellen sind Alleskönner. Sie können sich praktisch zu jedem Zelltyp im menschlichen Körper entwickeln. Damit haben Wissenschaftler ein Werkzeug in der Hand, um Krankheiten zu behandeln und zu heilen. Doch die Herstellung der Stammzellen war bis vor kurzem ein Problem. Denn die embryonalen Stammzellen konnte man nur durch ein umstrittenes Verfahren erzeugen. Das änderte sich im Jahr 2006. Der japanische Wissenschaftler Shinya Yamanaka entwickelte ein Verfahren, mit dem menschliche Körperzellen in Stammzellen umgewandelt werden können. Im BiOfunk betrachten wir, wie Yamanaka das schaffte. Und was man eigentlich unter Stammzellen versteht … Weitere Infos auf www.BiOfunk.net
Wie wirken Antiallergika und warum machen sie manchmal müde?
Der Botenstoff Histamin wird von Immunzellen ausgeschüttet, wenn das Immunsystem Alarm schlägt. Das Histamin löst im Körper verschiedene Reaktionen aus, je nach Organ und Zelltyp. Antihistaminika blockieren den Histamin-Rezeptor bei den anderen Körperzellen. Das heißt, sie verhindern, dass sich das Histamin an Blutgefäße, Lungenzellen oder Hautzellen heften kann und dort eine Immunreaktion auslöst. Wenn Histamin in die Nervenzellen des Gehirns gelangt, hat das eine wachmachende Wirkung. Wenn der Histaminzugang aber durch ein Medikament blockiert wird, ist die Folge Müdigkeit. Von Helena Salamun / Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.
Der ungarische Mediziner hat mit seiner Arbeit die Augenheilkunde revolutioniert: Er programmierte einen Zelltyp im Auge so um, dass dieser die Funktion von defekten Lichtrezeptor-Zellen übernehmen konnte. Im Gespräch mit Diana Huth verrät er außerdem, was wir tun können, um unser Sehvermögen allgemein zu verbessern und ob Karotten wirklich gut für die Augen sind (in englischer Sprache). Zum Körber-Preis (Livestream / Aufzeichnung): https://www.koerber-stiftung.de/koerber-preis-fuer-die-europaeische-wissenschaft Das IOB (Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel): https://iob.ch/
Der ungarische Mediziner hat mit seiner Arbeit die Augenheilkunde revolutioniert: Er programmierte einen Zelltyp im Auge so um, dass dieser die Funktion von defekten Lichtrezeptor-Zellen übernehmen konnte. Im Gespräch mit Diana Huth verrät er außerdem, was wir tun können, um unser Sehvermögen allgemein zu verbessern und ob Karotten wirklich gut für die Augen sind (in englischer Sprache). Zum Körber-Preis (Livestream / Aufzeichnung): https://www.koerber-stiftung.de/koerber-preis-fuer-die-europaeische-wissenschaft Das IOB (Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel): https://iob.ch/
Jeanette ist frisch für Euch aus Lappland zurück gekommen, während Christoph ein spannendes Interview mit Vinodh Ilangovan aufgenommen hat. Er ist ein indischer Biologe, der am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie als Postdoc forscht. Im Interview sprechen Vinodh und Christoph über biologische Uhren, also den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus von Menschen. Diesen zu untersuchen die sehr schwierig, da man Menschen schlecht ihr Leben lang in eine dunkle Kammer unter regulierten Bedingungen stecken kann. Daher wählen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Studien oft so genannte Modellorganismen, meist Mäuse oder Fruchtfliegen. Bei denen kann man Generationen von Tieren durch ihre kürzere Lebenszeit besser erfoschen und auch der genetische Code ist deutlich kürzer als bei Menschen. Im weiteren lernen wir viel über Genetik. Die DNA bei allen Lebewesen wird in regelmäßigen, nach Zelltyp und Lebensumständen variierenden Zyklen durch die RNA abgelesen und daraufhin Proteine, Enzyme und Botenstoffe im allgemeinen produziert. Es gibt ebenfalls Mechanismen, wenn Teile der DNA nicht abgelesen werden, indem diese gehemmt werden. Zum Beispiel werden über Tag keine Hormone produziert, die Müdigkeit bewirken, wenn man in der Nacht zuvor genug geschlafen hat. Oder wenn man schläft, wird nicht produziert, was Hunger verursacht. Diese Regelkreise kann man durch Veränderungen der DNA unterbrechen und beeinflussen. Solche genetischen Veränderungen werden dann an den Modellorganismen vorgenommen und deren Verhalten anschließend untersucht. Diese Forschung soll dann ermöglichen, die bioligische Uhr von Menschen besser zu verstehen und Tagesabläufe besser daran anzupassen, was auch einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge darstellt. Auch gibt es mitlerweile schon erste Versuche, mittels Medikamenten die innere Uhr zurückzusetzen und so die Auswirkungen eines Jet lag zu reduzieren. Außerdem sprechen wir über die Wichtigkeit von Wissenschaftskommunikation. Vinodh hat an einem sehr interessanten Wettbewerb "Dance your PhD" teilgenommen, worum es sich hierbei handelt, erfahrt ihr in diesem Video: Dance your PhD mit Vinodh Falls ihr sehen und lesen wollt, wie ein Studium in Helsinki so aussieht, dann guckt gerne mal auf Jeanettes Blog. Zuletzt reden wir auch über die ethischen Bedenken bei Tierversuchen. Mehr dazu im Podcast. Falls ihr Frage oder Anregungen habt, dann immer her damit, entweder direkt unter dieser Folge kommentieren oder eine Mail an info@mandelbrot-talks.de schreiben. Jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß beim Hören! Eure Christoph und Jeanette
Stammzellen, die Fast-Alleskönner (Folge 13)
Sie haben das Potential, sich in jeden Zelltyp unseres Körpers zu verwandeln. Mit embryonalen Stammzellen könnten sich eines Tages geschädigte Organe nachzüchten und Krankheiten wie Alzheimer heilen lassen. Man kann mit ihnen aber auch Mischwesens aus tierischen und menschlichen Zellen schaffen. Und was, wenn die Bemühungen Erfolg haben, Stammzellen von erwachsenen Menschen umzuprogrammieren, um künstliche Ei- und Samenzellen zu gewinnen?
Ewige Jugend – viele wünschen sie sich, zahlreiche haben danach gesucht.Wie kann man den Alterungsprozess umdrehen? ForscherInnen der Med Uni Graz sind der Antwort auf diese Frage einen Schritt näher gekommen: Eine Substanz einen einen verjüngenden Effekt, wenn man einen bestimmten Zelltyp entfernt. Doch ist das der Schlüssel zur Adoleszenz ad infinitum? Der Beitrag Für immer jung erschien zuerst auf AirCampus.
Ewige Jugend - viele wünschen sie sich, zahlreiche haben danach gesucht.Wie kann man den Alterungsprozess umdrehen? ForscherInnen der Med Uni Graz sind der Antwort auf diese Frage einen Schritt näher gekommen: Eine Substanz einen einen verjüngenden Effekt, wenn man einen bestimmten Zelltyp entfernt. Doch ist das der Schlüssel zur Adoleszenz ad infinitum?
Live vom 33. Chaos Communication Congress aus Hamburg zeichnen wir unsere 20. Folge auf. Am Podcast-Tisch des Sendezentrums nimmt Adrian mit den beiden Gästen Matthias (war schon dabei in Folge D, Folge F, Folge R) und Lars vom Auf-Distanz Podcast live vor Publikum auf. Dabei geht es um folgende 3 Themen mit dem Anfangsbuchstaben T: - Eigentlich erwartet man keine große Innovationen beim Luftanhalten. Dennoch hat sich der Sport rund ums /*/Tauchen/*/ stets professionalisiert. Matthias berichtet über die ersten Tauchaparaten, die von Da Vinci entwickelt wurden bis hin zu modernsten Methoden zur Flüssigatmung und den Problemen von ausgasenden Stoffen in der Blutbahn. - /*/Transit/*/ bedeutet erstmal nur, dass etwas an etwas anderem vorbeizieht. In der Astronomie meint man damit, dass ein Himmelskörper vor einem anderen herwandert und ihn somit teilweise Verdeckt. Lars ist Hobby-Astronom und beschreibt die Grundlagen des Transits allgemein - und im speziellen am Beispiel des Merkurtransit. - Wir nehmen unsere Umwelt über viele Sinne wahr. Ein sehr wichtiger Part wird vom /*/Tastsinn/*/ übernommen. Dabei kommen vier verschiedene Zelltypen in einer Menge verschiedener Kombinationen zum Einsatz. Adrian erklärt wie wir überhaupt tasten und welchen Part davon welcher Zelltyp übernimmt. Wir wünschen viel Spaß beim Nachhören dieser Live-Produktion.
Die Rolle der Perizyten bei steriler Inflammation
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Die vorliegende Arbeit untersuchte die Rolle der Perizyten bei steriler Inflammation. Bisher war in diesem Zusammenhang der Einfluss der Perizyten nicht bekannt, ebenso wenig ob und wie sie zu Entzündungsreaktionen beitragen. Weiterhin war der Einfluss der Perizyten auf die interstitielle Migration myeloider Zellen in vivo unerforscht. Hier konnte gezeigt werden, dass Perizyten durch eine Vielzahl von Rezeptoren wie TLR2, TLR4, TNFR1, FPR2 in der Lage sind inflammatorische Reize zu detektieren und daraufhin einen proinflammatorischen Phänotyp annehmen. Dieser ist durch die vermehrte Expression von NLRP3 sowie des Adhäsionsmoleküls ICAM-1 und die Sekretion von Chemokinen wie CXCL1, IL8 und CCL2 gekennzeichnet. Weiterhin wird das Chemokin-ähnliche Molekül MIF von aktivierten Perizyten sowohl sezerniert als auch an der Oberfläche präsentiert. Die ausgeschütteten Chemokine beeinflussen wiederum Monozyten und neutrophile Granulozyten durch ihre chemotaktische Wirkung. Auch konnte ein anti-apoptotischer sowie aktivierender Effekt der Perizyten auf neutrophile Granulozyten gezeigt werden, was die Überlebensdauer dieser Zellen im interstitiellen Gewebe signifikant verlängert. Anhand eines Mausmodells und der 2-Photonen Mikroskopie wurde gezeigt, dass Perizyten auch in vivo einen entscheidenden Beitrag zur Rekrutierung neutrophiler Granulozyten und Monozyten zur Inflammation leisten. Zum ersten Mal wurde die Interaktion myeloider Zellen mit Perizyten in vivo visualisiert und genauer charakterisiert. Diese Interaktion beeinflusst die interstitielle Migration neutrophiler Granulozyten und Monozyten abhängig davon, ob ein Stimulus für gerichtete oder ungerichtete Migration vorliegt. Es wurde deutlich, dass Perizyten sowohl einen chemotaktischen als auch einen haptotaktischen Reiz auf myeloide Leukozyten ausüben, was an einer Polarisierung der Zellen zu erkennen ist. Ebenso tragen sie durch die Interaktion zur Aktivierung der myeloiden Zellen in vivo bei. Diese Arbeit leistet demnach einen Beitrag zur genaueren Definition der Rolle von Perizyten bei steriler Inflammation. Hierfür wurden die zellulären und molekularen Mechanismen in vitro und die in vivo ablaufenden Prozesse bei der interstitiellen Migration myeloider Zellen genauer charakterisiert. Dabei konnten Perizyten als neuer Zelltyp identifiziert werden, der Gewebeschäden detektiert und aktiv zur akuten Entzündungsreaktion beiträgt indem er die Rekrutierung und Funktionalität myeloider Leukozyten unterstützt.
Gesundheits-assoziierte Lebensqualität von Patienten im Frühstadium einer chronisch lymphatischen Leukämie vom B-Zelltyp
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Thu, 2 Jul 2009 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10586/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10586/1/Brueck_Alexandra.pdf Brück, Alexandra
Promotor-gestützte in vivo-Markierung stabil transfizierter embryonaler Stammzellen zur Aufreinigung kardial differenzierter Subpopulationen: Ansatz zur Zelltherapie ischämischer Herzerkrankungen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Embryonale Stammzellen stellen aufgrund ihrer Fähigkeit, in vitro in verschiedene Subtypen von Kardiomyozyten zu differenzieren, eine vielversprechende Quelle für eine spezifische Zellersatztherapie ischämischer Herzerkrankungen dar. Ein wesentliches Hindernis, das große therapeutische Potenzial embryonaler Stammzellen für klinische Zelltransplantationen zu nutzen, besteht darin, dass es bisher kein geeignetes Verfahren gibt, den gewünschten Zelltyp zu isolieren. Die Applikation hochaufgereinigter definierter Subpopulationen ist jedoch Voraussetzung, um optimale funktionelle Effekte zu erzielen und andererseits eine potenzielle intramyokardiale Teratomformation aus mittransplantierten undifferenzierten ES-Zellen zu vermeiden. Die Verwendung Zelltyp-spezifischer Promotoren zur Expression eines transgenen Oberflächenmarkers könnte die zellschonende und nicht immunogene Aufreinigung eines gewünschten aus ES-Zellen gewonnenen Zelltyps mit hoher Ausbeute ermöglichen und damit eine wichtige Basis für künftige Zelltransplantationen liefern. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Protokoll etabliert, um mittels der magnetischen Zellsortierung (MACS), dem gegenwärtigen Goldstandard einer zellschonenden und effizienten Zellseparation, stabil transfizierte murine embryonale Stammzellen aufzureinigen. Für MACS wurden ES-Zellen markiert, die ein intrazellulär trunkiertes CD4-Oberflächenprotein (∆CD4) unter der Kontrolle des konstitutiv aktiven PGK-Promotors stabil exprimierten. Um die markierten Zellen in vivo fluoreszenzmikroskopisch detektieren zu können, erfolgte in einem Parallelansatz eine Fusion des ∆CD4 mit einem intrazellulären EGFP-Teil (∆CD4EGFP). Die Funktionalität dieses Fusionsproteins wurde ebenso gezeigt wie dessen Eignung für die MACS-Aufreinigung, mit welcher Reinheiten von über 97% erzielt wurden. Die Expression des ∆CD4-Moleküls ohne EGFP-Anteil führte nach MACS zu über 98% positiven vitalen Zellen. Dabei waren die jeweils erzielten Reinheiten unabhängig von dem Differenzierungszustand der Zellen und der initialen Frequenz positiver Zellen (0,6% bis 16%). Die Vitalität der aufgereinigten Zellen nach dem MACS-Prozess wurde dadurch belegt, dass diese in der Lage waren, zu reaggregieren und normale „Embryoid Bodies“ auszubilden, die Marker aller drei embryonaler Keimblätter exprimierten. Parallel zur Etablierung der MACS-Methode wurde der kardial spezifische humane 2,75kb Nkx2.5-Promotor über die Expression des in vivo-Markers EGFP in murinen embryonalen Stammzellen untersucht. Die fluoreszenzmikroskopischen und durchflusszytometrischen Ergebnisse korrelierten mit dem erwarteten embryonalen Aktivitätsprofil des Nkx2.5-Promotors. RT-PCR-Analysen früher kardialer Marker zeigten, dass der hNkx2.5-Promotor Zellen markiert, deren Expressionsmuster dem früher kardial determinierter Zellen entspricht. Der 2,75 kb lange hNkx2.5-Promotor bietet damit einen vielversprechenden Ansatz, kardiale Vorläuferzellen innerhalb des heterogenen Zellspektrums sich differenzierender ES-Zellen zu identifizieren. Ein Transfer auf das in dieser Arbeit etablierte MACS-System könnte die effiziente, zellschonende und nicht immunogene Aufreinigung kardialer Vorläuferzellen aus humanen ES-Zellen ermöglichen. Dieser Ansatz könnte die Therapie ischämischer Herzmuskelerkrankungen mit embryonalen Stammzellen der klinischen Anwendung einen entscheidenden Schritt näher bringen.
Expression, Isolierung und Funktionsanalyse des OR5 Geruchsrezeptors: einem Vertreter der G-Protein gekoppelten Rezeptoren
Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Die Familie der Geruchsrezeptoren ist zwar ein zentrales Forschungsgebiet, dennoch ist wenig über sie bekannt. Im Folgenden wird dargestellt, worin die beiden Hauptursachen für die Problematik der Analyse von Geruchsrezeptoren bestehen und welche Strategien in dieser Arbeit gewählt wurden, um einen experimentellen Ansatz zur Untersuchung von Geruchsrezeptoren zu finden: 1. Erst wenigen Geruchsrezeptoren konnten Liganden zugeordnet werden . Da noch keine Struktur eines Geruchsrezeptors bekannt ist, können bislang Modellvorstellungen nur über Sequenzhomologien innerhalb der Rezeptorgruppe oder anhand verwandter Rezeptoren, z. B. dem Rinderopsin, erstellt werden. Offensichtlich reichen diese Modelle jedoch nicht aus, um effektiv Liganden zuzuordnen oder Struktur-Funktion-Zusammenhänge zu erkennen. Das HEK-293-Zellsystem erwies sich zwar als das bisher effektivste heterologe Expressionssystem für diese Art von Rezeptoren, doch auch hier ist die Zahl beschriebener, funktionell exprimierter ORs begrenzt . Es gibt also nur wenige Möglichkeiten, Geruchsrezeptoren funktionell zu exprimieren, und daher besteht ein Bedarf an weiteren Expressionssystemen, um diese Rezeptoren in vivo untersuchen zu können. 2. Neben der Problematik einer funktionellen Expression gibt es bislang kein Expressionssystem, welches die Herstellung geeigneter Mengen für eine Strukturaufklärung dieser Rezeptoren ermöglicht. Die Menge der synthetisierten Rezeptoren ist in der Regel zu gering oder die Zielproteinspezies liegt in Einschlusskörpern vor. Zu 1) Die funktionelle Expression mit korrekter Translokation des Membranproteins sollte in Kombination mit einer Semliki Forest Virus-basierten Infektion in Säugetier P19-Zellen durchgeführt werden. Ausgewählt wurde diese Zelllinie aufgrund folgender Tatsachen: es handelt sich bei der P19-Zelllinie um Teratokarzinom-Zellen, welche ursprünglich aus embryonalen Stammzellen, implantiert in Hodengewebe, generiert wurden. Einem Gewebe also, in dem in vivo eine Geruchsrezeptor-Expression nachgewiesen wurde . Ein weiterer vielversprechender Umstand war die Differenzierbarkeit dieser Fibroblasten-ähnlichen Zellen in neuronale Zellen, dem Zelltyp, der auch in vivo für olfaktorische Neuronen vorliegt. Dementsprechend lautet die Annahme, dass es sich um eine optimale Zelllinie für die Expression rekombinanter ORs handeln kann, die zur zeitgerechten Expression aller für die olfaktorische Signalkaskade notwendigen Bestandteile befähigt ist. Die Zelllinie sollte bezüglich ihrer Eignung als Expressionsplattform für Geruchsrezeptoren charakterisiert und Expressionsstudien am Beispiel des Rezeptors OR5 durchgeführt werden. Zu 2) Die Überexpression des Membranproteins zur quantitativen Isolierung erfolgte in Hefe. Gegenüber E. coli ist der Hefeorganismus zur Durchführung posttranslationaler Modifikationen fähig. Ein Vorteil im Vergleich zu Säugerzellen sind die hohen erreichbaren Zelldichten. Primärgewebe kam für diese Fragestellung nicht in Frage: eine Isolierung wäre mit sehr geringen Ausbeuten verbunden, eine Problematik, die durch die Verwendung von heterologen Expressionssystemen umgangen werden kann. Es wurde eine „unfolded protein response“ (UPR)-kontrollierte Expression in Saccharomyces cerevisiae ausgewählt, um zu gewährleisten, dass überwiegend korrekt gefaltetes Rezeptorprotein gebildet wird. Mit dieser Arbeit sollten erstmals durch eine optimierte Expression, Produktion und Isolierung ausreichende Proteinmengen des Geruchsrezeptors OR5 (aus R. norvegicus) mit einer Homogenität von >90% zur Verfügung gestellt werden, um biochemische und strukturelle Charakterisierungen durchzuführen. Zusätzlich sollten monoklonale OR5-Antikörper generiert werden, um eine spezifische Detektion und Immunopräzipitation des Geruchsrezeptors OR5 zu ermöglichen. Zusammengefasst tragen die etablierten Systeme dazu bei, die genaue Rolle der ORs in der Geruchswahrnehmung in Zukunft entschlüsseln zu können. Mit Hilfe der P19-Zelllinie wird die OR-Charakterisierung in einem heterologen System ermöglicht, und durch den Gebrauch des Hefeexpressionsystem und die optimierte Isolierungs-Strategie kann das Material für eine Strukturaufklärung bereitgestellt werden.
Kernpositionierung und funktionelle Regulation von Genen der humanen CFTR-Region auf Chromosom 7
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die komplexen Zusammenhänge zwischen der Kernlokalisation, der transkriptionellen Aktivität und dem Replikationsverhalten von Zelltyp-spezifisch regulierten Genen in menschlichen Zellen besser zu verstehen. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Kernlokalisation der drei benachbarten, jedoch funktionell unabhängigen Gene GASZ, CFTR und CORTBP2 der humanen CFTR-Region auf Chromosom 7q31 ermittelt und mit dem Expressionsverhalten verglichen. Durch eine 2D-Erosionsanalyse wurde die radiale Positionierung dieser Gene in einer Reihe von Zelllinien und primären Zelltypen untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass transkriptionell aktive Gene der CFTR-Region bevorzugt im Zellkerninneren lokalisierten, nicht exprimierte Gene waren dagegen eng mit der Kernperipherie assoziiert. Die benachbarten Genloci wiesen dabei eine voneinander weitgehend unabhängige Lokalisation auf. Unter Verwendung hoch auflösender konfokaler Mikroskopie und dreidimensionaler Bildrekonstruktion konnte diese Korrelation durch eine 3D-Erosionsanalyse im Wesentlichen bestätigt werden. Um zu ermitteln, ob die unterschiedlich positionierten Genloci mit verschiedenen Chromatin-Fraktionen assoziiert sind, wurde eine Kolokalisationsanalyse vorgenommen. Die Daten haben gezeigt, dass inaktive Genloci der CFTR-Region zu einem hohen Anteil mit dem perinukleären Heterochromatin assoziiert sind, aktive Genloci lokalisierten dagegen bevorzugt in dem hyperazetylierten Euchromatin im Kerninneren. Mehrfarben-FISH Experimente haben gezeigt, dass die eng benachbarten Genloci entsprechend ihrer transkriptionellen Aktivität simultan mit unterschiedlichen Bereichen im Zellkern assoziiert sein können und vermutlich die intergenischen Bereiche zwischen den Genen als flexible Linker dienen. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen im Gegensatz zu früheren Studien (Sadoni et al., 1999; Volpi et al., 2000; Williams et al., 2002; Mahy et al., 2002) die Vermutung nahe, dass die Positionierung subchromosomaler Regionen auf der Ebene einzelner Gene reguliert wird. Durch die Behandlung der Zellen mit TSA wurde außerdem gezeigt, dass eine erhöhte Histonazetylierung zu der Dissoziation eines inaktiven Genlokus von heterochromatischen Bereichen führt, die transkriptionelle Aktivität davon jedoch nicht beeinflusst wird. Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde untersucht, welcher funktionelle Zusammenhang zwischen dem Replikationsverhalten von GASZ, CFTR und CORTBP2 und der transkriptionellen Aktivität und Kernlokalisation dieser Gene besteht. Die Bestimmung der Replikationszeitpunkte wurde durch die Untersuchung des Auftretens von FISH-Dubletten während definierter S-Phase Stadien vorgenommen. Da bei dieser Analyse die Möglichkeit besteht, den Anteil an Dubletten durch eine verlängerte Schwester-Chromatid Kohäsion zu unterschätzen (Azuara et al., 2003), wurden die ermittelten Zeitpunkte darüber hinaus durch verschiedene Fixierungsmethoden überprüft. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass transkriptionell aktive Genloci, die in dem hyperazetylierten Euchromatin lokalisierten, zu einem früheren Zeitpunkt replizierten als nicht exprimierte Genloci, die eng mit dem perinukleären Heterochromatin assoziiert waren. Durch eine TSA-Behandlung der Zellen wurde nachgewiesen, dass vor allem die Assoziation mit definierten Chromatin-Fraktionen einen Einfluss auf das Replikationsverhalten ausübt, die transkriptionelle Aktivität und das Replikationsverhalten jedoch nur indirekt miteinander in Zusammenhang stehen. Auf der Basis dieser Daten und früherer Studien wurde ein Modell erstellt, das die epigenetischen Mechanismen zueinander in Beziehung setzt, die an der Aktivierung Zelltyp-spezifisch regulierter Gene beteiligt sind. Der letzte Teil dieser Arbeit war der Frage gewidmet, ob Komponenten der Zellkernlamina an der perinukleären Positionierung des reprimierten CFTR-Lokus beteiligt sind. Dazu wurden HeLa S6 Zellen mit Lamin A/C-, Lap2- oder Emerin-siRNAs transfiziert. Nach erfolgreichem Knockdown wurde die Kernlokalisation des CFTR-Lokus durch Erosionsanalysen und Abstandsmessungen zu der Kernperipherie ermittelt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass nach dem Knockdown von Lamin A/C, Lap2 oder Emerin der CFTR-Lokus signifikant weiter im Kerninneren lokalisierte. Dabei schienen Lamin A/C und Lap2 einen stärkeren Einfluss auf die Lokalisation von CFTR auszuüben als Emerin. Auch wenn in früheren Arbeiten bereits gezeigt wurde, dass die Kernlamina für die Positionierung peripheren Chromatins von Bedeutung ist (Sullivan et al., 1999; Goldman et al., 2004; Zastrow et al., 2004), konnte hier zum ersten Mal ein direkter Einfluss auf die Lokalisation eines einzelnen Genlokus demonstriert werden. In einem ergänzenden Ansatz wurde die Kernlokalisation von CFTR in Fibroblasten von HGPS-Patienten untersucht, die auf Grund der Akkumulation von mutiertem Lamin A/C Deformationen der Zellkernlamina und Zellzyklus-Defekte aufwiesen (Eriksson et al., 2003; Goldman et al., 2004). Durch Abstandsmessungen zu der Kernperipherie und durch Kolokalisationsanalysen wurde gezeigt, dass der CFTR-Lokus in HGPS-Zellen einen größeren Abstand zur Kernperipherie aufwies und häufiger im hyperazetylierten Euchromatin lokalisierte als in Fibroblasten eines gesunden Probanden. Insgesamt unterstützen diese Daten die Vermutung, dass die Misslokalisation von reprimierten Genen in ein verändertes Chromatin-Umfeld an dem Krankheitsbild dieser und anderer Laminopathien beteiligt sein könnte.
Charakterisierung der Zellen des Glomus Caroticum
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Zellen des Glomus caroticum der Ratte alle notwendigen Komponenten zur Biosynthese, Speicherung und Freisetzung von Dopamin und Histamin besitzen und diese Transmitter bei Hypoxie freisetzen können. Erstmals wurde hier Histamin als Transmitter im Glomus caroticum nachgewiesen: es wurde gezeigt, dass die Sensorzellen des Glomus caroticum das Histamin synthetisierende Enzym exprimieren. Die Speicherung von Histamin in Vesikeln erfolgt mit Hilfe eines vesikulären Monoamintransporters (VMAT2). Bisher bekannte immunhistochemische Ergebnisse über die Expression dieses Transportproteins in den Sensorzellen konnten bestätigt und mittels RT-PCR-Untersuchungen belegt werden. Ferner wurde nachgewiesen, dass die Sensorzellen auch über wichtige Komponenten des Exozytoseapparates verfügen. Darüber hinaus zeigten RT-PCR- Untersuchungen, dass im Glomus caroticum die mRNA der Histaminrezeptoren H1, H2 und H3 exprimiert wird. Die Menge an Histamin im Glomus caroticum wurde mittels Radioimmunoassay bestimmt. Im Glomus caroticum ist mehr Histamin enthalten als in anderen Geweben der Ratte, und die Menge an Histamin ist um ein Vielfaches größer als die Menge des im Glomus caroticum enthaltenen Dopamins. In vitro Experimente zeigten, dass die Freisetzung von Histamin aus dem Glomus caroticum durch Hypoxie verstärkt wird. Eine vermehrte Freisetzung bei Hypoxie konnte amperometrisch auch für Dopamin bestätigt werden. Es wurde hier zum ersten Mal beschrieben, dass ein Zelltyp zwei verschiedene Amine als Transmitter nutzt. Damit spielt sowohl Dopamin als auch Histamin eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle der Sauerstoffversorgung des Organismus und, aufgrund der Lage des Glomus caroticum, besonders des Gehirns. Mit dem Nachweis von Expression und Aktivität des limitierenden Enzyms für die Tetrahydrobiopterin-Synthese wurde gezeigt, dass das Glomus caroticum sämtliche für die Dopaminsynthese notwendigen Schritte selbst durchführen kann. Damit erfüllt das Glomus caroticum die notwendigen Eigenschaften für eine erfolgreiche Autotransplantation in das Striatum bei Morbus Parkinson.
Untersuchungen zur Funktion Dendritischer Zellen in vivo
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Dendritische Zellen (engl.: dendritic cells, DC) gelten seit ihrer Entdeckung als eine der wichtigsten Zelltypen des Immunsystems. Dies gilt sowohl für die Erzeugung von Immunität als auch von Toleranz, insbesondere in Bezug auf T-Zell-vermittelte Immunreaktionen (Banchereau et al. 1998). Im Zuge dessen wird in DC enorme Hoffnung bezüglich des Verständnisses von Autoimmunerkrankungen sowie Erkrankungen wie z.B. Krebs gesetzt, bei der DC schon seit einigen Jahren zur Immuntherapie verwendet werden (Banchereau et al. 2001). Die Analysen von DC beinhalteten jedoch bisher immer die Isolation von DC ex vivo oder deren Kultivierung in vitro. Diese experimentellen Versuchsschritte zeigten einen tiefgreifenden Einfluss auf den Phänotyp von DC und somit auch auf deren immunstimulatorischen Eigenschaften (Pierre et al. 1997; Gallucci et al. 1999). In der vorliegenden Arbeit wurde durch die Entwicklung eines transgenen Maussystems erstmals der generelle Einfluss von DC auf CD8-T-Zellen in vivo detailliert analysiert. Dies konnte direkt an der Qualität der CD8-T-Zellantworten auf bestimmte Immunstimuli abgelesen werden, ohne die DC isolieren oder anderweitig manipulieren zu müssen. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Bedeutung von DC im Thymus bei der Selektion sich entwickelnder CD8-T-Zellen analysiert, da es in Bezug auf die Bedeutung von DC sowohl bei der positiven als auch bei der negativen Selektion widersprüchliche Meinungen gibt. Es konnte gezeigt werden, dass DC im Thymus nicht zur positiven Selektion von CD8-T-Zellen befähigt sind, sondern dass hierbei den Epithelzellen des Thymus eine entscheidende Bedeutung zukommt. Durch Zelltransferversuche konnte weiterhin gezeigt werden, dass DC zur Eliminierung autoreaktiver CD8-T-Zellen, und somit zur Induktion zentraler Toleranz, durch negative Selektion im Thymus ausreichten. Im zweiten Teil der Arbeit wurde das Vermögen von DC sowie die Qualität der durch sie induzierten CD8-T-Zell-Immunantworten untersucht. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass DC ausreichend sind, um eine vollständige und funktionelle Immunantwort durch CD8-T-Effektorzellen in vivo zu induzieren. Bei der Aktivierung von CD8-T-Zellen nur durch DC, konnten beim Vergleich mit Wildtyp-Mäusen jedoch auch qualitative sowie quantitative Unterschiede festgestellt werden, die eine mögliche Bedeutung weiterer Zellen bei der „Feinregulation“ CD8-basierter T-Zellantworten wahrscheinlich machen. Im Gegensatz hierzu konnten keine Unterschiede bei CD8-TZellreaktion nach Induktion von Toleranz erkannt werden. DC konnten in diesem Fall eindeutig als der hauptverantwortliche Zelltyp zur Erzeugung peripherer Toleranz in vivo identifiziert werden.
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen der Tunika von Cystodytes dellechiajei DELLA VALLE (Urochordata, Ascidiacea)
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
In der vorliegenden Dissertation wurde mit licht- und elektronenmikroskopischen Methoden die Tunika von Cystodytes dellechiajei (Ascidiacea, Aplousobranchia) histologisch und cytologisch untersucht. Diese koloniebildende Ascidie kommt in zwei Farbvarianten (violette und graugrüne Kolonien) im Mittelmeer vor. Beide Farbvarianten enthalten pharmakologisch interessante, intensiv farbige Pyridoacridinalkaloide. Bisher lagen allerdings noch keine Informationen darüber vor, in welchen Organen der Tiere diese Sekundärstoffe lokalisiert sind bzw. welche Zellen sie produzieren. Daher wurden zunächst die Gewebeelemente der Ascidie charakterisiert. Eine mittelgroße Kolonie enthält ca. 100 Zooide, die vollständig in eine gemeinsame Tunika eingebettet sind. Die Tunika bildet mit über 98 % das Hauptvolumen der Kolonien, während Zooidgewebe nur einen Volumenanteil von 1,25 % ausmachen. Die Kolonien werden nach außen von einer 70 - 100 nm dicken Cuticula abgeschlossen, darunter befindet sich eine subcuticuläre Schicht aus sehr dicht angeordneten Matrixfasern (Faserabstände < 0,5 µm). Die Tunikamatrix besteht aus drehrunden Fasern (Ø 15-25 nm) die in Streutextur ein dichtes Geflecht bilden. Eine histochemische Analyse der Matrix zeigte, daß sie zu einem großen Teil aus Mukopolysacchariden aufgebaut ist. Die Zooide liegen in individuellen, nach oben offenen Hohlräumen, die von einer dichten Schicht aus Matrixfasern ausgekleidet sind. Jedes Zooid besitzt zudem eine Kapsel aus überlappend angeordneten, scheibenförmigen Kalkschuppen. Die Zooide sind durch individuelle Kanäle mit der Meerwasserumgebung verbunden. Jeder Kanal besitzt an seinem distalen Ende eine sechslappige Öffnung aus Tunikagewebe, die geöffnet und verschlossen werden kann. Die Tunika enthält sechs verschiedene Zelltypen: Blasenzellen, Pigmentzellen, granuläre und vakuolisierte filopodiale Zellen, kompartimentierte Zellen und Morulazellen. Blasenzellen besitzen eine große Vakuole (Ø ca. 60 µm), die mit Schwefelsäure (pH 1) gefüllt ist. Blasenzellen bilden den Hauptanteil des Tunikavolumens. In violetten Pigmentzellen konnten pharmakologisch aktive Pyridoacridinalkaloide (= violette Pigmente) nachgewiesen werden. Das Pigment der grünen Kolonien wurde chemisch bisher nicht identifiziert. Die cytotoxischen Stoffe werden über ein komplexes System aus Fibrillen und Pigmentkörnern in der Vakuole angereichert. Violette und grüne Pigmentzellen unterscheiden sich in Anzahl und Größe der Pigmentkörner, besitzen aber denselben Grundaufbau aus fibrillären und granulären Elementen innerhalb der Vakuole. Je nach physiologischem Zustand der Pigmentzellen kommen verschiedene Bautypen von Pigmentzellen vor: Oligojunktionale, polyjunktionale und agranuläre Pigmentzellen. Beim polyjunktionalen und agranulären Typ liegt eine Überproduktion an Netzwerkfibrillen vor, während der oligojunktionale Typ ein ausgewogenes Verhältnis an Netzwerkfibrillen und Pigmentkörnern enthält. Die Mehrzahl der Pigmentzellen ist oligojunktional, daher wird dieser Typ auch als „Grundtyp” bezeichnet. Filopodiale Zellen haben mehrere lange cytoplasmatische Ausläufer, die netzwerkartig die Tunika durchziehen. Granuläre filopodiale Zellen enthalten zahlreiche eosinophile Granula mit verschieden elektronendichtem Inhalt. Vakuolisierte filopodiale Zellen besitzen keine oder nur sehr wenige Granula. Beide Typen der filopodialen Zellen phagocytieren in der Tunikamatrix vorkommende Bakterienzellen. In filopodialen Zellen wurden häufig große lysosomale Kompartimente nachgewiesen. Filopodiale Zellen könnten einen universalen Zelltyp darstellen, der aus den Zooiden in die Tunika einwandert und sich dort in die übrigen Tunkazelltypen umwandelt. Kompartimentierte Zellen enthalten große lysosomale Kompartimente, die mit myelinartigen Membrankörpern und granulärem Material gefüllt sind. Die kompartimentierten Zellen enthalten häufig große Mengen an Bakterien des Typs A. In der Tunika wurden darüber hinaus große Mengen an stäbchenförmigen Bakterienzellen drei verschiedener Strukturtypen (Typ A, B, C) nachgewiesen. Bakterienzellen des Typs A sind Gram-positive Stäbchen, Zellen der Typen B und C sind Gram-negativ. Filopodiale Zellen phagocytieren vor allem Bakterien des Typs B und C, während in kompartimentierten Zellen große Mengen an Bakterien des Typs A nachgewiesen werden konnten (intrazelluläre Bakteriendichten bis 1011 Zellen/ml). Aus Tunikagewebe wurden drei verschiedene Bakterienstämme isoliert, kultiviert und mikroskopisch untersucht. Alle drei Stämme sind Gram-negativ und unbegeißelt, sind also wahrscheinlich dem in der Tunika nachgewiesenen Typ B zuzuordnen. Die Isolate bilden häufig pleomorphe Zellen aus, die meisten Zellen sind jedoch stäbchenförmig. Die Tunika der Larven von C. dellechiajei ist vierschichtig. Nur die innerste Schicht, das ”inner compartment” enthält granuläre filopodiale Zellen, Pigmentzellen und Blasenzellen. Kompartimentierte Zellen und Morulazellen fehlen. Darüber hinaus enthält das inner compartment Mischformen zwischen granulären filopodialen Zellen und Blasen- bzw. Pigmentzellen und Ansammlungen stäbchenförmiger, Gram-negativer Bakterienzellen.