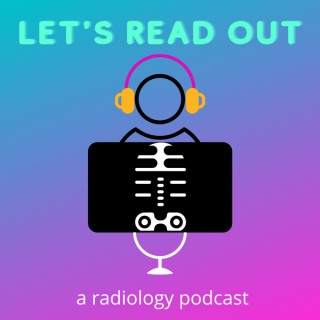Podcasts about Extravasation
- 30PODCASTS
- 45EPISODES
- 14mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Jan 2, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about Extravasation
Latest news about Extravasation
- Extravasation of Borrelia burgdorferi Across the Blood–Brain Barrier is an Extremely Rare Event Wiley: Advanced Science: Table of Contents - Mar 12, 2025
- Extravasation rulemaking to dominate ACMUI public meeting June 17 AuntMinnie.com Headlines - Jun 14, 2024
- A Versatile Microfluidic Platform for Extravasation Studies Based on DNA Origami – Cell Interactions Wiley: Angewandte Chemie International Edition: Table of Contents - Apr 30, 2024
- Impact of Fibrinogen, Fibrin Thrombi, and Thrombin on Cancer Cell Extravasation Using In Vitro Microvascular Networks Wiley: Advanced Healthcare Materials: Table of Contents - Jul 27, 2023
- [ASAP] Role of Micelle Size in Cell Transcytosis-Based Tumor Extravasation, Infiltration, and Treatment Efficacy Nano Letters: Latest Articles (ACS Publications) - Apr 12, 2023
Latest podcast episodes about Extravasation
Episode 396: Nursing Considerations From the ONS/ASCO Extravasation Guideline
"We proposed a concept to the American Society of Clinical Oncology (ASCO), recognizing that extravasation management requires significant interdisciplinary collaboration and rapid action. There can occasionally be uncertainty or lack of clear guidance when an extravasation event occurs, and our objective was to look at this evidence with the expert panel to create a resource to support oncology teams overall. We hope that the guideline can help mitigate harm and improve patient outcomes," Caroline Clark, MSN, APRN, AGCNS-BC, OCN®, EBP-C, director of guidelines and quality at ONS, told Chelsea Backler, MSN, APRN, AGCNS-BC, AOCNS®, VA-BC, oncology clinical specialist at ONS, during a conversation about the ONS/ASCO Guideline on the Management of Antineoplastic Extravasation. Music Credit: "Fireflies and Stardust" by Kevin MacLeod Licensed under Creative Commons by Attribution 3.0 Earn 0.5 contact hours of nursing continuing professional development (NCPD) by listening to the full recording and completing an evaluation at courses.ons.org by January 2, 2027. The planners and faculty for this episode have no relevant financial relationships with ineligible companies to disclose. ONS is accredited as a provider of nursing continuing professional development by the American Nurses Credentialing Center's Commission on Accreditation. Learning outcome: Learners will report an increase in knowledge related to the management of antineoplastic extravasation. Episode Notes Complete this evaluation for free NCPD. ONS/ASCO Guideline on the Management of Antineoplastic Extravasation ONS Podcast™ episodes: Episode 391: Pharmacology 101: Antibody–Drug Conjugates Episode 335: Ultrasound-Guided IV Placement in the Oncology Setting Episode 145: Administer Taxane Chemotherapies With Confidence Episode 127: Reduce and Manage Extravasations When Administering Cancer Treatments ONS Voice articles: Access Devices and Central Lines: New Evidence and Innovations Are Changing Practice, but Individual Patient Needs Always Come First New Extravasation Guidelines Provide Recommendations for Protecting Patients and Standardizing Care Standardizing Venous Access Assessment and Validating Safe Chemo Administration Drastically Lowers Rates of Adverse Venous Events This Organization's Program Trains Non-Oncology Nurses to Deliver Antineoplastic Agents Safely ONS books: Access Device Guidelines: Recommendations for Nursing Practice and Education (fourth edition) Chemotherapy and Immunotherapy Guidelines and Recommendations for Practice (second edition) Clinical Guide to Antineoplastic Therapy: A Chemotherapy Handbook (fourth edition) ONS courses: Complications of Vascular Access Devices (VAD) and IV Therapy ONS Fundamentals of Chemotherapy and Immunotherapy Administration™ ONS Oncology Treatment Modalities Clinical Journal of Oncology Nursing articles: Chemotherapy Extravasation: Incidence of and Factors Associated With Events in a Community Cancer Center Standardized Venous Access Assessment and Safe Chemotherapy Administration to Reduce Adverse Venous Events Oncology Nursing Forum article: Management of Extravasation of Antineoplastic Agents in Patients Undergoing Treatment for Cancer: A Systematic Review ONS huddle cards: Antineoplastic Administration Chemotherapy Immunotherapy Implanted Venous Port ONS position statements: Administration (Infusion and Injection) of Antineoplastic Therapies in the Home Education of the Nurse Who Administers and Cares for the Individual Receiving Antineoplastic Therapies ONS Guidelines™ for Extravasation Management ONS Oncologic Emergencies Learning Library ONS/ASCO Algorithm on the Management of Antineoplastic Extravasation of Vesicant or Irritant With Vesicant Properties in Adults American Society of Clinical Oncology (ASCO) Podcast: Management of Antineoplastic Extravasation: ONS-ASCO Guideline To discuss the information in this episode with other oncology nurses, visit the ONS Communities. To find resources for creating an ONS Podcast club in your chapter or nursing community, visit the ONS Podcast Library. To provide feedback or otherwise reach ONS about the podcast, email pubONSVoice@ons.org. Highlights From This Episode "The focus of this guideline was specifically on intravenous antineoplastic extravasation or when a vesicant or an irritant with vesicant properties leaks out of the vascular space. This can cause an injury to the patient that's influenced by several factors including the specific drug that was involved in the extravasation, whether it was DNA binding, how much extravasated, the affected area, and individual patient characteristics." TS 1:48 "The panel identified and ranked outcomes that mattered most with extravasation. Not surprising, one of the first was tissue necrosis. Like, 'How are we going to prevent tissue necrosis and preserve tissue?' The next were pain, quality of life, delays in cancer treatment: How is an extravasation going to delay cancer treatment that's vital to the patient? Is an extravasation also going to result in hospitalization or additional surgical interventions that would be burdensome to the patient? ... We had a systematic review team that then went in and summarized the data, and the panel applied the grading of recommendations, assessment, development, and evaluation (GRADE) criteria, grading quality of evidence and weighing factors like patient preferences, cost, and feasibility of an intervention. From there, they developed their recommendations." TS 7:35 "The panel, from the onset, wanted to make sure we had something visual for our readers to reference. They combined evidence from the systematic review, other scholarly sources, and their real-world clinical experience to make this one-page supplementary algorithm. They wanted it to be comprehensive and easy to follow, and they included not only those acute management steps but also guidance on 'How do I document this and what are the objective and subjective assessment factors to look at? What am I going to tell the patient?' In practice, for use of that, I would compare it to your current processes and identify any gaps to inform policies in your individual organizations." TS 16:34 "The guidelines don't take place of clinician expertise; they're not intended to cover every situation, but a situation that keeps coming up that we should talk about as a limitation, is we're seeing these case reports of tissue injury with antibody–drug conjugate extravasation. There's still not enough evidence to inform care around the use of antidotes with those agents, so this still needs to be addressed on a case-by-case basis. We still need publication of those case studies, what was done, and outcomes to help inform direction." TS 19:24 "Beyond the acute management is to ensure thorough documentation regarding extravasation. Whether you're on electronic documentation or on paper, are the prompts there for the nurse to capture all of the factors that should be captured regarding that extravasation? The size, the measurement, the patient's complaints. Is there redness? Things like that. And then within the teams, everyone should know where to find that initial extravasation assessment so that later on, if they're in a different clinic, they have something to go by to see how the extravasation is healing or progressing. ... I think there's an importance here, too, to our novice oncology nurses and their preceptors. This could be anxiety-provoking for the whole team and the patient, so we want to increase confidence in management. So, I think using these resources for onboarding novice oncology nurses is important." TS 22:34
1092: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode1092 In this episode, I’ll discuss when to use a cold or warm compress to treat extravasation.
#451: MMM - IV Infiltration vs. Extravasation—Know the Difference
Let's start your week strong with a quick tip you can incorporate right away. In this Mo's Monday Minute shortie episode, I'm clearing up something that confuses a lot of nursing students: the difference between IV infiltration and extravasation. ___________________ FREE CLASS - If all you've heard are nursing school horror stories, then you need this class! Join me in this on-demand session where I dispel all those nursing school myths and show you that YES...you can thrive in nursing school without it taking over your life! 20 Secrets of Successful Nursing Students – Learn key strategies that will help you be a successful nursing student with this FREE guide! All Straight A Nursing Resources - Check out everything Straight A Nursing has to offer, including free resources and online courses to help you succeed!
Peripheral Vasopressors, Practically Safe: What a 250-Patient Prospective Cohort Means for Your Unit
A new prospective multicenter cohort of 250 patients with shock examines the safety and outcomes of peripheral vasopressor administration. Extravasation events were rare and clustered only after several days of infusion, while norepinephrine use and simple physiologic markers correlated with survival. In this episode, I translate the findings into bedside guardrails—which sites and gauges to use, how to monitor, and when to pivot to a central line.The Vasopressor & Inotrope HandbookAmazon: https://amzn.to/47qJZe1 (Affiliate Link)My Store: https://eddyjoemd.myshopify.com/products/the-vasopressor-inotrope-handbook (Use "podcast" to save 10%)Citation:Petros A, Melkie A, Kotiso KS, Kebede D, Oljira CF, Assefa Gemechu F, Yusuf H, Abebe S, Ashagre A, Bekele A, Yohannes A, Etesa EK, Bedru M, Gebremariam TH. Peripheral line for vasopressor administration: Prospective multicenter observational cohort study for survival and safety. PLoS One. 2025 Oct 13;20(10):e0333275. doi: 10.1371/journal.pone.0333275. PMID: 41082535; PMCID: PMC12517475.
In this episode, we review the high-yield topic of Leukocyte Extravasation from the Pathology section.Follow Medbullets on social media:Facebook: www.facebook.com/medbulletsInstagram: www.instagram.com/medbulletsofficialTwitter: www.twitter.com/medbullets
Management of Antineoplastic Extravasation: ONS-ASCO Guideline
Dr. Tanya Thomas and Dr. Aparna Jotwani join the podcast to discuss the new Oncology Nursing Society and American Society of Clinical Oncology evidence-based guideline on the management of antineoplastic extravasation. They discuss recommendations from the expert panel on: management of extravasation of vesicant or irritant with vesicant properties antineoplastic agents, management of extravasation of paclitaxel or docetaxel, use & duration of thermal compress, and escalation of care. They share the importance of this comprehensive interdisciplinary guideline, highlight the algorithm as a useful tool for clinicians, and outline the outstanding questions related to the management of extravasation. Read the full guideline, “ONS/ASCO Guideline on the Management of Antineoplastic Extravasation” at www.asco.org/supportive-care-guidelines TRANSCRIPT This guideline, clinical tools, and resources are available at www.asco.org/supportive-care-guidelines. Read the full text of the guideline and review authors' disclosures of potential conflicts of interest in the JCO Oncology Practice, https://ascopubs.org/doi/10.1200/OP-25-00579 Brittany Harvey: Hello and welcome to the ASCO Guidelines podcast, one of ASCO's podcasts delivering timely information to keep you up to date on the latest changes, challenges, and advances in oncology. You can find all the shows, including this one, at asco.org/podcasts. My name is Brittany Harvey, and today I'm interviewing Dr. Tanya Thomas, clinical chair of the guideline and clinical nurse specialist from University of Virginia Health, and Dr. Aparna Jotwani, medical oncologist from Baylor College of Medicine, authors on "Management of Antineoplastic Extravasation: Oncology Nursing Society – American Society of Clinical Oncology Guideline." Thank you for being here today, Dr. Thomas and Dr. Jotwani. Dr. Aparna Jotwani: Thank you. Dr. Tanya Thomas: Thank you for having us. Brittany Harvey: And then before we discuss this guideline, I'd like to note that ASCO takes great care in the development of its guidelines and ensuring that the ASCO conflict of interest policy is followed for each guideline. The disclosures of potential conflicts of interest for the guideline panel, including Dr. Thomas and Dr. Jotwani, who have joined us here today, are available online with the publication of the guideline in JCO Oncology Practice, which is linked in the show notes. So then to dive into the content here, Dr. Thomas, could you start us off by providing an overview of both the scope and the objectives of this guideline? Dr. Tanya Thomas: Yes, so the objective of this guideline is to provide the evidence-based recommendations to help support our interdisciplinary teams, including the oncologist, the advanced practice providers, pharmacists, and nurses who are involved in the care and management of patients who are experiencing an extravasation of an antineoplastic agent. While rare, the antineoplastic and certain chemotherapy extravasations are oncologic emergencies. The recommendations are to minimize negative consequences and provide a standardized approach to the care when such an event occurs. Dr. Aparna Jotwani: I would add that our scope is limited to intravenous antineoplastic vesicants, irritants, and irritants with vesicant potential. The scope of the guideline applies to the care team for adult oncology patients receiving treatments through venous access. Outside the scope is management of extravasation during other routes of treatment administration, such as intraperitoneal, intravesical, and hepatic arterial infusion. Our recommendations regarding vascular access for therapy or interventions to prevent extravasations are also outside of the scope for this guideline. Brittany Harvey: Understood. I appreciate that background and understanding what's in scope and what's out of scope for this guideline. So then I'd like to pivot and talk about the key recommendations of this guideline across the clinical questions. So first, Dr. Jotwani, what does the panel recommend for patients with extravasation of vesicant or irritant with vesicant properties antineoplastic agents? Dr. Aparna Jotwani: The panel strongly recommends for all classes where an antidote exists to proceed with using the antidote. Recommendations for paclitaxel and docetaxel are specifically addressed in a recommendation. This is further detailed in Tables 1 and 4 within the guideline. Evidence on the use of antidotes for extravasation is limited to nonrandomized, uncontrolled, observational studies and case series. Placebo-controlled trials on this topic would be unethical. There is also a lack of comparative data for different antidote strategies. However, potential benefits of using the antidotes include tissue preservation and avoiding tissue necrosis. In developing the guidelines, we had an in-person roundtable discussion and weighed risks and benefits to ensure patient safety above all else. Brittany Harvey: I appreciate that description of the recommendation here. So then you just mentioned that there's a specific recommendation for paclitaxel and docetaxel. So what is recommended for those patients with extravasation of paclitaxel or docetaxel? Dr. Aparna Jotwani: So here, we conditionally recommended the specific use of hyaluronidase as the antidote. This was based on five studies that all used hyaluronidase as an antidote to lower the risk of tissue necrosis. In the studies included, with a subgroup of patients that experienced taxane-related extravasation, development of necrosis ranged from 0% to 0.83% among the patients who received an antidote. The potential harms associated with this were likely trivial. Brittany Harvey: Thank you for providing that recommendation as well. So then the next section of the guideline, Dr. Thomas, what does the expert panel recommend for use and duration of thermal compress? Dr. Tanya Thomas: So the expert panel actually recommends the use of thermal compresses, and the recommendations are based on the available literature for the various agents and the actual time frames most frequently used for the compress application. The utilization of a thermal compress is recommended for 15 to 20 minutes at a time for 3 to 4 times daily, at least for the first 48 to 72 hours after that extravasation occurs. The actual frequency and duration may vary based on the extent of the extravasation and the agent involved in that extravasation. The intent of the warm compress is to help disperse the agent and reduce the localized accumulation of the agent, whereas the cold compress, it actually helps prevent the dispersion or the spread of the agent while allowing the antidote to help neutralize that agent. Warm compresses are recommended for extravasations involving the vinca alkaloids, etoposide, oxaliplatin, and the taxanes - paclitaxel and docetaxel - only when coadministering the antidote hyaluronidase. The use of a cold compress is actually recommended for extravasations involving the anthracyclines, antimetabolites, alkylating agents, and taxanes when coadministration of the antidote hyaluronidase does not occur. Brittany Harvey: Understood. Those specific and actionable recommendations are really key for clinical practice. So then, following those recommendations, how does the guideline address escalation of care and surgical referral for patients with central line extravasation? Dr. Tanya Thomas: So this topic actually had a lot of discussion. And while there is not enough evidence to make strong recommendations, the expert panel recognized that surgical referrals should be considered in certain scenarios. Dr. Aparna Jotwani: We discussed that certain scenarios would include high-risk populations, such as patients that are receiving DNA-binding vesicants, those with high-volume estimated extravasation, and those with CTCAE grade 2, which would be erythema associated with symptoms such as edema, pain, induration, and phlebitis, or grade 3, which would be symptoms of ulceration or necrosis or concern for severe tissue damage, or grade 4, where you would have a life-threatening consequence extravasation, may have a greater likelihood of benefiting from surgical referral and/or escalation of care as deemed appropriate. Brittany Harvey: Great. And yes, it's really important to provide all of these recommendations that you've both just gone through, even when we're faced with very low evidence. So then, Dr. Thomas, in your view, what is the importance of this guideline, and how will it impact clinical practice? Dr. Tanya Thomas: So when extravasations occur in the clinical setting, members of the interdisciplinary team can be faced with barriers related to where to look for the information, how to find all the relevant information in one concise place, how to provide education to the patient about how to care for the site of extravasation in the home setting, and also when to escalate to specialized teams. This can actually cause some added stress and anxiety, and in certain circumstances, may lead to delays in efficient management. This guideline provides the resource clinicians have been looking for. It includes comprehensive recommendations for antineoplastic extravasations in one guideline while also providing a one-page algorithm with the key information regarding the management of the extravasations. This allows all levels of providers to have evidence-based recommendations regarding initial management of the extravasation, for instance, how to manage the infusion, key site assessment reminders, available antidotes, and the use of thermal compress; the required documentation, recommended follow-up scheduling, in addition to key aspects of the patient education. This type of guidance is not found in any other single document regarding antineoplastic extravasation. Having this document readily available at the point of care potentially can reduce time required for providers to search for management recommendations and also provide consistency in patient education and follow-up management scheduling. It reduces uncertainty within interdisciplinary teams and can help inform policy development for clinicians to approach extravasations with confidence. Brittany Harvey: Absolutely. I agree that this is an incredible resource for clinicians with the recommendations, the algorithm that you mentioned, and the supporting evidence that underpins these recommendations to really provide both efficient and effective care for patients. So beyond the impact for clinical practice, Dr. Jotwani, how will these guideline recommendations affect patients receiving antineoplastic treatment for cancer? Dr. Aparna Jotwani: Exactly. In addition to the clinical care team, we want to help and benefit our patients. So, oncology patients that experience extravasations are at risk for, aside of the side effects of tissue necrosis and infection, they also are at risk for delay of cancer treatment. In making these guidelines, we kept in mind the cost and the efforts for patients, additional visits that they could incur, additional time and supplies for care of the extravasation, as well as cost. Our guideline aims to provide an evidence-based approach to the care of oncology patients receiving antineoplastic intravenous therapy. While there are gaps in the data due to the nature of these events, based on careful literature review, these guidelines serve as a basis for quality, standardized oncology care during extravasation. Personally, I hope our graphics especially can be used across the systems to guide clinical care. Brittany Harvey: Definitely. We hope that these recommendations improve treatment and treatment outcomes for all patients receiving antineoplastic treatment for cancer. So then you've also just mentioned some gaps in the literature. So Dr. Thomas, I'd like to turn to you to wrap us up and ask, what are the outstanding questions for the management of antineoplastic extravasation? Dr. Tanya Thomas: Yes, that's a good question. Two of the main outstanding questions are related to the management of extravasations involving the novel agents and extravasations involving multi-agent regimens. The current literature regarding how to effectively manage the multi-agent regimens, for instance, there is no clear guidance for managing the extravasation for someone who is receiving a regimen that involves simultaneous administration of, let's say, a vinca alkaloid and an anthracycline. One of those agents requires a warm compress while the other requires a cold compress, and there are different antidotes for those two agents. Additionally, there has not been a lot of published information on the impact of extravasation of those novel agents like the antibody-drug conjugates. With the pace of the drug development, a subgroup of the guideline panelists actually are exploring case reports specific to novel agents to help inform some future work. Brittany Harvey: Yes, we'll look forward to learning more about how to address these ongoing issues and potentially impact guideline recommendations in the future as well. So I want to thank you both so much for your work to develop this incredibly important guideline, and thank you for your time today, Dr. Thomas and Dr. Jotwani. Dr. Aparna Jotwani: Thank you for the opportunity. Dr. Tanya Thomas: Yes, thank you. Brittany Harvey: And finally, thank you to all of our listeners for tuning in to the ASCO Guidelines podcast. To read the full guideline, go to www.asco.org/supportive-care-guidelines. I also encourage you to check out the companion episode on this guideline on the ONS podcast, available on Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, and YouTube Music. And finally, you can also find many of our guidelines and interactive resources in the free ASCO Guidelines app, which is available in the Apple App Store or the Google Play Store. If you've enjoyed what you've heard today, please rate and review the podcast and be sure to subscribe so you never miss an episode. The purpose of this podcast is to educate and to inform. This is not a substitute for professional medical care and is not intended for use in the diagnosis or treatment of individual conditions. Guests on this podcast express their own opinions, experience, and conclusions. Guest statements on the podcast do not express the opinions of ASCO. The mention of any product, service, organization, activity, or therapy should not be construed as an ASCO endorsement.
Trust Your Instincts for Better Health Outcomes with Pam Kohl, Patient Advocate
In this empowering episode, we sit down with Pam Kohl, Patient Advocate, to explore the critical role trusting your intuition when receiving health care. Pam shares her personal journey from an early breast cancer diagnosis to living with metastatic breast cancer, revealing her remarkable resilience and determination. Her story underscores the importance of trusting your instincts, advocating thorough testing, and staying informed to navigate the complexities of the healthcare system effectively.Find out how you are the best advocate for your health outcomes. Listen to the episode and discover:Navigating the Challenges of Breast CancerPam Cole's story is one of resilience and determination. After initially being diagnosed with stage 1 ER+ breast cancer in 2009, she underwent a lumpectomy, radiation, and five years of endocrine therapy. Despite being told she was cured, Pam faced a recurrence of her cancer, which eventually led to a metastatic diagnosis. The Power of Knowledge and Self-AdvocacyThroughout the episode, Pam emphasizes the necessity of understanding diagnostic tools and the need to demand comprehensive testing, such as PET scans, when necessary. Advancements in Breast Cancer Care and Nuclear Medicine SafetyThe conversation extends beyond personal experiences, touching on advancements in breast cancer management, particularly for ER+ cases. HER HEALTHX Improving Health Outcomes for WomenThe conversation explores the implications of medical gaslight and how HER HEALTHX, a nonprofit organization is dedicated to addressing the broader impact of medical gaslighting on women and their communities.3 Takeaways:Feel Empowered: When you understand your diagnosis and the available medical options is crucial for effective self-advocacy. Ask questions and don't be afraid to make choices that align with your instincts.Safety in Nuclear Medicine: The conversation sheds light on the importance of safety standards in medical testing and the advocacy needed to improve these practices. Support H.R.6815 — 118th Congress (2023-2024)Community Impact: Addressing how medical gaslighting affects not just the individual but the wider community."You need to be paying attention to your body and trusting your intuition. Trust yourself and advocate for yourself. It's the most important thing you can do."-Pam KohlThank you Pam for sharing your story. Join Pam Kohl and host Natalie Benamou on October 23rd for a panel discussion about Extravasation and Step Therapy at 11 AM CT/ 12 PM ET.Register hereResources:https://www.safernuclearmedicine.org/American Cancer SocietyHER HEALTHXAbout Pam KohlPam Kohl, a North Carolina native with over 40 years of experience in government and nonprofit management, has dedicated her career to breast cancer advocacy. As the former Executive Director of Susan G. Komen's North Carolina Triangle to the Coast Affiliate, she advocated for equitable breast cancer support and research across 29 counties. Pam directed the Komen Metastatic Breast Cancer Collaborative Research Initiative, focusing on finding treatments and cures, especially after her own battles with breast cancer. Diagnosed initially in 2009 with Stage 1 ER+ breast cancer and declared cancer-free in 2014, she faced a recurrence in 2016 and was diagnosed with Stage IV metastatic breast cancer in 2017. Her treatment regimen includes Verzenio, Fulvestrant, and regular scans.Connect with Host Natalie Benamou, Founder HerCsuite®Natalie Benamou is the host of "Women Leaders on the Move '' and the Founder of HerCsuite®, a powerful women's network providing connect circles for women's careers and businesses. She is dedicated to making it easier for women to achieve success in all aspects of their lives. Natalie is also the Founder and President of HER HEALTHX, a nonprofit on improving health outcomes for women.Natalie Benamou on LinkedInHerCsuite® on LinkedIn
923: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode923. In this episode, I’ll discuss if phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation. The post 923: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
892: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode892. In this episode, I’ll discuss when to use a cold or warm compress to treat extravasation. The post 892: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
892: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode892. In this episode, I’ll discuss when to use a cold or warm compress to treat extravasation. The post 892: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
848: Treatment of norepinephrine extravasation
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode848. In this episode, I’ll discuss the treatment of norepinephrine extravasation. The post 848: Treatment of norepinephrine extravasation appeared first on Pharmacy Joe.
848: Treatment of norepinephrine extravasation
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode848. In this episode, I’ll discuss the treatment of norepinephrine extravasation. The post 848: Treatment of norepinephrine extravasation appeared first on Pharmacy Joe.
OncoSnacks 9: Chemotherapy Extravasation
Chemotherapy extravasation can occur day or night, and one must always be vigilant. While many agents are irritants and may not pose significant risks, vesicants pose a different story. A tale of danger and intrigue, this situation can lead to the involvement of a friendly neighbourhood surgeon or Spiderman. In worst-case scenarios, significant tissue damage, treatment delay, and a sizeable psychological burden on the patient can occur. In this OncoSnacks episode, Michael and Josh explore this world, highlighting potential agents and how to prevent, diagnose and manage them.For more episodes, resources and blog posts, visit www.inquisitiveonc.comFind us on Twitter @InquisitiveOnc!If you want us to look at a specific trial or subject, email us at inquisitiveonc@gmail.comArt courtesy of Taryn SilverMusic courtesy of Music Unlimited: https://pixabay.com/users/music_unlimited-27600023/Disclaimer: This podcast is for educational purposes only. If you are unwell, seek medical advice. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
In this episode, host Dr. Jacob Fleming interviews Dr. Douglas Beall, interventional radiologist, about the latest advances in vertebral augmentation, how to reduce complications, and tips for producing successful and sustainable outcomes. --- CHECK OUT OUR SPONSOR RADPAD® Radiation Protection https://www.radpad.com/ --- EARN CME Reflect on how this Podcast applies to your day-to-day and earn free AMA PRA Category 1 CMEs: https://earnc.me/PdIxV5 --- SHOW NOTES In this episode, host Dr. Jacob Fleming interviews Dr. Douglas Beall, interventional radiologist, about the latest advances in vertebral augmentation, how to reduce complications, and tips for producing successful and sustainable outcomes. This is the third installment of our 4-part BackTable VI series on osteoporosis treatment. Dr. Beall begins by discussing the newest technique in the treatment of vertebral compression fractures, screw-assisted vertebral augmentation, with emphasis on how it can decrease the excessive vertebral motion induced by a fracture. He uses the three-column approach (anterior, middle, and posterior column) using SpineJack in the front and pedicle screws in the back. They also discuss vertebral body stents and shaped balloons, two emerging technologies that will be available soon. Next, they discuss complications in kyphoplasty and vertebral body augmentation. Dr. Beall shares how to recognize various types of cement extravasation. Importantly, if the cement starts to form a lenticular shape, stop injecting because continued injection will cause the cement to enter the spinal canal. The lenticular, biconvex shape that occurs with this pattern is due to the anterior epidural ligaments and midline anterior epidural ligament. He says to let the cement harden in the anterior epidural space once you reach the basivertebral plexus, and then continue injecting. Extravasation, to some degree, is normal, and recognizing where it is going is the key to avoiding complications. We end by discussing how to improve outcomes. Dr. Beall says that injecting more cement is the best way to produce better outcomes. Lastly, he adds that filling the cleft is the best way to achieve the greatest degree of pain reduction, which ultimately is what indicates a successful outcome. --- RESOURCES Dr. Douglas Beall Twitter: @DougBeall BackTable VI Episode 94, Innovation in Spine Interventions with Dr. Douglas Beall: https://www.backtable.com/shows/vi/podcasts/94/innovation-in-spine-interventions Cianfoni publication on Stent-Screw-Assisted Internal Fixation (SAIF): https://jnis.bmj.com/content/11/6/603 Venmans publication on Pulmonary Emboli during Vertebroplasty: www.ajnr.org/content/29/10/1983
An update to one of Pharmacotherapy's most downloaded articles. Learn from Dr. Sylvia Stefanos about the risk and management of extravasation injuries. Full text of the manuscript is available at: https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phar.2794.
Peripheral IV Infiltration and Extravasation (PIVIE) Injuries
This podcast will discuss peripheral IV infiltration and extravasation injuries (PIVIE). By the end of this podcast, learners should be able to recognize the risks of PIVIE injuries in the pediatric population, distinguish between an extravasation injury and an infiltration injury, and develop an appropriate management plan for different types of PIVIE injuries. It was developed by Alexander Perry, a medical student at the University of Alberta in collaboration with Dr. Courtney Wilkes, Dr. Jaret Olson, and Dr. Chris Novak.
New segment Rad Roundup: Recaps in 5 minutes or less. Rad resident Dr. Sydney Payne joins us to discuss contrast extravasations including patients at risk and pearls of management.
Role of PIEZO1 in leukocyte extravasation, CD8+ T-cell activation in macrophage activation syndrome, and ABO O blood group as a novel risk factor for HIT
In this week's episode we first review new work revealing the critical role of the tension-sensitive cation channel PIEZO1 in the transendothelial migration of leukocytes. We'll also review new research suggesting that CD8+ T-cells dimly expressing the CD4 antigen are increased in patients with various forms of secondary HLH, a finding that may have diagnostic, prognostic, and therapeutic significance. Finally, we'll review a large, genome-wide association study identifying the ABO O blood group as a novel risk factor for heparin-induced thrombocytopenia—a finding that could have implications for prediction of this syndrome and for the management of related conditions.
Ep. 210 Modern Vertebral Augmentation with Dr. Doug Beall
In this episode, host Dr. Jacob Fleming interviews Dr. Douglas Beall, interventional radiologist, about the latest advances in vertebral augmentation, how to reduce complications, and tips for producing successful and sustainable outcomes. --- CHECK OUT OUR SPONSOR RADPAD® Radiation Protection https://www.radpad.com/ --- EARN CME Reflect on how this Podcast applies to your day-to-day and earn AMA PRA Category 1 CMEs: https://earnc.me/PdIxV5 --- SHOW NOTES In this episode, host Dr. Jacob Fleming interviews Dr. Douglas Beall, interventional radiologist, about the latest advances in vertebral augmentation, how to reduce complications, and tips for producing successful and sustainable outcomes. This is the third installment of our 4-part BackTable VI series on osteoporosis treatment. Dr. Beall begins by discussing the newest technique in the treatment of vertebral compression fractures, screw-assisted vertebral augmentation, with emphasis on how it can decrease the excessive vertebral motion induced by a fracture. He uses the three-column approach (anterior, middle, and posterior column) using SpineJack in the front and pedicle screws in the back. They also discuss vertebral body stents and shaped balloons, two emerging technologies that will be available soon. Next, they discuss complications in kyphoplasty and vertebral body augmentation. Dr. Beall shares how to recognize various types of cement extravasation. Importantly, if the cement starts to form a lenticular shape, stop injecting because continued injection will cause the cement to enter the spinal canal. The lenticular, biconvex shape that occurs with this pattern is due to the anterior epidural ligaments and midline anterior epidural ligament. He says to let the cement harden in the anterior epidural space once you reach the basivertebral plexus, and then continue injecting. Extravasation, to some degree, is normal, and recognizing where it is going is the key to avoiding complications. We end by discussing how to improve outcomes. Dr. Beall says that injecting more cement is the best way to produce better outcomes. Lastly, he adds that filling the cleft is the best way to achieve the greatest degree of pain reduction, which ultimately is what indicates a successful outcome. --- RESOURCES Dr. Douglas Beall Twitter: @DougBeall BackTable VI Episode 94, Innovation in Spine Interventions with Dr. Douglas Beall: https://www.backtable.com/shows/vi/podcasts/94/innovation-in-spine-interventions Cianfoni publication on Stent-Screw-Assisted Internal Fixation (SAIF): https://jnis.bmj.com/content/11/6/603 Venmans publication on Pulmonary Emboli during Vertebroplasty: www.ajnr.org/content/29/10/1983
In this episode, we review the high-yield topic of Leukocyte Extravasation from the Pathology section. Follow Medbullets on social media: Facebook: www.facebook.com/medbullets Instagram: www.instagram.com/medbulletsofficialx Twitter: www.twitter.com/medbulletsIn this episode --- Send in a voice message: https://anchor.fm/medbulletsstep1/message
683: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode683. In this episode, I’ll discuss if phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation. The post 683: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
683: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode683. In this episode, I’ll discuss if phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation. The post 683: Is phentolamine the only thing you can use for vasopressor extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
630: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode630. In this episode, I'll discuss when to use a cold or warm compress to treat extravasation. The post 630: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
630: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation?
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode630. In this episode, I ll discuss when to use a cold or warm compress to treat extravasation. The post 630: Should hot or cold compresses be used to treat extravasation? appeared first on Pharmacy Joe.
This episode covers leukocyte extravasation!
This is the third in the series taking a look at lesser known or underappreciated death metal albums Tracks played; Crematory – Chunks Of Flesh – Denial (1992) Cemetary- Nigthmare Lake – An Evil Shade Of Grey (1992) Afflicted - Harbouring The Soul – Prodigal Sun (1992) Afflicted – Dawn Of Glory – Dawn Of Glory (1995) Hellwitch - Mordirivial Dissemination - Syzygial Miscreancy (1990) Mythic - Winter Solstice - Mourning in the Winter Solstice (1993) Acrostichon - Immolation Of The Agnostic - Engraved In Black (1995) Asmodina – Blood - Inferno (1997) Аспид – Он пришёл (Аспид) - Extravasation (1993) Bloodrust – Jackals - Burning of Aeons (2020) Host; Phil Wadey Contact us at philsbreakfastmetal@gmail.com Facebook page; www.facebook.com/Philsbreakfastmetal/?fref=ts Twitter; @BreakfastMetal
How does extravasation affect nuclear medicine? In what ways does vascular access impact nuclear medicine? The ISAVE That Podcast welcomes Ron Lattanze, the CEO of Lucerno Dynamics, to the show to answer these questions and more through data and further research ahead of the closing of a public comment period for a petition he spearheaded to the Nuclear Regulatory Commission.0:00 AVA President Lori Kaczmarek, AVA Director of Clinical Education Judy Thompson and AVA Director of Communications Eric Seger kick off Episode 81:23 Lucerno Dynamics CEO Ron Lattanze Joins the Show2:00 Extravasation in Nuclear Medicine7:30 How Nuclear Medicine Impacts Vascular Access10:00 How Do We Address This Issue?13:31 A Deeper Explanation for Extravasation in Nuclear Medicine16:55 Extravasation in Nuclear Medicine is Preventable28:55 Public Comment at the Nuclear Regulatory Commission35:12 Comments Due by November 30Support the show (https://www.avainfo.org/donations/donate.asp?id=12834)
556: Treatment of norepinephrine extravasation
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode556. In this episode, I’ll discuss the treatment of norepinephrine extravasation. The post 556: Treatment of norepinephrine extravasation appeared first on Pharmacy Joe.
514: Mannitol Extravasation
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode514. In this episode, I ll discuss mannitol extravasation. The post 514: Mannitol Extravasation appeared first on Pharmacy Joe.
389: Phentolamine to treat dobutamine extravasation
The Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy Podcast
Show notes at pharmacyjoe.com/episode389. In this episode, I ll discuss whether to use phentolamine to treat dobutamine extravasation. The post 389: Phentolamine to treat dobutamine extravasation appeared first on Pharmacy Joe.
The Relevance of Ulnar-Sided Contrast Extravasation During Radiocarpal Joint Wrist Arthrography
Contrast material often extends from the radiocarpal joint into the proximal soft tissues adjacent to the ulnar aspect of the ulnar styloid during single-compartment radiocarpal joint MR arthrography of the wrist. Jack Porrino discusses his recent study that hypothesized this is a common finding unrelated to symptoms or examination technique. Read the accompanying article here: https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.18.20304
MR Arthrogram Features That Can Be Used to Distinguish Between True Inferior Glenohumeral Ligament Complex Tears and Iatrogenic Extravasation
Eric Chang discusses his study on features seen at shoulder MR arthrography that distinguish between iatrogenic contrast material extravasation and inferior glenohumeral ligament complex tears. Read the accompanying article here: https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.18.20090
Episode 15: January 10, 2018 - Infiltration & Extravasation: similar start, very different results
For all intents and purposes, infiltration and extravasation could be the same thing, except for one major difference. Listen in to the first episode of the series to find out why early identification of infiltration and extravasation is key to the prevention of potentially devastating complications.
Mechanismen der Extravasation von neutrophilen Granulozyten und inflammatorischen Monozyten im akuten Entzündungsgeschehen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 19/19
Thu, 10 Mar 2016 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19251/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19251/1/Zuchtriegel_Gabriele.pdf Zuchtriegel, Gabriele
Science Signaling Podcast for 9 February 2016: Transendothelial migration
Claus Jrgensen describes how his group used phosphoproteomic analysis to identify signaling events required for transendothelial migration of metastatic cancer cells.
Podcast 107 – Peripheral Vasopressor Infusions and Extravasation
Can we give vasopressors peripherally? And if we do, what if they leak?
Perspectives in Microvascular Fluid Handling: Does the Distribution of Coagulation Factors in Human Myocardium Comply with Plasma Extravasation in Venular Coronary Segments?
Background: Heterogeneity of vascular permeability has been suggested for the coronary system. Whereas arteriolar and capillary segments are tight, plasma proteins pass readily into the interstitial space at venular sites. Fittingly, lymphatic fluid is able to coagulate. However, heart tissue contains high concentrations of tissue factor, presumably enabling bleeding to be stopped immediately in this vital organ. The distribution of pro- and anti-coagulatively active factors in human heart tissue has now been determined in relation to the types of microvessels. Methods and Results: Samples of healthy explanted hearts and dilated cardiomyopathic hearts were immunohistochemically stained. Albumin was found throughout the interstitial space. Tissue factor was packed tightly around arterioles and capillaries, whereas the tissue surrounding venules and small veins was practically free of this starter of coagulation. Thrombomodulin was present at the luminal surface of all vessel segments and especially at venular endothelial cell junctions. Its product, the anticoagulant protein C, appeared only at discrete extravascular sites, mainly next to capillaries. These distribution patterns were basically identical in the healthy and diseased hearts, suggesting a general principle. Conclusions: Venular extravasation of plasma proteins probably would not bring prothrombin into intimate contact with tissue factor, avoiding interstitial coagulation in the absence of injury. Generation of activated protein C via thrombomodulin is favored in the vicinity of venular gaps, should thrombin occur inside coronary vessels. This regionalization of distribution supports the proposed physiological heterogeneity of the vascular barrier and complies with the passage of plasma proteins into the lymphatic system of the heart. Copyright (C) 2010 S. Karger AG, Basel
Die Mechanismen der Hirnmetastasierung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Metastasen sind die häufigsten bösartigen Hirntumore und gehen mit einer hohen Morbidität und Mortalität einher. Die steigende Inzidenz von Hirnmetastasen sowie die limitierten Therapieoptionen unterstreichen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer, wirkungsvollerer Ansätze zur Prävention und Therapie dieser gravierenden Erkrankung. Da momentan im Wesentlichen lediglich Endpunktuntersuchungen vorliegen, sind viele Schritte des Metastasierungsprozesses noch wenig verstanden. In der vorliegenden Dissertation wurde daher ein neuartiges Tiermodell etabliert, welches erstmalig das qualitative und quantitative Studium der einzelnen Prozesse der Hirnmetastasierung erlaubte, vom Arrest der Tumorzellen in Blutkapillaren bis hin zum Wachstum einer großen Metastase. Dabei wurden individuelle, fluoreszierende Tumorzellen in Gehirnen lebender Mäuse über einen Zeitraum von Minuten bis Monaten mittels 2-Photonen-Mikroskopie in vivo verfolgt und quantifiziert. Es konnten obligate, ineffiziente und erfolglose Schritte der Hirnmetastasierung bestimmt sowie die Rolle der bestehenden Hirngefäße, Endothelzellen und der Angiogenese ermittelt werden. Die in die Arteria carotis interna injizierten Lungenkarzinom- und Melanomzellen mussten folgende Schritte absolvieren, um über Wochen erfolgreich zu einer Makrometastase zu proliferieren (was nur wenigen Prozent gelang): 1.) vaskulärer Arrest durch Größenrestriktion in Gefäßgabeln, 2.) aktive und frühe Extravasation, 3.) Beibehaltung einer strikt perivaskulären Position über Wochen, 4.) Wachstum entlang bestehender Gefäße (Melanom) oder sehr frühe Angiogenese (Lungenkarzinom). Die Persistenz nicht-proliferierender Tumorzellen über viele Wochen (Ruhezustand, "dormancy") geschah nur im Einzelzellstadium und nur unter Beibehaltung eines strikten Gefäßkontaktes. "Dormancy" war bei Melanomzellen mit hoher Mobilität im Gehirn verbunden, wohingegen Lungenkarzinomzellen statisch blieben. Effiziente und ineffiziente Schritte waren vergleichbar für die Zell-Linien einer Tumorentität, unterschieden sich aber deutlich zwischen den Tumortypen und waren über die gesamte späte metastatische Kaskade verteilt. Chronische VEGF-A-Inhibition durch Bevacizumab induzierte einen Ruhezustand von Lungenkarzinom-Mikrometastasen durch Verhinderung ihres Angiogenese-abhängigen Wachstums zu Makrometastasen. Diese Ergebnisse sprechen für ein Potential antiangiogener Therapien für die Prophylaxe und Therapie der Hirnmetastasierung des Lungenkarzinoms. Das neue Tiermodell erlaubt es somit erstmals, die Wirkung von Therapien und molekularen Faktoren auf jeden einzelnen Schritt der späten metastatischen Kaskade zu bestimmen.
Die Bedeutung des Adhäsionsmoleküls JAM-A sowie der Chemokinrezeptoren Ccr1, -2 und -5 für die Rekrutierung von Leukozyten bei Entzündung und Ischämie-Reperfusion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Die Eigenschaft von Leukozyten, das Gefäßsystem zu verlassen und in das umliegende Gewebe auszuwandern, ist von essentieller Bedeutung für die Bekämpfung von Infektionen und darüber hinaus entscheidend für die Pathogenese des I/R-Schadens. Die Extravasation von Leukozyten stellt dabei einen kaskadenartig verlaufenden Prozess dar, welcher sich in die Schritte Rolling, Adhärenz, transendotheliale und interstitielle Migration gliedern lässt. Ein geeignetes Versuchsmodell, welches am M. cremaster der Maus in vivo alle Schritte des leukozytären Rekrutierungsprozesses während I/R zu analysieren erlaubt, liegt bisher nicht vor. Während die frühen Schritte des leukozytären Extravasationsprozesses weitgehend aufgeklärt sind, sind die Schritte der transendothelialen und interstitiellen Migration von Leukozyten unzureichend verstanden. In vitro Untersuchungen zeigen, dass das Molekül JAM-A in die Transmigration von Leukozyten involviert ist, jüngste in vivo Studien zeigen jedoch kontroverse Ergebnisse. Ferner gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass die Chemokinrezeptoren Ccr1, Ccr2 und Ccr5 an der Extravasation von Leukozyten beteiligt sind. Welche Bedeutung diese Chemokinrezeptoren für die einzelnen Schritte des leukozytären Rekrutierungsprozesses bei Entzündung und I/R besitzen, ist bislang unklar. Die Ziele der vorliegenden Arbeit waren daher i) ein geeignetes Modell zur Untersuchung aller Schritte des leukozytären Rekrutierungsprozesses bei I/R am M. cremaster der Maus zu entwickeln, ii) die Bedeutung des Adhäsionsmoleküls JAM-A für die Transmigration von Leukozyten zu untersuchen und iii) die Rolle der Chemokinrezeptoren Ccr1, Ccr2 und Ccr5 für die einzelnen Schritte des leukozytären Rekrutierungsprozesses bei Entzündung und I/R zu analysieren. In unterschiedlichen Versuchsansätzen wurde mit Hilfe der RLOT-Intravitalmikroskopie am M. cremaster anästhesierter Mäuse die leukozytären Migrationsparameter untersucht. Zur Bestimmung des Phänotyps transmigrierter Leukozyten wurden immunhistochemische Färbungen von Paraffinschnitten durchgeführt. In einer ersten Versuchsreihe wurden die einzelnen Schritte des leukozytären Extravasations-prozesses systematisch in Abhängigkeit von Ischämiedauer und Reperfusionszeit untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass es bereits nach 30 min Ischämie und 120 min Reperfusion gegenüber schein-operierten Kontrolltieren zu einem starken Anstieg von Leukozyten-adhärenz und -transmigration kommt. Eine Verlängerung der Ischämiezeit auf 60 bzw. 90 min konnte keine Steigerung der Effekte erzielen. Diese Befunde waren der Ausgangspunkt für weitergehende Untersuchungen, welche die Mechanismen des leukozytären Rekrutierungs-prozesses näher charakterisieren sollen. In diesem Zusammenhang wurde in einer zweiten Versuchsreihe unter Verwendung von JAM-A-defizienten Mäusen die Bedeutung des Adhäsionsmoleküls JAM-A für die Leukozytenrekrutierung systematisch unter verschiedenen inflammatorischen Bedingungen analysiert. Unsere Daten belegen, dass die transendotheliale Migration von neutrophilen Granulozyten und Monozyten einer Stimulus-spezifischen Regulation durch JAM-A unterliegt. Ferner lassen die Ergebnisse unserer Untersuchungen in eJAM-A-defizienten Tieren darauf schließen, dass endotheliales JAM-A die Transmigration von neutrophilen Granulozyten und Monozyten zwar in der Initialphase entzündlicher Prozesse vermittelt, zu späteren Zeitpunkten jedoch keine Bedeutung mehr zu besitzen scheint. Schließlich deuten unsere Befunde darauf hin, dass leukozytäres JAM-A an den der interstitiellen Leukozytenmigration zugrunde liegenden Mechanismen beteiligt ist. In einer letzten Versuchsreihe wurde die Rolle der Chemokinrezeptoren Ccr1, Ccr2 und Ccr5 für die Rekrutierung von Leukozyten bei Chemokin-induzierter Entzündung und I/R untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass diese Chemokinrezeptoren die Extravasation von neutrophilen Granulozyten und Monozyten bei Chemokin-induzierter Entzündung durch Effekte auf Adhärenz und (konsekutive) transendotheliale Migration mediieren und keinen Einfluss auf das interstitielle Migrationsverhalten transmigrierter Leukozyten besitzen. Des Weiteren ist es mittels durchflusszytometrischer Analyse gelungen, die Expression von Ccr2 und Ccr5 auf nativen neutrophilen Granulozyten nachzuweisen. Darüber hinaus konnte erstmals gezeigt werden, dass die Chemokinrezeptoren Ccr1, Ccr2 und Ccr5 zur Rekrutierung von neutrophilen Granulozyten und Monozyten in das postischämische Gewebe durch dynamische bzw. differentielle Regulation von Adhärenz und (konsekutiver) Transmigration beitragen.
Die Wirkung von Bradykinin auf die zerebrale Mikrozirkulation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirkung von Bradykinin auf die zerebrale Mikrozirkulation untersucht. Von besonderer Bedeutung war hierbei die Beurteilung der Interaktion von Leukozyten und Thrombozyten mit dem Gefäßendothel. Die verschiedenen Schritte der Leukozyten Aktivierung wurden bei vielen verschiedenen Krankheitsbildern nachgewiesen und tragen durch eine Verstärkung einer initialen Entzündungsreaktion zu einer zusätzlichen Schädigung des Gewebes bei. Zunehmend gibt es auch Hinweise für eine Beteiligung der Thrombozyten an der sekundären Gewebsschädigung z.B. nach Ischämie und Reperfusion unterschiedlicher Organsysteme. Die einzelnen Mechanismen, die zur Initiierung von Leukozyten und Thrombozy-ten Endothelinterkationen führen sind nur unzureichend verstanden. Untersuchungen an unterschiedli-chen Organen und bei unterschiedlichen Krankheitsbildern weisen auf eine Rolle des Kallikrein Kinin Systems bei der Aktivierung von Leukozyten hin. Die genauen Abläufe und die verantwortlichen Re-zeptoren des Kallikrein Kinin Systems wurden in der zerebralen Mikrozirkulation bisher nicht unter-sucht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war deshalb, die Wirkung von Bradykinin auf die zerebrale Mikrozirkulation und die dafür verantwortlichen Rezeptoren in einem in vivo Modell mit Hilfe der Fluoreszenz Intravitalmikroskopie zu untersuchen. Die Beurteilung der Mirkozirkulation sollte dabei in vivo erfolgen mit Zuhilfenahme der Histologie zur Beurteilung einer möglichen Extravasation von Leukozyten in das Hirnparenchym. Zur Durchführung der Untersuchungen wurde erstmals eine Methode zur Fluoreszenzfärbung von Thrombozyten in der Mongolischen Wüstenrennmaus etabliert. Dies ermöglichte in dem bereits etab-lierten Tiermodell des geschlossenen Schädelfensters die Untersuchung der einzelnen Schritte der Thrombozyten Endothelinteraktion in vivo. Zur Färbung der Thrombozyten war deren Isolation nötig, wobei die Aufrechterhaltung der Funktion der Thrombozyten in vitro und in vivo nachgewiesen wur-de. In dem verwendeten Modell war somit die Beurteilung von Leukozyten und Thrombozy-ten Endothelinteraktionen, arteriellen und venösen Gefäßdurchmessern, der funktionellen Kapillar-dichte, der mikrovaskulären Durchblutung und der Störung der Blut Hirnschranke möglich. Um eine mögliche Rolle des Kallikrein Kinin Systems bei pathologischen Vorgängen der zerebralen Mikrozirkulation zu untersuchen, erfolgte die intravasale Applikation von Bradykinin in verschiede-nen Konzentrationen über einen Zeitraum von 30 Minuten in die A. carotis interna. Während der Bradykinin Infusion kam es zu einem dosisabhängigen Abfall des Blutdrucks sowie der mikrovaskulären Durchblutung. Diese Werte erholten sich nach Ende der Infusion wieder und erreich-ten teilweise das Ausgangsniveau. Als möglicher Mechanismus für den Abfall des Blutdrucks und der Durchblutung kommt eine systemische Vasodilatation in Frage. Eine Veränderung der zerebralen Ge-fäßdurchmesser konnte nicht festgestellt werden. Die Blockade des Kinin B2 Rezeptors führte zu einer Verringerung des Blutdruckabfalls während der Bradykinin Infusion sowie zu einem höheren Anstieg des Blutdrucks bis zum Ende des Beobachtungszeitraums. Außerdem führte die Kinin B2 Rezep-tor Blockade zu einer geringeren Reduktion der mikrovaskulären Durchblutung während der Bradyki-nin Infusion. Im Gegensatz dazu führte die Blockade des Kinin B1 Rezeptors zu einer ausgeprägteren Reduktion der mikrovaskulären Durchblutung während der Infusion sowie am Ende des Beobach-tungszeitraums. Bradykinin induziert einen dosisabhängigen Anstieg der Anzahl rollender und adhärenter Leukozyten. Die Anzahl rollender Leukozyten nahm bis zum Ende des Beobachtungszeitraums stetig zu, die An-zahl adhärenter Leukozyten erreichte den Höchstwert eine Stunde nach Ende der Bradykinin Infusion. Analog zu den Untersuchungen aus der Intravitalmikroskopie fand sich in der histologischen Untersu-chung mit Hilfe der Esterase Färbung eine erhöhte Anzahl von Leukozyten im Hirnparenchym. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Bradykinin Leukozyten Endothelinteraktionen initiieren kann und an allen Schritten der Aktivierung bis zur Emigration in das Gewebe beteiligt ist. Diese Vorgänge schei-nen durch den Kinin B2 Rezeptor vermittelt zu werden, da eine Blockade desselben die Leukozy-ten Aktivierung verringern konnte. Die Blockade des Kinin B1 Rezeptors führte zu keiner signifikan-ten Veränderung der Leukozyten Endothelinteraktionen. Analog zur Wirkung auf die Leukozyten Endothelinteraktion führte Bradykinin zu einer Initiierung von Thrombozyten Endothelinteraktionen. Allerdings konnte lediglich eine erhöhte Anzahl rollender Thrombozyten beobachtet werden, adhärente Thrombozyten wurden nicht beobachtet. Eine mögliche Erklärung bieten Untersuchungen, die zeigen konnten, dass Bradykinin eine Thrombozy-ten Aktivierung hemmen kann. Da diese für die Adhärenz der Zellen am Gefäßendothel nötig ist, kann Bradykinin zwar durch Hochregulation endothelialer Adhäsionsmoleküle ein Rollen der Zellen am Endothel bewirken, jedoch eine feste Adhärenz verhindern. Wie bereits bei den Leukozy-ten Endothelinteraktionen führte die Gabe des Kinin B2 Rezeptorantagonisten zu einer Verringerung der rollenden Thrombozyten. Die funktionelle Kapillardichte änderte sich durch Infusion von Bradykinin ohne Rezeptorantagonisie-rung nur vorübergehend. Allerdings führte eine Blockade des Kinin B1 Rezeptors zu einem stetigen Abfall der funktionellen Kapillardichte bis zum Ende des Beobachtungszeitraums. Die verantwortli-chen Mechanismen sind dabei unklar, eine erhöhte Anzahl von adhärenten Leukozyten oder ein Ver-schluss der untersuchten Gefäßabschnitte durch Thrombozytenaggregate konnte nicht beobachtet wer-den. Insgesamt weisen die vorgestellten Versuche auf eine Beteiligung des Kallkrein Kinin Systems bei der Aktivierung von Leukozyten und Thrombozyten in der zerebralen Mikrozirkulation hin. Dieser Me-chanismus scheint durch den Kinin B2 Rezeptor vermittelt zu werden und wird möglicherweise durch eine Hochregulation endothelialer Adhäsionsmoleküle vermittelt. Die Aktivierung des Kinin B1 Re-zeptors könnte eine protektive Wirkung gegen die Mangelperfusion von Kapillaren mit Abnahme der nutritiven Durchblutung haben. Diese Ergebnisse bieten eine mögliche Erklärung für den protektiven Effekt von Kinin B2 Rezeptoran-tagonisten in unterschiedlichen Modellen zerebraler Insulte. Eine protektive Wirkung des Kinin B1 Rezeptors wurde häufig postuliert, es gibt jedoch bisher wenige Untersuchung zur Wirkung von Kinin B1 Rezeptoragonisten bei pathologischen Prozessen des Gehirns. Die vorliegenden Ergebnisse können die Grundlage für weitere Untersuchungen zu Veränderungen der Mikrozirkulation bei verschiedenen Krankheitsbildern des zentralen Nervensystems bilden. Nur eine genaue Kenntnis der komplexen und multifaktoriellen pathophysiologischen Prozesse wird eine effektive Therapie dieser Erkrankungen ermöglichen.
Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran bei der experimentellen zerebralen Ischämie mit Reperfusion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Experimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass es beim Schlaganfall in der Reperfusionsphase zu einer Schädigung der Basalmembran und zu einem Zusammenbruch der mikrovaskulären Integrität kommt. Dies kann zu einer intrazerebralen Hämorrhagie mit zusätzlichen neurologischen Schäden führen. Die systemische Thrombolyse mit rekombinantem Gewebe-Plasminogen-Aktivator (rt-PA) zielt auf die Fibrinolyse des Thrombus, der das Hirngefäß verschließt, um den zerebralen Blutfluß wiederherzustellen und den Infarkt zu verkleinern. Jedoch haben klinische Studien gezeigt, dass die Thrombolyse die Gefahr einer intrazerebralen Blutung steigert. Klinische und experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass eine postischämische Hypothermie das Infarktvolumen verkleinern kann. Der postulierte Wirkungsmechanismus einer Hypothermie ist die Verminderung der Aktivität unspezifischer und spezifischer proteolytischer Systeme (z.B. endogene Plasminogenaktivatoren (u-PA und t-PA) oder die Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9). Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran der Hirngefäße nach einer zerebralen Ischämie mit Reperfusion zu untersuchen und mögliche Schädigungsmechanismen darzulegen. Hierzu wurde bei narkotisierten, beatmeten Ratten eine 3-stündige transiente fokale zerebrale Ischämie mit 24-stündiger Reperfusion erzeugt. Postischämisch wurde durch extrakorporale Kühlung eine 24-stündige milde bis moderate Hypothermie erzeugt und mittels Temperatursonde ständig gemessen und überwacht. Nach Beendigung des Versuches wurden die Hirne entnommen und einer volumetrischen, immunohistochemischen und biochemischen Aufarbeitung und Auswertung zugeführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine postischämische Hypothermie die Degradation der Basalmembran zum großen Teil verhindert und die Infarktgröße signifikant reduziert. Gleichzeitig kommt es durch diesen strukturellen Erhalt der Basalmembran zu einem funktionellen Erhalt der Integrität und zu einer Verminderung der Extravasation von korpuskulären und nichtkorpuskulären Blutbestandteilen. Zusätzlich konnte eine mögliche Ursache für die Degradation der Basalmembran und den Verlust der mikrovaskulären Integrität aufgezeigt werden. Die postischämische Hypothermiebehandlung verhinderte die Steigerung der Aktivität der Plasminogen-Aktivatoren u-PA und t-PA und der Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9. Wir schließen aus den vorliegenden Untersuchungen, dass eine postischämische Hypothermie das Risiko des Auftretens einer Hämorrhagie als gefürchtete Komplikation nach einer zerebralen Ischämie senken kann. Dies gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da die therapeutische Anwendung der systemischen Thrombolyse die Gefahr des Auftretens einer Hämorrhagie steigert. Eine systemische Thrombolyse in Kombination mit einer Hypothermie wäre eine mögliche Therapieoption, um die Gefahr des Auftretens einer intrazerebralen Blutung zu vermindern. Der genaue Pathomechanismus ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Deshalb sind vor der Anwendung beim Menschen noch weitere experimentelle und klinische Studien notwendig.
Untersuchungen zur Rolle des HIV-1-Tat-Proteins in der AIDS-assoziierten Vaskulopathie
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Bei Patienten, die mit dem humanen Immundefizienzvirus-1 (HIV-1) infiziert sind, kommt es häufig zu krankhaften Veränderungen des Endothels, die zu einer Fehlfunktion des Gefäßsystems führen. Klinischer Ausdruck dieser als acquired immune deficiency syndrome (AIDS)-assoziierten Vaskulopathie bezeichneten Veränderungen sind Schädigungen des Aortenendothels, die mit einer erhöhten Adhäsion mononukleärer Zellen an das Endothel einhergehen, Defekte der Blut-Hirn-Schranke, die zur Entstehung von Demenz beitragen, sowie das Kaposi-Sarkom (KS), das durch eine sehr starke Extravasation von T-Zellen und Monozyten gekennzeichnet ist. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass das regulatorische HIV-1-Tat-Protein und das inflammatorische Zytokin TNF-a synergistisch die Adhäsion der promonozytären Zelllinie U937 und von PBMZ an humane mikrovaskuläre Endothelzellen (HMVEZ) erhöht. Die adhäsionsfördernde Wirkung wurde selektiv bei HIV-1-Tat beobachtet, andere virale Proteine des HIV-1, wie Negativfaktor (Nef) und das Glykoprotein gp41, hatten keinen Einfluss auf die Adhäsion. Anhand zellspezifischer Marker wurde gezeigt, dass HIV-1-Tat in periphere mononukleäre Blutzellen (PBMZ) spezifisch die Adhäsion von Monozyten und T-Zellen erhöhte, jedoch nicht von B-Zellen. Intravital-mikroskopische Untersuchungen an der Maus bestätigten in vivo, dass HIV-1-Tat und TNF-a synergistisch die Adhäsion von Leukozyten an das Endothel erhöhten. HIV-1-Tat reguliert die Expression einer großen Anzahl zellulärer Gene. Diese Fehlregulation durch HIV-1-Tat könnte an der Enstehung der AIDS-assoziierten Vaskulopathie beteiligt sein. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird die parakrine Wirkung von HIV-1-Tat auf die Genexpression in Monozyten mittels der suppressed subtractive hybridization (SSH)-Methode untersucht. Hierbei wurde O-linked N-Acetylglucosamine-transferase (OGT) als Gen identifiziert, dessen Expression durch HIV-1-Tat unterdrückt wird. Bisher ist bekannt, dass OGT ein Repressor der basalen Transkription und der SP-1-regulierten Transkription ist. Die Expression von OGT wurde sowohl auf mRNA-Ebene als auch auf Protein-Ebene durch HIV-1-Tat und VEGF121 gehemmt, wobei die Regulierung über den VEGF-Rezeptor Flt-1 vermittelt wurde. Weitere Faktoren wie inflammatorische Zytokine (TNF-a, IL-1b, IFN-g und IL-2), angiogene Wachstumsfaktoren (bFGF und VEGF165) und Chemokine (IL-8, MIP-1a, IP-10, MCP-1 und SDF-1a) hatten keine hemmende Wirkung auf die OGT-Expression. Die schnelle Abnahme von intrazellulärem OGT-Protein wurde weder durch lysosomale Proteasen noch durch Proteasen des Proteasoms verursacht. Expressionsstudien an PBMZ von fünf verschiedenen Probanden zeigten, dass bei zwei Probanden die OGT-Konzentration durch HIV-1-Tat zunahm, bei zweien nahm sie ab und bei einer Person gab es keine Veränderung. Diese Ergebnisse belegen, dass HIV-1-Tat entscheidend an der Entstehung der AIDS-assoziierten Vaskulopathie, insbesondere von KS, beteiligt sein könnte. Die Repression von OGT durch HIV-1-Tat könnte die weitreichende Wirkung des HIV-1-Tat-Proteins auf zelluläre und virale Gene erklären.
Untersuchung zur Pathophysiologie der experimentellen Pneumokokkenmeningitis an der Ratte
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Zusammenfassung Trotz beträchtlicher Fortschritte in der antibiotischen Behandlung bakterieller Erkrankungen blieb der Krankheitsverlauf und die Sterberate der bakteriellen Meningitis, insbesondere der Pneumokokkenmeningitis, innerhalb der letzten Jahre unverändert. Mit der Erkenntnis, daß das Ausmaß der intrakraniellen Entzündung positiv mit dem Verlauf der Erkrankung korreliert, gewann die Frage nach der Rolle der Leukozyten im Rahmen des Krankheitsgeschehens zunehmend an Bedeutung. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher, die Bedeutung von Granulozyten, Monozyten und des Zusammenspiels dieser beiden Zellarten im Rahmen der pathophysiologischen Abläufe während der experimentellen Pneumokokkenmeningitis aufzudecken. Insbesondere wurden Veränderungen in den Parametern intrakranieller Druck, Liquorpleozytose und Blut-Hirnschrankenstörung in der Frühphase und im fortgeschrittenen Stadium der Meningitis untersucht. Hierfür kamen zwei Tiermodelle zur Anwendung: 1) Frühphase der Erkrankung: Hierbei wurde narkotisierten Ratten durch intrazisternale Injektion von Hitze-abgetöteten Pneumokokken (HKP) eine Meningitis induziert. Anschließend wurden über einen Zeitraum von sechs Stunden kontinuierlich Blutdruck, intrakranieller Druck und Temperatur überwacht. Eine Stunde vor Versuchsende erhielten die Tiere 1 ml Evans-blau zur Quantifizierung der Blut-Hirnschrankenstörung intravenös injiziert. Nach Ablauf des Beobachtungszeitraums wurden Liquorproben zur Bestimmung der Zellzahl und Evans-blau-Konzentration und Gehirnproben zur histologischen Aufarbeitung gewonnen. 2) Fortgeschrittenes Stadium der Erkrankung (Spätphase): In diesem Modell wurde die Meningitis mittels transkutaner Injektion von Streptococcus pneumoniae Serotyp 3 in die Cisterna magna ausgelöst. 24 Stunden nach Injektion wurden auch bei diesen Tieren die Leukozytenzahl und Evans-blau Konzentration im Liquor bestimmt sowie Gehirnproben zur weiteren Aufarbeitung gewonnen. Um die Beteiligung der Granulozyten an den pathophysiologischen Veränderungen während der Früh- bzw. Spätphase der bakteriellen Meningitis untersuchen zu können, wurden die Versuchstiere mit einem gegen polymorphkernige Leukozyten gerichteten Antikörper (Rabbit Anti-Rat-PMN-Antikörper) vorbehandelt, wodurch eine nahezu vollständige Depletion der Granulozyten erreicht wurde. Um ebenso die durch Monozyten bedingten Auswirkungen während der Frühphase der Pneumokokkenmeningitis feststellen zu können, wurde eine weitere Gruppe mit λ-Carrageenan vorbehandelt, einer Substanz, deren toxische Wirkung auf mononukleäre Zellen bekannt ist. In einer dritten Gruppe schließlich wurden beide Wirkstoffe in Kombination miteinander verabreicht. Für die Frühphase der Pneumokokkenmeningitis ergaben sich folgende Ergebnisse: 1) Die intrazisternale Gabe von Hitze-abgetöteten Pneumokokken führte im Verlauf von sechs Stunden bei den Ratten zu einem Anstieg des intrakraniellen Drucks, der Liquorleukozytenzahl und zur Störung der Blut-Hirnschrankenfunktion. 2) Die Depletion neutrophiler oder monozytärer Zellen bewirkte bei den Versuchstieren eine signifikante Reduktion der Liquorpleozytose und des intrakraniellen Druckanstieges. Gemessen an der Evans-blau-Extravasation wiesen diese Tiere auch eine geringere Funktionsstörung der Blut-Hirnschranke auf. 3) Bei den zweifach-depletierten Tieren waren diese Ergebnisse noch ausgeprägter. Sie zeigten bzgl. des intrakraniellen Druckanstieges, der Liquorpleozytose und Blut-Hirnschrankenfunktion keinen wesentlichen Unterschied zu unbehandelten Kontrolltieren. Für das fortgeschrittene Stadium der Meningitis zeigte sich folgendes: Nach Depletion granulozytärer Zellen ließ sich auch hier eine deutliche Reduktion des intrakraniellen Druckanstieges, der Liquorpleozytose und der Blut-Hirnschrankenstörung erreichen. Allerdings war diese Reduktion weitaus schwächer ausgeprägt als in den vorangegangenen Untersuchungen. Derzeit liegen noch keine Langzeituntersuchungen zur Wirkdauer des gegen polymorphkernige Leukozyten gerichteten Antikörpers vor. Daher ist nur zu vermuten, daß möglicherweise ein zunehmender Wirkverlust des Antikörpers während des Experiments für diese Diskrepanz verantwortlich sein könnte. Unterstützung findet diese Annahme durch den eindeutig höheren prozentualen Anteil neutrophiler Zellen in Differentialblutbildern von Langzeitversuchen verglichen mit denjenigen der Kurzzeitversuche. Da mit Carrageenan vorbehandelte Tiere zum Teil erhebliche Blutdrucksenkungen im Laufe des Experimentes aufwiesen, war es nicht möglich, diese Substanz in den Langzeitversuchen einzusetzen. Zusammenfassend konnte mit dieser Arbeit gezeigt werden, daß Granulozyten, aber auch Monozyten eine essentielle Rolle im Hinblick auf die Ursachen pathophysiologischer Veränderungen während der Früh- und vermutlich auch der späteren Phase der Pneumokokkenmeningitis spielen. Andere Methoden zur Depletion monozytärer Zellen sollten künftig angewendet werden, um die Auswirkungen einer Monozyten-Depletion auf die fortgeschrittene Phase der Pneumokokkenmeningitis genauer untersuchen zu können. Es kommen verschiedene Mechanismen in Betracht, wie Granulozyten und Monozyten zu diesen Veränderungen führen können: 1) Neutrophile sind als Produzenten gewebezerstörender Faktoren bekannt. Ihr Waffenarsenal umfaßt eine Vielzahl toxischer Metabolite, darunter freie Sauerstoffradikale, Stickstoffmonoxid und Enzyme wie Matrix-Metalloproteinasen. In vorangegangenen Studien wurde bereits die Relevanz dieser Mediatoren für die bakterielle Meningitis belegt (z.B. Pfister et al., 1990 a,b; Koedel et al., 1995; Paul et al., 1998). Ohne Mithilfe anderer Mitglieder des Immunsystems sind Neutrophile nicht fähig zwischen fremden und wirtseigenen Antigenen zu unterscheiden; ihre „Waffen“ richten sich in diesem Fall auch gegen den eigenen Wirt. Frühere Studien zeigten, daß im Liquorraum von einem Komplementmangel ausgegangen werden muß und somit hier der zellulären Abwehr die nötige Unterstützung fehlt, um das richtige Ziel der Zerstörung preiszugeben. 2) Monozyten/Makrophagen gelten als Hauptproduzenten von IL-1 und anderen Chemokinen, die als chemotaktisches Signal für Neutrophile dienen. Sie stellen damit unverzichtbare Komplizen und Vorläufer für granulozytäre Zellen dar, da sie wesentlich an deren Immigration in den Subarachnoidalraum beteiligt sind. Ferner könnten mononukleäre Zellen durch ihre Freisetzung von Glutamat direkt an den auftretenden Schäden beteiligt sein.
Effekte von Diaspirin cross-linked Hemoglobin (DCLHbTM) auf die Mikrozirkulation und den Gewebe–pO2 im Vergleich zu unterschiedlich lang gelagerten Erythrozytenkonzentraten im validierten Rückenhautkammermodel am Syrischen Goldhamster
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Zunehmende Kosten und eine steigende Nachfrage nach Fremdblut bei rückläufiger Spendebereitschaft weisen auf die Notwendigkeit von Blutersatzstoffen hin. Bei kritischen Hämoglobinwerten werden beim Einsatz von kristalloiden und/oder kolloidalen Infusionslösungen zur Wiederherstellung der Makrohämodynamik und des Sauerstofftransportes nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Die in den letzten Jahren entwickelten künstlichen Hämoglobinlösungen weisen bisher positive Ergebnisse auf in Bezug auf die Makrozirkulation. Der Einfluß dieser Lösungen auf die Mikrozirkulation ist derzeit noch wenig untersucht worden. Aus diesem Grunde wurde am Institut für Chirurgische Forschung eine experimentelle Studie am validierten Rückenhautkammermodel am Syrischen Goldhamster durchgeführt. In dieser Studie wurden die Auswirkungen des künstlichen Sauerstoffträgers DCLHbTM auf die Mikrozirkulation und die Gewebeoxygenierung mit unterschiedlich lang gelagerten Erythrozytenkonzentraten verglichen. Als Modell diente die Rückenhautkammer am Syrischen Goldhamster. Zur Untersuchung der Mikrozirkulation diente das Intravitalmikroskop. Insgesamt beinhaltet dieser Teil der Studie 5 verschiedene Gruppen mit je 8 Versuchstieren (DCLHbTM n=8; Syngenes Vollblut n=8; Syngene Erythrozytenkonzentrate 1 Tag gelagert n=8; Syngene Erythrozytenkonzentrate 11-14 Tage gelagert n=8; Syngene Erythrozytenkonzentrate 24-28 Tage gelagert n=8). Die Gewebeoxygenierung wurde unter Zuhilfenahme der Mehrdraht-Oberflächensonde analysiert. Diese Messung erfolgte in 4 weiteren Gruppen von 7 bzw. 8 Versuchstieren. (DCLHbTM n=8; Syngenes Vollblut n=8; Syngene Erythrozytenkonzentrate 1 Tag gelagert n=7; Syngene Erythrozytenkonzentrate 24-28 Tage gelagert n=7). Die Applikation der entsprechenden Blutkonzentrate erfolgte durch isovolämische Austauschtransfusion. Die folgenden mikrozirkulatorischen Parameter wurden mit Hilfe der Intravitalmikroskopie quantitativ erfaßt: Gefäßdurchmesser, postkapilläre venoläre Blutfließgeschwindigkeit, Funktionelle Kapillardichte, Leukozyten/Endothel-Interaktion, Extravasation, Scherrate. Zur Beurteilung der Makrohämodynamik wurden kontinuierlich der mittlere arterielle Blutdruck und die Herzfrequenz aufgezeichnet. Zur Beurteilung der lokalen Gewebe-Sauerstoffversorgung wurden für jede der 4 untersuchten Gruppen PO2-Summenhistogramme erstellt.Im Bereich der mikrozirkulatorischen Parameter arteriolärer und postkapillärer venolärer Gefäßdurchmesser traten weder in der DCLHbTM - noch in der Gruppe der 24-28 Tage lang gelagerten Syngene Erythrozytenkonzentrate wesentliche Veränderungen auf. In den übrigen Versuchsgruppen nahm der Gefäßdurchmesser gering, jedoch statistisch signifikant zu. In keiner der zu untersuchenden Gruppen kam es zu einem signifikanten Anstieg der postkapillären venolären Blutfließgeschwindigkeit. Die ermittelten Werte der rollenden, adhärenten sowie nicht adhärenten Leukozyten waren starken jedoch statistisch nicht signifikanten Schwankungen unterworfen. In Bezug auf die endotheliale Integrität waren geringe Zunahmen der arteriolären als auch der postkapillären venolären Extravasation zu erkennen. Statistisch signifikante Unterschiede wurden innerhalb der Arteriolen nur in der Gruppe 11-14 Tage gelagerte Syngene Erythrozytenkonzentrate festgestellt. Die Extravasation aus postkapillaren Venolen erreichte in der Gruppe Syngenes Vollblut statistisch signifikante Werte. Die Funktionelle Kapillardichte nahm statistisch signifikant ab in der Gruppe DCLHbTM. Diese Reduktion war in den anderen Versuchsgruppen nicht zu beobachten. Dagegen nahm die Scherrate lediglich in der Gruppe der 14 Tage lang gelagerten Syngenen Erythrozytenkonzentrate statistisch signifikant ab. Der Einfluß von DCLHbTM auf die Makrohämodynamik bewirkte einen sofortigen signifikanten Anstieg des mittleren arteriellen Blutdruckes bei konstanter Herzfrequenz. In den übrigen Versuchsgruppen kam es zu keinen wesentlichen Änderungen der Makrohämodynamik. Nach Hämodilution mit DCLHbTM trat während des Versuches eine tendenzielle Verbesserung der Gewebeoxygenierung auf. Bei Blutersatz durch frisches Syngenes Vollblut bzw. 1 Tag lang gelagerte Syngene Erythrozytenkonzentrate verbesserte sich der Gewebesauerstoffpartialdruck signifikant. In der Gruppe der 24-28 Tage lang gelagerten Syngene Erythrozytenkonzentrate verbesserte sich die Gewebeoxygenierung nicht. Faßt man die gesamten hier erhobenen Daten der Intravitalmikroskopie und der Gewebesauerstoff-Partialdrücke zusammen, so läßt sich folgende Aussage treffen: ohne wesentliche Beeinflussung und negative Auswirkung auf die Mikrozirkulation führt der Austausch von Syngenem Vollblut, bzw. frischen Erythrozytenkonzentraten zu einer Verbesserung der Gewebeoxygenierung des Skelettmuskels. Sowohl der Austausch von 24-28 Tage gelagerten Syngenen Erythrozytenkonzentraten und der von DCLHbTM bewirkttendenziell eine Verbesserung der Gewebe-pO2-Partialdrücke. Daraus läßt sich ableiten, daß die Transfusion von frischen Erythrozytenkonzentraten nach wie vor die optimale Versorgung der Gewebeoxygenierung darstellt. Dennoch beinhalten die künstlichen Hämoglobinlösungen eine wirksame Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Sauerstofftransportes. Speziell die von Blutgruppen unabhängige, quasi infektfreie künstliche Hämoglobin-Lösung wäre von großer Bedeutung für die Notfallmedizin.