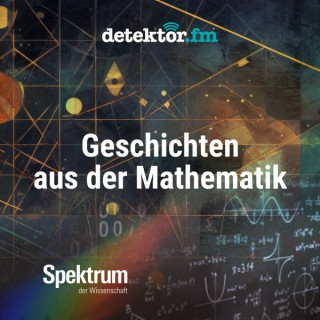Podcasts about datscha
- 29PODCASTS
- 37EPISODES
- 41mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about datscha
Latest news about datscha
- Oxford Street footfall jumps 24% thanks to international visitors Retail Gazette - Aug 24, 2022
Latest podcast episodes about datscha
66. Proptech-profilen om framtidens fastighetsbolag: så blir fastighetsaffären lönsam
I detta avsnittet möter Christian Nilsson, Sverigechef på iBinder SVerige, proptech-profilen Magnus Svantegård, som berättar om resan från Datscha till dagens roll som rådgivare och investerare. Han beskriver hur digitaliseringens möjligheter länge översteg behovet, men att regelverk och ESG-krav nu driver på adoptionen; Datschas framgång förklaras med tajming, starka ägare, en produkt i världsklass och en hård sälj-/marknadskultur. Magnus varnar för att bygga egna system utan rätt produktkompetens och pekar på att Sverige ofta ligger före många marknader, men att internationell expansion kräver anpassning. Om AI menar han att effekten överskattas kortsiktigt och underskattas långsiktigt; det viktiga är vilket resultat tekniken skapar. Framåt ser han ökat effektivitetstryck, fortsatt proptech-tillväxt kring 20–30 % per år och trolig konsolidering bland mindre fastighetsbolag, samt ett samhällsbehov av fler entreprenörer när arbetsroller förändras.Om AvimaByggsnack görs av oss på Avima. Vi håller ordning på din information i stora och komplexa projekt inom infrastruktur, samhällsbyggnad och fastighet. Vi ser till att kommunikationen och dokumentationen funkar hela vägen, från tidiga skeden till förvaltning.Läs mer om oss på Avima.seEn del av iBindergruppeniBindergruppen finns för alla som vill jobba smartare med information, kommunikation och dokumentation i bygg- och anläggningsprojekt. Med bolag som iBinder, Avima, SokoPro, SundaHus, REQS och Byggnet är vi verksamma i hela Norden – och vi växer! Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar hela fastighetens livscykel.Läs mer om på ibinder.com
First set of Kollektiv Ost and Kayf at Snow Control festival in france 2025.
Wer ist die radikal anti-russische Kaja Kallas? | Von Thomas Röper
Die ehemalige estnische Ministerpräsidentin und heutige Chefin der EU-Außenpolitik Kaja Kallas ist eine der radikalsten Anti-Russen in der EU. Interessant ist ihre Geschichte, denn ihre Familie gehörte zur regierenden Elite in der Sowjetunion und hat nach der Wende einfach die Fahne in den neuen Wind gehängt.Ein Kommentar von Thomas Röper.Wenn Kaja Kallas in den letzten Jahren durch etwas aufgefallen ist, dann vor allem durch ihre radikal anti-russische Haltung und die Horrorgeschichten, die sie westlichen Medien gerne über das Leid erzählt, das ihre Familie in der Zeit der Sowjetunion angeblich durchleben musste. Schon daran sieht man allerdings, dass die Dame es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt, was sie mit ihrer neuen Chefin, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gemeinsam hat.Die „schlimmen Jahre“ in der SowjetunionFrau Kallas erzählt gerne von dem schrecklichen Leben, das ihre Familie angeblich unter sowjetischer Herrschaft erdulden musste.Allerdings gehörte ihre Familie zur politischen Elite der estnischen Sowjetrepublik, Frau Kallas wurde für sowjetische Verhältnisse mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, ihre Familie gehörte zur „Nomenklatura“, wie man damals sagte.Ihr Vater Siim Kallas trat 1972 im Alter von 23 Jahren in die Kommunistische Partei ein und machte im Finanzministerium der Estnischen Sowjetrepublik Karriere. 1979, im Alter von gerade mal 31 Jahren, war er bereits Direktor des Vorstands der Estnischen Sberbank, also der staatlichen Bank. In der sowjetischen Verwaltungshierarchie entsprach das der Position eines stellvertretenden Ministers in der Regierung der Estnischen Sowjetrepublik und war mit einem hohen sozialen Status, einem Dienstwagen, einer Datscha, einer schönen Wohnung, einem angemessenen Gehalt und Zugang zu „exotischen“ Waren verbunden, die den Normalsterblichen meist verwehrt blieben.Die 1977 geborene Kaja Kallas wuchs in ihrer Kindheit also mit Vergünstigungen auf, von denen ihre Altersgenossen nicht einmal träumen konnten.Ihr Papa, der Genosse Siim Kallas, machte in der von Kaja heute als „imperiale“ Macht bezeichneten Sowjetunion eine Parteikarriere und wurde 1986 stellvertretender Herausgeber der estnischen Parteizeitung Rahva Hääl („Stimme des Volkes“) und 1989 Vorsitzender der Gewerkschaftsorganisationen Sowjetestlands.Kaja Kallas versucht möglichst, diese Teile ihrer Biografie vergessen zu machen und spricht lieber darüber, wie hart es für sie war, „unter dem Joch der sowjetischen Tyrannei“ zu leben...hier weiterlesen: https://apolut.net/wer-ist-die-radikal-anti-russische-kaja-kallas-von-thomas-roper/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
"Hip und begehrt: Die Datscha" – von Dirk Kaesler & Stefanie von Wietersheim - Kolumne
Rätsel des Lebens – Kolumne von Dirk Kaesler & Stefanie von Wietersheim Dirk Kaesler & Stefanie von Wietersheim Hip und begehrt: die Datscha – Warum die Datschen-Kultur nach der Wende mehr denn je blüht (Hördauer ca. 16 Minuten) Unter der Überschrift „Rätsel des Lebens“ schreiben wir jeden Monat in unserer Kolumne darüber, was uns in der aktuellen Gesellschaft als erstaunlich, rätselhaft, aufsehenerregend oder amüsant erscheint. Rätsel des Lebens. Warum, um Gottes Willen, haben wir uns insgesamt 50 Folgen der Netflix-Serie „The Crown“ angesehen, von denen jede 58 Minuten dauert? Die Windsor-Story in Einzelhappen über Monate genossen oder als Binge Watching reingezogen – und dabei gefiebert, gelacht, geweint und schließlich getrauert, als alles vorerst vorbei war? ... Den Text der Kolumne finden Sie hier Dirk Kaesler Prof. Dr., war nach seiner Promotion und Habilitation an der Universität München von 1984 bis 1995 Professor für Allgemeine Soziologie an der Universität Hamburg, von 1995 bis zu seiner Pensionierung 2009 an der Universität Marburg. Er lebt inzwischen in Potsdam. Zu seinen Forschungs- und Publikationsschwerpunkten gehören Wissenschafts- und Religionssoziologie, Politische Soziologie, Geschichte und Theorien der Soziologie, ihre Klassiker und Hauptwerke und dabei vor allem Max Weber. Zu seinen letzten Buchveröffentlichungen gehören die 2014 im Verlag C.H. Beck erschienene Biographie „Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn“ und sein zusammen mit Stefanie von Wietersheim 2021 im Verlag LiteraturWissenschaft veröffentlichter Band "Schön deutsch. Eine Entdeckungsreise".2009 bis 2014 sind in "literaturkritik.de" regelmäßig seine Glossen "Abstimmungen mit der Welt" erschienen. Stefanie von Wietersheim ist Kulturjournalistin und Buchautorin. Ihre Bildbände Frauen & ihre Refugien, Vom Glück mit Büchern zu leben und Mütter & Töchter wurden zu Klassikern ihres Genres. In ihrem Buch Grand Paris – Savoir-vivre für Insider und solche, die es werden wollen schreibt sie über ihre Wahlheimat Frankreich. Sie geht als Autorin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im In- und Ausland auf Reportage. Zusammen mit Dirk Kaesler veröffentlichte sie 2021 im Verlag LiteraturWissenschaft.de Schön deutsch. Eine Entdeckungsreise. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, hören Sie doch hier mal rein. Sprecher: Matthias Pöhlmann Aufnahme, Schnitt und Realisation Uwe Kullnick
Die Weltpolitik hat sich in das Leben von German Moyzhes geschlichen. Ihm bleibt nur noch die Hoffnung auf Veränderung – und der Traum, in seine Datscha nach Russland zurückzukehren. Heutiger Gast: Leon Igel, Redaktor Host: Simon Schaffer Weitere Informationen zum Thema: https://www.nzz.ch/international/nach-gefangenenaustausch-german-moyzhes-liebt-russland-noch-immer-ld.1849031 Informiere dich kurz, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem «NZZ Briefing». Jetzt kostenlos registrieren und abonnieren unter go.nzz.ch/briefing
Der Sturz Chruschtschows - Anruf auf der Datscha
Er war der mächtigste Mann der Sowjetunion - bis Verschwörer in Moskau seinen Sturz planten: Vor 60 Jahren musste Nikita Chruschtschow seinen Platz räumen. Viele Parteifunktionäre fühlten sich von seinen Reformen übergangen. Dornblüth, Gesine www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
Aus Gorkis "Sommergästen" wird "Datscha": Uraufführung in Berlin
Mumot, André www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit
Bis zu seinem Lebensende fürchtet der Mathematiker Andrei Kolmogorow die sowjetische Geheimpolizei, die ihn auf Stalins Geheiß beobachtet. Denn Kolmogorow führt ein Leben, das in der Stalin-Diktatur eigentlich nicht geduldet wird. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:01) Einleitung (00:02:14) Andrei Kolmogorows Aufwachsen in der Sowjetunion (00:03:47) Mathematische Forschung unter Stalin (00:05:50) Forschung zwischen Universität und Datscha (00:09:18) Verfolgt von der Geheimpolizei (00:10:11) Die Lusin-Affäre (00:12:04) Der Vermesser des Zufalls (00:14:08) Kolmogorow-Komplexität (00:17:46) Die Komplexität von Wettervorhersagen (00:21:44) Die Konsequenzen der Klatsche (00:23:49) Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-andrei-kolmogorow
Geschichten aus der Mathematik | Andrei Kolmogorow und das Doppelleben in der Diktatur
Bis zu seinem Lebensende fürchtet der Mathematiker Andrei Kolmogorow die sowjetische Geheimpolizei, die ihn auf Stalins Geheiß beobachtet. Denn Kolmogorow führt ein Leben, das in der Stalin-Diktatur eigentlich nicht geduldet wird. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:01) Einleitung (00:02:14) Andrei Kolmogorows Aufwachsen in der Sowjetunion (00:03:47) Mathematische Forschung unter Stalin (00:05:50) Forschung zwischen Universität und Datscha (00:09:18) Verfolgt von der Geheimpolizei (00:10:11) Die Lusin-Affäre (00:12:04) Der Vermesser des Zufalls (00:14:08) Kolmogorow-Komplexität (00:17:46) Die Komplexität von Wettervorhersagen (00:21:44) Die Konsequenzen der Klatsche (00:23:49) Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-andrei-kolmogorow
Andrei Kolmogorow und das Doppelleben in der Diktatur
Bis zu seinem Lebensende fürchtet der Mathematiker Andrei Kolmogorow die sowjetische Geheimpolizei, die ihn auf Stalins Geheiß beobachtet. Denn Kolmogorow führt ein Leben, das in der Stalin-Diktatur eigentlich nicht geduldet wird. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:01) Einleitung (00:02:14) Andrei Kolmogorows Aufwachsen in der Sowjetunion (00:03:47) Mathematische Forschung unter Stalin (00:05:50) Forschung zwischen Universität und Datscha (00:09:18) Verfolgt von der Geheimpolizei (00:10:11) Die Lusin-Affäre (00:12:04) Der Vermesser des Zufalls (00:14:08) Kolmogorow-Komplexität (00:17:46) Die Komplexität von Wettervorhersagen (00:21:44) Die Konsequenzen der Klatsche (00:23:49) Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-andrei-kolmogorow
Lutz Dursthoff – Nachruf aufs Paradies | Gespräch
Zusammen mit seiner Frau hat sich Lutz Dursthoff in seiner russischen Datscha ein kleines Paradies erschaffen. Über dieses Kleinod in der Provinz, die wilde Natur, die Eigenheiten der Nachbarn, wollte er ein Buch schreiben - doch dann kam alles anders. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich auch das Dorfleben verändert. Und so ist das Buch ein wehmütiger, aber trotziger Abgesang auf eine kleine, ländliche Idylle geworden. Der Krieg ist dort nicht zu sehen und zu hören, aber doch zu spüren. Kiepenheuer & Witsch Verlag, 256 Seiten, 23 Euro ISBN 978-3462006254
Philip Venables' Werke sind vielschichtig und am Puls der Zeit
Seine Vertonung des queeren Kultbuches «The Faggots & Their Friends Between Revolutions» aus den 70er-Jahren war ein Highlight des Festivalsommers in Aix-en-Provence. Der 44-järhige britische Komponist studierte Naturwissenschaften, bevor er sich der Musik zuwandte. Zunächst komponierte er instrumentale Werke, und reicherte sie bald um theatrale Elemente und Text an, wie sein Violinkonzert, das er für den mit ihm befreundeten Geiger Pekka Kuusisto komponierte. Schliesslich fand er im Musiktheater seine Domäne. Seine Werke spielen sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab, sie regen zum Denken an, sind direkt, gehen unter die Haut, und sie drehen sich um aktuelle, drängende Themen. «Denis & Katya» (2019) etwa, ein Liebesdrama in einer russischen Datscha, welches vor ein paar Jahren weltweit Medienaufmerksamkeit erregte und teils über Social Media gestreamt wurde. In der psychologischen Studie «4.48 Psychosis» (komponiert 2016 für das Royal Opera House in London) vertonte er das letzte Libretto von Sarah Kane und brachte damit eindringlich die Leiden einer depressiven Frau auf die Opernbühne. Und schliesslich «The Faggots & Their Friends Between Revolutions»: Ein musikalisch buntes Musiktheater, das Einblicke in die Geschichte der Queer-Community gibt - aus queerer Perspektive. Musikalisch oszillieren seine Werke zwischen Barock und Clubmusik, zwischen Gesprochenem und klassischem Gesang; Text, Musik, Schauspiel und Video überlagern und ergänzen sich. Seine Opern werden auf den bedeutendsten Festivals und an grossen Häusern gezeigt. Seit einigen Jahren arbeitet er mit dem Librettisten und Regisseur Ted Huffman zusammen, sie sind ein symbiotisches Team. Trotz aller Modernität hat Venables aber auch ein Faible für die klare und klassische Struktur der Nummernoper, in welcher sich Rezitative und Arien abwechseln.
Gerade sind Winterferien. Silvester feiern wir auf einer kleinen Datscha, nicht weit weg vom Stadtrand, mit einem bunten Strauß spannender Gäste, die ihre Geschichten erzählen. Ein Freund von mir lädt mich nach Udmurtien ein, eine autonome Region westlich von Jekaterinburg, die von Udmurten bewohnt wird - jener Freund gehört selbst zu ihnen. Ebenfalls aus seiner Heimatregion stammt Herr Kalaschnikow. Der Name ist nach wie vor Programm, die Herstellung der gleichnamigen automatischen Feuerwaffen ist die Haupteinkommensquelle der Gegend. Ein Exportgut, das gut zu einer Stadt passt, die trister kaum sein könnte. Handlungszeit: 14.12.2021 - 08.01.2022
Osteuropa: Buzludzha in Bulgarien | Zugfahrt durch Serbien & Montenegro | Stalins Datscha in Sotchi
Wir reisen durch Osteuropa - mit preisgekrönten Reportagen: In Bulgarien besuchen wir das kommunistische Buzludzha-Denkmal. Von Belgrad geht es mit dem Zug durch Serbien und Montenegro nach Bar und wir besuchen Stalins Datscha in Sotchi. Alle Reportagen haben den Reisepreis "Columbus" erhalten.
Zwei Freundinnen zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Ihre Heimat, die Sowjetunion, in Auflösung begriffen und die Zukunft kaum zu greifen. Eine Art Fortschreibung von Tschechows "Kirschgarten" als Roman.
Radio Datscha #1 facebook.com/heydatschamusic @DatschaMusic
ShishaCast Episode 26 - Neue Moze Varity, Berlin Tour und andere neue Pfeifen
ShishaCast Ep. 26 Einleitung Setups Reallife: F1 neue season, saugroboter, Kegel Bday, Smilodox, ESN Drop, Special: Hookain Berlin - 1.Anfahrt Blaze Bus inkl. Pfeife, Fabrik Disco like, testen, Berlin Gourmet Tour, Köpfchen bei David 2.Hotelgym Pleite, Spaziergang, frühstücken Datscha, Köpfchen im Vikings, Fabrik, Golds Gym (Wette), BK, Köpfchen bei Cengiz 3.Frühstück/Brunch KaDeWe Kartoffelacker, Heimfahrt News Blarry Sucht Blaze Prototypen FYL New Flavour & Prototypen Hookain Bases: Base, Nature, Dark Farbige AO 912 AEON x Novitec GRPKiss ByCandy Darkside Darksupra + Teekanne Kvze Matten Holster Socken Paket statt GRP Blaze Tornado White & Tinylip von Hookain Bero Mind SSW Paket Steamulation Pro X Prime Aladin Epox 425 AF Double Kick
Obwohl Bestsellerautor Wladimir Kaminer („Russendisko“, „Die Kreuzfahrer“) ein ausgesprochener Großstadtmensch ist, liebt er seine Datscha in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Dorthin begleitet ihn unser Host Michel Abdollahi – es ist übrigens die erste Folge von „Unterwegs mit...“, die nicht im ICE, sondern in einer Regionalbahn aufgezeichnet wurde. Auf der Fahrt von Berlin-Gesundbrunnen nach Löwenberg erzählt Kaminer, wohin er reisen wird, wenn Corona endlich vorbei ist, warum man Dostojewski nicht nur auf Russisch, sondern genauso gut auf Deutsch lesen kann und warum man manche Straßen lieber nicht ausbauen sollte – auch wenn sie es noch so nötig hätten.Ein spannendes Gespräch über Nebel und weite Horizonte, Teenie-Literatur und Tschechow, Putin und Sputnik V – und die Frage, warum die meisten Menschen in Sachen Politik den Sprung ins kalte Wasser scheuen.Wladimir Kaminers neuester Roman, „Der verlorene Sommer: Deutschland raucht auf dem Balkon“ erscheint am 19.4.2021.Weiterführende Links:Homepage DB MOBIL:https://dbmobil.de/Infos zum Bahnfahren in Coronazeiten:Bahn.de/coronaWladimir Kaminer bei Facebook:https://de-de.facebook.com/wladimir.kaminer.7Homepage von Wladimir Kaminerhttp://www.wladimirkaminer.deMichel Abdollahi bei Facebook:https://www.facebook.com/michel.abdollahi/Michel Abdollahi bei Twitter und Instagram:@bisomratte
Die Datscha ist der Ort, wo Millionen von Russinnen und Russen ihre schönsten Tage verbringen. Das Sommerhäuschen vor der Stadt ist ein Sehnsuchtsort. Hier wird gegärtnert, gefaulenzt und gefeiert. Hierher fliehen die Menschen vor der Enge ihrer Wohnungen, aber auch vor der russischen Realität. Die ersten Datschen waren Geschenke des Zaren an treue Untertanen. Aber erst viel später in der Sowjetunion der 50er Jahren wurden Datschen zum Massenphänomen. Millionen erhielten ein Stück Land geschenkt, zumeist 600 Quadratmeter gross. Heute haben rund 40 Prozent der russischen Familien draussen in den Wäldern und Wiesen vor ihrer Stadt ein Sommerhaus. Wer von der Politik Wladimir Putins nichts mehr hören will, weder von seiner Politik gegenüber Belarus noch über den Nowitschok-Angriff auf den Oppositionellen Nawalny, der findet in seiner Datscha einen Ort der Ruhe, eine kleine private Welt, in der ihm niemand dreinredet. Die Datschen sind zumeist von hohen Zäunen und Hecken umgeben. Dahinter verbringt sich eine bürgerliche geordnete Lebenswelt. Wer in den letzten 20 Jahren zu Geld gekommen ist, konnte sein Sommerhaus ausbauen und verschönern. Noch in den 90er Jahren aber waren die Datschen für viele eine überlebenswichtige Einrichtung. Hier pflanzten die Leute die Lebensmittel, die in den Städten knapp und teuer geworden waren. Die Datschniki hätten Russland vor dem Zerfall gerettet, sagt Andrej Tumanow. Er ist Herausgeber der wichtigsten Datschen-Zeitung Russlands und er betont, dass die Datschenbesitzerinnen und -besitzer auch heute eine staatstragende Gesellschaftsgruppe seien. Wieso das so ist und wie das zusammenpasst mit der Flucht ins Private auf der Datscha, zeigt der Besuch bei Tumanow und in zwei anderen Datschensiedlungen. (Erstausstrahlung: 10. Oktober 2020)
Die Datscha ist der Ort, wo Millionen von Russinnen und Russen ihre schönsten Tage verbringen. Das Sommerhäuschen vor der Stadt ist ein Sehnsuchtsort. Hier wird gegärtnert, gefaulenzt und gefeiert. Hierher fliehen die Menschen vor der Enge ihrer Wohnungen, aber auch vor der russischen Realität. Die ersten Datschen waren Geschenke des Zaren an treue Untertanen. Aber erst viel später in der Sowjetunion der 50er Jahren wurden Datschen zum Massenphänomen. Millionen erhielten ein Stück Land geschenkt, zumeist 600 Quadratmeter gross. Heute haben rund 40 Prozent der russischen Familien draussen in den Wäldern und Wiesen vor ihrer Stadt ein Sommerhaus. Wer von der Politik Wladimir Putins nichts mehr hören will, weder von seiner Politik gegenüber Belarus noch über den Nowitschok-Angriff auf den Oppositionellen Nawalny, der findet in seiner Datscha einen Ort der Ruhe, eine kleine private Welt, in der ihm niemand dreinredet. Die Datschen sind zumeist von hohen Zäunen und Hecken umgeben. Dahinter verbringt sich eine bürgerliche geordnete Lebenswelt. Wer in den letzten 20 Jahren zu Geld gekommen ist, konnte sein Sommerhaus ausbauen und verschönern. Noch in den 90er Jahren aber waren die Datschen für viele eine überlebenswichtige Einrichtung. Hier pflanzten die Leute die Lebensmittel, die in den Städten knapp und teuer geworden waren. Die Datschniki hätten Russland vor dem Zerfall gerettet, sagt Andrej Tumanow. Er ist Herausgeber der wichtigsten Datschen-Zeitung Russlands und er betont, dass die Datschenbesitzerinnen und -besitzer auch heute eine staatstragende Gesellschaftsgruppe seien. Wieso das so ist und wie das zusammenpasst mit der Flucht ins Private auf der Datscha, zeigt der Besuch bei Tumanow und in zwei anderen Datschensiedlungen. (Erstausstrahlung: 10. Oktober 2020)
Die Datscha ist der Ort, wo Millionen von Russinnen und Russen ihre schönsten Tage verbringen. Das Sommerhäuschen vor der Stadt ist ein Sehnsuchtsort. Hier wird gegärtnert, gefaulenzt und gefeiert. Hierher fliehen die Menschen vor der Enge ihrer Wohnungen, aber auch vor der russischen Realität. Die ersten Datschen waren Geschenke des Zaren an treue Untertanen. Aber erst viel später in der Sowjetunion der 50er Jahren wurden Datschen zum Massenphänomen. Millionen erhielten ein Stück Land geschenkt, zumeist 600 Quadratmeter gross. Heute haben rund 40 Prozent der russischen Familien draussen in den Wäldern und Wiesen vor ihrer Stadt ein Sommerhaus. Wer von der Politik Wladimir Putins nichts mehr hören will, weder von seiner Politik gegenüber Belarus noch über den Nowitschok-Angriff auf den Oppositionellen Nawalny, der findet in seiner Datscha einen Ort der Ruhe, eine kleine private Welt, in der ihm niemand dreinredet. Die Datschen sind zumeist von hohen Zäunen und Hecken umgeben. Dahinter verbirgt sich eine bürgerliche geordnete Lebenswelt. Wer in den letzten 20 Jahren zu Geld gekommen ist, konnte sein Sommerhaus ausbauen und verschönern. Noch in den 90er Jahren aber waren die Datschen für viele eine überlebenswichtige Einrichtung. Hier pflanzten die Leute die Lebensmittel, die in den Städten knapp und teuer geworden waren. Die Datschniki hätten Russland vor dem Zerfall gerettet, sagt Andrej Tumanow. Er ist Herausgeber der wichtigsten Datschen-Zeitung Russlands und er betont, dass die Datschenbesitzerinnen und -besitzer auch heute eine staatstragende Gesellschaftsgruppe seien. Wieso das so ist und wie das zusammenpasst mit der Flucht ins Private auf der Datscha, zeigt der Besuch bei Tumanow und in zwei anderen Datschensiedlungen.
Die Datscha ist der Ort, wo Millionen von Russinnen und Russen ihre schönsten Tage verbringen. Das Sommerhäuschen vor der Stadt ist ein Sehnsuchtsort. Hier wird gegärtnert, gefaulenzt und gefeiert. Hierher fliehen die Menschen vor der Enge ihrer Wohnungen, aber auch vor der russischen Realität. Die ersten Datschen waren Geschenke des Zaren an treue Untertanen. Aber erst viel später in der Sowjetunion der 50er Jahren wurden Datschen zum Massenphänomen. Millionen erhielten ein Stück Land geschenkt, zumeist 600 Quadratmeter gross. Heute haben rund 40 Prozent der russischen Familien draussen in den Wäldern und Wiesen vor ihrer Stadt ein Sommerhaus. Wer von der Politik Wladimir Putins nichts mehr hören will, weder von seiner Politik gegenüber Belarus noch über den Nowitschok-Angriff auf den Oppositionellen Nawalny, der findet in seiner Datscha einen Ort der Ruhe, eine kleine private Welt, in der ihm niemand dreinredet. Die Datschen sind zumeist von hohen Zäunen und Hecken umgeben. Dahinter verbirgt sich eine bürgerliche geordnete Lebenswelt. Wer in den letzten 20 Jahren zu Geld gekommen ist, konnte sein Sommerhaus ausbauen und verschönern. Noch in den 90er Jahren aber waren die Datschen für viele eine überlebenswichtige Einrichtung. Hier pflanzten die Leute die Lebensmittel, die in den Städten knapp und teuer geworden waren. Die Datschniki hätten Russland vor dem Zerfall gerettet, sagt Andrej Tumanow. Er ist Herausgeber der wichtigsten Datschen-Zeitung Russlands und er betont, dass die Datschenbesitzerinnen und -besitzer auch heute eine staatstragende Gesellschaftsgruppe seien. Wieso das so ist und wie das zusammenpasst mit der Flucht ins Private auf der Datscha, zeigt der Besuch bei Tumanow und in zwei anderen Datschensiedlungen.
Datscha Radio - Listening to the Universe: Radiophonien des Alls (#21)
Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. „Listening to the Universe – Radiophonien des Alls“ widmet sich radiophonen Themen und Musiken, die dem Phänomen des Kometen 109P/Swift-Tuttle nachspüren. Denn alljährlich, wenn die Erde um den 12. August herum der Umlaufbahn des Kometen am nächsten kommt, fallen Kometenteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre und leuchten dort als Sternschnuppen auf. Von kosmogonischen Mythen bis zu den Signalen von Meteoriten-Detektoren, von Sternenlicht- inspirierten Geigenimprovisationen bis zu experimentellen Horoskopen: Mit seinem weitgestreuten Themenspektrum möchte Datscha Radio den ‚fallenden Sternen‘ in den ihnen verbundenen Fiktionen und künstlerischen Umsetzungen in Raum und Materie nachspüren. == Datscha Radio Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. Ziel ist es, neue Hörerfahrungen diesseits der gängigen Dichotomien von Kultur/Natur oder Sender/Empfänger zu kreieren. Inhaltlich richtet sich der Fokus auf Themen von Ökologie, *Feminismus und Klangforschung. Datscha Radio arbeitet zumeist open air, das Studio ist zugangsoffen, der Sendeverlauf inklusiv, die Gestaltung des Programms erfolgt im Team. In seinen zeitlichen Abläufen tritt das Projekt mit seinem Sendekonzept für eine Programmgestaltung diesseits der gesellschaftlich-ökonomischen verordneten Stundendoktrin ein. Datscha Radio ist nicht-kommerziell, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär.
Datscha Radio - Listening to the Universe: Radiophonien des Alls (#22)
Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. „Listening to the Universe – Radiophonien des Alls“ widmet sich radiophonen Themen und Musiken, die dem Phänomen des Kometen 109P/Swift-Tuttle nachspüren. Denn alljährlich, wenn die Erde um den 12. August herum der Umlaufbahn des Kometen am nächsten kommt, fallen Kometenteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre und leuchten dort als Sternschnuppen auf. Von kosmogonischen Mythen bis zu den Signalen von Meteoriten-Detektoren, von Sternenlicht- inspirierten Geigenimprovisationen bis zu experimentellen Horoskopen: Mit seinem weitgestreuten Themenspektrum möchte Datscha Radio den ‚fallenden Sternen‘ in den ihnen verbundenen Fiktionen und künstlerischen Umsetzungen in Raum und Materie nachspüren. == Datscha Radio Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. Ziel ist es, neue Hörerfahrungen diesseits der gängigen Dichotomien von Kultur/Natur oder Sender/Empfänger zu kreieren. Inhaltlich richtet sich der Fokus auf Themen von Ökologie, *Feminismus und Klangforschung. Datscha Radio arbeitet zumeist open air, das Studio ist zugangsoffen, der Sendeverlauf inklusiv, die Gestaltung des Programms erfolgt im Team. In seinen zeitlichen Abläufen tritt das Projekt mit seinem Sendekonzept für eine Programmgestaltung diesseits der gesellschaftlich-ökonomischen verordneten Stundendoktrin ein. Datscha Radio ist nicht-kommerziell, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär.
Datscha Radio - Listening to the Universe: Radiophonien des Alls (#23)
Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. „Listening to the Universe – Radiophonien des Alls“ widmet sich radiophonen Themen und Musiken, die dem Phänomen des Kometen 109P/Swift-Tuttle nachspüren. Denn alljährlich, wenn die Erde um den 12. August herum der Umlaufbahn des Kometen am nächsten kommt, fallen Kometenteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre und leuchten dort als Sternschnuppen auf. Von kosmogonischen Mythen bis zu den Signalen von Meteoriten-Detektoren, von Sternenlicht- inspirierten Geigenimprovisationen bis zu experimentellen Horoskopen: Mit seinem weitgestreuten Themenspektrum möchte Datscha Radio den ‚fallenden Sternen‘ in den ihnen verbundenen Fiktionen und künstlerischen Umsetzungen in Raum und Materie nachspüren. == Datscha Radio Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. Ziel ist es, neue Hörerfahrungen diesseits der gängigen Dichotomien von Kultur/Natur oder Sender/Empfänger zu kreieren. Inhaltlich richtet sich der Fokus auf Themen von Ökologie, *Feminismus und Klangforschung. Datscha Radio arbeitet zumeist open air, das Studio ist zugangsoffen, der Sendeverlauf inklusiv, die Gestaltung des Programms erfolgt im Team. In seinen zeitlichen Abläufen tritt das Projekt mit seinem Sendekonzept für eine Programmgestaltung diesseits der gesellschaftlich-ökonomischen verordneten Stundendoktrin ein. Datscha Radio ist nicht-kommerziell, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär.
Datscha Radio - Listening to the Universe: Radiophonien des Alls (#24)
Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. „Listening to the Universe – Radiophonien des Alls“ widmet sich radiophonen Themen und Musiken, die dem Phänomen des Kometen 109P/Swift-Tuttle nachspüren. Denn alljährlich, wenn die Erde um den 12. August herum der Umlaufbahn des Kometen am nächsten kommt, fallen Kometenteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre und leuchten dort als Sternschnuppen auf. Von kosmogonischen Mythen bis zu den Signalen von Meteoriten-Detektoren, von Sternenlicht- inspirierten Geigenimprovisationen bis zu experimentellen Horoskopen: Mit seinem weitgestreuten Themenspektrum möchte Datscha Radio den ‚fallenden Sternen‘ in den ihnen verbundenen Fiktionen und künstlerischen Umsetzungen in Raum und Materie nachspüren. == Datscha Radio Datscha Radio ist eine seit 2012 aktive Berliner Radiokunst-Initiative, die sich für eine erweiterte Kultur des Radiomachens einsetzt. Ziel ist es, neue Hörerfahrungen diesseits der gängigen Dichotomien von Kultur/Natur oder Sender/Empfänger zu kreieren. Inhaltlich richtet sich der Fokus auf Themen von Ökologie, *Feminismus und Klangforschung. Datscha Radio arbeitet zumeist open air, das Studio ist zugangsoffen, der Sendeverlauf inklusiv, die Gestaltung des Programms erfolgt im Team. In seinen zeitlichen Abläufen tritt das Projekt mit seinem Sendekonzept für eine Programmgestaltung diesseits der gesellschaftlich-ökonomischen verordneten Stundendoktrin ein. Datscha Radio ist nicht-kommerziell, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär.
Casi un millón de alemanes posee un huerto a las afueras de la ciudad, y es que muchos lo consideran el lugar perfecto para desconectar. ¿Es cierto esto? Krieger se adentra en este oasis verde para descubrir por qué sigue atrayendo a tanta gente.
Russland-Korrespondent David Nauer kommt ins Schwärmen, wenn er von der Datscha erzählt. Die russischen Garten- und Ferienhäuschen erleben einen Boom. Sie erinnern an die Schrebergärten in der Schweiz und funktionieren auch ähnlich. Die Datscha-Community hat ihre eigenen Gesetze. SRF 3-Moderatorin Florence Fischer ergründet mit David Nauer die Sehnsucht nach der russischen Datscha.
Russland-Korrespondent David Nauer kommt ins Schwärmen, wenn er von der Datscha erzählt. Die russischen Garten- und Ferienhäuschen erleben einen Boom. Sie erinnern an die Schrebergärten in der Schweiz und funktionieren auch ähnlich. Die Datscha-Community hat ihre eigenen Gesetze. SRF 3-Moderatorin Florence Fischer ergründet mit David Nauer die Sehnsucht nach der russischen Datscha.
Die Russen haben die Quarantäne bisher diszipliniert eingehalten. Wer eine Datscha hat, genießt das Privileg von frischer Luft und Sonne. Doch: Haben die Moskauer eigentlich Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Ulrich Heyden berichtet aus der russischen Hauptstadt. von Ulrich Heyden, Moskau https://deutsch.rt.com/meinung/102021-russland-quarantane-ohne-ende/
Neue Bestimmungen verbieten den Bewohnern Kemerovos, ihre Häuser zu verlassen. Wer kann, verlässt die Stadt oder fährt auf die Datscha. Zurück bleiben Studenten aus Kasachsten, Zentralasien und ich, eingesperrt in einem Wohnheim, dessen Innenleben ich erst jetzt so richtig kennen lernen kann... Schnell merke ich, dass die Ausgangssperre recht annehmbar werden dürfte. +++++++++++++++++++++ Dies ist Jubiläumsfolge #10. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hören solltet, bitte geht auf anchor.fm/tiefschnee und lasst mir eine Nachricht da!
Michael Fagré har haft stor framgång med att bygga upp IT-avdelningen på Datscha och i Techrekpodden så berättar han om framgångsfaktorerna för att skapa ett bra rykte där folk vill arbeta. Vi får höra om hur du kan skapa ett klimat där teamet kan vara öppna med både styrkor och svagheter och att föregå med gott exempel som ledare. Datscha har även startat upp en utvecklingsavdelning i Luleå och Michael berättar om smarta tekniker för att få samarbetet att flyta på mellan två olika kontor. Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se Vill du lära dig mer om Sourcing för att lyckas med din IT-rekrytering? Anmäl dig till vår Utbildning i Sourcing.
Der Russe und seine Datscha - Kleines Glück im Grünen
600 Quadratmeter mit Schuppen: Das bekamen in der Sowjetunion einst Arbeiter zugeteilt - als Sommerhaus und zum Beackern. Rasch wurde die Datscha russisches Kulturgut und sie ist es bis heute. Und aus manchen Hütten sind Paläste geworden. Von Gesine Dornblüth www.deutschlandfunkkultur.de, Die Reportage Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
James and Eddie were joined by Magnus Svantegard from Datscha to discuss the latest PropTech news, events and find out more about the business.
CPD Accredited Google Hangout - 9th March 2017 - Guest is Mark Bruno, Datscha
This week we discussed news of the week, demonstrated our new online real time live auction and our guest this week was Mark Bruno from Datscha.
gaya kloud live in the mix with Niklas on Sax at 21.02.2014 at La Datscha Potsdam
I started playing music as a DJ in 1991. At first in Potsdam, later on in Berlin in a variety of clubs – more than I can even remember. Since that time I've included lots of different styles in my sets, like house, techno, breakbeat, D&B, downbeats, etc.. It was a great honour to play together with so many excellent Djs like Rok, Alec Empire, ED2000, Tanith, Thomas P. Heckmann, Beroshima, Mijk van Dijk, Copasetic, Hell, Rene, Bass Dee, and so on. Visiting so many clubs and open airs in Germany gave me allways a big pleasure. After my daughter was born, I settled a little to focus on my family and job, but I still love to create monthly mixes, bringing all those experiences and joy about music together. Listen, enjoy, comment and share! And if you're convinced by my sound then it would be great if I see you at one of the irregular gigs, please check: facebook.com/gayakloud Thanks!
gaya kloud live in the mix with Niklas on Sax at 21.02.2014 at La Datscha Potsdam
I started playing music as a DJ in 1991. At first in Potsdam, later on in Berlin in a variety of clubs – more than I can even remember. Since that time I've included lots of different styles in my sets, like house, techno, breakbeat, D&B, downbeats, etc.. It was a great honour to play together with so many excellent Djs like Rok, Alec Empire, ED2000, Tanith, Thomas P. Heckmann, Beroshima, Mijk van Dijk, Copasetic, Hell, Rene, Bass Dee, and so on. Visiting so many clubs and open airs in Germany gave me allways a big pleasure. After my daughter was born, I settled a little to focus on my family and job, but I still love to create monthly mixes, bringing all those experiences and joy about music together. Listen, enjoy, comment and share! And if you're convinced by my sound then it would be great if I see you at one of the irregular gigs, please check: facebook.com/gayakloud Thanks!