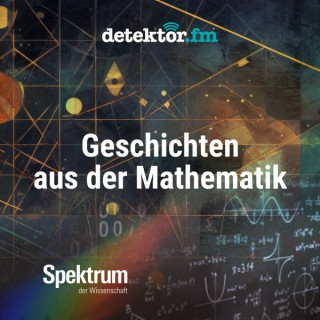Podcasts about Informatik
- 775PODCASTS
- 2,363EPISODES
- 50mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Jan 28, 2026LATEST
POPULARITY
Categories
Best podcasts about Informatik
Latest news about Informatik
- Propylaeum-DOK: Digital Repository: Ancient History AWOL - The Ancient World Online - Dec 26, 2025
- Finanz Informatik and IBM extend and expand collaboration GuruFocus New Articles - May 14, 2025
- Vector Informatik, Synopsys team up to enhance SDV development Yahoo! News - Mar 10, 2025
- Vector Informatik and Synopsys Announce Strategic Collaboration to Advance Software-Defined Vehicle Development Stocks - Investing.com - Mar 10, 2025
- CVE-2006-5512 | Zwahlen Informatik Online Shop article.htm cat cross site scripting (EDB-28848 / XFDB-29753) VulDB Updates - Jan 6, 2025
- NooK 2024: Call for Participation CCC Event Blog - Jul 17, 2024
- A Python Engineer’s Introduction To 3D Gaussian Splatting (Part 1) Towards Data Science - Medium - Jun 11, 2024
- (Wirtschafts-) Informatik studieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Fachhochschule Aachen) SAP Blogs - Mar 14, 2023
- The (very) short story of “Ideasoft” Christian Heilmann - Dec 22, 2022
- Boffins find COVID changed the way sysadmins work – probably for the worse The Register - Nov 9, 2022
Latest podcast episodes about Informatik
Trendscout: Warum Neugier & Disziplin die Superkräfte unserer Zeit bleiben
digital kompakt | Business & Digitalisierung von Startup bis Corporate
Fünf Dinge, die mit 20 alles verändert hätten: Für Trendscout Raphael Gielgen stand Lernen nie still – vom Schreiner zur globalen Zukunftsexpertise bei Vitra. Warum Leselust, Technologieverständnis, kulturelles Gespür und Disziplin nicht nur Karrieren, sondern Lebensläufe formen, erzählt Gielgen ehrlich und ohne Filter. Zwischen Scheitern, Neugier und der Kunst, im Analogen verwurzelt zu bleiben, entfaltet sich ein Lebensweg, der Möglichkeiten nie kleinredet. Du erfährst... ...wie Raphael Gielgen als Trendscout die Zukunft der Arbeit weltweit erkundet. ...warum Lesen und Neugierde entscheidende Bausteine für Erfolg darstellen. ...welche Rolle Disziplin und Sprachenlernen in Raphaels Lebensweg spielten. __________________________ ||||| PERSONEN |||||
In dieser Samstagsfolge von Alles auf Aktien melden wir uns aus dem Zentrum der Macht. Von dem Ort, an dem die Eliten die Welt in dieser Woche neu geordnet haben. Wir sprechen über den ganz besonderen Vibe beim Weltwirtschaftsforum, über einen Bundeskanzler im Wohnzimmer und über Moritz' Begegnung mit Emmanuel Macron. Wir analysieren, warum der Hype um Donald Trump womöglich seinen Peak erreicht hat – und wieso Friedrich Merz enttäuschte. Es geht um Alex Karps Schelte für Deutschland, Jensen Huangs Hoffnung für Europa und Elon Musks Versprechen auf eine bessere Zukunft. Wir klären, welche Software wirklich von KI gefressen wird und was die Demokratisierung der Informatik für viele Jobs bedeutet. Und zum Schluss erzählen wir von Holgers Kaiserschmarren-Waterloo. Ein Gespräch aus der Davos-WG mit Olaf Gersemann. Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. Noch mehr "Alles auf Aktien" findet Ihr bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html. Der Börsen-Podcast Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast "Deffner&Zschäpitz" hören. +++ Werbung +++ Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte! https://linktr.ee/alles_auf_aktien Impressum: https://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html Datenschutz: https://www.welt.de/services/article157550705/Datenschutzerklaerung-WELT-DIGITAL.html
Was 2026 wirklich zählt
digital kompakt | Business & Digitalisierung von Startup bis Corporate
Wem wird 2026 gehören: denen, die Geschwindigkeit in messbare Ergebnisse übersetzen, oder jenen, die am Status quo festhalten? Führende Stimmen aus Handel, Tech und Analyse zeigen, wie KI vom Trend zur Basis wird, Entscheidungen Resonanz erzeugen und wofür echte Verbindung zählt. Zwischen Aufbruch und Überforderung verdichten sich Chancen und Risiken zu einem neuen Spiel: Wenige gewinnen, viele verlieren, wenn Wandel nicht zur Praxis wird. Ein Panorama echter Prognosen für alle, die Zukunft gestalten wollen. Du erfährst... ...wie Technologie und KI 2026 Arbeitsalltag und persönliche Freiheit transformieren. ...welche neuen Standards das nächste Business-Level durch die Effekte von KI prägen. ...warum Live-Events in einer KI-geprägten Welt an Bedeutung gewinnen. __________________________ ||||| PERSONEN |||||
Was 2026 wirklich zählt
digital kompakt | Business & Digitalisierung von Startup bis Corporate
Erfüllung schlägt Erfolg: 2026 wird zum Prüfstein für alle, die Business jenseits von Buzzwords und perfekten Plänen denken. Zehn führende Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Unternehmertum teilen ihre Predictions für 2026 und warum Nähe, Verantwortung und Mut zu echten Entscheidungen zählen, während KI, Deep Tech und Agenten unseren Alltag umkrempeln. Du erfährst... …wie Karin Kuschik die Bedeutung von Erfüllung und Berufung im Business 2026 sieht. …warum Verena Pausder 2026 als das Jahr des Deep Tech-Durchbruchs betrachtet. …welche Rolle echte Begegnungen und psychologische Infrastruktur laut Vanessa Laszlo spielen. __________________________ ||||| PERSONEN |||||
#526 Dr. Gerald “Gerry” Haag | Unternehmer, Transformator, Zukuntsgestalter
Unser heutiger Gast hat zunächst Informatik an der Christian-Albrechts Universität zu Kiel studiert, anschließend einen Master in Human Kinetics an der University of British Columbia absolviert und schließlich in Biomechanik an der Universität Tübingen promoviert. Nach seiner Promotion hat er drei Jahre als Hafenmeister an der kanadischen Pazifikküste gearbeitet, ein bewusst gewählter Kontrast zur akademischen Laufbahn. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat er dann an der Schnittstelle von Unternehmertum, Technologie und Kultur gewirkt: Er war einer der ersten Executives bei Amazon Europa, hat LOVEFiLM mit aufgebaut, das Lifestyle-Unternehmen Barefoot Living mit gegründet, als VP den internationalen Rollout von Peloton verantwortet und darüber hinaus zahlreiche Unternehmen als Gründer, Investor oder Berater begleitet, unter anderem Gourmondo, Checkdomain, Onlineprinters oder Privax. Doch er ist weit mehr als ein Seriengründer: Als Initiator des Netzwerks Happy Humans und des Gründerevents Letsgofreeriding bringt er Menschen zusammen, die an eine flourishing Zukunft glauben – mit mehr Miteinander, mehr Verantwortung und mehr innerer Freiheit. Gerry lebt auf Mallorca, ist Vater von vier Kindern, leidenschaftlicher Surfer und Freerider, Community-Builder und Kulturarchitekt mit globalem Blick. Seit über acht Jahren beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 500 Episoden mit fast 700 Persönlichkeiten haben wir darüber gesprochen, was sich verändert hat – und was sich weiter verändern muss. Wie kann eine Unternehmenskultur entstehen, die nicht nur Performance liefert, sondern langfristig wirkt – im Einklang mit Mensch und Umwelt? Wie schaffen wir mehr Miteinander in einer Welt, die sich zu oft um Selbstoptimierung dreht? Wie verändert sich Arbeit, wenn wir sie vom Geld entkoppeln – und was lernen wir aus anderen Lebenskonzepten und Kulturen? Und wie gelingt eine Schulbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Menschen ins Leben begleitet? Fest steht: Für die Lösung unserer aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Impulse. Deshalb suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work – heute mit Dr. Gerald „Gerry“ Haag. [Hier](https://linktr.ee/onthewaytonewwork) findet ihr alle Links zum Podcast und unseren aktuellen Werbepartnern
Vierdimensionale Elefanten, YouTube-Shitstorms, vertauschte Körper und jede Menge Donuts. Karo, Demian und Manon schauen auf ein Jahr voller „Geschichten aus der Mathematik“ zurück. (00:01:59) Trolley Problems bei den DMV Topic Days (00:11:08) Trolley Problems bei den Geschichten aus der Mathematik (00:46:16) Verabschiedung (00:47:58) Best of „Geschichten aus der Mathematik“-Outtakes Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-jahresrueckblick-2025
Geschichten aus der Mathematik | Das mathematische Trolley-Problem
Vierdimensionale Elefanten, YouTube-Shitstorms, vertauschte Körper und jede Menge Donuts. Karo, Demian und Manon schauen auf ein Jahr voller „Geschichten aus der Mathematik“ zurück. (00:01:59) Trolley Problems bei den DMV Topic Days (00:11:08) Trolley Problems bei den Geschichten aus der Mathematik (00:46:16) Verabschiedung (00:47:58) Best of „Geschichten aus der Mathematik“-Outtakes Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-jahresrueckblick-2025
Vierdimensionale Elefanten, YouTube-Shitstorms, vertauschte Körper und jede Menge Donuts. Karo, Demian und Manon schauen auf ein Jahr voller „Geschichten aus der Mathematik“ zurück. (00:01:59) Trolley Problems bei den DMV Topic Days (00:11:08) Trolley Problems bei den Geschichten aus der Mathematik (00:46:16) Verabschiedung (00:47:58) Best of „Geschichten aus der Mathematik“-Outtakes Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-jahresrueckblick-2025
KI 2 was gibts Neues? - §LIT - Bewusst Publizieren 13
§LIT - Bewusst Publizieren 13KI 2 Was gibts Neues? - §LIT 13Uwe Kullnick spricht mit der Anwältin Nadja Kobler-Ringler und dem Informatiker Prof. Dr. Arno Bücken(Hördauer ca. 75 Minuten)Prof. Dr. Arno Bücken: als fachliche Schwerpunkte seiner Professur nennt Prof. Bücken Datenanalyse, Vernetzung von Assets und Visualisierung von Daten. Der 48-Jährige wird in der Lehre die Module Angewandte Informatik, Hardwarenahe Programmierung, Objektorientierte Programmierung, Industrial Internet of Things, Big Data, vernetzte Produktionssysteme und intelligente Anwendungen sowie Mensch-Maschine-Schnittstelle in den Studiengängen Chemieingenieurwesen, Chemtronik und Umwelttechnologie übernehmen.Prof. Bücken studierte Informatik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und absolvierte einen Gastaufenthalt an der Carnegie-Mellon-University in Pittsburgh, Pennsylvania. An der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen promovierte er zum Doktor der Ingenieurwissenschaften im Fachgebiet Elektrotechnik.Als Autor, Selfpublisher, Blogger, Influencer oder Verleger ist es wichtig, sich mit rechtlichen Aspekten auseinanderzusetzen, um mögliche Probleme zu vermeiden. Mit etwas Wissen und Vorsicht kann man diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen.In diesem Blog werde ich mit Dr. Nadja Kobler-Ringler, einer selbständigen Anwältin, Autorin sowie Lektorin, über die rechtlichen Probleme sprechen, denen man begegnen kann, und wie man ihnen vorbeugen oder mit ihnen umgehen kann, falls sie bereits aufgetreten sind. In diesem Sinn werden wir regelmäßig Probleme diskutieren und nach Lösungen suchen.Ihr könnt uns auch Themen vorschlagen, die euch interessieren und über die ich mit Nadja sprechen kann. Wir sind auch daran interessiert, von Euren Erfahrungen zu hören und sie in unseren Sendungen zu diskutieren.Hier sind einige der Themen, über die wir demnächst sprechen möchten:Ist es ok, ein Buch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu schreiben?Kann ich jeden Verlagsvertrag bedenkenlos unterschreiben?Was ist, wenn das Lektorat mein Werk total „zerstört“? Das Cover „nix is“ und der Satz auch zu wünschen übrig lässt?Rechtliche Aspekte von Self-Publishing , Verlags-Publishing und MischformenEin Buch ist ein Spiegelbild der Realität. Darf es das sein? Was gilt es zu beachten?Wie mache ich eigentlich rechtlich gute Werbung für meine Veröffentlichung?Wie sieht es mit Lesungshonoraren aus und welche Rechnungsmerkmale muss man beachten?Schreibwettbewerbe – sind die nur ein Traum oder kann man wirklich erfolgreich sein?Wie gestaltet man seinen eigenen Web-Auftritt, vor allem: was muss ins Impressum und in die Datenschutzerklärung?Was tun bei negativen Rezensionen oder gar Abmahnungen?Coaching und Weiterbildung – worauf sollte ich achten?Manchmal endet jedoch alles im Streit und man möchte den Rückzug aus einem Vertrag antreten. Da ist es wichtig zu wissen, wie man am besten vorgeht.An wen wendet man sich bei einer Abmahnung und wie reagiert man darauf? ACHTUNG: Diese Sendung ersetzt keine persönliche Rechtsberatung!VertragsbeendigungenDr. Nadja Kobler-Ringler lebt mit Ehemann, Sohn, Büchern, Texten und tausenden noch ungeschriebenen Wörtern im Bonner Umland. 2024 feiert sie das zwanzigjährige Bestehen ihrer Rechtsanwaltskanzlei, zu der seit rund fünfzehn Jahren auch ein breitgefächertes Lektoratsangebot gehört.Dr. rer. nat. Uwe Kullnick, ist Neurophysiologe und seit 2012 als freier Schriftsteller und Journalist tätig. Zwischen 2014 und 2019 war er Vorsitzender beim Freien Deutschen Autorenverband Bayern (FDA). Außerdem war er von 2015 bis 2017 Präsident des FDA-Bundesverbandes. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. Seit 2015 leitet er das Literatur (Podcast) Radio Hörbahn (früher Literatur Radio Bayern). Er lebt seit 2000 in München.Du würdest gern die bisherigen Folgen hören, dann schau doch mal hierhin.Redaktion und Realisation Uwe Kullnick
1 Jahr später: Hat sich der Doktor gelohnt? - while(true) ep. 25
while(true) ist seit 2018 der Podcast rund um Informatik und Software Engineering. Dr. Sebastian Hahner arbeitet als Software Engineer in der Automobilindustrie und entwickelt in seiner Freizeit im Rahmen zahlreicher Open-Source Projekte Werkzeuge für Content-Creator & Streamer. Zuvor forschte er als PostDoc am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an der Schnittstelle von Software-Architektur und Sicherheit. Der Podcast verbindet praxisnahe Einblicke, spannende Forschung und persönliche Erfahrungen aus der Welt der Informatik.
Heute erzählt Lars etwas über seine zukünftigen Kanal Pläne und ich spoilere mal soviel: Hytale soll eine große Rolle spielen. Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Konrad Zuse - Der Pionier des Computerzeitalters
Bauingenieur Konrad Zuse baute in den 1930er-Jahren Rechenmaschinen, die neue Maßstäbe in der Technik setzten. Er ist damit einer der Wegbereiter der Informatik. Ob er der Erfinder des ersten Computers ist, bleibt strittig. 1995 ist Zuse gestorben. Schroeder, Carina www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
Mit 15 allein in einem fremden Land: Wie eine Ukrainerin ihr Leben in Deutschland meistert
Ohne Eltern in einem fremden Land: Nach der Flucht aus der Ukraine, baute sich die damals 15-jährige Sofiia Naumova ein Leben in Deutschland auf – mit Erfolg. Seit fast vier Jahren tobt der Angriffskrieg in der Ukraine: Bomben zerstören ganze Städte, nehmen Menschen ihr Zuhause oder sogar ihr Leben. Doch die Ukrainerinnen und Ukrainer geben nicht auf. Sie wollen weiterleben – manche in ihrer Heimat und manche auch bei uns in Deutschland. Eine von ihnen ist Sofiia Naumova. Ende März 2022 - kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine - floh sie mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester nach Schönau im Schwarzwald. Da war sie 15 Jahre alt - jetzt ist sie 18, hat in diesem Jahr ihr Abi mit 1,0 gemacht und studiert inzwischen in München Informatik. Wie sie die Kraft gefunden hat, trotzdem optimistisch zu bleiben? „Der Wunsch nach Sicherheit“, sagt Naumova im Interview mit SWR Aktuell. Deutsch habe sie sehr schnell gelernt. Denn: Der Klang der deutschen Sprache habe sie schon vorher fasziniert, so Naumova. Sie habe sich mit der Aussprache beschäftigt – in erster Linie, um deutsche Liedtexte singen zu können. Trotzdem war auch die Sprache erst einmal eine Barriere als die Schülerin in Schönau ankam. „Das liegt vor allem auch am Dialekt“, sagt sie. „Freunde zu finden, war nicht schwer. Schwieriger war es mit der Sprache, weil man einfach zwei Drittel von dem, was Menschen sagen, nicht versteht.“ Nicht nur die Sprache brachte Herausforderungen mit sich. Als sich ihre Mutter dazu entschloss, wieder zurück in die Ukraine zum Vater zu gehen, stand auch Sofiia Naumova vor einer schweren Entscheidung: mitkommen oder bleiben. Die junge Frau sagt, sie sei ihrer Mutter sehr dankbar, dass sie in Deutschland bleiben durfte. Wie Sofiia Naumova ihr Leben als Schülerin in einem fremden Land gemeistert hat, erzählt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.
Felix Klein ist der Mathematiker hinter der berühmten „Kleinschen Flasche“ — und der entscheidende Mann im ewigen Wettstreit zwischen Berlin und Göttingen. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:04) Einleitung (00:02:55) Felix Klein und seine „Flasche“ (00:05:04) „Sei niemals langweilig!“ (00:08:02) Das Mathe-Battle Göttingen vs. Berlin (00:14:05) Der Streit um die Funktionen (00:21:04) Die Kleinsche Flasche und das Möbiusband (00:26:56) Das Dimensionen-Problem und der Kleinsche Elefant (00:30:39) Demians und Manons Gedanken zur Kleinschen Flasche (00:33:14) Ausblick & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-felix-klein
Geschichten aus der Mathematik | Felix Klein und die gestohlenen Funktionen
Felix Klein ist der Mathematiker hinter der berühmten „Kleinschen Flasche“ — und der entscheidende Mann im ewigen Wettstreit zwischen Berlin und Göttingen. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:04) Einleitung (00:02:55) Felix Klein und seine „Flasche“ (00:05:04) „Sei niemals langweilig!“ (00:08:02) Das Mathe-Battle Göttingen vs. Berlin (00:14:05) Der Streit um die Funktionen (00:21:04) Die Kleinsche Flasche und das Möbiusband (00:26:56) Das Dimensionen-Problem und der Kleinsche Elefant (00:30:39) Demians und Manons Gedanken zur Kleinschen Flasche (00:33:14) Ausblick & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-felix-klein
Felix Klein ist der Mathematiker hinter der berühmten „Kleinschen Flasche“ — und der entscheidende Mann im ewigen Wettstreit zwischen Berlin und Göttingen. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:04) Einleitung (00:02:55) Felix Klein und seine „Flasche“ (00:05:04) „Sei niemals langweilig!“ (00:08:02) Das Mathe-Battle Göttingen vs. Berlin (00:14:05) Der Streit um die Funktionen (00:21:04) Die Kleinsche Flasche und das Möbiusband (00:26:56) Das Dimensionen-Problem und der Kleinsche Elefant (00:30:39) Demians und Manons Gedanken zur Kleinschen Flasche (00:33:14) Ausblick & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-felix-klein
KI-Experte: Was sind die wichtigsten KI-Tools dieses Jahr?
digital kompakt | Business & Digitalisierung von Startup bis Corporate
Vertrautes Wissen hilft wenig, wenn sich der Tool-Dschungel ständig verschiebt: Dominik erklärt, warum nicht Masse, sondern Passung zählt und wie Neuerfindung plötzlich aus Berlin, Schwarzwald oder Jönköping kommt. Von der KI, die eigene Anzüge entwirft, bis zur Automatisierung mit unglaublichem Hebel erleben Teams, wie menschliche Präferenzen und technischer Fortschritt gemeinsam Stolpersteine und Routinen verändern. Ein Raum für Mut, Reduktion und echte Ambiguität. Du erfährst... …welche sieben KI-Tools aktuell den Markt revolutionieren. …wie du mit LangDoc DSGVO-konform KI-Modelle nutzt. …warum Flux aus dem Schwarzwald ein Gamechanger in der Bilderstellung ist. __________________________ ||||| PERSONEN |||||
Deine Autorenwebsite: Wie du mit deiner Homepage Leser:innen und Verlage überzeugst – Teil 1
Zeilenschlinger-Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren
Homepage, Unterseiten für die Bücher, Impressum und Verlinkungen: Es gibt vieles, das man beim Aufbaue einer Website als Autor:in bedenken sollte. Was darf auf keinen Fall fehlen, was ist verzichtbar und wie baut man eigentlich eine Website, wenn man keine Ahnung von Design oder Informatik hat? Ist der eigene Internetauftritt tatsächlich kein Hexenwerk?Der Frage stellen sich Laura, Emmy und Cara in dieser Doppelfolge. Weil das Thema so umfangreich ist, haben wir entschieden, sie in zwei Teile aufzuteilen. Damit es nicht zu viel auf einmal wird. Also schalte auch nächste Woche wieder ein, damit du umfangreich über das Thema Autor:innen-Websites informiert bist.Links aus der Folge✩ Unsere Folge zu Testlesenden: https://www.youtube.com/watch?v=GseldMTd56s&pp=ygUZemVpbGVuc2NobGluZ2VyIHRlc3RsZXNlctIHCQmtCQGHKiGM7w%3D%3D✩ Write Choice Club: https://www.write-choice-club.de✩ Emmys Website: https://emmyleedavis-autorin.de/✩ Website von Lauras Autoren-Duo Revolution Romance: https://revolutionromance.de/✩ Caras Website: https://portal-fantasy.deStelle dich deinem fantastischen Buchabenteuer mit den Zeilenschlingern! In dieser Reihe von 12 Online-Workshops begleiten wir dichSchritt für Schritt durch den gesamten Schreibprozess.✩ Jetzt mehr erfahren: https://zeilenschlinger.de/fantastisches-buchabenteuer/Komm jetzt in unseren Zeilenschlinger Discord Channel: https://discord.gg/nRnDa5xt36Du möchtest mit Chris an deinem Buch arbeiten? Egal, ob Lektorat, Beratung oderCoaching, hier findest du mehr zu ihren Angeboten und wie du sie kontaktierenkannst: https://christineroedl.de/Du bist Fantasy-Autor:in und möchtest dich optimal auf den Schreibmarathon imNovember vorbereiten?✩ Dann hol dir jetzt den Fantastischen Preptober vomZeilenschlinger und starte im Schreibmonat voll durch! https://elopage.com/s/Zeilenschlinger/fantastischer-preptober Du möchtest deine Marketing-Planung digital angehen?✩ Dann hol dir jetzt den Zugangzum Trello-Board "Plotte dein Autorinnenmarketing"✩ Als Hörerin desZeilenschlinger-Podcasts bekommst du 20 Prozent Rabatt mit dem Gutscheincode:"Schling". Du möchtest Ordnung in das Chaos deinesAutor:innen-Lebens bringen?✩ Dann hol dir jetzt den Zugangzur "All-In-One Notion-Vorlage für Autorinnen" https://elopage.com/s/Zeilenschlinger/organisiere-dein-autor-innen-leben Du kämpfst (immer mal wieder) mit einer Schreibblockade?✩ Dann hol dir jetzt unserenOnline-Kurs "In 30 Tagen Schreibblockaden überwinden" https://elopage.com/s/Zeilenschlinger/in-30-tagen-schreibblockaden-ueberwinden-90034d47 Du willst dein Buch im Podcast vorstellen oder alsDienstleister:in in der Buchbubble, deine Kund:innen erreichen?✩ Informiere dich hier: https://www.zeilenschlinger.de/werbeplatz Kennt ihr schon unseren Arschtritt des Monats?✩ Als Newsletter-Abonnenterhältst zu exklusiven Zugang zu unserer Datenbank, in der wir Vorlagen undChecklisten zu unseren Themen teilen.✩ Du erhältst Einblick inunseren persönlichen Schreibprozess.✩ Hier geht es zur Anmeldung: https://zeilenschlinger.de/#Newsletter-Anmeldung Euch gefällt unser Podcast? Wir würden uns über EureUnterstützung freuen:✩ Werdet offizieller Patreon: https://www.patreon.com/Zeilenschlinger✩ Gebt uns einen Kaffee aus überKo-Fi: https://ko-fi.com/zeilenschlinger Vielen Dank an unsere Patreons!✩ Vivien Busch✩ Carolin Streckmann Folge uns gern auch auf unseren anderen Kanälen, um aufdem Laufenden zu bleiben:✩ Instagram: https://www.instagram.com/zeilenschlinger/✩ TikTok: https://www.tiktok.com/@zeilenschlinger Hanna auf YouTube: https://www.youtube.com/@Hanna_BuchmarketingChris auf YouTube: https://www.youtube.com/@chrisroedl
Heute erzählt Lars etwas über seine zukünftigen Kanal Pläne und ich spoilere mal soviel: Hytale soll eine große Rolle spielen. Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Data Science (click here to comment) 8. Dezember 2025, Jochen
Mäzen vor 85 Jahren geboren - Klaus Tschira, ein großer Freund der Astronomie
Klaus Tschira, einer der Gründer des Softwareunternehmens SAP, hat sich mit seiner Stiftung für die Astronomie, die Informatik und den Kontakt zwischen der Naturwissenschaft und der Öffentlichkeit eingesetzt. Am 7. Dezember würde er 85 Jahre alt. Lorenzen, Dirk www.deutschlandfunk.de, Sternzeit
Die versammelte Redaktion von Spektrum der Wissenschaft scheitert daran, das Haus vom Nikolaus zu zeichnen. Was ist da los? In dieser Geschichte aus der Mathematik springen wir zu den Anfängen der Graphentheorie, ins Königsberg des 18. Jahrhunderts. Wir sind ein Türchen im Podcast-Adventskalender 2025 von Wissenschaftspodcasts.de! Hier geht’s zum ganzen Adventskalender: wissenschaftspodcasts.de/adventskalender2025 Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:00) Intro (00:01:37) Begrüßung (00:03:19) „Das Haus vom Nikolaus“ und was es mit Mathe zu tun hat (00:06:46) Das Königsberger Brückenproblem (00:11:59) Euler, das Haus vom Nikolaus, und die Graphentheorie (00:18:37) Fazit und das eigentlich Schöne am Studium >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-haus-vom-nikolaus-graphentheorie-euler
Geschichten aus der Mathematik | Das unmögliche Haus vom Nikolaus und die Graphentheorie
Die versammelte Redaktion von Spektrum der Wissenschaft scheitert daran, das Haus vom Nikolaus zu zeichnen. Was ist da los? In dieser Geschichte aus der Mathematik springen wir zu den Anfängen der Graphentheorie, ins Königsberg des 18. Jahrhunderts. Wir sind ein Türchen im Podcast-Adventskalender 2025 von Wissenschaftspodcasts.de! Hier geht’s zum ganzen Adventskalender: wissenschaftspodcasts.de/adventskalender2025 Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:00) Intro (00:01:37) Begrüßung (00:03:19) „Das Haus vom Nikolaus“ und was es mit Mathe zu tun hat (00:06:46) Das Königsberger Brückenproblem (00:11:59) Euler, das Haus vom Nikolaus, und die Graphentheorie (00:18:37) Fazit und das eigentlich Schöne am Studium >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-haus-vom-nikolaus-graphentheorie-euler
Wie wir auf Penisschweinchen kommen wollt ihr wissen? Okay, dafür müsst ihr einfach in den Podcast reinhören. Heute wird es aber ganz gemütlich unterhaltsam. Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Welche Hardware nutzen eigentlich Lars und Croco ... das und wie immer vieles mehr gibt es in der heutigen Folge zu hören. Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
In den 1960er-Jahren arbeitet Margaret Hamilton als Softwareentwicklerin für die NASA. Anfangs wird sie belächelt. Doch sie ist es, die die Software entwickelt, die 1969 die Mondlandung ermöglicht. (00:00:03) Einleitung (00:02:01) Software-Pionierin Margaret Hamilton (00:06:19) Der Wettlauf ins All (00:09:15) Die Software hinter der Mondlandung (00:11:53) Eine Notfall-Software für den Ernstfall (00:13:35) Wie Hamiltons Software die Mondlandung ermöglicht (00:18:17) Woran die Mondlandung fast gescheitert wäre (00:23:22) Programmieren in den 60er-Jahren (00:30:27) Wissenschaft ist Teamarbeit (00:35:18) Verabschiedung Das Bild von Margaret Hamilton neben dem riesigen Stapel Apollo-11-Code findet ihr hier. Ihr wollt Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag loswerden? Gerne! Schreibt uns an podcast@spektrum.de – wir freuen uns auf eure Nachrichten! Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-margaret-hamilton
Geschichten aus der Mathematik | Margaret Hamilton und die Rettung der Mondlandung
In den 1960er-Jahren arbeitet Margaret Hamilton als Softwareentwicklerin für die NASA. Anfangs wird sie belächelt. Doch sie ist es, die die Software entwickelt, die 1969 die Mondlandung ermöglicht. (00:00:03) Einleitung (00:02:01) Software-Pionierin Margaret Hamilton (00:06:19) Der Wettlauf ins All (00:09:15) Die Software hinter der Mondlandung (00:11:53) Eine Notfall-Software für den Ernstfall (00:13:35) Wie Hamiltons Software die Mondlandung ermöglicht (00:18:17) Woran die Mondlandung fast gescheitert wäre (00:23:22) Programmieren in den 60er-Jahren (00:30:27) Wissenschaft ist Teamarbeit (00:35:18) Verabschiedung Das Bild von Margaret Hamilton neben dem riesigen Stapel Apollo-11-Code findet ihr hier. Ihr wollt Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag loswerden? Gerne! Schreibt uns an podcast@spektrum.de – wir freuen uns auf eure Nachrichten! Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-margaret-hamilton
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Heute beantwortet euch Croco eure Fragen aus seinem Hotelzimmer mit Blick auf den Berliner Fernsehturm. Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Sind Kinder für Creator ein Nachteil? Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Nach der letzten Folge ohne Lars ist Croco jetzt wieder am Start! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Wie baust du Mobile Games, die nicht nur Spaß machen, sondern auch auf jeder Plattform funktionieren und sich selbst tragen? In dieser Episode sprechen wir über Mobile Gaming: von der Idee über den Game Loop bis zur Monetarisierung. Mit dabei ist Fabi Fink, Game Lead bei Lotum. Lotum steht für Social Casual und Puzzle Hits wie Quiz Planet und Word Blitz, hat die Marke von 1 Milliarde Installationen geknackt und spielt technisch die gesamte Klaviatur von Web bis Native.Wir klären, warum Mobile inzwischen rund die Hälfte des Gaming-Umsatzes ausmacht und ordnen Hypercasual, Casual, Midcore und Hardcore mit vielen Beispielen ein. Wir zeigen, was Mobile heute bedeutet: Native Apps in App Store und Play Store, aber auch Games als Facebook Instant Games sowie Integrationen für Reddit, Discord, TikTok und Netflix. Du erfährst, wie Social Loops auf Plattformen funktionieren, warum asynchrones Multiplayer ein Growth-Hebel ist und was Viralität gegenüber klassischer User Acquisition auszeichnet.Technisch gehen wir tief rein: Warum Lotum für viele Titel auf Vue.js setzt und Game-UX wie eine hochinteraktive Web-App denkt. Wir sprechen über Performance-Details, GPU-freundliche Animationen und warum beim WordBlitz-Core Plain JavaScript die Nase vorn hat. Im Backend wird es handfest mit WebSockets, Redis-Clustern und Realtime-Events in der Google Cloud. Dazu kommen Tools und Plattformen wie Nakama (Open Source Backend for Games) und SpacetimeDB, plus eine ehrliche Kostenstory rund um Firebase.Natürlich geht es auch ums Geld: Ads vs. In-App Purchases, Hybrid-Modelle, ROAS über 180 Tage und was erfolgreiche Titel wirklich auszeichnet. Wir teilen KPI-Realität, A/B-Testing-Erkenntnisse, warum kleine UX-Texte große Effekte haben können und welche Schwelle ein Spiel bei Lotum erreichen sollte, um weiterverfolgt zu werden.Wenn du wissen willst, wie moderne Mobile Games entstehen – technologisch, produktseitig und monetär – schnapp dir diese Episode.Unsere aktuellen Werbepartner findest du auf https://engineeringkiosk.dev/partnersDas schnelle Feedback zur Episode:
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Heute haben wir ein paar spannende Fragen im Gepäck! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
E-Rezept-Chaos, Android-Öffnung, ISS-Jubiläum | #heiseshow
Anna Bicker, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und Malte Kirchner sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über folgende Themen: - Papier-Comeback droht: Was ist los beim E-Rezept? – Kassenärzte warnen vor einem möglichen Kollaps des E-Rezept-Systems wegen fehlender Heilberufsausweise. Droht tatsächlich die Rückkehr zum Papierrezept? Welche technischen und organisatorischen Probleme stecken hinter der Krise? Und was bedeutet das für Patienten und Apotheken? - Neue Spielregeln: Wie sich der Google-Epic-Deal auswirkt – Google und Epic Games haben sich auf weltweite Änderungen bei Android geeinigt. Was umfasst die Vereinbarung konkret? Welche Auswirkungen hat das auf App-Stores und Entwickler, auch bei Apples App Store? Und profitieren am Ende auch die Nutzer davon? - Hoch hinaus: Was ist nach 25 Jahren ISS geblieben? – Die Internationale Raumstation feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse hat die ISS in einem Vierteljahrhundert gebracht? Wie geht es mit der Station in den kommenden Jahren weiter? Und welche Rolle spielt sie für künftige Weltraummissionen? Außerdem wieder mit dabei: ein Nerd-Geburtstag, das WTF der Woche und knifflige Quizfragen.
Die Software RenderMan erweckt 1996 die Figuren von „Toy Story“ zum Leben. Dahinter steckt ein Team um den Computergrafiker Pat Hanrahan, der Computer bis heute magisch findet. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen oder Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:00) Einleitung (00:01:55) Pat Hanrahan und Toy Story (00:05:20) Ein unmotivierter Teenager (00:08:35) Der Computer als Leinwand (00:11:47) Kunst und Computergrafik a NYIT (00:15:59) Renderman und Toy Story (00:22:52) Eine Programiersprache für Licht und Schatten (00:28:30) Rendern mit Renderman (00:30:32) Warum sehen die Menschen in Toy Story so creepy aus? (00:33:37) Kinderheitserinnerungen von Karo, Demian und Manon (00:36:11) Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-pat-hanrahan
Geschichten aus der Mathematik | Pat Hanrahan und der Toy-Story-Code
Die Software RenderMan erweckt 1996 die Figuren von „Toy Story“ zum Leben. Dahinter steckt ein Team um den Computergrafiker Pat Hanrahan, der Computer bis heute magisch findet. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen oder Feedback an podcast@spektrum.de. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:00) Einleitung (00:01:55) Pat Hanrahan und Toy Story (00:05:20) Ein unmotivierter Teenager (00:08:35) Der Computer als Leinwand (00:11:47) Kunst und Computergrafik a NYIT (00:15:59) Renderman und Toy Story (00:22:52) Eine Programiersprache für Licht und Schatten (00:28:30) Rendern mit Renderman (00:30:32) Warum sehen die Menschen in Toy Story so creepy aus? (00:33:37) Kinderheitserinnerungen von Karo, Demian und Manon (00:36:11) Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-pat-hanrahan
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Heute haben wir ein paar spannende Fragen im Gepäck! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Heute haben wir ein paar spannende Fragen im Gepäck! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
AD: www.digital-fuer-deutschland.de Heute haben wir ein paar spannende Fragen im Gepäck! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Kinder für Technik begeistern: Gadgets, Plattformen, Tipps | c't uplink
Kinder interessieren sich in aller Regel für technische und naturwissenschaftliche Phänomene um sie herum. Mit altersgerechten Programmierplattformen, niedlichen Selbstbau-Robotern oder spannenden Brettspielen können Eltern diese Neugier fördern und gemeinsam mit dem Nachwuchs Spaß haben. In der c't-Ausgabe 22/2025 stellen wir kindgerechte Programmierplattformen, lokale Makerspaces und kluge Lernspielzeuge vor. Dorothee Wiegand, langjährige c't-Redakteurin und nun -Autorin, und c't-Redakteur Sylvester Tremmel sprechen im Podcast über das Thema und geben wertvolle Tipps. Gemeinsam basteln Laut den beiden ist man nie zu jung, um sich mit Technik zu beschäftigen. „Mein Kleiner hat Schalter geliebt, da war er kein Jahr alt“, erzählt Sylvester im c't uplink. „Kinder haben einen natürlichen Forschergeist“, meint auch Dorothee. „Sie machen Trial-and-Error-Experimente: Wenn ich jetzt den Lichtschalter anmache und es wird hell und dann mache ich ihn wieder aus, passiert das beim zweiten Mal genauso? Oder passiert dann vielleicht was anderes und warum ist das so?“ Es helfe aber zusätzlich, wenn man die Kinder mit dem Spielzeug nicht allein lässt, sondern sich gemeinsam damit beschäftigt. Wenn man den Karton gleich nach dem Kauf schon einmal aufmacht und nachsieht, ob zum Beispiel noch Batterien nötig sind oder Kabel zugeschnitten werden müssen, kann man das gemeinsame Spielen und Basteln gut vorbereiten. Hauptsache, Spaß dabei Letztendlich gehe es immer darum, dass die Kinder mit Spaß bei der Sache sind. „Solche Spielzeuge sollen nicht den Fachkräftemangel beheben“, stellt Dorothee klar. Das Ziel im privaten Umfeld sei nicht, den Informatik- oder Physikunterricht in der Schule zu ersetzen. „Es kommt auch drauf an, wie man seinem Kind das neue Spielzeug verkauft“, meint Sylvester. Also zum Beispiel das Brettspiel rund um Algorithmen einfach mal ausprobieren und schauen, ob es Spaß macht, statt zu betonen, wie viel Kinder dabei lernen. So kommen diese spielerisch in Kontakt mit algorithmischem Denken, Programmiergrundlagen oder naturwissenschaftlichen Phänomenen. Beispielsweise beim Scratch-Programmieren arbeite man mit fertigen Code-Blöcken, die wie Puzzleteile aneinanderpassen. Dieses Prinzip verhindert Tipp- und Syntaxfehler und vermeidet Frust bei den jungen Programmierern. Ähnlich reduziert funktioniert der für den Artikel getestete kleine Roboter, den man mit farbigen Filzstiftstrichen steuert. „Sehr intuitiv und sehr hands-on!“, findet Dorothee. Mit dabei: Dorothee Wiegand, Sylvester Tremmel Moderation: Greta Friedrich Produktion: Ralf Taschke Mehr darüber, wie und mit welchen Angeboten und Gadgets Sie Kinder für Technik begeistern können, lesen Sie in der c't-Ausgabe 22/2025, auf ct.de sowie in der c't-App für iOS und Android. Die Ausgabe 22/2025 gibt es aktuell am Kiosk.
Kinder für Technik begeistern: Gadgets, Plattformen, Tipps | c't uplink
Kinder interessieren sich in aller Regel für technische und naturwissenschaftliche Phänomene um sie herum. Mit altersgerechten Programmierplattformen, niedlichen Selbstbau-Robotern oder spannenden Brettspielen können Eltern diese Neugier fördern und gemeinsam mit dem Nachwuchs Spaß haben. In der c't-Ausgabe 22/2025 stellen wir kindgerechte Programmierplattformen, lokale Makerspaces und kluge Lernspielzeuge vor. Dorothee Wiegand, langjährige c't-Redakteurin und nun -Autorin, und c't-Redakteur Sylvester Tremmel sprechen im Podcast über das Thema und geben wertvolle Tipps. Gemeinsam basteln Laut den beiden ist man nie zu jung, um sich mit Technik zu beschäftigen. „Mein Kleiner hat Schalter geliebt, da war er kein Jahr alt“, erzählt Sylvester im c't uplink. „Kinder haben einen natürlichen Forschergeist“, meint auch Dorothee. „Sie machen Trial-and-Error-Experimente: Wenn ich jetzt den Lichtschalter anmache und es wird hell und dann mache ich ihn wieder aus, passiert das beim zweiten Mal genauso? Oder passiert dann vielleicht was anderes und warum ist das so?“ Es helfe aber zusätzlich, wenn man die Kinder mit dem Spielzeug nicht allein lässt, sondern sich gemeinsam damit beschäftigt. Wenn man den Karton gleich nach dem Kauf schon einmal aufmacht und nachsieht, ob zum Beispiel noch Batterien nötig sind oder Kabel zugeschnitten werden müssen, kann man das gemeinsame Spielen und Basteln gut vorbereiten. Hauptsache, Spaß dabei Letztendlich gehe es immer darum, dass die Kinder mit Spaß bei der Sache sind. „Solche Spielzeuge sollen nicht den Fachkräftemangel beheben“, stellt Dorothee klar. Das Ziel im privaten Umfeld sei nicht, den Informatik- oder Physikunterricht in der Schule zu ersetzen. „Es kommt auch drauf an, wie man seinem Kind das neue Spielzeug verkauft“, meint Sylvester. Also zum Beispiel das Brettspiel rund um Algorithmen einfach mal ausprobieren und schauen, ob es Spaß macht, statt zu betonen, wie viel Kinder dabei lernen. So kommen diese spielerisch in Kontakt mit algorithmischem Denken, Programmiergrundlagen oder naturwissenschaftlichen Phänomenen. Beispielsweise beim Scratch-Programmieren arbeite man mit fertigen Code-Blöcken, die wie Puzzleteile aneinanderpassen. Dieses Prinzip verhindert Tipp- und Syntaxfehler und vermeidet Frust bei den jungen Programmierern. Ähnlich reduziert funktioniert der für den Artikel getestete kleine Roboter, den man mit farbigen Filzstiftstrichen steuert. „Sehr intuitiv und sehr hands-on!“, findet Dorothee. Mit dabei: Dorothee Wiegand, Sylvester Tremmel Moderation: Greta Friedrich Produktion: Ralf Taschke Mehr darüber, wie und mit welchen Angeboten und Gadgets Sie Kinder für Technik begeistern können, lesen Sie in der c't-Ausgabe 22/2025, auf ct.de sowie in der c't-App für iOS und Android. Die Ausgabe 22/2025 gibt es aktuell am Kiosk.
Leonardo Fibonacci ist einer der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters. Heute kennen wir ihn vor allem für eine berühmte Zahlenreihe, die er aus seiner Auseinandersetzung mit fiktiven Kaninchen ableitet — aber er bringt auch die indisch-arabischen Ziffern 0 bis 9 nach Europa, damit diese endlich die römischen Zahlen ablösen. Manons „Spektrum“-Artikel über die lange Geschichte der Null lest ihr hier. Zur Podcastfolge von „Behind Science“, in der Manon und Demian über die Null sprechen, kommt ihr hier. Hört gerne auch die „Geschichten aus der Mathematik“ über Florence Nightingale und Niccolò Tartaglia! Ihr wollt Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag loswerden? Gerne! Schreibt uns an podcast@spektrum.de – wir freuen uns auf eure Nachrichten! Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:09) Einleitung (00:03:39) Die Geschichte unseres Zahlensystems (00:08:58) Die Studienreisen Fibonaccis (00:13:39) Das Liber Abaci (00:17:09) Ein Sieg im Rechenwettbewerb – und ein später Siegeszug (00:21:40) Fibonaccis hypothetisches Kaninchenproblem (00:26:39) Die Fibonacci-Folge und der goldene Schnitt (00:31:29) Fazit & Verabschiedung >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-leonardo-fibonacci
Heute haben wir ein paar spannende Fragen im Gepäck! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Wie relevant ist Informatik als Schulfach? Interview Nadine Dittert, Uni Koblenz
Hong, Elena www.deutschlandfunk.de, Campus & Karriere
Informatik als neues Pflichtfach in Hamburg: Was fällt stattdessen weg?
Neubig, Magdalena www.deutschlandfunk.de, Campus & Karriere
Die Menschen in Gaza feierten anfangs Woche das Ende der israelischen Angriffe. Doch der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört, viele Menschen leben in Zelten. Eine Krankenpflegerin vor Ort von «Ärzte ohne Grenzen» hat SRF über die aktuelle Situation in Gaza berichtet. Weitere Themen: · In Spanien haben gestern Zehntausende Menschen gegen Israels Vorgehen in Gaza demonstriert. In Barcelona ist es gar zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Und das alles, obwohl seit fünf Tagen eine Waffenruhe herrscht. Wieso also diese landesweiten Demonstrationen? · Junge Chinesinnen und Chinesen protestieren lautstark in den sozialen Medien gegen das neue sogennante K-Visum. Dieses erleichtert ausländischen Fachkräften aus den MINT-Bereichen – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – die Arbeitsaufnahme in China. Gleichzeitig verzeichnet China Rekordwerte bei der Jugendarbeitslosigkeit. · «Balljunkies» – so nennen Hundebesitzerinnen und -besitzer jene Vierbeiner, die scheinbar nie genug vom Spielen bekommen. Doch was, wenn diese Leidenschaft zur Sucht wird? Forschende der Universität Bern und der Veterinärmedizinischen Universität Wien haben erstmals untersucht, ob Hunde tatsächlich ein sucht-ähnliches Verhalten entwickeln können.
Ken Keeler ist Mathematiker — und er schreibt Drehbücher, in denen er zeitweise auch ein bisschen Mathematik unterbringt. Für die Sci-Fi-Zeichentrickserie „Futurama“ hat er sich ein mathematisches Problem ausgedacht, ohne zu wissen, ob es dafür eine Lösung gibt. Das hat ihn angespornt, eine zu finden. Manons „Spektrum“-Artikel über die Futurama-Folge „Im Körper meines Freundes“ und das Futurama-Theorem lest ihr hier. Und das veröffentliche Paper zum Futurama-Theorem findet ihr hier. Ihr wollt Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag loswerden? Gerne! Schreibt uns an podcast@spektrum.de – wir freuen uns auf eure Nachrichten! Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung. (00:00:00) Einleitung (00:04:48) Futurama und Mathematik (00:07:35) Der Mindswitcher von Futurama (00:11:08) Unumkehrbarer Körpertausch? (00:13:09) Das Problem, das Ken Keeler lösen wollte (00:15:49) Das Futurama-Theorem (00:22:39) Echte Mathematik & Easter Eggs (00:25:55) Verabschiedung… und ein Easter Egg? >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/geschichten-aus-der-mathematik-futurama
Das eskaliert diesmal sehr schnell! Sagt bitte danach nicht, ich hätte euch nicht gewarnt! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr für nichts Zeit habt? Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Lars berichtet von seiner kleinen Detour! Die Väter Lars, ehemals angehender Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik und Andi aka Crocodileandy, gelernter Architekt, sind auf Umwegen zu Social Media Stars geworden. Mit Kreativität und dem Willen anderen etwas beizubringen haben sie mit Hilfe von Minecraft ihre Reichweite gewonnen. In dem Podcast "Besser als Nackt" dreht sich alles um die unverblümte Wahrheit des Lebens. Viel Spaß beim Anhören!
Magazín Experiment: Učíme se programovat přírodu, říká americký informatik. Proč potřebuje umělá inteligence tělo?
Fyzik a informatik Neil Gershenfeld z amerického MIT se snaží pomocí umělé inteligence oživit neživou hmotu. Kromě toho ale také svým projektem sítě dílen s moderními technologiemi pomáhá šířit technické vzdělání ve školách nebo tradičních společnostech rozvojových zemí. Přes dva tisíce těchto takzvaných fablabů dnes využívají lidé ve více než sto zemích světa.