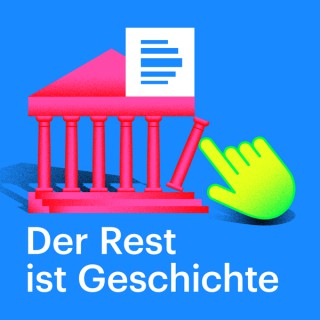Podcasts about sowjetunion
Communist state in Europe and Asia that lasted from 1922 to 1991
- 678PODCASTS
- 1,812EPISODES
- 36mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Jan 23, 2026LATEST

POPULARITY
Categories
Best podcasts about sowjetunion
Latest news about sowjetunion
- The Russian Reconstruction Program libcom.org - Feb 6, 2025
- Friedrich Pollock Is a Crucial Guide to the Rise of Automation Jacobin - Aug 30, 2023
Latest podcast episodes about sowjetunion
WISSEN, MACHT, ORDNUNG - Homo Sovieticus, Idealtyp oder Opportunist?
Ein neuer Mensch für eine neue Gesellschaft: In den 1930er-Jahren setzt die Sowjetunion alles daran, den Homo Sovieticus hervorzubringen - einen kommunistischen Idealbürger. Durch gezielte Umerziehung sollte ein "Neuer Mensch" entstehen: angepasst, diszipliniert, politisch loyal. Wie erfolgreich war das soziale Experiment? Von Fiona Rachel Fischer (BR 2025)
Deutschlands Spätheimkehrer und ihr schwieriges Kriegsgepäck
Der Zug mit den letzten Kriegsgefangenen rollt am 16.1.1956 in Friedland ein. Am Bahnsteig nur jubelnde Begrüßung. Keine kritische Frage nach Schuld und Verantwortung. Von Thomas Klug.
Findet Felix – Das gestohlene Baby
Ein Baby verschwindet 1984 spurlos aus einem Kinderwagen. Wenige Tage später taucht ein fremdes Kind auf. War es ein perfider Tausch? Der KGB scheint involviert. Die Spur führt ins heutige Russland.
#93 - Nina Sawatzki über die Sowjetunion, Silber bei Olympia und das Erfolgsrezept im Nachwuchs
Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge, Volleyball mit Senf. Bevor ich in die Folge reinstarte, möchte ich mich bei allen Hörerinne und Hörern bedanken. Ein großer Dank geht an meine Gäste und an euch liebe Premium-Senfis. Ich habe für das kommende Jahr 2026 folgende Bitte. 1. Bitte folgt dem Podcast und lässt mir eine Bewertung da, falls möglich 5 Sterne – aber ich will euch nicht drängen. 2. Wer im Jahr 2026 Premium-Senfi werden möchte und so den Podcast mit einmaligen 30 Euro unterstützen kann, findet die Infos in den Shownotes. Es ist aber eigentlich ganz einfach, 30 euro überweisen und schon bist du Premium-Senfi, wirst namentlich erwähnt und hast die Chance tollen Volleyball mit Senfi-Merch zu gewinnen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge.Heute war die erfolgreichste Nachwuchstrainerin Österreichs (vielleicht sogar weltweit) zu Gast im Podcast. Nina Sawatzki, kommt ursprünglich aus Armenien, ist also in der Sowjetunion aufgewachsen und war selbst professionelle Volleyballerin. Sie wurde Europameisterin, gewann Silber bei Olympia und Bronze bei der Weltmeisterschaft. Sie berichtet über ihre vielen Stationen, die sie von Russland über Polen und Deutschland bis nach Österreich brachten. Wir gehen auf die Unterschiede zwischen der Sowjetunion, Deutschland und Österreich ein und Nina erklärt ihren Zugang, mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich arbeiten zu können. Wer von ihren Schützlingen noch spielt und vor allem in welchen Ligen diese nun spielen und vieles mehr hört ihr in einer weiteren Folge, Volleyball mit Senf.https://de.wikipedia.org/wiki/Nina_Sawatzkihttps://www.facebook.com/nina.sawatzki+++++Werde Premium-Senfi+++++Wer möchte, kann mit nur 30 Euro pro Jahr Premium-Senfi werden. 4mal im Jahr werde ich eine Verlosung unter allen Premium-Senfis machen. Zu Gewinnen gibt es VolleyballmitSenf-Shirts, Espresso-Tassen oder Cappis. Außerdem werde ich alle Premium-Senfis im Podcast begrüßen und jedes mal, sobald eine oder einer dazukommt, wird der Vorname dieser Person im Podcast erwähnt. Dazu bitte VMS und den Namen als Betreff bei der Überweisung angeben., sofern er sich vom Bankkontoinhaber unterscheidet.Überweisung an: Peter Eglseer, AT83 2033 3000 0027 1585Wer sich eine Volleyball mit Senf Kaffeetasse kaufen möchte, bitte einfach eine Mail an volleyballmitsenf@gmail.com oder eine DM auf Instagram schreiben. volleyballmitsenf
Die in der ehem. Sowjetunion aufgewachsene Alina Bronsky erzählt in "Essen" vergnüglich bis melancholisch von den Speisen ihres Lebens und das wofür sie stehen: Fürsorge, Emanzipation, aber auch emotionale Erpressung.
DIE VORSCHAU - 0099 - 2025KW52 - Neue Serien, Shows und Dokus kurz & kompakt vorgestellt
Zwischen den Jahren gratuliert der Eismann u.a. der "Mini Playback Show" & "Mr. Bean" und spricht über "The Rainmaker", "The Copenhagen Test", "Lost Places der Sowjetunion", "Suche mich nicht", "Tödliche Codes - Jagd auf den Zodiac-Killer" und "The Way Home". Pssst...: Abonnieren und Weitersagen ist erlaubt! (wir sagen's auch nicht weiter...)Abonniert uns auf Spotify, Apple & Co // RSS-Feed: https://podcasters.spotify.com/pod/show/dievorschauKontakt: dievorschau@wunschliste.deEin Service von http://www.wunschliste.de Und hier geht's direkt zum TOHUWAPODCAST: https://podcasters.spotify.com/pod/show/tohuwapodcast
106 - Zwischen Paragraphen und Postmigrantisch: Spätaussiedler und Aktivisten in Berlin mit Eugenie Frank und Nikita Heidt
Diese Folge ist der zweite Teil einer Podcast-Reihe zu transgenerationalen Traumata, Aussiedler:innen, Spätaussiedler:innen sowie hybriden und fluiden Identitäten im Spiegel des PostOst-Diskurses.Migration bedeutet hybride Identitäten und das ständige Sich-Erklären-Müssen. Die Rückkehrdebatten, die Suche nach echten Räumen, die prekäre Förderlogik und die Krisen heutiger Zeit werfen Fragen auf:
Mit Schoko-Panzern gegen Neo-AdolfAnti-Diplomatie: Im Vorfeld zur heutigen Friedensverhandlung haben Bundeskanzler Merz & Co. erneut das Feindbild Russland beschworen und Putin mit Hitler verglichen. Ein Kommentar von Paul Clemente.Am vergangenen Donnerstag verkündete die Pressesprecherin im Weißen Haus, Karoline Leavitt: Donald Trump wolle beim Ukraine-Krieg nicht länger moderieren.„Der Präsident ist extrem frustriert über beide Seiten dieses Krieges und hat Treffen satt, die nur um des Treffens willen stattfinden. Er will keine weiteren Diskussionen. Er will Taten sehen. Er will, dass dieser Krieg ein Ende hat.“Auf die Frage, ob Trump einen Vertreter zu den Friedensverhandlungen nach Berlin sende, erwiderte Leavitt:„Wenn es eine echte Chance gibt, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese Treffen der Zeit der Vereinigten Staaten an diesem Wochenende würdig sind – dann werden wir einen Vertreter entsenden.“ Inzwischen hat Trump gleich zwei Unterhändler in die deutsche Hauptstadt geschickt: Steve Witkoff und Jared Kushner. Aber sieht der US-Präsident dort wirklich „echte Chancen“ für ein Friedensabkommen? Eher vorstellbar wäre: Dass die beiden eine Eskalation verhindern sollen. Schließlich berauschen sich deutsche Politiker zunehmend am Bellizismus. Eine Kostprobe gab Bundeskanzler Friedrich Merz vor wenigen Tagen. Auf dem CSU-Parteitag in München erklärte Merz: Der russische Staatspräsident sei ein zweiter Hitler und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Chamberlain-Aufguss. Nein, originell ist dieser Vergleich nicht. Die Mainstream-Medien bemühen ihn fast täglich, aber: In der gegenwärtigen Situation ist er brandgefährlich. Denn mit einem Hitler kann man nicht Frieden schließen. Bei ihm verbieten sich Kompromisse oder gar Entgegenkommen. Fassen wir die Argumentation der Rede zusammen:So wie Hitler verfolge Putin den Aufbau eines Imperiums. Wie er das macht? Ganz einfach: Indem er frühere Mitgliedsstaaten der UdSSR militärisch einkassiert. Genau da zieht Merz die Parallele zum Jahr 1938 - dem Jahr, als Hitlers finstere Pläne zur Eroberung Europas sich abzeichneten. So wie inzwischen die Absichten vom bösen Putin. O-Ton Merz:„Das war eigentlich das Muster, das wir schon 2014 hätten sehen müssen. Und spätestens seit 2022 wissen wir es, dass es ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist, gegen Europa ist. Und wenn die Ukraine fällt, dann hört er nicht auf. Und genauso wenig wie 1938 das Sudetenland nicht gereicht hat. Putin hört nicht auf. Und wer heute noch glaubt, dass er damit genug hat, der soll bitte die Strategien, die Papiere, die Reden, die Auftritte von ihm genau analysieren.“Der feuchte Traum des Kreml-Chefs sei eine„Wiederherstellung der alten Sowjetunion in den Grenzen der alten Sowjetunion, mit einer massiven Gefährdung, auch militärischen Gefährdung der Länder, die früher einmal zu diesem Imperium dazugehört haben“.Zum Glück blieb diese Parallelisierung nicht unwidersprochen. Der englische Historiker Jeffrey Sachs stellte gegenüber der Berliner Zeitung klar: Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Folge 293: Viktor Nekrassow – "In den Schützengräben von Stalingrad"
Heute wenden wir uns einem Schriftsteller zu, dessen Lebensweg untrennbar mit einem der dramatischsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs verbunden ist. Viktor Nekrassow diente als junger Offizier in Stalingrad und erlebte die verheerenden Kämpfe nicht aus der Distanz, sondern unmittelbar in den Schützengräben, Seite an Seite mit seinen Kameraden. Gerade deshalb ist sein Werk so bemerkenswert: Es eröffnet die Möglichkeit, den Kampf um Stalingrad aus einer sowjetischen Perspektive zu betrachten. Bemerkenswert ist zudem Nekrassows literarischer Werdegang. Bevor er zu schreiben begann, hatte er keinerlei Erfahrung als Autor. Gerade diese Unmittelbarkeit seiner Beobachtungen und sein Stil machten sein Debüt so kraftvoll. Mit seinem Roman In den Schützengräben von Stalingrad gelang ihm auf Anhieb ein Werk, das weit über die Grenzen der Sowjetunion hinaus Aufmerksamkeit erregte. Das Buch wurde zu einem internationalen Erfolg, brachte ihm schlagartig Weltruhm ein und erschien schließlich in mehr als dreißig Sprachen – ein Beleg dafür, wie sehr seine präzise, schonungslose Darstellung des Kriegsgeschehens die Leser und Leserinnen weltweit berührte.
Advent, Advent, Advent – Sünndag brennt al dat drütte Talliglicht op'n Kranz. Duuert also ni mehr lang, bet de Wiehnachsman kümmt. Un de Wiehnachsmann, as he bi uns bekannt is, de kümmt ut de USA. Vun dor keem in Westdüütschland je veel no'n Tweeten Weltkrieg. Cola, Zigaretten, un noch so veel mehr. Dormols sünd de Amerikoners bi uns as de Retters fiert worrn. Dor hett sick so'n lütt beten wat an ännert, dücht mi. Dor bringt in Oogenblick 'n oln witten Mann mit 'n orangschen Kopp tehmli veel dör'nanner. Donald Trump. In Osten vun Düütschland, dor, wonehm 40 Johr lang de DDR ween is, harr Russland dat seggen. Genauer geseggt, de Sowjetunjon. Un jüst düsse Sowjetunion wünscht sick de ole witte Mann trüch, de dor dat seggen hett un de noch mehr dör'nanner bringt. Wladimir Putin. Noch leever weer he wohrschienli de Zar vun Russland un op't Letzt‘ vun ganz Eurasien. Un dorto, de Kaiser vun‘ amerikanischen Kontinent to ween, wurr Trump ook ni nä seggen. Egol. In Russland kümmt ni de Wiehnachsmann. Dor kümmt in de Niejohrsnacht „Väterchen Frost“. Jo, un bi dat wat nu in Kreml vör sick geiht, löppt een dat ook würkli kold un frosti den Rüüch hendohl. Na jo, de Wiehnachsmann, also de ut de USA, hett sick in Russland siet de 90er Johrn ook mehr un mehr dörsett. Dormit hett Putin vöriged Johr sluss mokt. He hett 'n Werbefilm dreihn loten, in den Väterchen Frost mit'n Panzer ünnerwegens is un den Santa Klooß mit all sien Rentiern un sien Sledden, mit 'n Raket meern bi't Fleegen in de Luft jogt. Dor fallt di echt nix mehr to in. Overs dat harr ook vun Trump kom‘ kunnt. Twee vun de mächtigsten Lüüd vun de Welt föhrt sick mitünner op as twee opfällige Göörn ut de Regenbogengrupp‘ in Kinnergoorn. Blots de Folgen sünd veel slimmer wenn Wladimir un Donald ehr drullige fief Minuten hebbt. Dor ward di Angst un Bang bi. Dorüm wurr dat ook düssed Johr ni so dull mit Geschinke för de beiden utsehn. För ehr harr de Wiehnachsmann jüst so wenig in Büddel as Väterchen Frost… In düssen Sinn
An den Außengrenzen der EU floriert russische Propaganda. Wie wehren sich Moldau und Rumänien? Ein Podcast mit Florian Kührer-Wielach von Pragmaticus.Das Thema:Als Russland noch Sowjetunion war, war die Republik Moldau Teil jenes Imperiums, das der russische Präsident Wladimir Putin wiederbeleben will. Mit gezielter Propaganda versucht er, Wahlen in den Ländern Südosteuropas zu beeinflussen. Durch Desinformation, Stimmenkauf, Kirchenpropaganda und gekaufte Politiker. Mit dieser Strategie ist er unterschiedlich erfolgreich. Der Südosteuropa-Experte Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) berichtet in diesem Podcast, wie sich die Republik Moldau und Rumänien gegenüber dem Aggressor Russland positionieren. Er analysiert, mit welchen Argumenten die russische Propaganda punktet und wie sie es schafft, Gesellschaften zu polarisieren. Das, was an den Außengrenzen der EU passiert, zeigt immer auch, welche Herausforderungen der gesamte Kontinent zu stemmen hat und ist insofern ein Einblick in Sicherheit, Minderheitenpolitik und die Anstrengungen für eine liberale Weltordnung. Die gute Nachricht: Die Europäische Union kann sich als Gegenpol noch gut positionieren. Wie lange noch? Unser Gast in dieser Folge: Florian Kührer-Wielach stammt aus Horn im Waldviertel in Österreich. Der auf die Geschichte Südosteuropas spezialisierte Historiker ist der Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS). Für den Pragmaticus schrieb er zuletzt eine Analyse über die Republik Moldau nach den Wahlen und ist in diesem Podcast über die Situation in der Republik Moldau und Rumänien zu hören.Dies ist ein Podcast von Der Pragmaticus. Sie finden uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und X (Twitter).
Merz kritisiert US-Sicherheitsstrategie
Bundeskanzler Merz reagiert wenig überrascht, dafür deutlich auf Sicherheitstrategie der USA. │ Der Militärische Abschirmdienst warnt vor einer verschärften Bedrohungslage für die Bundeswehr. │ Selenskyj will überarbeitete Version eines Friedensplans heute an die USA weiterleiten. │ Tschechiens neue Regierung könnte negative Folgen für die Ukraine haben. │ Putin will Sowjetunion wiederherstellen? - Kreml weist Aussage von Merz zurück. │ Litauen erklärt den Ausnahmezustand, weil Ballons vom russischen Verbündeten Belarus über die Grenze fliegen. │ Der AfD dürfte die US-Sicherheitsstrategie gefallen - Hintergründe zum Verhältnis zwischen AfD und den USA. │ Nirgends leben Reporterinnen und Reporter im Moment so gefährlich wie in Gaza, sagt der neue Bericht der "Reporter ohne Grenzen".
Valery Tscheplanowa: "Europa steht für Freiheit - absolut"
"Die Bedeutung von Europa ist für mich noch viel größer geworden", sagt die Schauspielerin und Schriftstellerin Valery Tscheplanowa mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Handlungsfreiheit und Meinungsfreiheit, das bedeutet Europa und ein friedliches Miteinander der verschiedensten Kulturen. Ich lebe europäisch, ich reise europäisch - ich esse sogar europäisch." Von Valery Tscheplanowa.
80 Jahre Nürnberger Prozesse – Interview mit russischem Generalkonsul Krasnitskiy: Moskau vermisst Anerkennung der sowjetischen Rolle
Anlässlich des 80. Jahrestages der Nürnberger Prozesse kritisiert der russische Generalkonsul Oleg Krasnitskiy die mangelnde Anerkennung der sowjetischen Rolle und fordert die internationale Anerkennung des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion als Völkermord. Im Gespräch mit den NachDenkSeiten beschreibt Krasnitskiy die deutsch-russischen Beziehungen offen als „hybriden Kriegszustand“ und beklagt Versuche, die Gedenkkultur zu verändern. Er appelliert anWeiterlesen
Was bedeutet eigentlich Freiheit? Ein Gespräch mit Timothy Snyder - Folge #1514
Der Historiker Timothy Snyder weiß, was echte Freiheit ausmacht – und dass Freiheit mehr ist, als nur die Absenz von Regeln. Er betont, dass Freiheit nur dann wirklich funktioniert, wenn es moralische und politische Strukturen gibt. Alles andere führt zur Willkürherrschaft. Wahre Freiheit entsteht also nicht im Vakuum, sondern braucht Regeln, Bildung, Verantwortung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wie Synder das während des Zerfalls der Sowjetunion gelernt hat, wie die Tech-Bros und ihre rechten Unterstützer dies alles missberstehen. Und was wir tun müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen, darüber spricht Snyder mit Misha Glenny - Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen - und Eva Konzett - Journalistin beim Falter. Diese Episode ist Teil des Podcasts Future Discontinuous, den der Falter in Zusammenarbeit mit dem IWM produziert. Er wurde in englischer Sprache und am 5. November erstmals ausgestrahlt. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
30 Jahre Dayton: Bosnien-Herzegowina und die Stabilität auf dem Balkan – mit Adnan Ćerimagić
Dieser Tage jährt sich das Abkommen von Dayton zum 30. Mal. Mit Adnan Ćerimagić, Analyst am Think Tank European Stabilität Initiative, sprechen wir über die lange Vorgeschichte des Krieges, der auf den Zusammenbruch der Sowjetunion folgte und gehen der Frage nach, wie stabil oder labil die Region ist. Buchtipp: Julian Borger, The Butcher's Trail – How the Search for Balkan War Criminals Became the World's Most Successful Manhunt, https://www.amazon.de/Butchers-Trail-Criminals-Successful-Manhunt/dp/1590516052Unterstützen Sie uns einmalig oder regelmäßig hierUnser Schwesterpodcast: Der Hauptausschuss der SalonkolumnistenDie Website der SalonkolumnistenDer Ostausschuss der Salonkolumnisten auf TwitterDas Panel auf Twitter:Dr. Franziska DaviesProf. Jan Claas BehrendsDr. Gustav GresselGabriele WoidelkoDas Moderationsteam:Jan-Philipp HeinRichard VolkmannDavid HarnaschProducer: David HarnaschPostproduction: Chris GruberTitle track vocals: Masha (10, from Odesa)
„Im Großen und Ganzen sind wir die Verlierer“ – Sowjetischer Diplomat über den Zwei-plus-Vier-Vertrag – Teil 2
Die deutsche Wiedervereinigung stellte die Sowjetunion im Jahr 1990 vor immense politische und diplomatische Herausforderungen. Wie Wladimir Michailowitsch Polenow, sowjetisch/russischer Diplomat, berichtet, war der Prozess von Unsicherheit und dem Gefühl einer „Zerlegung“ der DDR geprägt. Artem Pawlowitsch Sokolow führte dieses Interview im Rahmen des analytischen Berichts des Instituts für Internationale Studien der MGIMO (Moskauer StaatlichesWeiterlesen
Warum die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Russland ins Stocken kommt
Die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Russland kommt seit 2022 ins Stocken. Seit 1992 konnte der Volksbund die Gebeine von einer halben Million deutscher Soldaten, die von 1941 bis 1945 gegen die Sowjetunion gekämpft hatten, identifizieren und 22 deutsche Soldatenfriedhöfe anlegen oder wiederherrichten. Das war möglich aufgrund eines Abkommens zwischen Russland und Deutschland, inWeiterlesen
Martin Lutz: Energieabhängigkeit und nationale Sicherheit im Kalten Krieg
Energieabhängigkeit bedeutete seit den Ölkrisen der 1970er Jahre in der Bundesrepublik vor allem: Die Abhängigkeit vom Öl aus dem Nahen Osten, und diese galt es zu verringern. Doch dazu mehr sibirisches Erdgas aus der Sowjetunion, und dann ausgerechnet für die Energieversorgung des eingeschlossenen West-Berlins? Im verschärften Kalten Krieg nach Ende der Entspannungspolitik warf diese Frage Mitte der 1980er Jahre elementare Sicherheitsinteressen auf. Nicht zuletzt gab es die technische Herausforderung, wie man eigentlich eine Pipeline durch die Berliner Mauer baut. Mit der Berliner Erdgasversorgung beleuchtet der Vortrag einen entscheidenden Abschnitt in der langen Geschichte der deutsch-sowjetischen/russischen Energiebeziehungen mit Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Referent Martin Lutz ist Professor für Geschichte moderner Gesellschaften an der Universität Bielefeld.
The man who saved the world? Wassili Archipow - Der geheime Held der Kuba-Krise
Oktober 1962.Die Welt hält den Atem an. Vor der Küste Kubas stehen sich die Supermächte des Kalten Krieges gegenüber.Amerikanische Spionageflugzeuge haben sowjetische Raketen entdeckt - Atomraketen, die in Minuten Washington, New York oder Chicago zerstören könnten.Die USA verhängen eine Seeblockade, die Sowjetunion schickt ihre Flotte in Richtung Karibik.Ein einziger Fehltritt - und der Atomkrieg wäre Realität.Tief unter der Wasseroberfläche, an Bord des sowjetischen U-Boots B-59 glauben die Männer, der Krieg habe bereits begonnen.Der Kommandant befiehlt, den nuklearen Torpedo einsatzbereit zu machen.Nur einer widerspricht: Wassili Alexandrowitsch Archipow.Es ist der Moment, in dem ein einzelner Mann eventuell die Welt vor der nuklearen Katastrophe bewahrt - und doch jahrzehntelang unbekannt bleibt.
Die Jagd nach Yellow Cake – Uran aus dem Erzgebirge
Es ist ein Rohstoff von strategischer Bedeutung. Einer, der Weltgeschichte schrieb: Ohne Uran aus dem Erzgebirge hätte es keine sowjetischen Atomwaffen gegeben. Alexa Hennings erzählt vom Bergbau in Schlema und Umgebung.
Der Historiker Karl Schlögel, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, ruft die „friedensverwöhnten“ Deutschen zum Kampf gegen die Russen auf. Und gegen die Russen respektive die Sowjetunion hat er schon in seinen langen Jahren als maoistischer Kaderführer gekämpft. Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels kann wohl nur noch erhalten, wer in Sachen Ukraine-Krieg nach WaffenWeiterlesen
MEDIZINGESCHICHTEN - Weiße Kittel im Ost-West-Konflikt
Menschenversuche im "Kalten Krieg" - im Namen der Feindesabwehr wurden zigtausende Menschen zu medizinischen Versuchskaninchen. Im Osten wie im Westen. Zum Beispiel gab es radioaktive Verseuchung von Menschen in der Sowjetunion genauso wie Experimente mit Drogen und giftigen Chemikalien an Strafgefangenen in den USA. Von Lukas Grasberger (BR 2018)
Familiengeschichten - Zwei Autorinnen - viele Parallelen
Katerina Poladjan und Yulia Marfutova wurden in der ehemaligen Sowjetunion geboren und wuchsen in Deutschland auf. Das hat ihr Schreiben geprägt. Ihre neuen Romane kreisen um Familiengeschichten zwischen Moskau, USA und dem bulgarischen Goldstrand. Meyer, Frank www.deutschlandfunkkultur.de, Lesart
Familiengeschichten - Zwei Autorinnen - viele Parallelen
Katerina Poladjan und Yulia Marfutova wurden in der ehemaligen Sowjetunion geboren und wuchsen in Deutschland auf. Das hat ihr Schreiben geprägt. Ihre neuen Romane kreisen um Familiengeschichten zwischen Moskau, USA und dem bulgarischen Goldstrand. Meyer, Frank www.deutschlandfunkkultur.de, Lesart
Als Dean Reed 1961 nach Südamerika kommt, wird der US-Amerikaner als Superstar empfangen. Es ist ein Wendepunkt in seinem Leben: Im eigenen Land nur mäßig erfolgreich, macht er in den folgenden Jahren eine außergewöhnliche Karriere. Er tourt durch die Sowjetunion, zieht in die DDR und beteiligt sich an zahlreichen Protestaktionen gegen die US-Politik. Wir sprechen in der Folge über das Leben von Dean Reed, wie er als Roter Elvis bekannt wurde und warum sein Tod bis heute zu Spekulationen führt. // Erwähnte Folgen - GAG512: Eine kleine Geschichte der Sonnenbrille – https://gadg.fm/512 // Literatur - Stefan Ernsting: Der rote Elvis: Dean Reed, oder, Das kuriose Leben eines US-Rockstars in der DDR, 2004. - Reggie Nadelson: Comrade Rockstar: The Life and Mystery of Dean Reed, the All-American Boy Who Brought Rock 'N' Roll to the Soviet Union, 1991. - Thomas Latter: Red Elvis: The Cold War Cowboy (2022), Doku - Leopold Grün: Der rote Elvis (2007), Doku //Aus unserer Werbung Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/GeschichtenausderGeschichte // Wir sind jetzt auch bei CampfireFM! Wer direkt in Folgen kommentieren will, Zusatzmaterial und Blicke hinter die Kulissen sehen will: einfach die App installieren und unserer Community beitreten: https://www.joincampfire.fm/podcasts/22 //Wir haben auch ein Buch geschrieben: Wer es erwerben will, es ist überall im Handel, aber auch direkt über den Verlag zu erwerben: https://www.piper.de/buecher/geschichten-aus-der-geschichte-isbn-978-3-492-06363-0 Wer Becher, T-Shirts oder Hoodies erwerben will: Die gibt's unter https://geschichte.shop Wer unsere Folgen lieber ohne Werbung anhören will, kann das über eine kleine Unterstützung auf Steady oder ein Abo des GeschichteFM-Plus Kanals auf Apple Podcasts tun. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer dies möglich ist rezensiert oder bewertet. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder sogar Nachbarinnen und Nachbarn von uns erzählt! Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
#92 Spomeniks - Jugoslawiens monumentale Erinnerungskultur
Die Spomeniks erinnern an den Widerstand der Partisanen und an die Opfer des Faschismus. Sie verkörpern eine modernistische Form der Erinnerungskultur, die sich radikal vom sozialistischen Realismus der Sowjetunion unterschied. Ihre abstrakten Formen sollten Hoffnung, Freiheit und kollektiven Widerstand symbolisieren. Damit waren sie Teil einer staatlich geförderten Ästhetik, die den jugoslawischen Partisanenkampf ins Zentrum rückte und zugleich modernistisch und international anschlussfähig war. Heute verfallen viele dieser Monumente oder stehen im Schatten neuer nationalistischer Narrative. Doch seit rund einem Jahrzehnt wächst das Interesse – nicht nur in der Region, sondern auch international. Tourist:innen reisen an, weil die Spomeniks extrem „instagrammable“ sind und manche wie Relikte einer anderen Zivilisation wirken, fast so, als wären Außerirdische gelandet. Dabei wird oft vergessen, dass viele Spomeniks zugleich Massengräber sind.
In dieser Folge widmen wir uns einer der gefürchtetsten Organisationen der Sowjetunion: dem NKWD. Als Vorläufer des KGB war der sowjetische Geheimdienst in den 1930er und 1940er Jahren maßgeblich an politischen Säuberungen, Repressionen und der Errichtung des stalinistischen Terrors beteiligt. Millionen Menschen fielen seinen Verhören, Deportationen und Erschießungen zum Opfer. Doch was genau war der NKWD? Wie funktionierte sein System aus Überwachung, Angst und Gewalt? Und welche Rolle spielte er im Machtapparat Stalins? Wir blicken hinter die Fassade einer Organisation, die ganze Gesellschaften kontrollierte – und zerstörte.
Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung. Der Präsident schockierte viele mit seinen Angriffen auf die UNO, seinen Bemerkungen zur Migrationssituation in der EU und seiner Zurückweisung des Klimawandels als „Schwindel“ und „Betrug“. Anschließend sprechen wir über den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde. Unser Wissenschaftsthema widmet sich heute einem Artikel, der über einen Zusammenhang zwischen reduziertem Koffeinkonsum und lebhafteren Träumen berichtet. Und zum Schluss sprechen wir über die Verleihung der Ig-Nobelpreise 2025, mit denen skurrile, aber innovative Forschungsarbeiten ausgezeichnet werden. Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Subordinating Conjunctions – Part 1, und es wird um den sogenannten Plattenbau gehen. Ursprünglich kommt dieser Gebäudetyp aus der ehemaligen Sowjetunion. Er wurde später massenhaft in der DDR gebaut und scheint heutzutage ein trostloses Beton-Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein. Doch es gibt durchaus auch positive Assoziationen mit der „Platte“. Wenn wir darüber reden, was einem so richtig auf die Nerven geht, um auf unsere heutige Redewendung zu sprechen zu kommen, so fällt einem sofort Werbung ein. Das sind diese lästigen Spots, denen man anscheinend nicht entkommen kann und die sich doch tief in unser Unterbewusstsein einprägen. Wir werfen einen Blick auf die deutsche Werbung vergangener Jahre. Trumps Rede vor der UN-Generalversammlung – Beschwerden und Angriffe Anklage gegen Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Kann weniger Koffein Träume lebhafter und bunter machen? Ig-Nobelpreis 2025: Ernährungsphysiologischer Nutzen von Teflon und die physikalischen Grundlagen von Nudelsaucen Der Plattenbau Deutsche Werbung: The Good, the Bad and the Ugly
Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung. Der Präsident schockierte viele mit seinen Angriffen auf die UNO, seinen Bemerkungen zur Migrationssituation in der EU und seiner Zurückweisung des Klimawandels als „Schwindel“ und „Betrug“. Anschließend sprechen wir über den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde. Unser Wissenschaftsthema widmet sich heute einem Artikel, der über einen Zusammenhang zwischen reduziertem Koffeinkonsum und lebhafteren Träumen berichtet. Und zum Schluss sprechen wir über die Verleihung der Ig-Nobelpreise 2025, mit denen skurrile, aber innovative Forschungsarbeiten ausgezeichnet werden. Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Subordinating Conjunctions – Part 1, und es wird um den sogenannten Plattenbau gehen. Ursprünglich kommt dieser Gebäudetyp aus der ehemaligen Sowjetunion. Er wurde später massenhaft in der DDR gebaut und scheint heutzutage ein trostloses Beton-Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein. Doch es gibt durchaus auch positive Assoziationen mit der „Platte“. Wenn wir darüber reden, was einem so richtig auf die Nerven geht, um auf unsere heutige Redewendung zu sprechen zu kommen, so fällt einem sofort Werbung ein. Das sind diese lästigen Spots, denen man anscheinend nicht entkommen kann und die sich doch tief in unser Unterbewusstsein einprägen. Wir werfen einen Blick auf die deutsche Werbung vergangener Jahre. Trumps Rede vor der UN-Generalversammlung – Beschwerden und Angriffe Anklage gegen Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Kann weniger Koffein Träume lebhafter und bunter machen? Ig-Nobelpreis 2025: Ernährungsphysiologischer Nutzen von Teflon und die physikalischen Grundlagen von Nudelsaucen Der Plattenbau Deutsche Werbung: The Good, the Bad and the Ugly
Mieczysław Weinberg verliert im Holocaust seine Familie, wird Komponist in der Sowjetunion – aber ohne großen Durchbruch. Erst nach seinem Tod wird seine Musik wieder entdeckt – auch die 3. Sinfonie. Von Christoph Vratz.
Osteuropa-Historiker - Karl Schlögel: "Ich verstehe die Ukraine als ein Europa en miniature"
Sowjetunion, Polen, Ukraine: Seit Jahrzehnten analysiert Karl Schlögel die Entwicklungen im Osten - kulturhistorisch und verwoben mit eigenen Erfahrungen. Er warnte früh vor Putins Expansionspolitik und hat sich auch mit dem "Trumpismus" beschäftigt. Adler, Sabine www.deutschlandfunk.de, Zeitzeugen im Gespräch
Drohnen & MIGs / Russland als Besatzungsmacht in Geschichte und Gegenwart
Hybride Kriegsführung und Luftraumverletzungen durch Russland - viel ist während unserer Sommerpause geschehen, weshalb wir mit einem extralangen Militärteil einsteigen.Russland und die Sowjetunion haben eine lange Geschichte als Besatzungsmächte. Was "Besatzung" genau bedeutet, welche Folgen das für die Besetzten hatte und was wir in diese Hinsicht heute sehen, bespricht das Expertenteam des Ostausschusses in seiner ersten regulären Sitzung der neuen Saison.Telegramm-Kanal Zla Mavka (Widerstand in den von RU besetzten Gebieten in der UA): https://t.me/s/zlaya_mavkaVIDEO "Der russische Okkupant" - Youtube untertitelt und übersetzt automatisch, unten rechts aktivieren.Folge "Friedensstaat DDR - Mit Anne Rabe"Buchtipp: Carlo Masala - Wenn Russland gewinnt Ein Szenario.Unterstützen Sie uns einmalig oder regelmäßig hierUnser Schwesterpodcast: Der Hauptausschuss der SalonkolumnistenDie Website der SalonkolumnistenDer Ostausschuss der Salonkolumnisten auf TwitterDas Panel auf Twitter:Dr. Franziska DaviesProf. Jan Claas BehrendsDr. Gustav GresselGabriele WoidelkoDas Moderationsteam:Jan-Philipp HeinRichard VolkmannDavid HarnaschProducer: David HarnaschPostproduction: Chris GruberTitle track vocals: Masha (10, from Odesa)
Zu Geheimdiensten gibt es viele Mythen und Verschwörungen. Thomas Riegler ist Historiker und ein absoluter Geheimdienst-Nerd. Von ihm habe ich mir erklären lassen, wie Geheimdienste wirklich arbeiten. Es ist mehr fader Bürojob als James Bond, aber trotzdem ab und zu ziemlich spektakulär. Wir reden über den Mossad, 9/11, die Atombombe, Jan Marsalek und noch viel mehr. Geheimdienste, erklärt.
Pläne für das neue Quartier am Klybeckquai sorgen für Kritik
Die Bebauungspläne für den Klybeckquai in Basel stossen bei Politikerinnen und Politikern von links bis rechts auf Kritik. Während die einen fehlende Grünflächen beanstanden, fordern andere mehr bezahlbaren Wohnraum. Ausserdem: · Interview mit Politologin Eva Gschwind über 150 Jahre direkte Demokratie in Basel · Basler Musikfestival widmet sich Musik, die während Stalins Herrschaft in der Sowjetunion entstanden ist ·
Geschichtsverfälschung und Demokratiedefizite auf höchster EU-Ebene
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas behauptet in einem Interview, der Sieg der Sowjetunion und Chinas im Zweiten Weltkrieg sei ein falsches „Narrativ“ und erzeugt damit einen diplomatischen Eklat mit China. Auf EU-Ebene fordert sie „qualifizierte Mehrheitsentscheidungen“, beispielsweise bei den Sanktionspaketen, aber auch bei „vielen anderen“ Themen. Vetorecht sei „keine echte Demokratie“. Im „Kampf um Narrative“ solltenWeiterlesen
Die USA gelten als älteste Demokratie der Welt – doch unter Donald Trump fürchten viele den Aufstieg von Oligarchen. Was bedeutet das? Die Geschichte verheißt nichts Gutes: vom antiken Griechenland bis zur Ausbeutung der sterbenden Sowjetunion. Biesler, Jörg
Die Ukraine feiert heute ihren Unabhängigkeitstag. Vor 34 Jahren löste sie sich von der Sowjetunion. Präsident Selenski sprach seinen Landsleuten zum Jahrestag in einer Video-Ansprache Mut zu. Doch die militärische Situation bietet derzeit wenig Grund zum Feiern. Weitere Themen: Bundesrat und Parlament änderten vor drei Jahren die Spielregeln in der Psychotherapie: Ärztinnen und Ärzte können seither eine Therapie anordnen, die bei der Krankenkasse abgerechnet werden kann. Zu Unrecht befürchtete man höhere Kosten. In Europa kämpft der Buchhandel mit sinkenden Auflagen. Anders in der westafrikanischen Elfenbeiküste. Dort wächst die Bevölkerung. Ein Besuch an der Buchmessen in der Hauptstadt Abidjan.
Manche Dinge klingen schier unbegreiflich. Meistens genau so lange, bis sie einem selbst passieren. Wer hat nicht auch schon ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn man in der Zeitung gelesen hat: „Wohnwagenfahrer vergisst Ehefrau an Tankstelle im Rheinland und bemerkt das Ganze erst auf der Fähre in Genua.“ Ein ganz ähnlicher Fauxpas ist nun den beiden Profi-Podcastern Jakob Lundt & Thomas Schmitt unterlaufen. Während die beiden nach der Baywatch Berlin Summer Breeze wieder frisch rasiert im Florida-TV-Gag-Blaumann zum Dienst erschienen sind, ist einfach niemandem aufgefallen, dass Klaas leider nicht rechtzeitig zum Saisonstart aus Italien abgeholt wurde. Klar, ein gewisser Teil der Verantwortung ist auch Klaas anzulasten. Der wiederum kann aber zu seiner Verteidigung vorbringen, dass die Firma „Peroni“ erstmals im Jahr 2025 ein neues Getränk namens „Peroncino” auf den Markt gebracht hat. Das sind etwas kleinere Peroni-Glasflaschen. Die bleiben länger kalt, haben ein schickes Etikett – und wenn etwas erst mal gekauft ist, kann man das ja nicht einfach alles wegschmeißen. Kurzum: Arbeit, Schmarbeit – es kann sich nicht ein Mensch (Klaas) um alle Probleme der Menschheit gleichzeitig kümmern. Die Latenz des Zugeschalteten wird natürlich von den anderen sofort ausgenutzt, indem sie Heufer-Umlauf spüren lassen, dass eine halbe Sekunde Delay in der Podcast-Währung direkt ein Timing-Bankrott bedeuten kann. Um unnötige historische Vergleiche selten verlegen, zitiert Schmitt an dieser Stelle sogar Gorbatschow: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ Ist die Sowjetunion am Ende an einem wackligen Zoom-Call gescheitert und fliegt Putin deshalb und gar nicht für einen geschenkten Porzellanadler als Briefbeschwerer um die halbe Welt? Was man ausserdem in dieser Ausgabe lernen kann: Die Arbeit zur Erhaltung des Planeten und seiner Arten wird gerecht aufgeteilt. Der Sänger der Böhsen Onkelz kümmert sich um den Klimawandel & um den Fortbestand von Bienen. Donald Trump schenkt Selenski eine schicke Mütze aus dem MAGA Gift Shop, damit der nicht immer so traurig guckt. Klaas hat versehentlich eine Art Escort-Ring für italienische Mamas ausgehoben, die einem zwar keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, aber immerhin Frühstück machen, lieb gucken und die Wäsche bügeln. Währenddessen reist Jakob ab sofort Carsten Maschmeyer hinterher, in der Hoffnung von dessen Schulterpolstern noch etwas von Elton Johns St. Tropez Sonnencreme zu kratzen. So hat jeder sein Puzzlestück zum Einsetzen parat und wenn wir alle mal ein paar Meter Abstand nehmen, erkennen wir das sog. große Ganze: eine neue Folge Baywatch Berlin (Alltagsversion) namens: "Plötzlich Papst". Gute Unterhaltung. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/BaywatchBerlin
Luise Meier über ihren Roman 'Hyphen' und kommunistisches Utopisieren. Future Histories LIVE Das Gespräch mit Luise Meier ist Teil des Formats ‚Future Histories LIVE‘. In unregelmäßigen Abständen werden hierbei einzelne Episoden live – soll heißen vor Publikum – aufgezeichnet. Diese Folge Future Histories ist am 3. August 2025 auf Einladung des Hamburger Künstler*innenkollektivs Zollo entstanden. Shownotes Luise Meiers Website: http://www.luisemeier.com/ Meier, L. (erscheint am 30.10.2025). Proletkult vs. Neoliberale Denkpanzer. Matthes & Seitz Berlin. https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/proletkult-vs-neoliberale-denkpanzer.html Meier, L. (2024). Hyphen. Matthes & Seitz Berlin. https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/hyphen.html Meier, L. (2018). MRX Maschine. Matthes & Seitz Berlin. https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/mrx-maschine.html Müller, T. (2024). Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps. Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben. Mandelbaum. https://www.mandelbaum.at/buecher/tadzio-mueller/zwischen-friedlicher-sabotage-und-kollaps/ Eiden-Offe, P. (2017). Die Poesie der Klasse. Romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats. Matthes & Seitz Berlin. https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/die-poesie-der-klasse.html zu Ernst Bloch: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch Mazzini, S. (2012). Kältestrom – Wärmestrom. In: Dietschy, B., Zeilinger, D. & Zimmermann, R. (2012). Bloch-Wörterbuch: Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs. De Gruyter. S.224-231. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110256710.224/html zu „the purpose of a system is what it does” (POSIWID): https://en.wikipedia.org/wiki/The_purpose_of_a_system_is_what_it_does zu Stafford Beer: https://de.wikipedia.org/wiki/Stafford_Beer zu Beers Teich-Computer Experiment: https://www.lesswrong.com/posts/YBbcKg5AeX3tot3cC/cybernetic-dreams-beer-s-pond-brain zu Kybernetik: https://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik https://monoskop.org/Cybernetics zu Alexander Bogdanov: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Alexandrowitsch_Bogdanow https://monoskop.org/Alexander_Bogdanov Völkel, M. (2024). Kybernetik in der Sowjetunion. Ein politisches und gesellschaftliches Modernisierungsprojekt? LIT Verlag. https://lit-verlag.de/isbn/978-3-643-15541-2/ Noorizadeh, B. (2018). After Scarcity. https://vimeo.com/296563987 zum theoretischen und politischen Konflikt zwischen Bogdanov und Lenin: https://jacobin.de/artikel/alexander-bogdanow-revolutionaerer-denker-und-sci-fi-pionier Sochor, Z. A. (1988). Revolution and Culture. The Bogdanov-Lenin Controversy. Cornell University Press. https://monoskop.org/images/6/6f/Sochor_Zenovia_Revolution_and_Culture_The_Bogdanov-Lenin_Controversy.pdf Bogdanov, A. A. (1923). Der rote Stern. Ein utopistischer Roman. Verlag der Jugendinternationale. https://www.gutenberg.org/ebooks/62985 zum “Prolekult“: https://de.wikipedia.org/wiki/Proletkult zu Cybersyn: https://de.wikipedia.org/wiki/Cybersyn https://www.the-santiago-boys.com/ Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende's Chile. MIT Prress. https://direct.mit.edu/books/monograph/2129/Cybernetic-RevolutionariesTechnology-and-Politics zu Salvador Allende: https://de.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende zum Putsch in Chile 1973: https://de.wikipedia.org/wiki/Putsch_in_Chile_1973 zu Victor Turner: https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Turner Turner, V. (2005). Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Campus Verlag. https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/kulturwissenschaften/das_ritual-2418.html zu Thomas Müntzer: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer zu Anatoli Wassiljewitsch Lunatscharski: https://de.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Wassiljewitsch_Lunatscharski zu Maxim Gorki: https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim_Gorki zum „Gotterbauertum“: https://en.wikipedia.org/wiki/God-Building Thematisch angrenzende Folgen S03E44 | Anna Kornbluh on Climate Counteraesthetics https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s03/e44-anna-kornbluh-on-climate-counteraesthetics/ S03E33 | Tadzio Müller zu Solidarischem Preppen im Kollaps https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s03/e33-tadzio-mueller-zu-solidarischem-preppen-im-kollaps/ S03E32 | Jacob Blumenfeld on Climate Barbarism and Managing Decline https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s03/e32-jacob-blumenfeld-on-climate-barbarism-and-managing-decline/ S03E30 | Matt Huber & Kohei Saito on Growth, Progress and Left Imaginaries https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s03/e30-matt-huber-kohei-saito-on-growth-progress-and-left-imaginaries/ S02E26 | Andrea Vetter zu Degrowth und Technologie https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s02/e26-andrea-vetter-zu-degrowth-und-technologie/ S02E25 | Bini Adamczak zu Beziehungsweisen https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s02/e25-bini-adamczak-zu-beziehungsweisen/ S01E16 | Richard Barbrook on Imaginary Futures https://www.futurehistories.today/episoden-blog/s01/e16-richard-barbrook-on-imaginary-futures/ Future Histories Kontakt & Unterstützung Wenn euch Future Histories gefällt, dann erwägt doch bitte eine Unterstützung auf Patreon: https://www.patreon.com/join/FutureHistories Schreibt mir unter: office@futurehistories.today Diskutiert mit mir auf Twitter (#FutureHistories): https://twitter.com/FutureHpodcast auf Bluesky: https://bsky.app/profile/futurehistories.bsky.social auf Instagram: https://www.instagram.com/futurehpodcast/ auf Mastodon: https://mstdn.social/@FutureHistories Webseite mit allen Folgen: www.futurehistories.today English webpage: https://futurehistories-international.com Episode Keywords #LuiseMeier, #JanGroos, #FutureHistories, #Podcast, #Klimakrise, #Sozial-ökologischeTransformation, #Klimabewegung, #Kapitalismus, #Gesellschaft, #PolitischeImaginationen, #Zukunft, #Utopie, #Solidarität, #Literatur, #Kybernetik, #StaffordBeer, #Cybersyn, #AlexanderBogdanov, #ErnstBloch, #Marxismus, #Klimakollaps, #Kollaps
Dimitri Schostakowitsch: 5. Sinfonie - erzwungener Jubel?
Die Partei hat ihre Ohren überall: Schostakowitsch steht unter parteipolitischer Beobachtung. Stalin gefällt seine „chaotische“ Musik nicht. Also verpackt der Komponist seinen Widerstand in „ordentlichere“ Töne ... Von Christoph Vratz.
Wladimir Putin ist, mit einer kurzen Unterbrechung, seit 25 Jahren in Russland an der Macht. In dieser Zeit hat er einen Staat, der sich nach Ende der Sowjetunion auf dem Weg in die Demokratie befunden hat, in ein nationalistisches Reich umgebaut. Doch warum hat sich Russland zu dem Land entwickelt, das heute Krieg gegen die Ukraine führt und den Westen mit hybriden Angriffen unter Druck setzt? Michael Thumann ist Autor, leitet das Moskauer Büro der "Zeit" und hat schon in den 90er Jahren in der russischen Hauptstadt gelebt. Dort hat er auch schon Putin interviewt. Wir sprechen heute darüber, warum sich Russland in rund 25 Jahren so gewandelt hat und wie Putin eines der gefährlichsten Regime der Welt aufbauen konnte. **Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?** Mit einem STANDARD-Abonnement können Sie unsere Arbeit unterstützen und mithelfen, Journalismus mit Haltung auch in Zukunft sicherzustellen. Alle Infos und Angebote gibt es hier: [abo.derstandard.at](https://abo.derstandard.at/?ref=Podcast&utm_source=derstandard&utm_medium=podcast&utm_campaign=podcast&utm_content=podcast)
Kalter Krieg - Eisenhower startet "Space Race"
Das Kräftemessen zwischen den USA und der Sowjetunion geht weit über das Wettrüsten hinaus. US-Präsident Eisenhower will das Rennen um die Vorherrschaft im All gewinnen. Aber 1957 hat die Sowjetunion die Nase vorn.**********Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":00:11:29 - Paul-Henri Campbell hat sich mit dem Space Race literarisch beschäftigt.00:18:42 - Eugen Reichl zeichnet den Weg vom Sputnik-Schock bis zur erfolgreichen Mondlandung nach.00:28:59 - Thomas Reiter erklärt den Wert der Raumfahrt für das Leben auf der Erde.00:39:05 - Matthias von Hellfeld blickt auf den Beginn des Wettlaufs um die Vorherrschaft im All.**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Polarforschung im Kalten Krieg: Wissenschaftsaustausch in der AntarktisKalter Krieg: Ende des Koreakrieges 1953Kalter Krieg: Vorläufer hybrider Konflikte**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: TikTok und Instagram .**********In dieser Folge mit: Moderator: Markus Dichmann Gesprächspartner: Matthias von Hellfeld, Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte
Im Herbst 1962 stationiert die Sowjetunion auf Kuba heimlich Atomraketen. Als US-Präsident John F. Kennedy durch Überwachungsfotos davon erfährt, stellt er Moskau ein Ultimatum und droht mit Vergeltung. Es beginnen die gefährlichsten Wochen des Kalten Krieges. Dies ist der zweite Teil jenes Dramas, das die Welt an den Rand des Abgrunds brachte: die Kubakrise.Host und Redaktion: Insa Bethke/GEO EPOCHE Gast: Andreas SedlmairSprecher: Peter KaempfeProduktion: Lia Wittfeld/Audio Alliance+++ Alle Rabattcodes und Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier: https://linktr.ee/geoepoche ++++++ Auf RTL+ und GEO EPOCHE+ erscheinen die neuen Folgen von "Verbrechen der Vergangenheit" jeweils 14 Tage früher als auf den anderen Plattformen. +++ Sie möchten uns schreiben? Wir freuen uns über Feedback per Mail anverbrechendervergangenheit@geo.deSIE MÖCHTEN MEHR VON GEO EPOCHE HÖREN UND LESEN?"Deutschland 1945": Unter www.geo.de/1945 finden Sie alle acht Folgen sowie ein vergünstigtes Abo für das Verbrechen der Vergangenheit-Special über das Kriegsende vor 80 Jahren.Folgen Sie GEO Epoche gern auf Social Media, bei Instagram (@geo_epoche) und Facebook (@geoepoche) +++AKTION: Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können unterwww.geo-epoche.de/podcast kostenlos ein eBook aus unserem Heft "Verbrechen der Vergangenheit" herunterladen.Außerdem können Sie unter www.geo-epoche.de einen Monat lang GEO EPOCHE + kostenlos testen - mit fast 3000 Artikeln zu allen Aspekten der Weltgeschichte sowie weiteren Audio-Inhalten.Weitere historische Reportagen mit Peter Kaempfe bietet der GEO EPOCHE-Podcast"Menschen, die Geschichte machten" - jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
ATOMBOMBE - Bauen mit der Vernichtungswaffe
Atombomben zünden im eigenen Land? Speicherseen aus der Erde sprengen mit nuklearen Sprengköpfen, ganze Bergketten pulverisieren für eine Autobahn? Oder gleich einen Durchbruch vom Atlantik zum Pazifischen Ozean mit einigen Nuklearexplosionen graben - und dafür Millionen Menschen umsiedeln? Klingt absurd. Und doch gab es in der Zeit des Kalten Krieges in den USA und der Sowjetunion ernstzunehmende Projekte dazu. Von Markus Mähner (BR 2025)
WIE WAR DAS DAMALS? Als die Atombombe in die Welt kam
Vor 80 Jahren, am 16. Juli 1945, beginnt mit dem Trinity-Test in der Wüste New Mexikos das Atomzeitalter. Mit der ersten nuklearen Explosion erlangt die Menschheit an diesem Tag die Fähigkeit, sich selbst zu vernichten. Die grausamen Einsätze der Atombombe im August 1945 über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki haben die Nukleartechnik mit dem gewaltsamen Tod von hunderttausenden Menschen in Verbindung gebracht. Seither wurde keine Atomwaffe mehr in einem Konflikt eingesetzt, obwohl seit dem Ende der 40er Jahre ein atomares Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion einsetzte. Die technische Entwicklung von thermonuklearen Bomben hat dazu die Fähigkeit gebracht, die Menschheit gleich mehrere Male zu vernichten.
Im Herbst 1962 stationiert die Sowjetunion auf Kuba heimlich Atomraketen. Als US-Präsident John F. Kennedy durch Überwachungsfotos davon erfährt, stellt er Moskau ein Ultimatum und droht mit Vergeltung. Es beginnen die gefährlichsten Wochen des Kalten Krieges. Dies ist der erste Teil jenes Dramas, das die Welt an den Rand des Abgrunds brachte: die Kubakrise.Host und Redaktion: Insa Bethke/GEO EPOCHE Gast: Andreas SedlmairSprecher: Peter KaempfeProduktion: Lia Wittfeld/Audio Alliance+++ Alle Rabattcodes und Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier: https://linktr.ee/geoepoche ++++++ Auf RTL+ und GEO EPOCHE+ erscheinen die neuen Folgen von "Verbrechen der Vergangenheit" jeweils 14 Tage früher als auf den anderen Plattformen. +++ Sie möchten uns schreiben? Wir freuen uns über Feedback per Mail anverbrechendervergangenheit@geo.deSIE MÖCHTEN MEHR VON GEO EPOCHE HÖREN UND LESEN?"Deutschland 1945": Unter www.geo.de/1945 finden Sie alle acht Folgen sowie ein vergünstigtes Abo für das Verbrechen der Vergangenheit-Special über das Kriegsende vor 80 Jahren.Folgen Sie GEO Epoche gern auf Social Media, bei Instagram (@geo_epoche) und Facebook (@geoepoche) +++AKTION: Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können unterwww.geo-epoche.de/podcast kostenlos ein eBook aus unserem Heft "Verbrechen der Vergangenheit" herunterladen.Außerdem können Sie unter www.geo-epoche.de einen Monat lang GEO EPOCHE + kostenlos testen - mit fast 3000 Artikeln zu allen Aspekten der Weltgeschichte sowie weiteren Audio-Inhalten.Weitere historische Reportagen mit Peter Kaempfe bietet der GEO EPOCHE-Podcast"Menschen, die Geschichte machten" - jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
WESTDEUTSCHLAND NACH 1945 - Wie die Sieger sich zerstritten
Der Zweite Weltkrieg war kaum vorbei, NS-Deutschland und Japan hatten kapituliert, da erkannten die Westalliierten und die Sowjetunion, dass sie keinen Draht mehr zueinander fanden. Das Ergebnis war der Auftakt zum "Kalten Krieg". Von Rainer Volk (BR 2007)
Bauen mit Atombomben - Zivile Projekte während des Kalten Krieges
Atombomben zünden im eigenen Land? Ganze Bergketten pulverisieren für eine Autobahn? Oder gleich einen Durchbruch vom Atlantik zum Pazifischen Ozean mit einigen Nuklearexplosionen graben und dafür Millionen Menschen umsiedeln? Klingt absurd. Und doch gab es in der Zeit des Kalten Krieges in der Sowjetunion und den USA ernstzunehmende Überlegungen dazu. Autor: Markus Mähner (BR 2025)
09.05.2025 – Langsam Gesprochene Nachrichten
Langsam gesprochene Nachrichten | Deutsch lernen | Deutsche Welle
09.05.2025 – Langsam Gesprochene Nachrichten – Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der DW von Freitag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.