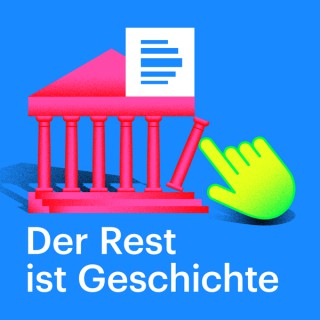Podcasts about diktatur
- 923PODCASTS
- 1,897EPISODES
- 40mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Feb 23, 2026LATEST
POPULARITY
Categories
Best podcasts about diktatur
Latest news about diktatur
- Die kurdische Frage und die nationale Frage: Nationalstaat oder Staatsbürgerschaftsstaat? libcom.org - Feb 20, 2026
- Propylaeum-DOK: Digital Repository: Ancient History AWOL - The Ancient World Online - Dec 26, 2025
- What Happened When Hitler Took On Germany’s Central Banker The Atlantic - Jul 25, 2025
- Bildungsmythen in der langen Geschichte der DDR Fonts In Use - Jul 2, 2024
Latest podcast episodes about diktatur
Woop! Woop! Heute spreche ich mit Nils C. Kumkar über "Polarisierung" (Suhrkamp) der Gesellschaft und wie wichtig das vielleicht doch für Politik ist. Mit Patrick Kaczmarczyk geht es um den "Zerfall der Weltordnung" (Westend) und ein bisschen ist es auch eine Selbsthilfegruppe für die aktuelle politische Lage. Enjoy!^^
Milena Preradovic (x.com/punktpreradovic) und Paul Brandenburg (x.com/docbrandenburg) über X-Akten statt Epstein-Akten, US-Aufmarsch im Iran, Trumps Friedensrat, Merz' Scheitern in München, das US-Portal freedom.gov, Ex-Prinz Andrew in Haft, einen lupenreinen Faschisten als Sprecher des Außenamtes, die Inszenierung von Korruptionsvorwürfen gegen die „AfD", KI-Lügen in den „Nachrichten" des Staatsfunks, Umvolkung über den Wehrdienst (Erstveröffentlichung: 21.02.2026).Inhalt:0:00 Intro und Spendenaufruf1:24 Trump gibt Alien-Akten frei3:17 US-Truppenaufmarsch gegen Iran7:34 Trumps Friedensrat für Gaza13:34 Generalinspektor Freuding und deutsche Aufrüstung15:15 Marco Rubio auf Münchner Sicherheitskonferenz22:00 Ende der Anonymität im Netz und Freedom.gov30:00 Epstein-Skandal und Prinz Andrew37:17 AfD-Sanktionen und Zensur in Deutschland49:23 ZDF-Fake-News mit KI-generierten Videos55:24 Migration als Militärpersonal und Großinsolvenzen1:03:37 Schlusswort und Aufruf zum WiderstandBecome a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/nacktes-niveau--5136972/support.
Demokratie: top, Diktatur: flop. Da sind sich die allermeisten Menschen in Deutschland einig. Trotzdem sagen viele: „Ein starker Anführer? Why not!" Das zeigt der aktuelle Deutschland-Monitor.
Jeder fünfte liebäugelt mit autoritären Ideen, ergibt eine umfassende Studie +++ Bei den Olympischen Winterspielen geht heute eine neue Sportart an den Start
Jetzt kommt die Zensur: Der Fahrplan in die Diktatur | Lage der Nation mit Roland Tichy
Unser Sponsor für diese Sendung ist die RealUnit Schweiz AG RealUnit Schweiz AG – Vermögensschutz und langfristiger Werterhalt mit einer bewährten Sachwertstrategie. Schützen Sie Ihre Ersparnisse und profitieren Sie jetzt von der Sonderaktion bis zum 26.2.26. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung können Sie bei Ihrer Bank neue Aktien zum Vorzugspreis und gebührenfrei zeichnen. Informationen finden Sie auf www.realunit.de Wenn Ihnen unser Video gefallen hat: Unterstützen Sie diese Form des Journalismus: https://www.tichyseinblick.de/unterstuetzen-sie-uns Das aktuelle Magazin finden Sie am Kiosk oder hier: https://live.tichyseinblick.shop/produkt/te-0326-unsere-besten/ Deutschland und Europa droht eine neue Ära der Zensur. Mit dem Digital Services Act (DSA), dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz, dem sogenannten Demokratie-Schutzschild sowie einer Chatkontrolle wird die Meinungsfreiheit der Bürger empfindlich beschnitten. Offiziell geht es um den Schutz von Kindern und der Demokratie – im Endergebnis wird ein totalitäres Regime der Zensur eingeführt. Roland Tichy erklärt in der Lage der Nation, wie dieser Prozess vor sich geht. Entscheidend sind dabei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, CDU-Chef Friedrich Merz sowie Institutionen wie die Bundesnetzagentur, das Bundeskriminalamt und die Landesmedienanstalten; diese Bundeseinrichtungen werden nach und nach zu Werkzeugen zur Sichtung, Kontrolle und Bestrafung aller regierungskritischen Äußerungen ausgebaut. Webseite: https://www.tichyseinblick.de Newsletter: https://www.tichyseinblick.de/newsletter/anmeldung/
Heide Sommer war Sekretärin von Theo Sommer, von Helmut Schmidt und Rudolf Augstein. Eine Vertrauensfrau für berühmte Männer. Über sich selbst sagt sie: "Ich bin die geniale Zweite". Interview: Stefanie Junker.
Medien, Moral und Maßstäbe: Warum Venezuela anders bewertet wird (Serie zu Venezuela, Teil 5)
Wenn deutsche Leitmedien über Venezuela berichten, geschieht dies seit Jahren mit einer auffälligen sprachlichen und moralischen Eindeutigkeit. Begriffe wie „Diktatur“, „Regime“ oder „Failed State“ strukturieren die Berichterstattung und prägen nachhaltig die Wahrnehmung politischer, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Sie erscheinen dabei weniger als erklärungsbedürftige Zuschreibungen denn als feststehende Deutungen, die kaum noch erläutert oder hinterfragt werden.Weiterlesen
Om socialistisk diktatur, moderat uppror, Wuthering Heights — nu med kroppsvätskor och åtalade aktivister.
Vi har besökt Stellenberg Gardens, kanske en av världens finaste privatträdgårdar. Dessutom blev vi guidade av ägarinnan. Det, ni! I en fin bokhandel, The Book Lounge, hittade Johan Asterixalbum. Susanna har istället läst om Karen Blixens Mitt Afrika, utgiven i Palmserien av Lind & Co. Tillsammans såg vi också om filmen. den håller förvånansvärt bra. Nya Wuthering Heightsfilmen av Saltburnregissören Emerald Fennell blir sågad överallt. Den ska vara riktigt kåtkladdig — stackars Emily Brontë — men kanske måste man se den ändå. Moderaten Sven Gustafsson i Haninge varnar väljarna för den socialistiska diktaturen. Men Reformisterna — Annie Ross, Linn Svansbo, Daniel Suhonen, Markus Kallifatides oc de andra — som väl i så fall måste vara socialismens avant-garde, är mest intresserade av de vanliga gamla skattehöjningarna. Bra artikel om dem i Svenskan av Jenny Nyman. Telegraph creddar regeringen för att ha fått grepp påp brottsligheten. Och nu leder utvisningsmissnöjet till osämja i Moderaterna också. Är det gamla enskilda flyktingöde-reportaget på väg tillbaka, lagom till valrörelsen? Ulf Lundell slutar föra dagbok. Spotify börjar trycka böcker (ljudböcker på papper?). Simona Mohamsson söker uppmärksamhet och nu verkar vi faktiskt ett steg närmare Halldorf-Heberlein-partiet, som Johan förutspådde förra veckan. Vad ska Rubio säga i München? Starmer sitter löst, brittiska Vogue publicerar en lång intervju med den imponerande Gisèle Pelicot och Karl-Oskar Bohlins förföljare blir åtalade. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Die Debatte mit Lukasz Tomaszewski, Carolina Chimoy und Nell Zink "Das Musterland der Demokratie sehen wir so schnell nicht wieder." (Carolina Chimoy) Ein Jahr nach dem Amtsantritt von Donald Trump II kommt es zum ersten Aufbegehren der Zivilgesellschaft und der Kulturwelt gegen den immer autokratischer regierenden US-Präsidenten. Manche Beobachter sprechen jetzt von einem Wendepunkt. Spätestens seit den tödlichen Schüssen in Minneapolis scheint sich etwas gelöst zu haben: Zunächst demonstrierten Tausende auf den Straßen der Stadt, dann in über 40 Bundesstaaten und jetzt meldet sich auch die Kultur zu Wort. Auf den ganz großen Bühnen: Zuletzt in Person von Latin-Superstar Bad Bunny bei der Superbowl Halftime Show. Host Lukasz Tomaszewski spricht mit der Journalistin Carolina Chimoy und der Schriftstellerin Nell Zink über staatliche Repressionen und die zunehmende Angst im Land. Und über die ersten, die dagegen aufbegehren. Kapitel: 00:00:00 Intro/ Der erste Gedanke 00:03:43 Trump-Gegner Bad Bunny 00:12:42 Protesthymne von Bruce Springsteen 00:15:30 Repressionen und Angst im Land of the Free 00:26:20 Young Republicans und Dumpinglöhne 00:30:29 Alptraum für Migranten 00:35:23 Checks and Balances verloren? 00:42:06 Protestformen 00:44:57 Wendepunkt 00:47:38 Der zweite Gedanke Mehr Infos und Fotos s. https://www.radiodrei.de/derzweitegedanke Schreiben Sie uns gern direkt an derzweitegedanke@radiodrei.de
Arm und diktatorisch regiert, steht Nicaragua selten im Zentrum der Auseinandersetzungen um die Zukunft Lateinamerikas. Unter dem einstigen Guerillaführer Daniel Ortega ist das Land wieder zur Diktatur geworden. Dora Maria Téllez, früher prominente Guerillakämpferin und Gesundheitsministerin, fordert im Bruno Kreisky Forum zur Solidarität mit politischen Gefangenen und Opfern der Repression auf und findet harte Worte für ihre ehemaligen Genossen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
„Unsere Demokratie“ wird zur autoritären Waffe | Von Janine Beicht
Der besitzanzeigende Betrug: Wie „unsere Demokratie“ zur autoritären Waffe der Macht wirdManchmal reicht ein Wort, um echte Auseinandersetzung zu verhindern. Hinter lauten Appellen versteckt sich oft ein System, das Freiheit nur vortäuscht und Mitbestimmung nur simuliert.Ein Kommentar von Janine Beicht. In den Reden der politischen Klasse Deutschlands taucht eine bestimmte Formulierung mit einer mantraartigen Hartnäckigkeit auf, die jeden, der noch zuhört, sofort alarmieren muss. Die „Unsere Demokratie“ wird so feierlich beschworen, als wäre sie ein unantastbares Heiligtum, das man gegen jede Berührung schützt. Sie zieht eine scharfe Grenze zwischen dem erwünschten Wir und dem unerwünschten Ihr, verwandelt eine offene Ordnung in das Privateigentum derer, die gerade an den Hebeln sitzen. Der Begriff „unsere Demokratie“ gehört zu den gefährlichsten politischen Formeln der Gegenwart, nicht weil er offen autoritär klingt, sondern weil er sich als Selbstverständlichkeit tarnt. Er schiebt sich weich und unauffällig in Reden, Leitartikel und Verlautbarungen, während er im Kern eine fundamentale Verrückung vornimmt. Wer diesen Ausdruck heute hört, darf ihn nicht länger als harmlose Redewendung abtun. Er ist ein Warnsignal, ein schleichendes Gift, dessen Wurzeln tief in einer Diktatur liegen, die viele nur zu gerne für überwunden erklären. Die historische Last: „Unsere Demokratie“ in der DDRHistorisch ist diese Denkfigur vorbelastet und zugleich verdrängt: Systeme, die sich selbst als demokratisch bezeichneten, haben oft genau nach diesem Muster funktioniert. Der Begriff klingt für viele zunächst warm und verbindend, wie ein Ausdruck geteilter Identität und gemeinsamer Werte, so als sei jeder eingeschlossen, jeder dürfe mitmachen, alles folge einem fairen, offenen Prozess. Er vermittelt Vertrautheit, fast Beruhigung und natürlich könnte niemand ernsthaft etwas dagegen haben. Genau diese scheinbare Unschuld macht ihn so tückisch. Aber: Er ist kein neutrales Wort für eine Regierungsform, sondern ein politisches Werkzeug, das schon früher autoritäre Strukturen kaschierte und Kritiker von vornherein als illegitim brandmarkte. Die Geschichte hat gezeigt, wie dieser Begriff ein System als alternativlos darstellte, und genau diese Logik wirkt bis heute fort, nur in neuem Gewand.In der Deutschen Demokratischen Republik war „unsere Demokratie“ eine der zentralen Parolen, mit der das Regime seine Herrschaft bestätigte, wie Dr. Stefan Weber auf seinem Blog „Plagiatsgutachten“ aufzeigt. (1) Dort schreibt er:„Die Pointe ist nun, dass ich denke, mit ziemlicher Sicherheit zeigen zu können, dass es sich um eine Kampfvokabel der DDR handelte, die unter anderem von Erich Honecker verwendet wurde. Zunächst weist der Google Books Ngram Viewer (2) darauf hin, dass der Begriff fast passgenau im Zeitraum des Bestehens der DDR – zwischen 1949 und 1990 – am häufigsten auftrat. Ein Kapitel „Unsere Demokratie“ findet sich in der Biografie „Aus meinem Leben“ (3) von Erich Honecker aus dem Jahr 1980.“ Dr. Stefan Weber (1)Es ging auch in der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik nie um ein offenes, lebendiges Verfahren, das Konkurrenz der Ideen, offene Kritik und regelmäßigen Machtwechsel ermöglichte und förderte. Der Begriff stand für ein starres, abgeschlossenes System, das sich selbst als endgültig und vollendet betrachtete. Jede Beanstandung wurde nicht als notwendiger Bestandteil einer lebendigen Gesellschaft gesehen, sondern als direkter Angriff auf das Ganze. Wer widersprach, stand sofort außerhalb des zugelassenen Rahmens und wurde ausgegrenzt oder verfolgt. So entstand eine Atmosphäre, in der echte Auseinandersetzung erstickt wurde und die Macht der Herrschenden unangetastet blieb. ...https://apolut.net/unsere-demokratie-wird-zur-autoritaren-waffe/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lasen den [sechsten Bericht](https://www.ipcc.ch) des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. In Folge 163 geht es um Kinder und Jugendliche. Sie sind die, die in Zukunft am meisten unter der Klimakrise zu leiden haben. Aber in der Forschung dazu kommen sie kaum vor. Was wir über das Wissen der jungen Menschen, ihre Ängste und Vorstellungen herausgefunden haben, diskutieren wir in der neuen Folge von “Das Klima”. Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.
Ece Temelkuran - "Ich habe gelernt, mir meine Heimat aus Menschen zu erschaffen"
Nach dem Putschversuch 2016 hat Autorin Ece Temelkuran ihre Heimat Türkei verlassen. Ihre Warnungen, wie schnell eine Demokratie zur Diktatur werden kann, wurden ignoriert. Ihr neues Buch handelt von dem Gefühl, ein neues Zuhause aufzubauen. Rabhansl, Christian www.deutschlandfunkkultur.de, Lesart
Ece Temelkuran - "Ich habe gelernt, mir meine Heimat aus Menschen zu erschaffen"
Nach dem Putschversuch 2016 hat Autorin Ece Temelkuran ihre Heimat Türkei verlassen. Ihre Warnungen, wie schnell eine Demokratie zur Diktatur werden kann, wurden ignoriert. Ihr neues Buch handelt von dem Gefühl, ein neues Zuhause aufzubauen. Rabhansl, Christian www.deutschlandfunkkultur.de, Lesart
Ece Temelkuran - "Ich habe gelernt, mir meine Heimat aus Menschen zu erschaffen"
Lesart - das Literaturmagazin (ganze Sendung) - Deutschlandfunk Kultur
Nach dem Putschversuch 2016 hat Autorin Ece Temelkuran ihre Heimat Türkei verlassen. Ihre Warnungen, wie schnell eine Demokratie zur Diktatur werden kann, wurden ignoriert. Ihr neues Buch handelt von dem Gefühl, ein neues Zuhause aufzubauen. Rabhansl, Christian www.deutschlandfunkkultur.de, Lesart
Folge 153 - Papa Doc und Baby Doc - die Duvalier-Diktatur
Weitere spannende Geschichten findet ihr in der aktuellen Ausgabe 02.2026 von DAMALS - Das Magazin für Geschichte.Folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und in den Sozialen Medien:Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/podcast/id1526985154Spotify: https://spoti.fi/2Ek5jIhFacebook: https://www.facebook.com/damalspodcast/Twitter: https://twitter.com/damalspodcastInstagram: https://www.instagram.com/damalsundheute_podcast/ Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Grönland als Machtbasis für Eliten und KI | Von Claudia Töpper
Warum Trumps Interesse an Grönland weder auf Rohstoffe noch auf die Nähe zu Russland zurückzuführen ist.Ein Kommentar von Claudia Töpper.Grönlands Eis dient als Schutz vor AufständenIn einem Interview, das vor vier Tagen auf YouTube erschien, nannte der Wirtschaftsexperte, Ernst Wolff interessante Hintergründe zu den geplanten Eroberungen der USA. (1) Wörtlich sagte er:„[…] Aber Grönland hat meiner Meinung nach auch einen Hintergrund, von dem überhaupt nicht geredet wird. Also in Grönland haben in den letzten Jahren investiert die ganz Großen in dem IT-Bereich. Also das sind Peter Thiel [Mitbegründer von PayPal und Palantir] hat da investiert, Bill Gates hat da investiert und Herr Andreessen [Mitbegründer von Netscape] und Larry Ellison [Gründer von Oracle] und all die Großen haben da investiert und das ist für die ganz interessant – Grönland – und zwar aus mehreren Gründen. Also diese leben ja alle von dem Fortschreiten der KI. KI ist ja im Moment die wichtigste Technologie, die entwickelt wird und KI braucht unglaublich viel Datenzentren. Nun baut man diese Datenzentren überall auf der Erde. Diese Datenzentren brauchen eine große Kühlung. Wo ist es am kühlsten? In der Antarktis. Und wo wären diese Datenzentren auch am sichersten gegenüber Sabotageakten und gegenüber der Gesamtbevölkerung der Welt? Auch in der Antarktis. Weil, da käme kein Mensch mehr hin, um da Sabotage zu verüben. Das wäre also eine abgeschlossene Welt für sich, wo die Datenzentren in Hülle und Fülle hinstellen könnten und die digitale Diktatur der Welt weiter vorbereiten könnten. Interessant ist, wer hat Donald Trump die Idee gegeben, überhaupt die Eingliederung Grönlands in das US-Staatsgebiet mal zu verlangen oder überhaupt zu beabsichtigen? Das war ein Mann namens Ronald Lauder. Mit [ihm] hat Donald Trump zusammen studiert. Ronald Lauder ist der Erbe des Estée Lauder Kosmetikkonzerns, also ein mehrfacher Milliardär. Und der Mann hat ihn auf die Idee gebracht, hat selber da auch schon investiert und jetzt kommt der Brückenschlag zum Nahen Osten, Ronald Lauder ist niemand anderes als der Chef und der Präsident des jüdischen Weltkongresses.“ (2)Des Weiteren ist für Donald Trump an Grönland noch folgendes interessant. „[…] Er [Trump] wird aus dem Hintergrund gedrängt von den Leuten, denen er ja dient. Also er ist ja nichts anderes als die Marionette der Großen im Silicon Valley. Also man weiß ja auch seine Adjutanten. Also sein Vizepräsident, J.D. Vance ist von Peter Thiel gefördert worden. Sein Außenminister, Marco Rubio ist von Larry Ellison gefördert worden. Die beide[n] sind von ihren Förderern zu Senatoren, einmal in Ohio und einmal in Florida gemacht worden, bevor sie den Sprung in die Regierung dann geschafft haben. Also es ist diese Fraktion da aus dem Silicon Valley, die Donald Trump in diese Richtung [Erpressung Grönlands und Dänemarks] drängen. Und die haben vor, da in Grönland tatsächlich etwas Besonderes zu errichten, nämlich das, was sie die Freedom City nennen. Das ist so eine Art Sonderwirtschaftszone. Da wird es keine Steuern geben, da wird es auch keine Regierung geben, da wird es auch keine Wahlen geben. Da werden die Konzerne selber herrschen. Das ist so das Idealbild dessen, wie sich vor allem Peter Thiel die Zukunft vorstellt.“ (3)Grüne Energie ist am EndeDass die KI die Technologie ist, auf die alle Konzerne ihre Zukunft aufbauen und ihren Blick richten, zeigen auch die Äußerungen, die auf dem WEF (World Economic Forum / Weltwirtschaftsforum), das letzte Woche in Davos stattfand, getätigt wurden. Hier erklärte der neue WEF-Chef und CEO von BlackRock (mit 4 Billionen US-Dollar der größte Vermögensverwalter), Larry Fink die deutsche Energiewende offenbar für beendet. Laut des Journalisten und Moderators, Robert Stein, erklärte Larry Fink in seiner Rede auf dem WEF, dass Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Sprachmaschinen, Diktaturen und Erinnerungskultur
Woop! Woop! In der heutigen Folge nehme ich euch mit auf eine literarische Reise durch drei völlig unterschiedliche Werke.
Digitaler Euro: Totale Kontrolle auch OHNE Programmierbarkeit?
Rechtlicher Hinweis: Nichts in diesem Video stellt eine Anlageberatung, Steuerberatung oder finanzielle Empfehlung dar. Die besprochenen Szenarien basieren auf einer Interpretation biblischer Texte und stellen keine Prognose für Finanzmärkte dar. _______________________________________________________ Der digitale Euro kommt: Die EU-Kommission plant die Einführung bis 2029. Während Ökonomen über Effizienz streiten und Bürgerrechtler vor dem „gläsernen Kunden" (oder Bürger) warnen, stellt sich für Bibelleser eine viel tiefere Frage: Bereitet diese Technologie den Weg für die Szenarien aus Offenbarung 13 vor? In diesem Video erklären wir, was ein digitaler Euro ist und was die EZB plant. Während viele Beobachter vor allem besorgt sind, der digitale Euro könnte „programmierbar" sein, argumentieren wir, dass das eigentliche Problem ein viel subtileres ist ... Die Kernthemen dieses Videos: Zeitplan: Was passiert 2026, 2027 und 2029? Programmierbarkeit vs. Struktur: Warum nicht nur das „programmierbare Geld" die Gefahr ist, sondern die Kombination mit zwei anderen Mitteln, nämlich der digitalen ID und der Abschaffung des Bargelds. Offenbarung 13: Warum Europa auf eine Diktatur zusteuert und wie das „Kaufen und Verkaufen" in einer bargeldlosen Gesellschaft kontrolliert werden kann. Der Fluchtweg: Warum das Ende des Bargelds die letzte „Fluchttür" schließen könnte. Unsere Hoffnung: Warum wir als Christen keine Angst haben müssen und was das „Endspiel" für uns bedeutet. Es geht nicht um Anlageberatung oder politische Mobilisierung, sondern um die Einordnung der Zeitzeichen und die Ermutigung, fest auf dem prophetischen Wort zu stehen. Weiterführende Links & Playlists: Mehr zur Offenbarung (Playlist) Das nächste Ereignis: Die Entrückung (Playlist): Warum wir als Christen nicht durch die große Trübsal gehen und was die Bibel über die Entrückung lehrt
Fußball unter Zwang - Die Ausbeutung ausländ. Spieler während der NS-Diktatur
Blaschke, Ronny www.deutschlandfunkkultur.de, Nachspiel. Feature
260122PC Fernweh Mensch Mahler am 22.01.2026Ich gehe jedes Jahr hin. Auf die CMT, das ist die größte Messe für Camping und Touristik der Welt. Und sie ist vor unserer Haustüre, auf der Messe Stuttgart. Ich genieße das: Messestände von Reiseveranstaltern, ferne Länder, nahe Ziele in der Umgebung. Was habe ich mitgenommen? Endlich mal Hurtigruten, von Hamburg bis zum Nordkap. Eine Tour durchs Baltikum, mit Kanu, Rad und zu Fuß. Eine Radwanderreise an der Loire, Königsschlösser, Fluss und wunderschöne Radwege. Eine Genuss- und Weinreise in Katalonien. Nächstes Jahr – zur goldenen Hochzeit – soll es die letzte große Flugreise sein – trotz Flugscham. Namibia und Südafrika. Auch, um dem Trubel zu entfliehen, den solch ein großes Ereignis mit sich bringt. Nur uns Beide zu feiern. Also: Wir reisen gerne und viel. Wir gönnen uns das und wissen doch, dass wir Privilegierte sind. Rentner, die nicht jeden Pfennig umdrehen müssen und zu der Generation gehören, die es sich noch leisten kann, weil sie noch gut aufgestellt sind. Natürlich fragen wir uns, wie es unseren Kindern und Enkeln einmal gehen wird, wenn sie so alt sind wie wir. Apropos alte Leute: die sind reichlich vertreten. Scharen sich um die riesigen Wohnmobile, die Pick-up-Trucks, die immer gigantischer werden. Was fällt sonst noch auf? Der Trend geht weg von Klassikern wie Spanien und Italien, Griechenland und den Kanaren. Gefragt sind zum Beispiel das Baltikum und der Balkan. Neues entdecken nach zig Jahren Gardasee und Adria. Ein weiterer Trend: Studienreisen Treckingtouren und Kultur. Erschreckend. Die Stände der USA – gähnend leer. Da will keiner hin, weil einer eine ausgrenzende Politik macht. Und ja: Länder, in denen Autokraten herrschen und es Diktatur gibt, mag ich nicht bereisen. Die Türkei gehört dazu, natürlich die USA oder auch Israel. Schade um wunderbare Menschen und wunderschöne Reiseziele. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Kabeldiebe verzögern Fertigstellung einesKindergartens in Pfungstadt, 80 Jahre freie Wahlen - auch in Südhessen
Auf der Baustelle des neuen Kindergartens Regenbogen in Pfungstadt hat ein Kabeldiebstahl für große Schäden und Verzögerungen gesorgt. Unbekannte Täter haben Stromkabel aus dem fast fertigen Neubau gestohlen. Dabei wurden große Teile der elektrischen Anlage zerstört. Außerdem: Am 20.01.1946 fanden die ersten freien Wahlen in Hessen nach der Diktatur statt - auch bei uns in Südhessen. Und: Endspurt: Bewerbungsfrist für Kultursommer 2026 läuft am Wochenende aus.
Experten für Geopolitik gehen davon aus, dass die Rivalität zwischen China und den USA eine der gefährlichsten Konstellationen des 21. Jahrhunderts ist. Der langjährige Peking-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Kai Strittmatter, hat mehrere Bücher über die Situation in dem Land geschrieben. Besonders viel Aufmerksamkeit hat „Die Neuerfindung der Diktatur” auf sich gezogen – eine Beschreibung des Überwachungsstaates in China. Beim Humanities Festival des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) im vergangenen Herbst hat Podcast-Host Raimund Löw mit Strittmatter über den Aufstieg Chinas und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gesprochen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Historische Aufarbeitung, künstlerisches Interesse oder als Propagandamittel – es gab und gibt sehr unterschiedliche Gründe, sich mit dem Bauernkrieg der Jahre 1525 und 1526 zu beschäftigen. In der Gastspielausstellung des Salzburg Museum, „Heroisch und verklärt – der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur“ wird ein Teil der vielfältigen Rezeptionsgeschichte präsentiert. In dieser Folge stelle ich Ihnen ein paar der in der Ausstellung gezeigten Werke und ihre Geschichten vor. Herzlich willkommen bei Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum.
Kriegserklärung ans Unternehmertum: SPD fordert höhere Steuern für Firmenerben – Weltwoche Daily DE
Werden Sie JETZT Abonnent unserer Digitalzeitung Weltwoche Deutschland. Nur EUR 5.- im ersten Monat. https://weltwoche.de/abonnemente/Aktuelle Ausgabe von Weltwoche Deutschland: https://weltwoche.de/aktuelle-ausgabe/KOSTENLOS:Täglicher Newsletter https://weltwoche.de/newsletter/App Weltwoche Deutschland http://tosto.re/weltwochedeutschlandDie Weltwoche: Das ist die andere Sicht! Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.Kriegserklärung ans Unternehmertum: SPD fordert höhere Steuern fürFirmenerben.EU-Bürokratie wie Horrorwelt in «Stranger Things».Fall Le Pen: EU auf dem Weg zur Diktatur?Die Weltwoche auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/weltwoche/Twitter: https://twitter.com/WeltwocheTikTok: https://www.tiktok.com/@weltwocheTelegram: https://t.me/Die_WeltwocheFacebook: https://www.facebook.com/weltwoche Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Crans ist überall: Was die Katastrophe über die Schweiz aussagt – Weltwoche Daily CH
Werden Sie JETZT Abonnent der Weltwoche. Digital nur CHF 9.- im ersten Monat. https://weltwoche.ch/abonnemente/Aktuelle Ausgabe der Weltwoche: https://weltwoche.ch/aktuelle-ausgabe/KOSTENLOS: Täglicher Newsletter https://weltwoche.ch/newsletter/App Weltwoche Schweiz https://tosto.re/weltwocheDie Weltwoche: Das ist die andere Sicht! Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.Crans ist überall: Was die Katastrophe über die Schweiz aussagt. Würdigung von Sergio Ermotti. St. Galler Impfdiktat. Nationalbankchef Schlegel mischt sich in US-Streit ein.Streit um Grönland: Schweizer Nato-Fans, schaut hin!EU: eine Diktatur?Die Weltwoche auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/weltwoche/Twitter: https://twitter.com/WeltwocheTikTok: https://www.tiktok.com/@weltwocheTelegram: https://t.me/Die_Weltwoche Facebook: https://www.facebook.com/DIE.WELTWOCHE Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Die Menschen, die gerade im Iran gegen das Regime aufbegehren, riskieren ihr Leben. Hunderte Demonstranten sollen bereits tot sein. Die religiöse Diktatur hält sich seit 1979 – obwohl es immer wieder heftige Proteste gibt. Tran, Anh
Angriff in der Nacht: Wie Trump Venezuelas Maduro stürzte. Mit Peter Neumann
Ein historischer Tag.In der Nacht lässt US-Präsident Donald Trump den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro von US-Spezialkräften festnehmen und außer Landes bringen.Militärschlag, Geheimdienstoperation, Völkerrechtsbruch – oder Befreiung von einer Diktatur?Paul spricht am Flughafen, auf dem Weg nach Kolumbien an die venezolanische Grenze, mit Sicherheitsexperte Peter Neumann über eine Aktion, die die Weltordnung verändern könnte.Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne Like & Abo da!GANZ NEU: Diskutiert mit Paul, Filipp & unseren Gästen und erfahrt noch mehr über die Hintergründe der Episoden auf joincampfire.fm/ronzheimerPaul auf Instagram | Paul auf XRONZHEIMER. jetzt auch im Video auf YouTube!Redaktion: Filipp Piatov, Lieven Jenrich u. Moritz MüllerExecutive Producer: Daniel van Moll Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Der Burgos-Prozess: Als die ETA Franco vor der Welt blamierte
ETA-Angeklagte drehen den Schauprozess um, prangern Folter an – und zwingen Franco, die Todesurteile vom 28.12.1970 unter weltweitem Druck zurückzunehmen. Von Thomas Pfaff.
Iryna Herasimovich: «Exil ist eine unsichtbare Arbeit»
Wie unterwandert Kunst die Diktatur in Belarus? Dazu forscht Iryna Herasimovich am Slavischen Seminar in Zürich. Als sie in die Schweiz kam, wollte sie nur einige Monate bleiben, um Literatur zu übersetzen. Doch die gewaltsame Niederschlagung der Protestbewegung verunmöglichte eine Rückkehr. «Hier habe ich das Gefühl, endlich angekommen zu sein», sagt Iryna Herasimovich, wenn sie von ihrer Arbeit am Slavischen Seminar in Zürich erzählt. Sie habe das Glück, dass ihr Umfeld sensibel auf ihre Situation reagiere. Hinter ihr liegen Jahre voller Entscheidungen, die sie nie treffen wollte: Sie musste ihre Wohnung in Minsk per Video auflösen, ihr altes Leben und vor allem geliebte Menschen für unbestimmte Zeit zurücklassen. Heute kann sie sagen: «Exil ist nicht nur Verlust, sondern auch eine Bereicherung.» In «Musik für einen Gast» erzählt Iryna Herasimovich davon, weshalb ihr ein Lied von Mani Matter während der Revolutionswirren geholfen hat. Und sie erklärt, weshalb übersetzen für sie auch eine politische Bedeutung hat: «Es geht um die Haltung, sich auf andere einzulassen und sich zu bemühen, sie zu verstehen.» Die Musiktitel: 1. Belarussisches Volkslied: «Lito» (Ivan Kirchuk / Siarhei Douhushau / Margarita Levchuk) 2. Uladzimier Teraŭski - «Kupalinka» (Singfrauen Winterthur / Albin Brun Quartett) 3. Erstes Wiener Heimorgelorchester (EWHO) – «Die Letten werden die ersten sein» 4. Edvard Grieg - Peer-Gynt-Suite: «Åses Tod» (Zürcher Kammerorchester / Howard Griffiths) 5. Arvo Pärt - «Salve Regina» (Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier)
Melika Rezapour: „Ich will als Schauspielerin und Frau gesehen werden, ohne Adjektiv“
„The One Way Ticket" heißt der bisher erfolgreichste Kurzfilm von Melika Rezapour, Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin. Der Titel ist auch autobiografisch zu verstehen: Geboren in Teheran, hat Melika Rezapour dort Bauingenieurin gelernt, ist vor der Diktatur der Mullahs nach Deutschland geflohen, hat als Kassiererin und Putzkraft gearbeitet, in Berlin Schauspiel und Regie studiert, erste Filme gedreht und „Koochilika“ gegründet: eine Initiative, die Studierende und Auszubildende auf ihrem Weg nach Deutschland begleitet – Menschen, die auch ein „One Way Ticket“ gelöst haben.
Massenarbeitslosigkeit, Armut und Korruption: In der Jasmin-Revolution tragen die Tunesier ihren Unmut lautstark auf die Straße – und stürzen ihren Diktator. Von Christoph Vormweg.
Vor 15 Jahren verbrannte der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi sich selbst und löste damit eine Revolution aus. Es war der Auftakt zum „Arabischen Frühling“ und damit der Protest gegen die staatliche Willkür und Korruption nicht nur in Tunesien. Auch Ägypten stimmte mit ein, stürzte die Diktatur im Land - getragen von der Hoffnung auf Veränderung. In dieser Zeit brachen alte Tabus, ein neues Bewusstsein entwickelte sich und die Zivilgesellschaft wurde gestärkt. Doch was aus westlicher Perspektive als demokratischer Hoffnungsschimmer begann, endete ernüchternd. Statt Stabilität gewannen in der Region alte und neue autoritäre Mächte die Kontrolle, während wirtschaftliche und soziale Probleme geblieben sind - genau wie die Frustration. Die Bilanz des Arabischen Frühlings bleibt somit ambivalent. Und diese zieht der Tag, moderiert von Hadija Haruna-Oelker zusammen mit der freien Korrespondentin Sarah Mersch aus Tunis, der Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tunis Julia Bartmann, der Deutsch-Ägypterin Gina Seidel-Girgis und Jannis Grimm vom Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung. Podcast-Tipp: Deutschlandfunk - Hintergrund Tunesien - Was vom "Arabischen Frühling" übrig blieb Vor 15 Jahren löste der Tunesier Mohamed Bouazizi mit seiner Selbstverbrennung eine Revolution aus. Es war der Auftakt zum "Arabischen Frühling". Doch was als demokratischer Hoffnungsschimmer begann, endete in bitterer Ernüchterung. https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:ab6cef7ac570d206/
Ein Jahr nach dem Sturz der Assad-Diktatur suchen die Menschen nach Hoffnung in den Trümmern. Syrien ist zerstört, Häusergerippe brechen zusammen, es gibt kein Wasser und das Land ist übersät mit Minen und gefährlichen Munitionsresten. Immer wieder werden Massengräber entdeckt, immer wieder gibt es Wellen der Gewalt. Wie kann es da Hoffnung geben? Die neuen Machthaber treten selbstbewusst auf der Weltbühne auf und geben sich gemäßigt, aber in Syrien selbst gibt es nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg bislang nur wenig Fortschritt. Gibt es einen Weg in eine gute Zukunft? Wie empfindet die syrische Diaspora in Deutschland die Debatte um Rückkehr? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Moritz Behrendt, mit Dr. Regine Schwab vom Peace Research Institute in Frankfurt, mit Nahla Osman, vom Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine und mit dem ARD-Investigativ-Journalisten Sebastian Pittelkow vom NDR. Podcast-Tipp: 11KM - der tagesschau-Podcast Verschwunden, gefoltert, getötet: Einblicke in Assads Tötungsmaschinerie Ein Jahr nach dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad gelten mehr als 160.000 Menschen als vermisst. Bisher geheime Fotos und Dokumente werfen ein neues Licht darauf, wie Mitglieder des Assad-Regimes systematisch gefoltert und getötet haben sollen, unter anderem im syrischen Militärkrankenhaus Harasta. Die Daten stammen unter anderem von einer bisher geheimen Festplatte, die aus Syrien geschmuggelt und dem NDR zugespielt worden ist. In dieser 11KM-Folge nimmt uns NDR Investigativ-Journalist Amir Musawy vom internationalen Rechercheprojekt „Damascus Dossier“ mit auf die Spur dieser Festplatte. Es geht um eine geheime siebte Etage und um das Ausmaß von Assads Tötungsmaschinerie. https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:0785a0a33433342b/
Ein Jahr ohne Assad – Syrer zwischen Rückkehr und Angst
Vor genau einem Jahr feierten Syrer auf der ganzen Welt den Sturz des Langzeitdiktators Baschar al-Assad nach 24 Jahren. Wie blicken Syrer jetzt in ihr Heimatland? Janina Werner und Borhan Akid haben drei Geflüchtete gesprochen. Von Janina Werner.
Autokrat und Kriegsherr: Irina Scherbakowa erklärt Putin - #1529
Nobelpreisträgerin Irina Scherbakowa zeichnet nach, was den Weg zu Krieg und Diktatur bereitet hat: Die Verharmlosung des Stalinismus und Lügen über den Großen Vaterländischen Krieg. Die Unterwerfung der Ukraine bleibt ein zentrales Ziel des Regimes. Eine Mosse Lecture im Wiener Volkstheater. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Folge 292: Teil II Exilliteratur - Die Exilliteraten nach der Machtergreifung
Wie konnte ein politischer Erdrutsch historischen Ausmaßes zunächst wie ein beiläufiges Ereignis wirken? Unsere neue Folge blickt auf die Wochen nach dem 30. Januar 1933 – den Moment, in dem Adolf Hitler an die Macht kam und große Teile der deutschen Gesellschaft, besonders Künstler*innen und Intellektuelle, noch erstaunlich ruhig blieben. Während Einzelne entsetzt reagierten, setzten viele ihr Leben fort, als sei kaum etwas geschehen. Doch im Hintergrund wurde bereits das Fundament der Demokratie zerschlagen, die Pressefreiheit angegriffen und die kulturelle Landschaft systematisch »gleichgeschaltet«. In dieser Episode erzählen wir, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller die frühen Maßnahmen des Regimes erlebten, warum Warnsignale übersehen wurden – und wie die schleichende Diktatur schon vor dem Ermächtigungsgesetz Fakten schuf. Ein Blick auf Illusionen, Irrtümer, frühe Verfolgung und den Beginn des kulturellen Kahlschlags, der Deutschland nachhaltig veränderte
#796 - Russische Politologin Jekaterina Schulmann über Putin & den Ukrainekrieg
#373 deep dive mit Paul Lendvai: Sein Kampf für die Freiheit
Rattenmenschen, Pöbel-Diktatur und Kanzlers Windmaschine Weimer
Essteller statt Meisterschale. Könnte Habecks Idee sein: Merz-Regierung fördert E-Autos für Kleinverdiener. Welcher Schoko-Weihnachtsmann ist der Beste? Tschüß, Paule - unser Staffelfinale. Vom Live-Podcast beflügelt präsentieren Paul und Hajo Schumacher die frische und zugleich vorerst letzte Wochenschau. Unsere Themen: Jusos, Junge Union, China: Wenn die Jungen aufmucken. Abenteuer Flixbus. Albino-Eichhörnchen wünschen sich weiße Weihnacht. Finger weg vom Discount-Nikolaus. Folgt auf die Demokratie die Herrschaft des Pöbels? Die verblüffend aktuellen Überlegungen des alten Griechen Polybios. Kirchenasyl für aufständische Nonnen. Tübingen oder Stuttgart: Wo lohnt sich Straßenmusik? Müde, frustriert, illusionslos - was steckt hinter dem chinesischen Rattenmenschentrend? Mythos Familienunternehmen: Warum die Erbengesellschaft oft Innovationen bremst. Space-Paule statt Astro-Alex. Mondromantik oder All-Autonomie? Möwen stürzen sich sogar auf britisches Schulessen. Hurrikans treiben Kunstpreise. Plus: Vamos, Schatzi! Nächste Woche geht´s gleich weiter mit der neuen Staffel. Folge 1000b.Montag, 1.12. Dresden: Hajo liest aus dem Achilles-Krimi "Nur der Tod ist schneller"Teil 1 der Jubiläumsfolge bei YouTube Dem MutMachPodcast auf Instagram folgenDen MutMachPodCast unterstützen auf steadyPodcast Elefantenrunde mit Frank Stauss und HajoBücher:Suse SchumacherDie Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024Michael Meisheit + Hajo Schumacher Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Anna Ohnweiler: "Omas gegen Rechts ist eine Haltung"
Als Gründerin von „Omas gegen Rechts“ in Deutschland hat Anna Ohnweiler (75) eine Bewegung ins Leben gerufen, die heute Tausende Menschen vereint – für Demokratie, Toleranz und gegen jede Form von Extremismus. Die gebürtige Rumänin, die selbst in einer Diktatur aufwuchs und einst als Staatenlose nach Deutschland kam, erzählt von der Entstehung der Initiative und von eigenen Schulungen, um bei Stammtischgesprächen etwas entgegenhalten zu können. Warum ihr Engagement vor allem auch „Enkelschutz“ bedeutet, weshalb ihr Alter eher hilfreich ist und wie sie zu Einschüchterungsversuchen und Morddrohungen im Briefkasten steht, das hört Ihr in dieser Folge. Links: Website des Vereins „Omas gegen Rechts Deutschland“https://omasgegenrechts-deutschland.org Omas gegen Rechts Deutschland auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/145479739453585/?ref=share_group_link&rdid=oUJVPUdy0HWxx9vs&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fg%2F1ZK5fsgZLp%2F+++ 5-Minuten-Talk – wir haben ja nicht ewig Zeit - Podcast | RTL+ +++"Die Boss" ist ein Podcast von RTL+.Gastgeberin: Simone Menne.Redaktion: Alexandra Frank, Kirsten Frintrop, Isa von Heyl, Sarah Klößer und Sarah Stendel.Mitarbeit: Jane Reimers.Projektmanagement RTL+ & Schnitt: Kirsten Frintrop und Alexandra Frank.Postproduktion & Sounddesign: Aleksandra Zebisch.+++ Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html +++ Wir verarbeiten im Zusammenhang mit dem Angebot unserer Podcasts Daten. Wenn Sie der automatischen Übermittlung der Daten widersprechen wollen, klicken Sie hier: https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html+++ https://www.rtl.de/cms/service/footer-navigation/impressum.html +++Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Triggerwarnung: In dieser Folge geht es unter anderem um Rassismus Minerva Mirabal wächst in der Dominikanischen Republik auf, zu einer Zeit, in der Machthaber Trujillo keine Widerworte duldet und absolute Loyalität einfordert. Doch die junge Frau macht aus ihren Gedanken zu Politik und Gerechtigkeit keinen Hehl. Als die Mirabals 1949 zu einem Ball des Diktators eingeladen werden, bei dem er ihr Avancen macht, wird dieser Abend ihr Leben ein für alle Mal verändern. In ihr wächst ein Widerstand gegen das Regime, der sich nicht mehr aufhalten lässt und bald weit über ihre eigene Familie hinausgeht. In dieser Folge von „Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe“ sprechen wir darüber, was es bedeutet, Mut zu beweisen in einem System, das jede Abweichung bestraft. Es geht um weiblichen Widerstand, die Mechanismen einer Diktatur, Macht, Machismo und darum, wie drei Frauen zu Symbolfiguren eines ganzen Landes wurden und wie ihr Vermächtnis bis heute international nachhallt. Denn der Fall der Schmetterlinge ist der Grund, warum der 25. November heute als Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen gilt. Expert:innen in dieser Folge: Politikwissenschaftler Prof. Dr. Nikolaus Werz, ehemaliger Lehrstuhlinhaber für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock mit Forschungsschwerpunkt Politik in Lateinamerika, Prof. Dr. Barbara Potthast, Professorin für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte an der Universität zu Köln mit Schwerpunkt Genderbeziehungen, und Dr. Carolin Weyand, Rechtsanwältin und Vorständin der UN Women Deutschland Besonderer Dank an Minou Tavárez Mirabal, die Tochter von Minerva, mit der wir eng an dieser Folge zusammengearbeitet haben **Credit** Produzentinnen/ Hosts: Paulina Krasa, Laura Wohlers Redaktion: Paulina Krasa, Laura Wohlers, Marysol Mercado Schnitt: Pauline Korb Rechtliche Abnahme: Abel und Kollegen **Quellen (Auswahl)** Buch: “Alive in Their Garden: The True Story of the Mirabal Sisters and Their Fight for Freedom” von Dedé Mirabal Rede von Minou zum 60. Todestag der Mirabal Schwestern und die Grabrede an ihre Tante Dedé taz.blogs: https://t1p.de/zvm2s Publikation von Nikolaus Werz über Rafael Leónidas Trujillo: https://t1p.de/fo4pe BKA - Lagebilder: https://t1p.de/mf9nx Weiterführende Infos zu UN Women Deutschland: UN Women Deutschland www.unwomen.de Kampagnenseite www.gewalt-stoppen.org
Doping in der DDR - Pillen auch für Kinder und Jugendliche
Im Gegensatz zu Doping in der Bundesrepublik, war die Doping in der DDR staatlich reguliert. Aber war es dadurch für die Sportlerinnen und Sportler sicherer? Ein Vortrag der Historikerin Jutta Braun. Jutta Braun ist Historikerin und leitet am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) die Abteilung "Regime des Sozialen". Ihren Vortrag "Zwangsdoping in der Diktatur?" hat sie am 28. Juni 2025 bei der Langen Nacht der Wissenschaften in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin gehalten. ********** Schlagworte: +++ Doping +++ DDR +++ Sport +++ Wettkampf +++ Systemwettkampf +++ Kommunismus +++ Anabolika +++ Kinder +++ Jugendliche +++ Medizin +++ Sportfunktionäre +++ Trainer +++ Sportler +++ Sportlerinnen +++ Geschichte**********In dieser Folge mit: Moderation: Nina Bust-Bartels Vortragende: Jutta Braun, Historikerin, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF)**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Karl Marx und der Kommunismus: Die Rolle von Eigentum für soziale GerechtigkeitDenkmäler: In Polen werden Sowjet-Statuen abgerissenKalter Krieg: Epoche der Gegensätze**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: TikTok und Instagram .
Die Verehrung von Franco scheint in Spanien plötzlich wieder salonfähig zu sein. Die Opfer der Diktatur wehren sich dagegen, sie kämpfen gegen die Verdrängung der dunklen Vergangenheit an. Heutiger Gast: Ute Müller, Spanien-Korrespondentin Host: Antonia Moser Die [ganze Reportage von Ute Müller ](https://www.nzz.ch/international/50-jahre-nach-seinem-tod-lebt-francos-erbe-weiter-ld.1911296)gibts zu lesen bei der NZZ. Und falls du dazu noch ein Abo brauchst, [hier ](https://abo.nzz.ch/nzz-ch-probeabo-digital)gibt es eines.
“Weder Kooperationen noch Koalitionen”: Der CDU-Politiker Norbert Lammert plädiert für eine strikte Abgrenzung.
Francisco Franco - Bürgerkrieg, Diktatur, gespaltene Erinnerung
Es war die letzte faschistische Diktatur in Europa, und sie endete erst mit dem Tod des "Caudillo", des "Führers" Francisco Franco im November 1975. Der General stürzte Spanien in einen blutigen Bürgerkrieg und regierte danach mit harter Hand. Bis heute entzweit das Andenken an Franco das Land. Von Julia Devlin.
Diktatur, Revolution, Bürgerkrieg: wenn es um Donald Trumps politische Zukunft geht, sollte man nichts mehr ausschließen. Republikaner und Demokraten arbeiten deshalb bereits kräftig an ihren Plänen für die nächsten US-Wahlen. Gibt es dann die große Abrechnung mit dem MAGA-Regime? Oder werden die Republikaner und Techoligarchen schon vorher ihre Macht zementieren? Das besprechen wir mit der deutsch-amerikanischen Politologin Cathryn Clüver-Ashbrook. **Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?** Mit einem STANDARD-Abonnement können Sie unsere Arbeit unterstützen und mithelfen, Journalismus mit Haltung auch in Zukunft sicherzustellen. Alle Infos und Angebote gibt es hier: [abo.derstandard.at](https://abo.derstandard.at/?ref=Podcast&utm_source=derstandard&utm_medium=podcast&utm_campaign=podcast&utm_content=podcast) Die STANDARD-Podcasts gibt es im November nicht nur zum Hören, sondern auch zum Live dabei sein. Und zwar auf der Buch Wien: Am 13. November sprechen wir ab 13 Uhr in "Edition Zukunft" mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl über die Zukunft des Verkehrs. Am 15. November ab 15:30 begrüßt Chefredakteur Gerold Riedmann im "CEO"-Podcast die Gründer der internationalen Gastronomiegruppe NENI. Und am 16. November ab 16:00 fragen wir in "Thema des Tages" die langjährige Washington-Korrespondentin Hannelore Veit, ob die USA noch zu retten sind. Alle weiteren Infos und Tickets finden Sie auf www.buchwien.at.
Parlamentswahl - Wo steht der Irak nach dem Ende der Diktatur?
20 Jahre nach dem Sturz Saddam Husseins hat sich der Irak erholt. Krieg und Zerstörung sind einer mühsam errungenen Stabilität gewichen, der Wiederaufbau geht voran. Alte Konflikte aber bestehen fort. Viele sehen mit Skepsis auf die anstehenden Wahlen. Behrendt, Moritz www.deutschlandfunk.de, Hintergrund
Betterov ist Musiker, Songwriter und für mich einer der spannendsten deutschsprachigen Künstler seiner Generation. Auf seinem neuen Album “Große Kunst” erzählt er die Geschichte seines Vaters, der 1989 aus der DDR geflohen ist – und damit auch die Geschichte einer ganzen Generation. Ich wollte von Betterov wissen, wie sehr seine Herkunft seine Kunst beeinflusst und wie er entschieden hat, den “Ostrelikten” ein Album zu widmen. Wir sprechen über Herkunft, Züchtigung in der Schule, Gewalt in der Jugend, seinen Weg vom Industriemechaniker zum Musiker, über Freiheit, Verantwortung und warum er lieber über die Diktatur seines Vaters singt, als den nächsten Algorithmus-Hit zu produzieren. Es geht um Scham, Mut, Reflexion und darum, was es bedeutet, wenn man die eigene Geschichte endlich versteht. WERBEPARTNER & RABATTE: https://linktr.ee/hotelmatze MEIN GAST: https://instagram.com/betterovmusik/ DINGE: “Große Kunst”: https://betterov.lnk.to/grossekunst Das Leben der anderen: https://bit.ly/47soJWI Joy Division: https://bit.ly/3JtBW8B Bon Iver: https://boniver.org/about/ Lukas Hambach - Produktion Lena Rocholl - Redaktion Mit Vergnügen - Vermarktung und Distribution Hotel Matze live - https://eventim.de/artist/hotel-matze/ 17.11.2025 – Stuttgart – Liederhalle Mozartsaal 18.11.2025 – Köln – Volksbühne am Rudolfplatz 06.12.2025 – Berlin – Deutsches Theater Berlin MEIN ZEUG: Mein Fragenset LIEBE: https://beherzt.net/liebe Mein erstes Fragenset: https://beherzt.net/matze Meine Spendenaktion: https://machmit.wellfair.ngo/hotel-matze-spendenaktion-2025 Mein Newsletter: https://matzehielscher.substack.com/ YouTube: https://bit.ly/2MXRILN TikTok: https://tiktok.com/@matzehielscher Instagram: https://instagram.com/matzehielscherHotel LinkedIn: https://linkedin.com/in/matzehielscher/ Mein Buch: https://bit.ly/39FtHQy
Der 18-jährige Oberschüler Hermann Flade wird mit Protest-Flugblättern gegen Wahlbetrug erwischt. In der DDR ein Grund für einen Schauprozess mit Todesurteil. Von Andrea Kath.