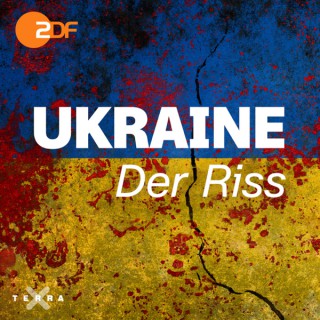Podcasts about orthodoxe kirche
- 29PODCASTS
- 36EPISODES
- 27mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Jan 18, 2024LATEST
POPULARITY
Best podcasts about orthodoxe kirche
Latest podcast episodes about orthodoxe kirche
Die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Unterstützung für Putin und den Krieg
Dornblüth, Gesinewww.deutschlandfunkkultur.de, Studio 9
Frauenbildnisse auf Ikonen: Ausstellung in Recklinghausen
Ikonen gelten als Fenster zum Himmel. Als Bildnisse, die die göttliche Ordnung spiegeln. Im Ikonenmuseum in Recklinghausen zeigt eine Ausstellung ausschließlich Frauenfiguren auf den Kultbildnissen der Orthodoxen Kirche. Autorin: Claudia Friedrich Von Claudia Friedrich.
Finnlands Orthodoxe Kirche: Von Russland längst abgelöst
Budde, Vanja / Budde, Alexanderwww.deutschlandfunkkultur.de, ReligionenDirekter Link zur Audiodatei
Russisch-Orthodoxe Kirche: Krieg mit Gottes Segen
Patriarch Kyrill I. ruft in Moskau zum "Krieg gegen das Böse" auf - und meint damit die Ukraine. Außerdem: Das dreckige Geschäft mit deutschem Müll in Rumänien und der beispiellose Smog in Skopje.
Der Krieg in der Ukraine dauert an. Was muss sich an unserem Diskurs ändern, damit der Krieg aufhört? Und was können die Kirchen tun?
Von ihren Eltern lernt Sascha die Liebe zur Kunst und die Hingabe an den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wiedergefundenen Glauben. Doch fast 70 Jahre offizieller Atheismus haben auch in den orthodoxen Kirchen Spuren hinterlassen: Wegen der Verfolgung während dieser Zeit stilisieren sich Geistliche zu "Märtyrern des Kommunismus". In Wahrheit gehört die Spitze der Orthodoxie aber spätestens seit den 1980er-Jahren zum Establishment. Die geistliche Elite arbeitete bis 1991 mit dem KGB zusammen - in Russland sogar noch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und auch Sasha bemerkt immer öfter, wie politisch die Kirche agiert. Obwohl es sich bei dem Krieg in der Ukraine nicht um einen Glaubenskrieg handelt, spielen die kirchlichen Institutionen eine wichtige Rolle. - Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die **Unabhängigkeit der ukrainischen Kirche** die orthodoxe Welt verändert hat, empfehlen wir diesen Artikel von Regina Elsner https://ukraineverstehen.de/elsner-wie-der-tomos-die-orthodoxe-welt-veraendert-hat/ und die Analyse von Nikolay Mitrokhin https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/288354/analyse-poroschenko-und-der-tomos-effekt/. - Inwiefern der **religiöse Konflikt den Kampf um die Unabhängigkeit** von Russland widerspiegelt - darum geht es in dieser Analyse https://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen207.pdf. - Außerdem empfehlen wir dieses Gespräch mit dem Religionssoziologen Dr. Leif Seibert über den **religiösen Einfluss im Krieg gegen die Ukraine** https://aktuell.uni-bielefeld.de/2022/05/12/putin-und-kyrill-profitieren-von-beidseitiger-legitimation/ und die Analyse: Die Russische Orthodoxe Kirche und das Konzept der "Russischen Welt" https://www.bpb.de/themen/europa/russland-analysen/nr-289/200275/analyse-die-russische-orthodoxe-kirche-und-das-konzept-der-russischen-welt/.
Ukraine - Der Riss | #4: Sasha und die Religion
Von ihren Eltern lernt Sascha die Liebe zur Kunst und die Hingabe an den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wiedergefundenen Glauben. Doch fast 70 Jahre offizieller Atheismus haben auch in den orthodoxen Kirchen Spuren hinterlassen: Wegen der Verfolgung während dieser Zeit stilisieren sich Geistliche zu "Märtyrern des Kommunismus". In Wahrheit gehört die Spitze der Orthodoxie aber spätestens seit den 1980er-Jahren zum Establishment. Die geistliche Elite arbeitete bis 1991 mit dem KGB zusammen - in Russland sogar noch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und auch Sasha bemerkt immer öfter, wie politisch die Kirche agiert. Obwohl es sich bei dem Krieg in der Ukraine nicht um einen Glaubenskrieg handelt, spielen die kirchlichen Institutionen eine wichtige Rolle. - Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die **Unabhängigkeit der ukrainischen Kirche** die orthodoxe Welt verändert hat, empfehlen wir diesen Artikel von Regina Elsner https://ukraineverstehen.de/elsner-wie-der-tomos-die-orthodoxe-welt-veraendert-hat/ und die Analyse von Nikolay Mitrokhin https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/288354/analyse-poroschenko-und-der-tomos-effekt/. - Inwiefern der **religiöse Konflikt den Kampf um die Unabhängigkeit** von Russland widerspiegelt - darum geht es in dieser Analyse https://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen207.pdf. - Außerdem empfehlen wir dieses Gespräch mit dem Religionssoziologen Dr. Leif Seibert über den **religiösen Einfluss im Krieg gegen die Ukraine** https://aktuell.uni-bielefeld.de/2022/05/12/putin-und-kyrill-profitieren-von-beidseitiger-legitimation/ und die Analyse: Die Russische Orthodoxe Kirche und das Konzept der "Russischen Welt" https://www.bpb.de/themen/europa/russland-analysen/nr-289/200275/analyse-die-russische-orthodoxe-kirche-und-das-konzept-der-russischen-welt/.
122: Wie wird man Bischof in der Serbisch-orthodoxe Kirche?
Ein sehr persönliches Gespräch mit Bischof Andrej Cilerdzic, der seit 2014 die Serbisch-orthodoxe Kirche in Österreich leitet. Wer und was ihn in seinem Leben geprägt hat, was er von der Katholischen Kirche hält und welche Mechanismen es in der serbischen Kirche bei der Wahl der Bischöfe und des Patriarchen gibt. Über das und vieles mehr gibt der Bischof Auskunft.
Thomas Bremer: “Sanktionen gegen Kyrill wären eher symbolisch”
Die EU hat gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine bereits zahlreiche Sanktionen verhängt: gegen Banken, Unternehmen - und auch gegen einzelne Personen. Politiker, Oligarchen und Putin-Vertraute sind inzwischen von den Sanktionen betroffen. Doch ein prominenter Name, der auch immer wieder mit dem Krieg in Verbindung gebracht wird, fehlt weiterhin: nämlich der des Patriarchen Kyrill, dem Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche. Warum der Name nicht auf der Liste steht und welche Rolle die Orthodoxe Kirche für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine spielt, darüber spricht Florian Schroeder mit Thomas Bremer. Er ist Professor für Ostkirchenkunde am Ökumenischen Institut der Universität Münster.
Was uns beflügelt und die Seele atmen lässt. Ein Gespräch mit dem spirituellen Autor Pierre Stutz
Die überschäumende Begeisterung, von der in der biblischen Pfingstgeschichte erzählt wird, die fällt vielen Menschen in diesen Wochen doch schwer. Zu sehr sind wir noch im Krisen-Modus gefangen. Aber vielleicht ist es gerade darum gut und heilsam, sich etwas von diesem pfingstlichen Geist der Freiheit anstecken zu lassen. Der spirituelle Autor Pierre Stutz hat Anregungen, wie es gelingen kann, der Seele etwas mehr Atemfreiheit zu verschaffen. Ein Gespräch mit ihm im zweiten Teil der Sendung.
Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland - im Gespräch mit Thomas Bremer
Röther, Christian [X]www.deutschlandfunk.de, Tag für TagDirekter Link zur Audiodatei
Kyrill und der Krieg. Ein Gespräch mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner
Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Ein Kriegsende, ein Waffenstillstand, geschweige denn ein Friede sind nicht absehbar. Die von Präsident Putin so genannte „Spezialoperation“ fordert täglich unzählige Opfer auf beiden Seiten, bringt sinnloses Leid und unermessliche Zerstörung. Umso mehr erstaunt es, dass der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. diesem Krieg in Predigten und Stellungnahmen seinen Segen gibt. Diese religiöse Rechtfertigung des Krieges hat zu großen Verwerfungen innerhalb der Orthodoxie und auch der Weltchristenheit geführt. Für diese Feiertagsausgabe von „Himmel und Erde“ haben die hr-Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner gesprochen. Die katholische Theologin arbeitet beim „Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien“ in Berlin.
Fliegt die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Weltkirchenrat?
(00:00:00) Der Riss zwischen Ost und West wegen des Krieges in der Ukraine führt auch mitten durch die Kirchen. Nun möchten einige Kirchen sogar, die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Weltkirchenrat, dem ÖRK, ausschliessen. Wir fragen nach, wie sinnvoll das wäre. Weitere Themen: (00:05:01) «Alice Schwarzer»: Sabine Derflingers Dokumentarfilm über die Feminismus-Ikone. (00:09:30) Raubkunst-Debatte in der Schweiz: Was bringt eine ständige Kommission – und wo bleiben Fragen offen bei der Motion von Jon Pult. (00:13:31) «Architekturwoche Basel»: Eine neue Veranstaltungsreihe soll im Zweijahresrhythmus Architekten und Stadtplanerinnen in Basel zusammenbringen. (00:18:07) «Neunau»: Beim künstlerisch-wissenschaftlichen Projekt macht der norditalienische Tonkünstler Sergio Maggioni das Schmelzen der Gletscher hörbar.
Orthodoxe Kirche - Moskau, das "Dritte Rom"
1472 heiratet der Moskauer Großfürst Iwan III. die Nichte des letzten Kaisers des Oströmischen Reiches. Es ist eine große und symbolische Eheschließung - hinter ihr steht der Wunsch, sich in die Tradition eines großen, untergegangenen Reiches zu stellen. Was steckt hinter der Idee von Moskau als dem "Dritten Rom"? **********Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":00:05:38 - Beitrag von Kristin Mockenhaupt über die Hochzeit Iwans III. mit Zoe Palaiologa im November 147200:11:02 - Gespräch mit dem Historiker David Khunchukashvili über die Idee eines "Dritten Roms"00:22:10 - Gespräch mit dem Russlandexperten Jörg Himmelreich über das Verhältnis der orthodoxen Kirche zum russischen Staat00:32:10 - Gespräch mit dem Historiker Dietmar Neutatz über die Frage, ob die heutige russische Führung aus der Idee eines "Dritten Rom" noch politische Folgerungen ableitet**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Ukraine, Russland, Kiewer Rus: Putins Blick auf die GeschichteRussland greift Ukraine militärisch anWeimarer Republik - 1922: Der Vertrag von Rapallo**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Oder folgt uns auf Instagram.
Putins heiliger Krieg? Die Kirchen im Ukraine-Konflikt
Zehneinhalb Wochen dauert der Krieg in der Ukraine, ein Kriegsende, ein Waffenstillstand, geschweige denn ein Friede ist nicht absehbar. Die von Präsident Putin so genannte Spezialoperation hat tausende Opfer auf beiden Seiten gefordert, sinnloses Leid und unermessliche Zerstörung gebracht. Umso mehr erstaunt es, dass das Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I. diesem Krieg in Predigten und Stellungnahmen seinen Segen gibt. Diese religiöse Rechtfertigung des Krieges hat zu großen Verwerfungen innerhalb der Orthodoxie und auch der Weltchristenheit geführt. In hr2-Camino „Nachgefragt“ sprechen die hr-Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner. Die katholische Theologin arbeitet beim Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin.
Die russische orthodoxe Kirche und der Krieg in der Ukraine
Seit acht Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Zivilbevölkerung wird nicht verschont, Bilder und Berichte sprechen für schwere Kriegsverbrechen.Von Brigitte Lehnhoff
Russisch-orthodoxe Kirche - Brüder im Ungeist: Patriarch Kyrill und Putin
An diesem Wochenende feiern orthodoxe Christen weltweit das Osterfest, auch in der Ukraine und in Russland. Doch statt sich für eine Waffenruhe stark zu machen, schweigt Patriarch Kyrill, das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche. Eine moralische Bankrotterklärung, kommentiert Benedikt Schulz.Schulz, BenediktDirekter Link zur Audiodatei
"Mit Ikonen werden Wunder verbunden" | Konstanze Runge erzählt von ihren Reisen quer durch Europa und Nordafrika
Überschattet vom Krieg in der Ukraine feiern am kommenden Wochenende die orthodoxen Christen das Osterfest. Im orthodoxen Christentum spielen die Kult- und Heiligenbilder, die Ikonen, eine besondere Rolle. In Frankfurt gibt es ein kleines, aber exquisites Museum, das sich der Bedeutung und Geschichte der Kult- und Heiligenbilder widmet. Leitende Kuratorin und Kustodin ist Konstanze Runge, heute zu Gast im "hr2-Doppelkopf. (Wdh. vom 23.09.2021)
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - Warum wir Dinge immer wieder tun. Und wie wir ungeliebte Gewohnheiten los werden
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das fängt schon früh morgens an. Bei den meisten Menschen läuft der Tagebeginn immer gleich ab. Die ersten Handgriffe, nachdem der Wecker geklingelt hat, der Weg ins Bad, die Zeit fürs Frühstück, der Aufbruch in den Tag - unbewusst haben wir uns feste Abläufe angewöhnt. Das hilft uns beim Übergang von der Nacht in den Tag. Und wir merken erst, wie wichtig unsere Gewohnten sind für ein gutes und vor allem sicheres Lebensgefühl, wenn mal was durcheinander gerät. Aber auch das ist mal eine gute Erfahrung: In der Fastenzeit ändern viele Menschen ganz bewusst ein paar Wochen lang lieb gewordene Gewohnheiten, verzichten zum Beispiel auf das Glas Wein am Abend und machen damit ganz neue Lebenserfahrungen. Warum wir Gewohnheiten brauchen, wann Gewohnheiten zum engen Korsett oder gar zum Zwang werden, und wie wir uns neue Verhaltensweisen angewöhnen können, darum geht es an diesem Sonntag im Himmel und Erde-Sonntagsthema.
Minderheit mit Herrschaftsanspruch: die serbisch-orthodoxe Kirche im Kosovo
Schulz, Benediktwww.deutschlandfunk.de, Tag für TagDirekter Link zur Audiodatei
Der Krieg in der Ukraine und die europäische Sicherheitsarchitektur
Der 24. Februar 2022 hat Europa verändert. Putin hat die Ukraine in den Krieg gestürzt und die nuklearen Streitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Die russische Invasion der Ukraine hat dem Westen vor Augen geführt, wie fragil die europäische Sicherheitsarchitektur ist. Gleichzeitig hat die westliche Staatengemeinschaft Einigkeit gezeigt und weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt, die auch die russische Bevölkerung hart treffen. Wie war es möglich, dass über dreißig Jahre nach Ende des Kalten Krieges Europa zu einem Kriegsschauplatz wird? War der Westen naiv? Hat man Putins Entschlossenheit unterschätzt? In dieser Podiumsdiskussion beleuchten wir einerseits den Krieg in der Ukraine, dessen Ursachen und sicherheits-, energie- und nuklearpolitischen Folgen. Andererseits fragen wir, wie lange Putin innenpolitisch noch Rückhalt hat und wie Russlands Bevölkerung die neue Situation bewertet. Es diskutieren: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Mangott, Experte für Internationale Beziehungen und Sicherheit im postsowjetischen Raum, Institut für Politikwissenschaft, Universität Innsbruck. Assoz. Prof. Dr. Martin Senn, Experte für Internationale Beziehungen, internationale Ordnungen und die (Nicht)verbreitung von Nuklearwaffen, Institut für Politikwissenschaft, Universität Innsbruck. Univ-Prof. Dr. Kristina Stoeckl, Expertin für Russische Orthodoxie und Religion und Politik in Russland, Institut für Soziologie, Universität Innsbruck. Moderation: Dr. Julia Mourão Permoser, Expertin für Migration und liberale Demokratien, Institut für Politikwissenschaft, Universität Innsbruck. Aufnahme vom 09.03.2022. Veröffentlicht am 14.03.2022. Mehr Infos auf unserer Homepage: https://www.uibk.ac.at/politikwissenschaft/kommunikation/artikel/podcast/mourao-permoser-ukraine.html Bild: Gerd Altmann auf Pixabay ---- Music by Lost Harmonies. This podcast gives the views of the author(s), and not the position of the Department of Political Science, University of Innsbruck. This work by the Department of Political Science, University of Innsbruck, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
Käßmann: Russisch-orthodoxe Kirche muss glasklar zum Frieden rufen
Die russisch-orthodoxe Kirche ist Präsident Putin eng verbunden. Höchste Zeit, dass sie ihren Einfluß geltend macht, sagt die frühere EKD-Ratsvorsitzende, Margot Käßmann. Und zwar mit einem glasklaren Aufruf zum Frieden.
Seit Tagen beherrschen der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Nachrichten. Welche Rolle spielen in diesem Konflikt die Kirchen, allen voran die für ganz Osteuropa relevante russisch-orthodoxe Kirche? Darüber haben wir mit Prof. Dr. Thomas Mark Németh gesprochen.
Russisch-orthodoxe Kirche expandiert in Afrika - Thomas Bremer im Gespräch
Schulz, Benediktwww.deutschlandfunk.de, Tag für TagDirekter Link zur Audiodatei
Gemeinsam Hand in Hand: Putin und die russisch-orthodoxe Kirche
Autor: Kellermann, Florian Sendung: Religionen Hören bis: 19.01.2038 04:14
Kölner Kirchenbank mit Constantin Miron: Was ist eigentlich die Orthodoxe Kirche?
Evangelisch Leben in Köln und Region - Die Kölner Kirchenbank
Auf der Kölner Kirchenbank erklärt der griechisch-orthodoxe Erzpriester des Ökumenischen Patriarchats in Köln-Deutz, Radu Constantin Miron, die orthodoxe Kirche und ihre Bedeutung. Was ist die orthodoxe Kirche in Deutschland? Was sind die zentralen Gedanken und wie sehen die Mitglieder sich im Hinblick auf ihren Gottesglauben? Fragen, über die Sammy Wintersohl mit Constantin Miron im Rahmen der Reihe Kölner Kirchenbank gesprochen hat. Es ist das zweite Mal, dass Constantin Miron auf der Kirchenbank Platz genommen hat. Im ersten Gespräch Anfang November 2020 sprach er über die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), deren Vorsitzender Miron seit 2019 ist. Als „Kirche der ersten Jahrhunderte“ bezeichnet Constantin Miron seine Glaubensgemeinschaft, als eine Kirche, die sich ihrer Wurzeln und Traditionen sehr bewusst ist, sich aber nicht von den anderen christlichen Kirchen abgrenzt. Gott auf „rechte Weise“ zu lobpreisen - diese Bedeutung steckt im altgriechischen Wort „orthodox“, das als „rechtgläubig“ übersetzt wird, in dem eben aber auch immer das „rechte Lobpreisen“ Gottes mitschwingt. „Das Wort ,rechtgläubig‘ ist ein Etikett, das uns angehängt wurde. Im Grunde sind wir alle katholisch, da wir ein allgemeingültiges Christentum vertreten und evangelisch, wenn wir aus dem Evangelium heraus leben,“ sagt Miron. Die Konfessionsbezeichnungen seien weder eine Abwertung, noch eine Abgrenzung, sondern eine geschichtliche Entwicklung, ist der Theologe überzeugt. Dies ist eine geschichtliche Entwicklung, die auch die orthodoxe Kirche im Blick hat, die aber nicht, wie Constantin Miron betont, das im sonntäglichen Gottesdienst gesprochene, apostolische Glaubensbekenntnis außer Kraft setzt. „Das, was Petrus und Paulus vor 2.000 Jahren geglaubt haben, glauben auch wir. Unsere Gottesdienste sind voller Lobpreis. Sie können mit dem Morgengottesdienst, der in die Abendmahlfeier übergeht, durchaus auch drei Stunden dauern. Man kommt, wann man kann und bleibt dann hoffentlich bis zum Schluss“, erklärt er weiter. Alles sei auf seine Weise „Heilige Schrift“ in diesen Gottesdiensten, so der Pfarrer und erläutert, dass es natürlich eine Predigt gibt, diese aber einen anderen Stellenwert als in evangelischen Gottesdiensten habe. Da der Gottesdienst in seiner griechisch-orthodoxen Gemeinde ein Stück Heimat sei, werde im Wesentlichen griechisch gesprochen, berichtet der Erzpriester. Doch die Entwicklung hin zu Gottesdiensten auf Deutsch sei im Gange. Die Sakramente ähneln denen der römisch-katholischen Kirche. Die Taufe gehört dazu, die Krankensalbung, die Trauung und die Beichte. Bei der Trauung stehe nicht so sehr das Ja-Wort im Mittelpunkt als vielmehr der Segen, den das Paar empfange. Jedes Paar sollte allerdings als Voraussetzung das Sakrament der Taufe, egal in welcher Kirche, empfangen haben. „Kann einer der Partner nichts mit dem Glauben anfangen und ist nicht getauft, ist das theologisch schwierig. Hier suchen wir gerade nach einem Weg, damit umzugehen.“ Für ihn ist die orthodoxe Kirche ein „Wir“, das neben den Gläubigen aus einem dreigliedrigen Amt besteht, denn getragen werde die orthodoxe Kirche von Bischöfen, Priestern und Diakonen. In der Regel kommen die Bischöfe aus dem Mönchsstand, und sind unverheiratet. Ein Priester darf zwar nicht heiraten, doch ein verheirateter Mann kann zum Priester oder Diakon geweiht werden. „Diese Regelung bewährt sich seit Jahrhunderten. Diskutiert wird gerade, ob das Zölibat der Bischöfe sinnvoll ist und, ob eine Ordination von Frauen möglich werden kann. Diakoninnen in Alexandrien gibt es schon, doch die Ordination wird vermutlich noch auf sich warten lassen.“ Bei dieser Thematik habe die orthodoxe Kirche weder Denk- noch Sprechverbote. Ein ähnliches Amt, wie das des Papstes, gebe es in der orthodoxen Kirche nicht, führt der Erzpriester aus. Jedoch sei der Patriarch von Konstantinopel derjenige, der als „Gleicher unter Gleichen“ den Bischöfen des gesamten orthodoxen Christentums vorste
Die griechisch-orthodoxe Kirche und ihr Umgang mit der Corona-Pandemie
Autor: Seralidou, Rodothea Sendung: Tag für Tag Hören bis: 19.01.2038 04:14
Die Ursache liegt in der Kalendergeschichte. Es gibt den julianischen und den gregorianischen Kalender. Den hat Papst Gregor XIII. nachgeschärft, um Kalenderungenauigkeiten zu beseitigen. Von Werner Mezger
#refocus 12 – Keltische Spiritualität und ihre Relevanz für heute
Die Renaissance der keltischen Weltsicht. | Reflexionen über die eigene religiöse Prägung und Weitung des Horizontes. | Auf welcher Grundlage sich Gemeinden bilden. | Die reformatorischen Bewegungen vor dem Hintergrund der Römisch-Katholischen Kirche. | Die Verengung des Heils auf "die Kirche" und auf "die Bibel". | Die christliche Mission unter den Kelten vor der Konstantinischen Wende. | Die Linie des Johannes, Apostel des Lichts: Koptische Kirche, Orthodoxe Kirche, Keltische Kirche. | Inhalte des keltischen Christentums: Das Gute überall, Gottes Transparenz im normalen Leben, Flache Organisation, Weisheit als hohes Gut. | Es gibt Raum innerhalb des christlichen Stromes für die, die in Konflikt mit den gängigen Formen des christlichen Glaubens in Westeuropa sind.
Am 16. Juli des Jahres 1054 ereignete sich in Konstantinopel etwas, das die Geschichte des Christentums für immer verändern sollte. Das Morgenländische Schisma nahm an diesem denkwürdigen Tag seinen Anfang. Der Papst und die Katholische Kirche des Westens auf der einen, die Orthodoxe Kirche des Ostens auf der anderen Seite überwarfen sich miteinander. Die Einheit des Christentums war damit ein für alle Mal Geschichte, die Unterschiede zwischen den beiden Kirchen gehen seitdem nur noch weiter auseinander und eine Wiedervereinigung scheint auch heute noch kaum vorstellbar. Zumindest wird die Geschichte dieses radikalen Bruchs gerne so erzählt. Doch ist das wirklich so einfach? Kann man das Schisma zwischen Ost und West wirklich auf einen einzigen Tag datieren? Melde dich hier für den Déjà-vu Newsletter an. Hier kannst du Déjà-vu Geschichte finanziell unterstützen. Wie so oft in der Geschichte, kann man das in Wirklichkeit nicht! Die christlichen Kirchen im Oströmischen Reich und die im ehemals Weströmischen Reich entwickelten sich zu diesem Zeitpunkt im 11. Jahrhundert, an dem das Schisma angeblich stattfand, bereits seit Hunderten von Jahren voneinander weg. Es gab seit langem Streitigkeiten um theologische Unterschiede, insbesondere den Streit um das Filioque oder die Natur des Heiligen Geistes. Aber doch sind diese Entwicklungen letzten Endes nur ein kleiner, fast schon unbedeutender Teil der Geschichte. Sie sind nur die sichtbarsten Zeichen einer kulturellen Entfremdung, die lange vor 1054 begann und auch danach noch eine ganze Weile andauerte. Diese Episode findest du auch auf deja-vu-geschichte.de. Dort kannst du mir sehr gerne ein Kommentar hinterlassen, ich würde mich freuen, von dir zu hören! Und wenn dir der Déjà-vu Geschichte Podcast gefällt, abonniere ihn doch bitte in deinem Podcatcher und bewerte ihn auf iTunes! Das hilft mir ungemein, ein bisschen Sichtbarkeit in der großen weiten Welt der Podcasts zu erlangen. Weiterlesen
Die Städtepartnerschaft mit Gabrovo, einer Industriestadt im Herzen der bulgarischen Stara Planina, besteht seit 1996. 2001 unterzeichneten Thun und Gabrovo einen bilateralen Zusammenarbeitsvertrag. In Gabrovo und in Thun wurde eine Koordinationsstelle für die Partnerschaftsprojekte eingerichtet. Im gleichen Jahr wurde auch der Förderverein Thun-Gabrovo ins Leben gerufen, welcher ideell und finanziell städtische wie auch eigene Projekte unterstützt. In der Zwischenzeit ist Bulgarien in der europäischen Union und die Bedürfnisse haben sich verändert. Wenn früher Hilfe in der Not geleistet wurde, geht es heute in erster Linie um den Wissenstransfer, die Förderung kleiner Unternehmen und die Pflege der Freundschaft. Auch die Orthodoxe Kirche darf nach dem Kommunismus wieder aktiv werden und arme Menschen unterstützen. Der Förderverein Thun-Gabrovo organisierte bereits zwei Reisen nach Bulgarien mit Titel: Kirchen, Klöster, Kultur. Das BeO Kirchenfenster vom 20. November um 21 Uhr zeigt einen kurzen Rückblick und eine Darstellung der verschiedenen Vorstellungen, wie es weiter gehen soll. www.thun-gabrovo.ch Hans Stalder
#01 Putin, Kirche und Kreml - Die orthodoxe Kirche in Russland
Staatschef Wladimir Putin und die russisch-orthodoxe Kirche präsentieren sich wechselseitig in harmonischer Zweisamkeit. Eine Allianz, die beiden Seiten nützt, wie ARD-Korrespondent Hermann Krause beschreibt.
Die russisch-orthodoxe Kirche hat Russlands Kultur entscheidend geprägt. Doch seit das Zarenreich im Jahre 988 das Christentum annahm, war die Kirche vielen Wechselfällen ausgesetzt. Autorin: Julia Devlin
Audiovortrag mit einigen Gedanken und Überlegungen zu Rasputin. Einige Infos zum Thema Rasputin als Teil des Esoterik Podcast. Dies ist die Tonspur eines Videos aus dem Youtube Esoterik-Kanal. Autor und Sprecher ist Sukadev Bretz, Gründer von Yoga Vidya. Diese Hörsendung ist erstellt worden als Diktat für einen Artikel im Yoga Wiki Bewusst Leben Lexikon von Yoga Vidya. Sukadev behandelt hier das Wort, den Ausdruck Rasputin und streut einige Yoga Überlegungen mit ein. Was meinst du dazu? Rasputin ist zu verstehen im Kontext mit Esoterik, Heilige, Russland, Mystiker, Christentum, Orthodoxe Kirche. Seminare zum Thema Raja Yoga, positives Denken, Gedankenkraft. Infos zu Klangtherapie Ausbildung. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration mit diesem Esoterik-Vortrag zum Thema Rasputin.
Der hl. Berg Athos und die Orthodoxe Kirche in Rußland
Fri, 1 Jan 1988 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/5259/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/5259/1/5259.pdf Nikolaou, Theodor Nikolaou, Theodor (1988): Der hl. Berg Athos und die Orthodoxe Kirche in Rußland. Spirituelle Impulse. In: Orthodoxes Forum, Vol. 2: pp. 209-226. Katholische Theologie
Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und die Orthodoxe Kirche
Fri, 1 Jan 1988 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/5262/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/5262/1/5262.pdf Nikolaou, Theodor Nikolaou, Theodor (1988): Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und die Orthodoxe Kirche. In: Ordinariats-Korrespondenz des Erzbistums München und Freising, Nr. 21: pp. 6-7. Katholische Theologi