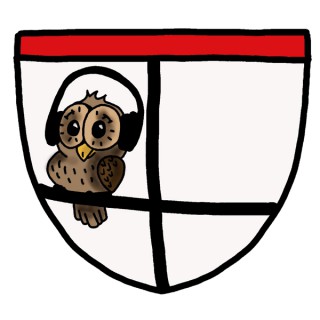Podcasts about wirbeltiere
- 27PODCASTS
- 28EPISODES
- 24mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jan 8, 2025LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about wirbeltiere
#77: Riesen und Zwerge – Speeddating mit den größten und kleinsten Tieren der Welt
Wir machen Speeddating mit unseren persönlichen Favoriten der größten und kleinsten Tiere der Erde. Ellenlange, aber sehr dünne Würmer; schwere, aber eher kurze Krebse; kleine Fledermäuse mit breiten Flügeln; winzige Vögel mit langem Schnabel; und dicke Fische. Ihr merkt schon: Was wirklich klein und was echt groß ist, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Aber als Königinnen des Tierisch-Podcasts lassen wir uns (abgesehen vom Wurmeklat) auf etwaige Diskussionen erst gar nicht ein und binden einfach unser ganz eigenes, buntes Bouquet der spannendsten Riesen und faszinierendsten Zwerge. Und wir finden heraus, was eigentlich gut daran ist besonders groß oder besonders klein zu sein und wo Ende Gelände ist – also wie winzig oder riesig kann man überhaupt werden, um immer noch ein funktionsfähiger Organismus zu sein? Weiterführende Links: Die kleinsten Säugetiere der Welt: https://www.sciencefocus.com/nature/top-10-earths-smallest-mammals Die größten und kleinsten Wirbeltiere: https://www.horniman.ac.uk/story/biggest-smallest-animals/ Wie klein kann man sein und was sind die Vorteile? https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/393620 Die zehn kleinsten Vögel der Welt: https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/birds/smallest-birds-in-the-world Riesenregenwurmprojekt: www.giantearthworm.org.au Der kleinste Frosch der Welt: https://news.mongabay.com/short-article/2024/11/one-of-the-tiniest-frogs-ever-is-discovered-in-brazil-defying-size-limits/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Grönlandhaie können 400 Jahre alt werden und sind damit die ältesten Wirbeltiere der Welt. Forschende aus Deutschland haben jetzt herausgefunden, warum die Haie so alt werden. Unser Kolumnist Thomas Hollmann denkt über lebensverlängernde Maßnahmen nach.
Die Q ist ein Tier | Eine Muhckumentary
Die Q ist ein Tier | Eine Muhckumentary Ob ihr euren Kaffee nun mit herkömmlicher Milch oder Hafermilch genießt, ob ihr zu eurer Ofenkartoffel lieber ein saftiges Steak oder doch lieber Gemüse in die Pfanne werft, liegt ganz bei euch. Doch wenn man bedenkt, dass das deutsche Tierschutzgesetz bereits seit über 50 Jahren existiert und besagt, dass Wirbeltiere nur aus einem "vernünftigen Grund" getötet werden dürfen, stellt sich die Frage, ob unsere Vorliebe für Fleisch einen solchen Grund darstellt. Dies ist eine Frage, die in einem Dokumentar- oder Essayfilm ausführlich behandelt werden könnte. Doch "Die Q ist ein Tier", der am 16. Mai startet, wählt einen anderen Ansatz. Welchen genau, erfahrt ihr von Schlogger, Till und Werner in unserer Besprechung. Drückt einfach auf Play, denn der Play-Button ist dafür da, um gedrückt zu werden. Viel Spaß mit der neuen Folge vom Tele-Stammtisch! Trailer Wir liefern euch launige und knackige Filmkritiken, Analysen und Talks über Kino- und Streamingfilme und -serien - immer aktuell, informativ und mit der nötigen Prise Humor. Website | Youtube | PayPal | BuyMeACoffee Großer Dank und Gruß für das Einsprechen unseres Intros geht raus an Engelbert von Nordhausen - besser bekannt als die deutsche Synchronstimme Samuel L. Jackson! Thank you very much to BASTIAN HAMMER for the orchestral part of the intro! I used the following sounds of freesound.org: 16mm Film Reel by bone666138 wilhelm_scream.wav by Syna-Max backspin.wav by il112 Crowd in a bar (LCR).wav by Leandros.Ntounis Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen Folgt uns ab sofort regelmäßig live auf Twitch: twitch.tv/dertelestammtisch
Vom Weißkopfseeadler über Koala und Löwe bis zum Regenwurm: Wenn wir uns über Emojis ausdrücken wollen, dann steht uns dafür eine ganze Reihe tierischer Symbole zur Verfügung. Nicht genug - lautet allerdings das Urteil eines italienischen Forschungsteams. In einer Studie haben Sie die Artenvielfalt in "Emojipedia", einem Online-Nachschlagewerk für Smileys und Co., analysiert. Das Ergebnis: Während Tiere recht gut vertreten sind, sind vor allem Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen stark unterrepräsentiert. Und auch einige Tiergruppen sind nur oberflächlich dargestellt: Während Weißkopfseeadler und Koala klar erkennbar sind, fehlt es an Insekten und Spinnentieren. Dabei gibt es viel mehr Gliederfüßer als Wirbeltiere in der Natur. Für die Forschenden steht fest: Mehr Artenvielfalt bei den Emojis würde mehr Menschen für Artenschutz sensibilisieren. | Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.
Vom Weißkopfseeadler über Koala und Löwe bis zum Regenwurm: Wenn wir uns über Emojis ausdrücken wollen, dann steht uns dafür eine ganze Reihe tierischer Symbole zur Verfügung. Nicht genug - lautet allerdings das Urteil eines italienischen Forschungsteams. In einer Studie haben Sie die Artenvielfalt in "Emojipedia", einem Online-Nachschlagewerk für Smileys und Co., analysiert. Das Ergebnis: Während Tiere recht gut vertreten sind, sind vor allem Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen stark unterrepräsentiert. Und auch einige Tiergruppen sind nur oberflächlich dargestellt: Während Weißkopfseeadler und Koala klar erkennbar sind, fehlt es an Insekten und Spinnentieren. Dabei gibt es viel mehr Gliederfüßer als Wirbeltiere in der Natur. Für die Forschenden steht fest: Mehr Artenvielfalt bei den Emojis würde mehr Menschen für Artenschutz sensibilisieren. | Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.
Vom Weißkopfseeadler über Koala und Löwe bis zum Regenwurm: Wenn wir uns über Emojis ausdrücken wollen, dann steht uns dafür eine ganze Reihe tierischer Symbole zur Verfügung. Nicht genug - lautet allerdings das Urteil eines italienischen Forschungsteams. In einer Studie haben Sie die Artenvielfalt in "Emojipedia", einem Online-Nachschlagewerk für Smileys und Co., analysiert. Das Ergebnis: Während Tiere recht gut vertreten sind, sind vor allem Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen stark unterrepräsentiert. Und auch einige Tiergruppen sind nur oberflächlich dargestellt: Während Weißkopfseeadler und Koala klar erkennbar sind, fehlt es an Insekten und Spinnentieren. Dabei gibt es viel mehr Gliederfüßer als Wirbeltiere in der Natur. Für die Forschenden steht fest: Mehr Artenvielfalt bei den Emojis würde mehr Menschen für Artenschutz sensibilisieren. | Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.
Vom Weißkopfseeadler über Koala und Löwe bis zum Regenwurm: Wenn wir uns über Emojis ausdrücken wollen, dann steht uns dafür eine ganze Reihe tierischer Symbole zur Verfügung. Nicht genug - lautet allerdings das Urteil eines italienischen Forschungsteams. In einer Studie haben Sie die Artenvielfalt in "Emojipedia", einem Online-Nachschlagewerk für Smileys und Co., analysiert. Das Ergebnis: Während Tiere recht gut vertreten sind, sind vor allem Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen stark unterrepräsentiert. Und auch einige Tiergruppen sind nur oberflächlich dargestellt: Während Weißkopfseeadler und Koala klar erkennbar sind, fehlt es an Insekten und Spinnentieren. Dabei gibt es viel mehr Gliederfüßer als Wirbeltiere in der Natur. Für die Forschenden steht fest: Mehr Artenvielfalt bei den Emojis würde mehr Menschen für Artenschutz sensibilisieren. | Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.
Nicht nur auf der Erde windet es, auch die Sonne sorgt für Wind. Doch was treibt ihn an? Zudem: Es gibt sie also wirklich, die Hirnzellen mit zwei Berufen. Und: Warum mehr Wirbeltiere aus Asien den Sprung nach Australien geschafft haben als umgekehrt. (00:40) Hirnzellen der anderen Art In unserem Gehirn herrscht strikte Arbeitsteilung zwischen den Zellen. Die einen Hirnzellen sind die Quasselstrippen. Die andern sind die Handwerker. Neuronen und Gliazellen eben. Das war lange die Lehrmeinung. Doch jetzt ist einem Westschweizer Forschungsteam erstmals der Nachweis gelungen: In unserem Gehirn gibts auch Zellen mit zwei Berufen. Gliazellen, die sowohl kommunikativ wie fleissig sind. (06:46) Meldungen Fälle von Dengue-Fieber am Gardasee. Erstmals menschliche Nieren in Schweinen gezüchtet. Breitmaulnashörner sollen in Afrika ausgewildert werden. (12:38) Rätselhafte Wallace-Linie Auf Bali leben keine Kakadus, auf der Nachbarinsel Lombok aber schon. Bereits dem britischen Naturforscher Alfred Russel Wallace ist Mitte des 19. Jahrhunderts die scharfe Trennung verschiedener Arten im indonesischen Inselarchipel aufgefallen. Nun scheint endlich klar, was dahintersteckt. (18:30) Was den Sonnenwind antreibt Auch die Sonne hat ihren Wind – ein Strom aus elektrisch geladenen Teilchen. Auf der Erde kreieren diese Sonnenteilchen romantische Polarlichter; sie können aber auch Satelliten zerstören und Stromausfälle verursachen. Nun haben Forschende ein grosses Geheimnis des Sonnenwinds gelüftet: was ihn antreibt.
#86 - Biodiversität: Warum wir darüber sprechen müssen | Janosch Birkert (EYCarbon)
Die Klimakrise ist jeden Tag präsent und die Reduktion von CO2-Emissionen ist heute in den Fokus vieler wirtschaftlicher Bestrebungen gerückt. Was dabei jedoch zu kurz kommt: Wir zerstören unseren Planeten noch auf andere Art und Weisen, v. a. im Bereich Biodiversität. Heute leben 60 Prozent weniger Wirbeltiere auf der Erde als 1970. In Deutschland ist die Anzahl an Fluginsekten ist in den letzten 30 Jahren um mindestens 75 Prozent zurückgegangen. Was können wir tun, um den Verfall zu stoppen? Antworten auf diese und weitere Fragen geben Dirk und Neu-Host Fabian im Gespräch mit Janosch Birkert (Lead, EYCarbon Deutschland). Freut euch auf folgende Themen: 03:33 - Janosch, stell' dich doch gerne einmal vor 05:16 - Was gehört alles zu Biodiversität? 08:26 - Warum müssen sich Unternehmen mit dem Thema beschäftigen? 13:42 - Wieso ist der Fokus derart stark auf CO2-Emissionen statt auf Biodiversitäts-Auswirkungen? 16:34 - Vorteil für Unternehmen, die Biodiversität fördern 18:59 - Welche konkreten Maßnahmen werden bereits umgesetzt? 22:32 - Wie wird Biodiversität im Bereich Financial Services berücksichtigt? 28:08 - Welche regulatorischen Vorschriften gibt es? 35:31 - Welche konkreten KPIs gibt es bzw. sind geplant? Ihr wollte mehr zum Thema erfahren und mit Expert:innen darüber diskutieren? - Dann sichert euch noch heute euer Ticket für das IMPACT FESTIVAL am 13. & 14. September 2023: IMPACT FESTIVAL - Tickets. Mehr Informationen findet ihr zudem in folgenden Report von EY: Next Stop: Biodiversity – Warum sie zur Unternehmensstrategie gehört. Ihr habt Feedback, Speaker-Wünsche oder Themenvorschläge für unseren Podcast? - Schreibt diese gerne an talk@between-the-towers.de. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen! - Abonniert uns direkt hier oder folgt uns auf LinkedIn, um keine Episode zu verpassen.
Ihr habt euch in den letzten Impulsen zeichnerisch an verschiedenen Insekten und Spinnentieren versucht. In der Kette der Tiere steht die Spinne in der Evolutionsgeschichte hinter den Insekten. Spinnentiere haben acht Beine und Insekten haben sechs Beine, das ist in gewisser Hinsicht ein evolutionärer Fortschritt. So wenden wir uns in diesem Impuls der nächsten evolutionären Stufe zu: den Amphibien und im Speziellen dem Frosch. Was zeichnet die Amphibien aus? Das ist eine sehr spannende Frage, vor allem, wenn wir uns dann weiter in Richtung nächster Stufe hangeln: das wären nach den Amphibien die Reptilien. Amphibien sind jedenfalls Wirbeltiere, sie haben eine Wirbelsäule wie wir Menschen. Wer gehört dazu? Zum Beispiel Salamander, Lurche, Kröten, Frösche, damit sind die Amphibien gemeint.
Zähne sind ideale Werkzeuge für das Zerkleinern von höchst unterschiedlicher Nahrung: Tiere können mit ihnen Gräser zu Brei zermahlen, Nussschalen aufbrechen oder Fleischstücke aus ihrer Beute reißen. Für den Siegeszug der Wirbeltiere rund um die Welt war die Entwicklung eines spezialisierten Gebisses ein entscheidender Erfolgsfaktor. Autorin: Prisca Straub
Der Grönlandhai - Das langlebigste bekannte Wirbeltier der Welt
Grönlandhaie werden bis zu 600 Jahre alt und sind damit die ältesten bekannten Wirbeltiere. Sie sind auch sehr langsam, sie schaffen nur rund drei Stundenkilometer. Ob sie gefährdet sind, weiß man nicht. Mit der Eisschmelze in der Arktis nimmt aber die Fischerei und damit die Bedrohung ihres Lebensraums zu. Autorin: Brigitte Kramer
Hach, was sind sie groß geworden..Wale haben sich zu den größten Säugetieren der Welt gemausert. Aber das hätten sie nie geschafft, wenn sie nicht wortwörtlich “in ihrem Element” wären. Vor ca. 60 Mio. Jahren sind sie vom Land ins Wasser gewechselt, haben sich von landlebenden Paarhufern zu Meeresbewohnern entwickelt. Welche anatomischen Besonderheiten für das Leben im Wasser nötig waren und warum Wale unersetzlich für das Ökosystem Meer sind - das erfährt Host Lukas Klaschinski von Dr. Oliver Hampe, Biologe und Experte für marine Wirbeltiere. Dieser Podcast entsteht in freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH und wurde 2021 als Bester Podcast mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Podcast und Museum gibt es auf: www.museumfuernaturkunde.berlin/beatsandbones
Kommunikation - Die Geräusche der frühen Wirbeltiere
Schröder, Tommawww.deutschlandfunk.de, Forschung aktuellDirekter Link zur Audiodatei
Living Planet Report 2022 - WWF: Drastischer Rückgang von Wirbeltierbeständen
Die Bestände wildlebender Wirbeltiere sind in den vergangenen 50 Jahren durch Umweltbelastungen stark geschrumpft. Dies geht aus einem Bericht des Umweltverbands WWF hervor. Besonders dramatisch ist laut demnach die Situation in Südamerika.Fecke, Brittawww.deutschlandfunk.de, Umwelt und VerbraucherDirekter Link zur Audiodatei
Das West-Nil-Virus kommt vor allem in wildlebenden Vögeln vor. Es kann aber auch von Mücken auf Pferde und Menschen übertragen werden. In der Schweiz wurde das West-Nil-Virus bei einheimischen Mücken erstmals im August 2022 im Tessin festgestellt. Das West-Nil-Fieber ist eine virale Erkrankung, welche hauptsächlich bei Vögeln auftritt. Sie kann aber auch auf Menschen, Säugetiere und andere Wirbeltiere übertragen werden. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über Stechmücken. Besonders betroffen vom West-Nil-Virus waren in den letzten Jahren Pferde. Menschen können sich weder bei erkrankten Personen noch bei Tieren direkt anstecken. Erkrankungen von Menschen und Pferden sind in der Schweiz bis heute (Stand September 2022) nicht nachgewiesen worden.
Meerestiere in grausamer Gefangenschaft: Im Gespräch mit Robert Marc Lehmann
Zoos, Sensationsgier und Artenschutz. Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) zählt allein in Deutschland 56 Zoos. Hinter Glas und Gittern werden in jedem einzelnen davon schätzungsweise 2330 Wirbeltiere in 270 verschiedenen Arten gehalten. Geht es den Tieren im Zoo gut? Manches Argument dafür klingt so: „Ja, denn Tiere können froh sein, wenn sie im Zoo und nicht in freier Wildbahn leben. Hier haben sie regelmäßiges Futter und keine Fressfeinde, außerdem stehen Tierärzt*innen immer bereit.“ Doch unser Gast der heutigen Folge klärt auf, wie schlecht es Tieren in Gefangenschaft wirklich geht. Gemeinsam mit Robert Marc Lehmann, dem gelernten Meeresbiologen und Forschungstaucher, erkunden wir, woher die Tiere in unseren Zoos kommen und wie die Arbeit hinter den Kulissen aussieht. Dabei konzentrieren wir uns im heutigen OCEAN CRIME auf Fisch vom Malawibuntbarsch bis zum Katzenhai. Tauch mit ein in den erschreckenden Kosmos, der wirtschaftliches Interesse und Sensationsgier vor jegliches Tierwohl stellt. Wie verwerflich sind Zoos wirklich? Was sind die Pro-Zoo-Argumente, und werden sie wissenschaftlich und ethisch geprüft? Buch „Mission Erde – Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen“: https://missionerde.shop/products/das-buch-mission-edre-die-welt-ist-es-wer-um-sie-zu-kampfen Mission Erde EV: https://missionerde.de Instagram Robert Marc Lehmann: https://www.instagram.com/robertmarclehmann/ ___ Schenke OCEAN CRIME deine Stimme beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcast Preis: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/ocean-crime/ ___ Mehr über BRACENET:
Zu den Geheimnissen der Evolution gehört die Tatsache, dass die Architektur im Gehirn aller Wirbeltiere, also auch von uns Menschen, bisexuell ist. Während sich im Äußeren die Geschlechtsmerkmale deutlich unterscheiden, sind sie auf der Landkarte des Gehirns, also in ihren Abbildungen in den Milliarden Neuronen im Kopf, fast nicht zu unterscheiden. Einige dieser Rätsel der Evolution dürfen aus ethischen Gründen nicht am Menschen selbst untersucht werden. Ein herausragend geeignetes Tier für die paläobiologischen und biologischen Untersuchungen ist ein sehr kämpferisches, bewegliches, intelligentes und aggressives Lebewesen, das zu unseren Vorfahren zählt: die etruskische Zwergspitzmaus. Sie ist körperlich so klein, dass sie, um die Hitze ihres Körpers auszubrüten, permanent jagen und fressen muss. Für die Navigation ihrer extrem raschen Bewegungen ist die Empfindlichkeit ihrer Barthaare entscheidend. Schaltungen zwischen Körper und Geist, die bei großen Lebewesen wie den Elefanten oder uns Menschen stark verlangsamt und gelegentlich verkümmert sind, sind bei diesen Winzlingen in vivo und mit allen Attributen der "Not, die erfinderisch macht" zu beobachten. Prof. Dr. Michael Brecht, Wissenschaftler am Bernstein Zentrum für Computational Neuroscience und der Humboldt-Universität zu Berlin, führt auf eine Forschungsreise in die Landschaften des Körpers, wie sie sich im Gehirn darstellen: "Die Innenausstattung von Angriffsgeist, Intelligenz und Feinsteuerung". Erstausstrahlung am 04.10.2016
Landgang der Wirbeltiere - Wie viel Lungenfisch steckt in uns?
Fische gehören zu unseren frühesten Vorfahren. Neue Genomanalysen zeigen jetzt, wie manche von ihnen vor rund 400 Millionen Jahren Lungen und Beine entwickelten, um an Land zu gehen.
#144: Warum fast alle Tiere symmetrisch aufgebaut sind
Wie erkläre ich’s meinem Kind? (Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ)
Die meisten Wirbeltiere sehen auf ihrer rechten und ihrer linken Seite annähernd gleich aus. Das scheint sich in der Evolution bewährt zu haben. Warum ist das so? Und was ist mit den Ausnahmen?
Mitten in Basel, unweit des Zolli-Hautpeingangs, liegt ein kleines Stückchen Australien. Dort, auf der Australis-Anlage, sind die Kängurus zu Hause. Genau genommen: die Westlichen Grauen Riesenkängurus. Ihr Pfleger Marc Brandenberger erzählt, wie er im Alltag mit den scheuen, aber imposanten Tieren umgeht, wie Bananen seine Beliebtheit steigern, und wie er merkt, dass ein Känguru Nachwuchs im Beutel hat. Kurator Adrian Baumeyer erklärt, wie die Jungen im Beutel von der Grösse eines Gummibärchen zu kleinen Kängurus heranwachsen und weshalb Kängurus lieber hüpfen statt laufen. Weshalb es Kängurus nur in Australien gibt, weiss Loic Costeur vom Naturhistorischen Museum Basel. Er ist Leiter der Abteilung Geowissenschaften und Kurator der Wirbeltiere. Für seine Erklärungen reist er gedanklich 100 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Ebenso zu Gast in dieser Sendung ist der Tierzahnarzt Stefan Grundmann von der Universität Zürich. Er wird dann in den Zolli gerufen, wenn ein Känguru eine dicke Backe hat. Er erzählt, wie knifflig es ist, ein Känguru auf den Behandlungstisch zu bekommen und weshalb die Zahnbehandlung bei einem Känguru ein grösseres Unterfangen ist. «Zolli-Radio» – der Podcast aus dem Zoo Basel.
Steffen, warum ich dich heute um Rat frage: Mein fast zweijähriger Sohn kennt zwar alle Namen der Kinder in seiner Kitagruppe, aber wenn ich ihn frage, welche Farbe ein Auto hat, dann kann er auch nach der 50. Erklärung, was Rot ist und was Blau, die Farben nicht unterscheiden. Als besorgte Mutter, die ihr Kind sowieso für hochbegabt hält, habe ich sofort gegoogelt und herausgefunden, dass Menschen erst mit zwei oder manche erst mit vier Jahren in der Lage sind, Farben zu unterscheiden. Warum ist das so? Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass die Zellen, die im Auge für die Farbwahrnehmung zuständig sind, die sogenannten Zäpfchenzellen, sich offenbar etwas später entwickeln als die Stäbchenzellen. Mit denen können wir einfach nur Hell-Dunkel-Unterschiede wahrnehmen, sie sind dafür aber sehr viel empfindlicher. Hinzu kommt, dass wir von diesen Zäpfchenzellen drei verschiedene Typen haben, die für jeweils verschiedene Wellenlängenbereiche, also Lichtfarben, zuständig sind. Und die für das kurzwelligste, also die für Blau, entwickeln sich etwas später als die anderen. Und dann muss natürlich das Gehirn, das ja eh schon eine ganze Menge in der Zeit lernen muss, außerdem auch noch lernen, mit diesem neuen Reiz umzugehen. Also muss ich mir keine Sorgen machen, dass mein Sohn farbenblind ist? Nicht zwangsläufig. Andererseits ist der wunde Punkt: Die Rot-Grün-Farbenblindheit ist eine Spezialität von Jungs. Warum ist das so? Weil die Gene für die lichtempfindlichen Farbstoffe in den Zäpfchenzellen dummerweise auf dem X-Chromosom liegen. Menschen, die zwei X-Chromosomen haben, haben zwangsläufig die Möglichkeit, mit einem intakten Gen das andere zu übertönen. Wenn sie aber nur eins davon haben, wie biologische Jungs, dann haben sie diese Möglichkeit nicht. Und was hat sich die Evolution dabei gedacht, dass Frauen, was die Farbwahrnehmung angeht, einen Vorteil haben? Das ist eine interessante Frage. Es hat schon lange gedauert, bis wir eine gute Theorie dafür hatten, warum Menschenaffen, zu denen wir zählen, überhaupt Rot und Grün unterscheiden können. Das können die anderen Wirbeltiere in der Regel nicht. Und die wichtigste Idee ist, dass in dem Gebiet, wo sich die modernen Menschen herausgebildet haben, der feine Unterschied nützlich war, zwischen reifen und unreifen Früchten unterscheiden zu können. Dann gibt es noch was total Irres: Leute, die Wochentage mit Farben verbinden. Die Synästhetiker, bei denen ist offenbar im Gehirn was anders verschaltet. Viele Leute, die sich berufsmäßig mit Düften beschäftigen, sind oft Synästhetiker, da gibt es wohl einen Zusammenhang.
Mit der Mutterblume fest in der passiv-aggressiven Wutbürger-Hand und dem maximalen Glimmer in der Krone, packen die Ostsee-Perlen heute die gefüllten Kinderwindeln zu ihren verworrenen Narkose-Träumen in ein blickdichtes Hundekottütchen, bevor sie im Partnertausch-Game mit einem alten Rummelpott-Schlager auf den Lippen eine zünftige Flaschenpost leeren. Nach dem Motto „das Schwein muss schwimmen“ treffen sie beim YouTube-„Blind Date“ lieber auf die Exkremente eines Vogels, als auf entlaufenen Aal oder Wirbeltiere in Knoblauch. Außerdem gehen sie mit Bibi & Tina zur Deutsch-Nachhilfe und mit dem Gruselclown und dem Wüstenrotfuchs zum trendigen Kescher-Betteln durch die angespannte Nachbarschaft. Wichtig: Nicht nur die Gartenmöbel rein- und rausstellen, sondern vorher prüfen, ob der Esel auch über die Brücke geht.
Metastasen - große Gefahr bei Krebs: Metastasierung von Tumoren verhindern
Wenn Krebszellen sich im Körper ausbreiten, können Tochtergeschwülste, sogenannte Metastasen, entstehen. Diese sind für etwa 90 Prozent der Todesfälle bei Krebspatienten verantwortlich. Ein wichtiger Ausbreitungsweg der Krebszellen verläuft über das Lymphgefässsystem, das, ähnlich wie das Blutgefässsystem, den ganzen Körper durchzieht und Lymphknoten miteinander verbindet. Bei der Wanderung von weißen Blutzellen durch dieses System, um beispielsweise die Abwehr von Krankheitserregern zu koordinieren, spielt ein spezielles Membranprotein, der Chemokin-Rezeptor 7 (CCR7), eine wichtige Rolle. Dieser sitzt in der Hülle der Zellen, der Zellmembran, und zwar so, dass er äussere Signale empfangen und diese in das Innere weiterleiten kann. Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Pharmaunternehmen F. Hoffmann-La Roche AG (Roche) haben Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI erstmals die Struktur von CCR7 entschlüsseln und den Grundstein für die Entwicklung eines Medikaments legen können, das die Metastasierung bestimmter häufiger Krebsarten wie Darmkrebs verhindern könnte. In den Zellen aller Wirbeltiere kommen 20 verschiedene Chemokin-Rezeptoren vor, die mit mehr als 40 Signalproteinen, sogenannten Chemokinen, interagieren können. Jedes dieser Signalproteine passt nur zu ganz speziellen Rezeptoren. Bindet eines der Signalproteine an einen Rezeptor, löst das wiederum Prozesse innerhalb der Zelle aus, die zu einer spezifischen zellulären Antwort auf das Signal führt. Paul Scherrer Institut PSI/Christina Bonanati Lesen Sie den gesamten Beitrag auch auf MEDIZIN ASPEKTE Originalpublikation: Structural basis for allosteric ligand recognition in the human CC chemokine receptor 7 K. Jaeger, S. Bruenle, T. Weinert, W. Guba, J. Muehle1, T. Miyazaki, M. Weber, A. Furrer, N. Haenggi, T. Tetaz, C. Huang, D. Mattle, J.-M. Vonach, A. Gast, A. Kuglstatter, M.G. Rudolph, P. Nogly, J. Benz, R.J.P. Dawson, J. Standfuss Cell, 22. August 2019 (online) DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2019.07.028
Fische sind aquatisch lebende Wirbeltiere mit Kiemen. In der Systematik sind Fische paraphyletisch, daher sind sie eine Gruppe morphologisch aehnlicher Tiere. Im engeren Sinne sind Fische die nicht zu den Landwirbeltieren gehoerenden Kiefermaeuler. Die aeltesten bekannten kieferlosen Fischartigen stammen aus dem fruehen Ordovizium, die Knorpelfische tauchen ab Grenze Silur/Devon vor etwa 420 Millionen Jahren auf. Und nun zu etwas voellig anderem...
Artikel lesen: http://www.hanf-magazin.com/medizin/cannabinoide/die-funktion-der-endocannabinoide/ „Jedes höhere Lebewesen verfügt über ein Endocannabinoid-System“ begegnet einem als Aussage häufiger. „Höheres Leben“ ist als Begriff jedoch nicht eindeutig definiert und meint in diesem Fall alle Wirbeltiere und weiteres gewebebildendes Getier. Auch Blutegel und andere Weichtiere oder Krustentiere haben dieses Endocannabinoid-System. Sie schütten ebenfalls Endocannabinoide aus, die an Cannabinoid-Rezeptoren einen Reiz und damit Wirkung auslösen. Endocannabinoide sind Botenstoffe beziehungsweise Neurotransmitter.
Wir blicken in der heutigen Folge nochmal auf Themen aus vorangegangenen Episoden zurück. Wir greifen da im Speziellen die Malariabekämpfung und das Anthropozän nochmal auf. Bei den Wissenschaftsnachrichten haben wir diesmal aktuelle Publikationen und Neuigkeiten aus den Fachbereichen Sprach- & Kulturforschung, Paläontologie, Materialforschung zum Thema Graphen, Medizin/Immunologie und eine Studie zur Gesundheit von Honigbienen im Gepäck. Im Anschluss gibt Katrin noch Einblicke in ihre Sichtweise auf die Bioinformatik: die Tücken des wissenschaftlichen Alltags und das digitale Laborjournal. Und weil das hier eine Geburtstagsfolge ist, gibt es Kuchen. Naja, ohne Boden. Viel Spaß beim Hören!
Evolution mikrobieller Pathogenität: Salmonella Pathogenitätsinsel 2 als Paradigma für horizontalen Gentransfer
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Diese Arbeit setzt sich mit den molekularen Mechanismen der Evolution von Virulenzfaktoren in Salmonella auseinander. Es wurde ein auf Sequenzvergleichen basierendes Verfahren eingesetzt, um neue lateral erworbene Elemente zu identifizieren, die möglicherweise Hinweise auf die Entwicklung von Virulenz und Wirtsspezifität innerhalb der Gattung Salmonella geben können. Mit Hilfe genetischer Analysen sollte darüber Aufschluss gewonnen werden, auf welche Weise diese genetischen Elemente in neue Wirtsgenome gelangen können. Des Weiteren wurde anhand der Salmonella Pathogenitätsinsel 2 (SPI2) nach möglichen Vehikeln und Transfermechanismen für den horizontalen Gentransfer gesucht. Es wurde analysiert, wie neu erworbene genetische Elemente in das regulatorische Netzwerk neuer Wirte integriert werden können und ob es Zusammenhänge zwischen der genetischen Ausstattung mit Virulenzmodulen und der Wirtsspezifität verschiedener Salmonella-Serotypen gibt. Dabei wurde festgestellt, dass einzelne Effektoren des SPI2-Virulons, die zum Teil außerhalb des SPI2-Locus im Genom kodiert sind, sehr heterogen innerhalb von Salmonella spp. verteilt sind. Diese Variabilität kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass sich diese Faktoren nicht als ein initialer Komplex in der „Ur-Salmonella“ manifestiert haben, wie es im Invasions-Virulon von SPI1 der Fall ist. Vielmehr sind die SPI2-Effektoren vermutlich in mehreren Schritten im Laufe der Evolution in das Genom von Salmonella spp. gelangt und möglicherweise auch z.T. wieder deletiert worden. Die Bedeutung der Verteilung dieser Effektorproteine für die Virulenz und die Wirtsspezifität von Salmonella wird auch dadurch offensichtlich, dass S. bongori als Besiedler kaltblütiger Wirbeltiere keines dieser zum SPI2-Virulon gehörigen Gene besitzt, die im Zusammenspiel das intrazelluläre Replizieren innerhalb warmblütiger Wirbeltiere ermöglichen. Das Kernstück des SPI2-Virulons, das für das intrazelluläre Replizieren und die systemische Ausbreitung von S. enterica im Wirtsorganismus verantwortlich ist, konnte erfolgreich transferiert werden. Der Einbau des SPI2-TTSS im SPI2-negativen System von S. bongori ermöglichte die heterologe Expression von SPI2-abhängigen Genen und die Sekretion von SPI2-Effektorproteinen in vitro. Durch die Etablierung des SifA-Phänotyps und den Nachweis der intrazellulären Lokalisation von SseF konnte gezeigt werden, dass das transferierte SPI2-TTSS zur heterologen Translokation von SPI2-Effektorproteinen aus S. bongori in die eukaryontische Zielzelle in der Lage ist.