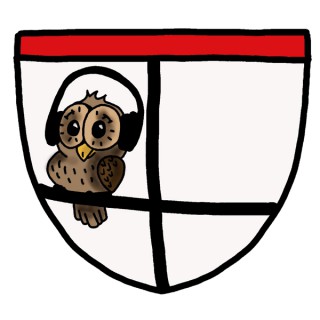Podcasts about bioinformatik
- 41PODCASTS
- 54EPISODES
- 43mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 15, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about bioinformatik
Latest podcast episodes about bioinformatik
Ab in die Zukunft? - Wie Biocomputer mit lebenden Gehirnzellen funktionieren
Ein australisches Start-Up bringt den ersten Computer auf den Markt, der mit menschlichen Gehirnzellen arbeitet. Dienen soll dieser “Biocomputer” zunächst insbesondere der medizinischen Forschung. Doch schon jetzt beäugen Tech-Riesen wie Amazon, Meta, Google und Co. die Technik dahinter. Eine Revolution in der Anwendung künstlicher Intelligenz oder nur eine Idee, die es nie bis in unseren Alltag schafft? BR-Journalist Gregor Schmalzried erzählt in dieser 11KM Folge, wem diese “Biocomputer” wohlmöglich nutzen könnten - und welche technischen und moralischen Grenzen es gibt. Hier geht's zu unserem heutigen Podcast-Tipp: “Der KI-Podcast", unter anderem mit unserem Gast Gregor Schmalzried: https://1.ard.de/der-ki-podcast Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Moritz Fehrle Mitarbeit: Lisa Hentschel, Marc Hoffmann Host: Elena Kuch Produktion: Viktor Fölsner-Veress, Christiane Gerheuser-Kamp und Jürgen Kopp Planung: Caspar von Au und Hardy Funk Distribution: Kerstin Ammermann Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Nicole Dienemann 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR
Was geht ab im Darm? – Mit Datenwissenschaften Mikrobiome verstehen lernen
Das Darmmikrobiom spielt eine zentrale Schlüsselrolle für die Wirksamkeit von Ernährung. Über den Zusammenhang von Ernährung und Datenanalyse spricht Katja Weber in dieser Folge mit Dr. Mattea Müller. Neben ihrer Forschung an der Schnittstelle von Ernährungswissenschaft, Mikrobiomforschung und Bioinformatik stellt Mattea Müller auch das Schulungs- und Vernetzungsprogramm MINT Meets Medicine (M3) vor.
Von Basenpaaren und Bytes: Die unsichtbare Infrastruktur der Genomforschung
Das menschliche Genom umfasst rund drei Milliarden Basenpaare – eine gewaltige Datenmenge, die ohne moderne Technik kaum zu bewältigen wäre. Genau hier kommt die Bioinformatik ins Spiel: Sie hilft dabei, diese Daten zu verarbeiten und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. In dieser Folge ist Camill Kaipf, Software Developer bei GHGA und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, zu Gast. Er erklärt, welche zentrale Rolle die Bioinformatik heute in der Genomforschung spielt, wie man in dieses Berufsfeld einsteigt und warum eine sichere IT-Infrastruktur unverzichtbar ist.
FIR #87 Dr. Saskia Meier-Andrae: ein positives Mindset für erfolgreiches Leadership
Seit Mitte März ist Dr. Saskia Meier-Andrae nach einer beeindruckenden Karriere bei BCG und Wayfair nun General Manager von eBay Deutschland. Ursprünglich ist die Geschäftsführerin studierte Mathematikerin mit einer Promotion in Bioinformatik. Ihr persönlicher Antrieb ist, Lösungen zu finden. Diese Leidenschaft prägt nicht nur ihren beruflichen Werdegang, sondern auch ihren Führungsstil. Darüber hinaus gibt Dr. Saskia Meier-Andrae spannende Einblicke hinter die Kulissen von eBay und die wichtigsten Trends im E-Commerce. Recommerce ist einer davon, den der 100%-Marktplatz seit seiner Gründung umsetzt. Mit 40% generierten Umsatz an Nicht-Neuware scheint eBay das zu gelingen. In dieser Folge mit Dr. Saskia Meier-Andrae und Verena Schlüpmann lernst Du…
Vi forsøger at finde ud af, hvordan menneskets mentale evolutionshistorie mon ser ud. Hvordan er vores psyke, sind eller mentale tilstande blevet skabt? Er vi blevet mere syge, eller er det samfundet, der gør os mere syge? Hvad er formålet med vores hjerner, og hvorfor bliver nogle af os syge på øverste etage? Det taler vi om i to programmer, der er virkelig spændende for os, der plejer at følge nutidens problemer mere end fortidens. Glæd dig til dagens episode, som du nu kan høre i DR Lyd. Vært: Svend Brinkmann. Gæst: Mikkel Heide Schierup, professor ved Aarhus Universitet ved Center for Bioinformatik.
Night Science - Anleitung für Geistesblitze
Ein Vortrag des Bioinformatikers Martin LercherModeration: Katrin Ohlendorf ********** Wissenschaft braucht Kreativität. Ohne Kreativität kein Fortschritt. Aber wo kommt sie her? Der Bioinformatiker Martin Lercher erklärt, wie Forschende auf neue Ideen kommen. Und diese Tools funktionieren nicht nur in der Wissenschaft! Martin Lercher ist Professor für Bioinformatik und Leiter der Arbeitsgruppe Computergestützte Zellbiologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Heißt: Er nähert sich biologischen Fragestellungen mit Informatik. Unter anderem forscht er etwa zur Evolution der Photosynthese oder zum Wachstum biologischer Organismen. Außerdem befasst er sich mit den kreativen Prozessen in der Naturwissenschaft, der sogenannten Night Science. Neben Artikel-Veröffentlichungen zum Thema betreibt er dazu auch zusammen mit Itai Yanai, Professor an der NYC, den Podcast "Night Science".Seinen Vortrag "Night Science – wie kommen Wissenschaftler*innen auf neue Ideen?" hat er am 7. März 2024 auf Einladung der HHU Düsseldorf als Bürgeruniversität gehalten, und zwar im Rahmen der Vortragsreihe "Forschung im Fokus", ein gemeinsames Projekt der HHU als Bürgeruniversität und der Evangelischen Stadtakademie. **********Schlagworte: +++ Wissenschaft +++ Forschung +++ Kreativität +++ Ideen +++ Night Science +++ Day Science +++ Selektive Wahrnehmung +++ Interdisziplinarität +++**********Zusätzliche InformationenBioinformatiker Martin Lercher**********Quellen aus der Folge:Artikelsammlung von Martin Lercher und seinem Kollegen Itai Yanai zu Night ScienceNight-Science-Podcast von Martin Lercher und Itai YanaiVideo: Animation von Heider und Simmel (1944)Video: Test für selektive Wahrnehmung von Daniel SimonsVersuch zur selektiven Wahrnehmung von Martin Lercher und Itai YanaiAlle Quellen findet ihr hier.**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Kreativität: Was Amy Winehouse und Albert Einstein kreativ gemacht hatOrganisationsforschung: Was Unternehmen kreativ machtNeurodiversität: Anders, aber völlig richtig im Kopf**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
Velkommen til en spændende episode om Teal Dots i Roche. Erik har inviteret Morten Lindow i studiet for at fortælle om den teal dot han er en del af i Roche og hvordan de hele tiden udvikler deres måde at arbejde på i RNA. Morten og Erik kommer bl.a. ind på:Hvorfor har de lavet en RNA-teal dot og hvordan hænger det sammen i pharma branchen. Hvordan har de struktureret sig som teal dot omkring ledelse, cirkler, portfolier, rytmer og principper. Hvordan sammenspillet med andre afdelinger er og hvem der bestemmer hvem der bestemmer. Episodens Gæst: Morten Lindow har en Ph.d. i Bioinformatik fra Københavns Universitet, og er nu RNA Strategy Lead i Roche. Tidligere har han arbejdet i Santaris og Lundbeck, og hans interesse for biologi og informatik er tydelig. Parallelt med det videnskabelige arbejde har Morten i stigende grad kastet sig over New Ways of Working, moderne leadership og organisatorisk design, hvilket var et af de store omdrejningspunkter for etableringen af den såkaldte “RNAHub” i Basel, hvor Roche har hovedkvarter.
Et fodspor på en halv meters længde på en slette i Afrika tyder på, at der har været en elefant forbi. Men moderne biologi har også adgang til genetiske spor, som fortæller en hel masse mere om elefanten og alle dens forgængeres oprindelse og udvikling. Kortlægning af arters genom er i fuld gang med at opklare gamle mysterier, og den nye viden kan bruges til fremtidig naturbeskyttelse. Samtidig sladrer forskningen om, hvordan vores egen udgave af et stort pattedyr har fortrængt de andre. Medvirkende: Rasmus Heller, lektor på Institut for Biologi på Københavns Universitet, Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi. Værter: Biologerne Johan Olsen og Vicky Knudsen. Radiohund og ret lille pattedyr: Gunnar. Producer: Carsten Nielsen.
KI-Update kompakt: Arbeitsmarkt, Prompt2Model, Bioinformatik-Code, Bargainer.ai
Bis 2035 kein Arbeitsplatz mehr ohne KI Automatisierte Sprachmodelle mit Prompt2Model Benchmark für KI-generierten Bioinformatik-Code Und spielerisch das Verhandlungsgeschick mit ChatGPT testen heise.de/ki-update https://www.heise.de/thema/Kuenstliche-Intelligenz https://the-decoder.de/ https://www.heiseplus.de/podcast
#390 Daniel Steinhöfer | Berater, Trainer, Agil Coach und Autor von “Liberating Structures”
Unser heutiger Gast hat zunächst Bioinformatik mit den Schwerpunkten Genomanalyse und Proteinvorhersage an der TUM studiert. Ebenfalls in München, aber an der Ludwig-Maximilians Universität, hat er dann Informatik und im Nebenfach Biologie studiert und als Diplom-Informatiker mit der Note 1 abgeschlossen. In seinem früheren Leben - so beschreibt er es heute - war er begeisterter Softwareentwickler. Seit vielen Jahren berät er als Agile Coach und Trainer Großunternehmen. Seine berufliche Heimat für seine Arbeit hat er seit über 14 Jahren bei der Holisticon AG gefunden. Er ist außerdem Autor von “Liberating Structures - Entscheidungsfindung revolutionieren”. Er zählt zu den Vorreitern dieses unserer Ansicht nach noch viel zu unbekannten Methoden-Baukastens in Deutschland, und er arbeitet dabei ganz eng mit Keith McCandless und Henri Lipmanowicz, den Begründern dieser Methode zusammen. Es wundert wenig, dass es die Mission unseres heutigen Gastes ist, möglichst viele Menschen mit Liberating Structures zu infizieren. Er ist überzeugt davon, dass Liberating Structures uns helfen können, wertschätzender und zielführender miteinander zu wirken. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt - statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von “New Work” wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie sehr müssen wir unseren Toolbaukasten bei der Entwicklung von Ideen und bei der Findung von Entscheidungen weiter entwickeln und welche Rolle kann dabei ein Ansatz wie “Liberating Structures” spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen! Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work - heute mit Daniel Steinhöfer.
KI-Update kompakt: New York Times vs. KI, LLM-Politik, Open-Source-Datensatz für die Bioinformatik
Unsere Themen: New York Times schützt ihre Inhalte vor KI-Unternehmen ChatGPT von OpenAI und LLaMA von Meta haben unterschiedliche politische Ausrichtungen OpenProteinSet bringt gigantischen Open-Source-Datensatz für die Bioinformatik Google untersucht das Grokking-Phänomen im KI-Training
Wofür braucht man eigentlich ein Referenzgenom? In der Genomforschung geht es um die Analyse unseres genetischen Codes. Die Abfolge der DNA-Basen ist bei jedem Mensch anders und es sind gerade diese Unterschiede, die besonders spannend sind. Sie zu verstehen hilft Forschenden herauszufinden, was im Code wo kodiert ist und welche genetischen Varianten möglicherweise krankmachende Effekte nach sich ziehen. Um Unterschiede zu erkennen ist es notwendig, Genome zu vergleichen. Aber wie vergleicht man Genome sinnvoll und was ist eigentlich der Maßstab dafür, wie ein Genom aussehen kann? Professor Tobias Marschall und Jana Ebler erklären, was ein sogenanntes Referenzgenom ist und machen deutlich, warum der pangenomische Ansatz heutzutage der richtige ist.
Marcel Roth spricht mit Uwe Scholz vom IPK aus Gatersleben und mit Elsa Kirchner von der Uni Duisburg-Essen über Bioinformatik, Genetik, Cyborgs und Gehirn-Computer-Schnittstellen. Wie digital wird das Leben?
[Best of] Bioinformatik 3: Sammenhæng mellem køn, livsstil og gener
Denne tredje podcast om bioinformatik handler om forskelle mellem kønnene, om alle de parametre i vores liv, som gør at vi overlever en krise på intensivafdelingen eller ej, om hvad der har mest indflydelse - livsstil, medicin eller gener, og hvorfor man er begyndt at give personnumre til danskere som er født for 200 år siden. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Københavns Universitet i dette tredie og sidste program, i en serie om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
Det har vist sig at genernes funktioner er langt mere kompliceret end forskerne først troede. Nu ved vi at en funktion ikke nødvendigvis stammer fra et enket gen, men kan være en kombination af mange gener. Selv om man har alvorlige genfejl så kan de blive ophævet af særlige gener, som beskytter kroppens celler så fejlen ikke betyder noget. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, SUND, Københavns Universitet i dette andet af tre programmer, der handler om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
Bioinformatik beskæftiger sig med at indsamle og undersøge data fra levende organismer. Virkelighedens virus som kan forårsage sygdomme, bygger på digital information og har på den måde mange ligheder med de elektroniske virus som inficerer vores computer. I dag er gensekventering blevet en industrialiseret proces, og prisen for at sekvensere et menneskes gener er faldet fra 20 milliarder kr. til under 6.000 kr. Den biologiske indsigt og de medicinske muligheder som er skabt ud fra denne eksplosion af information, er mangfoldige. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, SUND på Københavns Universitet i dette første af tre programmer, der handler om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
Gericht bestätigt Kündigung einer maßnahmenkritischen Wissenschaftlerin | Von Bastian Barucker
Den vollständigen Standpunkte-Text (inkl. ggf. Quellenhinweisen und Links) finden Sie hier: https://apolut.net/gericht-bestaetigt-ausserordentliche-kuendigung-einer-massnahmenkritischen-wissenschaftlerin-von-bastian-barucker/Diplom-Biomathematikerin Jeanette Bahr ist seit 2002 an der Universitätsmedizin Greifswald beschäftigt. Sie befasst sich in ihrer Arbeit mit der Auswertung klinischer Studien. Im Februar 2022 wurde sie aufgrund zweier Reden auf maßnahmenkritischen Demos von ihrem Arbeitgeber außerordentlich gekündigt. Nun bestätigt ein Arbeitsgericht die Kündigung und unterstellt Frau Bahr die Aufstellung falscher Tatsachen, darunter ihre Behauptung, die Covid-19 Impfungen seien “neuartig und nicht ausreichend getestet.”Ein Standpunkt von Bastian Barucker.Die Universitätsmedizin Greifswald (UG), ehemaliger Arbeitgeber von Frau Bahr, spielt in der Corona-Politik des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Rolle, da zwei der vier Experten, die die Landesregierung beraten, dort angestellt sind. Der Leiter des Institus für Hygiene und Umweltmedizin, Prof. Dr. med. Nils-Olaf Hübner und Prof. Dr. Lars Kaderali, Leiter des Instituts für Bioinformatik sitzen im Corona-Expertenrat des Bundeslandes, welches in den letzten 2,5 Jahren oftmals die härtesten Maßnahmen umsetzte.Grund für die Kündigung waren Bahrs Aussagen auf maßnahmenkritischen Demos Anfang 2022 in Greifswald und Wolgast, in welchen Sie anzweifelte, dass der PCR-Test das Sars-Cov2 Virus nachweisen kann, darauf hinwies, dass die Corona-Impfung “neuartig und wenig erforscht” ist und die Impfnebenwirkungen untererfasst sind. Sie forderte einen sofortigen Impfstopp und verurteilte den Impfdruck, der auf Mitarbeiter der Universitätsmedizin ausgeübt wird. In einem Interview mit dem Autor hatte Frau Bahr Ende März den Hergang der Kündigung ausführlich beschrieben. Bahr hat Klage gegen die Kündidung erhoben, da sie ihre Aussagen als von der Meinungsfreiheit geschützt erachtet...weiterlesen hier: https://apolut.net/gericht-bestaetigt-ausserordentliche-kuendigung-einer-massnahmenkritischen-wissenschaftlerin-von-bastian-barucker/+++Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.+++Dieser Beitrag erschien zuerst am 8.9.2022 auf dem Blog von Bastian Barucker.+++Bildquelle: shutterstock / Sergii GnatiukApolut ist auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommen Sie zu den Stores von Apple und Huawei. Hier der Link: https://apolut.net/app/Die apolut-App steht auch zum Download (als sogenannte Standalone- oder APK-App) auf unserer Homepage zur Verfügung. Mit diesem Link können Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen: https://apolut.net/apolut_app.apk+++Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/+++Ihnen gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/+++Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut+++Website und Social Media:Website: https://apolut.net/Odysee: https://odysee.com/@apolut:aRumble: https://rumble.com/ApolutInstagram: https://www.instagram.com/apolut_net/Gettr: https://gettr.com/user/apolut_netTelegram: https://t.me/s/apolutFacebook: https://www.facebook.com/apolut/Soundcloud: https://soundcloud.com/apolut Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
In der Rubrik “Investments & Exits” begrüßen wir heute Jan Miczaika, Partner bei HV Capital. Jan hat die Finanzierungsrunden von MedGenome, Bactolife und Neurofenix besprochen sowie die Neuigkeiten bei dem deutsch-österreichischen Startup Hello Inside. Gestern wurde bekannt gegeben, dass Lea-Sophie Cramer und Eric Demuth bei Hello Inside eingestiegen sind. Hello Inside vermarktet einen Biosensor, der an den Oberarm gepinnt wird und mit einer Mikro-Nadel die Blutzuckerwerte seiner Träger misst. Gestern wurde auch ein neues, auf Frauen zugeschnittenes Programm namens „Hello Hormones“ verkündet. Mit diesem sollen Frauen auf Basis der Blutzuckerwerte die „richtige Ernährung für die vier Zyklusphasen zu finden und hormonelle Imbalancen auszugleichen“ können. MedGenome, ein in Bangalore, Indien, ansässiges Unternehmen für genetische Diagnostik, Forschung und Daten, hat eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erhalten. Die Runde wurde von Novo Holdings geleitet, mit Beteiligung von LeapFrog Investments und Sofina. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die Erweiterung seines Produktangebots und die Verbesserung der Reichweite seiner wichtigsten diagnostischen Dienstleistungen, einschließlich reproduktiver und onkologischer Dienstleistungen, sowie für die Verbesserung der Bioinformatik- und SaaS-Angebote von MedGenome zu verwenden. Außerdem hat Neurofenix, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Startup aus dem Gesundheitsbereich, eine Kapitalinvestition von 7 Millionen Euro erhalten, um seine Produktlinie auszubauen und klinische Studien in den USA zu starten. Neurofenix verfolgt einen patientenzentrierten Ansatz für die Genesung und die Therapie zu Hause, der sich als einnehmender und unterstützender erweist. Die Serie-A-Runde wurde von AlbionVC angeführt, mit zusätzlicher Beteiligung von HTH, InHealth Ventures und bestehenden Investoren. Bactolife, ein Startup aus Kopenhagen, das sich mit der Darmmikrobiom-Gesundheit beschäftigt, hat eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar erhalten. Der Betrag wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation bereitgestellt. Bactolife beabsichtigt, die Mittel zu verwenden, um die Wirkung seiner Technologieplattform zu beschleunigen und Binding Proteins zu entwickeln, eine neuartige biologische Lösung zur Verringerung des Risikos von Darminfektionen bei Menschen und Tieren.
Jorden er hjem for millioner af arter, men der findes kun én slags menneske. Hvordan er vi blevet til dét, vi er i dag? Og hvordan adskiller vi os fra neandertalere, denisovanere og andre homo-forgængere, som også gik rundt og spillede smarte på to ben? Efter et hav af programmer om alt mellem himmel og jord fokuserer Vildt Naturligt endelig på dét, vi er mest optaget af: Os selv! Nye knoglefund og DNA-analyser omskriver jævnligt historien om vores ophav, men en ekspert i menneskets evolutionshistorie giver et kvalificeret bud på, hvordan vi er blevet, som vi er. Gæst: Professor Mikkel Heide Schierup, Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet. Forsker i menneskets evolution og i arv & miljø. Værter: Biologerne Johan Olsen & Vicky Knudsen. Producer: Carsten Nielsen. vildtnaturligt@dr.dk
Umweltinformatiker Thomas Nauss: "Streichhölzer im Wald gehen schon mal gar nicht."
Warum baut Thomas Nauss Hightech-Sensoren und künstliche Intelligenz in den Universitätswald von Marburg ein? Hilft das dem Wald, dem Klimawandel zu trotzen? Und was hat die Fledermaus von dieser Forschung? „Natur 4.0 - Der vernetzte Wald“ heißt das Projekt, über das der Spezialist für Umweltinformatik in dieser Ausgabe von „hr-iNFO Das Interview“ spricht. Und: Will er solche Spagate zwischen Bodenständigkeit und Futurismus auch an anderen Stellen der Philipps-Universität Marburg ausprobieren? Schließlich ist er dort seit Februar 2022 auch Uni-Präsident. | Bildquelle: Steffen Böttcher
Mikrobiome – Mikroorganismen im (Un-) Gleichgewicht
Das mikrobielle Gleichgewicht ist die Grundlage für gesundes Leben – egal ob beim Menschen, bei Tieren oder bei Pflanzen. Sogar Gewässer sowie Böden und damit ganze Ökosysteme sind davon abhängig. Gerät dieses dynamische Gleichgewicht von Bakterien, Pilzen und weiteren Mikroorganismen ins Wanken, kann das schwerwiegende Folgen haben. Bei der Erforschung des Mikroversums dreht sich alles um die Kommunikation und Interaktion der winzigen Lebewesen untereinander und mit ihrer Umwelt. Denn oft leben sie bereits seit Jahrmillionen zusammen und sind nur selten isoliert anzutreffen. Prof. Brakhage erzählt davon, dass der nächste antibiotische Wirkstoff vielleicht in unserem Vorgarten auf seine Entdeckung wartet. Und aus diesem im besten Fall ein Medikament entwickelt werden kann, das zielgerichtet unerwünschte Mikroorganismen angreift und die nützlichen nicht beeinträchtigt. Der Experte Prof. Axel Brakhage ist der Sprecher des Microverse-Clusters und Direktor am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie. Er erforscht unter anderem humanpathogene Pilze, die für uns Menschen eine Bedrohung darstellen können. Sein Fokus liegt auf dem Schimmelpilz Aspergillus fumigatus. Dieser ist überall in unserer Umwelt zu finden und kann bei vorerkrankten, immunsupprimierten Menschen eine lebensbedrohliche Aspergillose auslösen. Der Cluster Der Exzellenzcluster Balance of the Microverse bündelt die Stärken der Mikrobiologie, Chemischen Biologie, Infektionsbiologie, Medizin, Ökologie, Optik/Photonik, Materialwissenschaft, Bioinformatik und Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dem Universitätsklinikum und acht außeruniversitären Forschungsinstituten. Grundlage für das Konzept des Microverse-Clusters ist die erfolgreiche Exzellenz-Graduiertenschule Jena School for Microbial Communication. Vier Sonderforschungsbereiche, weitere koordinierte Forschungsprogramme sowie regionale Industriepartner verstärken den Microverse-Cluster. Der Podcast 57 Exzellenzcluster, 1 Podcast. Regelmäßig berichtet „Exzellent erklärt“ aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik, genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen: Von A wie Afrikastudien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung! Wenn Euch der Podcast gefallen hat, abonniert „Exzellent erklärt“ bei dem Podcast-Anbieter Eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklaert.de
(13) Dr. Charlotte Beelen - Softwareentwicklerin in Kanada
“Wenn ich erstmal Physik mache, dann kann ich mich immer noch weiter spezialisieren” - Dr. Charlotte Beelen berichtet in der 13. Folge des Meet your Future Podcasts über ihren Entschluss, Physik zu studieren. Sie hat in ihrem Studium viele Bereiche abdecken können -angefangen im Bachelor mit Astrophysik bis zur Biophysik im Master und anschließender Promotion. Charlotte ist nach ihrer Promotion nach Kanada ausgewandert und arbeitet nun in Vancouver im British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS. Dort arbeitet sie als Softwareentwicklerin im Bereich der Bioinformatik und befasst sich mit der Forschung an Viren und Resistenzen gegen Medikamenten. Du findest den Gedanken, nach dem Studium in ein anderes Land zu ziehen, spannend oder möchtest mehr über die Schnittstelle Biophysik- Informatik erfahren? Dann solltest du dir die aktuelle Folge des Meet your Future Podcasts anhören!
In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spreche ich mit Thorsten Paech, Client Solutions Manager Insurance bei Facebook. Facebook wird vom US-amerikanischen Unternehmen Meta Platforms betrieben. Es ist ein weltweit bekanntes, soziales Netzwerk, das seit 2004 existiert. Mit circa zwei Milliarden Nutzern täglich gehört es zu den größten Netzwerken der Welt. Thorsten Paech arbeitet seit sechs Jahren als Client Solutions Manager bei Facebook. Insgesamt kann er auf knapp 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Zuvor hat er Bioinformatik an der Universität Lübeck und Informatik an der Universität Hamburg studiert. In unserem Live-Gespräch erzählt Thorsten über die aktuellen Consumer Trends und wie sie sich seitens Facebook darstellen. Durch Corona habe sich der “digitale Wandel um den Faktor 10 beschleunigt”, erklärt er. Die Oma heute per Video Call anzurufen und alltägliche Produkte online zu bestellen, sei nun weit üblicher als vor zwei Jahren. Die gleichen Digitalisierungsprozesse haben sich in vielen Branchen vollzogen - so auch im Versicherungsbereich. Versicherungsvertreter nutzen plötzlich Messenger-Dienste, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, bieten Live-Streams an und schalten Werbung über Plattformen wie Facebook, erzählt Thorsten. Im Zuge dieses Wandels haben sich auch die Ansprüche der Kunden an die Versicherer gewandelt. Viele wünschen oder fordern nun die Möglichkeit Verträge online einsehen und abschließen zu können. Die Arbeit der Versicherer beginnt schon beim Schalten von Mobile First Werbung. Entsprechende Ansätze stecken vor allem bei großen Versicherern aber noch immer in den Kinderschuhen. Links in dieser Ausgabe Zur Homepage von Jonas Piela Zum LinkedIn-Profil von Jonas Piela Zum LinkedIn-Profil von Thorsten Paech Zum Topics & Trends Report 2021 von Facebook IQ Zur AR-Kampagne von N26 zum Weltfrauentag Über diesen Podcast Folgt uns auf LinkedIn für mehr Podcast-Updates Zur Podcast-Website Wir suchen immer nach neuen und spannenden Gesprächspartnern. Meldet euch bei Susan.
Z Nacetom Kranjcem o bioinformatiki in iskanju primernih genskih tarč, ki bi onemogočile rast populacij komarjev. #MetaPHoDcast Nace Kranjc to jesen končuje doktorski študij...
#050 Der Mensch als Programmierer des Lebens - André Choulika
In dieser Podcastepisode schilderte André Choulika, CEO von Cellectis, auf dem 17. 2b AHEAD Zukunftskongress die neuen Möglichkeiten der Genetik für die nächsten zehn Jahre.Er prognostiziert: Durch Genome Editing wird es in Zukunft möglich sein, unseren DNA Code sowohl neu- als auch umzuschreiben und somit alle im Menschen genetisch verankerten Begrenzungen aufzuheben. Choulika spricht vom Update des Humangenoms und einem Übergang des Sapiens 1.0 zu einer neuen menschlichen Zelle, die keine Mutationen mehr aufweisen wird. Werden wir so in baldiger Zukunft die gefährlichsten Menschheitskrankheiten wie zum Beispiel Krebs endgültig besiegt haben?Für Andé Choulika steht fest: Der Mensch wird sich selbst upgraden und zum Programmierer des Lebens entwickeln. In Zukunft wird es ihm sogar möglich sein, mithilfe von Technologien der Bioinformatik, Sequenzierung und Robotertechnik, komplett neue Lebensformen zu erschaffen sodass innerhalb der nächsten Jahrzehnte wohlmöglich schon künstliche Organismen unseren Planeten besiedeln werden.______________________________________Wenn du mehr erfahren willst, besuche auch meine Website: https://janszky.de/?p und abonniere diesen Kanal.Hier geht's zum 2b AHEAD Zukunftskongress: https://zukunftskongress.2bahead.com/?pWerde zum Future-Me Member: https://janszky.de/futureme_membership?pSichere Dir jetzt Dein Geschenk auf: https://janszky.de/geschenk?p
N2: Bioinformatik: Určite uvidíme aj omegu, koronavírus má v neočkovaných živnú pôdu na to, aby vyvíjal nové varianty
O tom, ako rýchlo koronavírus mutuje, kde sa najčastejšie mení, a či vieme z jeho genómu vyčítať ako vznikol, sme sa rozprávali s bioinformatikom Tomášom Vinařom z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
LF02 Über Sonnenbrillenviren und Bäckerhefeblobs: Françoise Barré-Sinoussi und Margaret Oakley Dayhoff
Heute stellen wir euch wieder zwei Wissenschaftlerinnen vor. Françoise Barré-Sinoussi ist Virologin, hat an Retroviren (leider ohne coole Sonnenbrillen) geforscht und sich vor allem mit dem HI-Virus beschäftigt. Die Verwandtschaft zwischen Mensch & Bäckerhefe hat Margaret Dayhoff erforscht… naja, nicht direkt, aber durch ihre Grundlagenarbeit in der Bioinformatik kann man sogar das feststellen.
Urbane Metagenomik – kleinste Lebewesen mit großer Aussagekraft
Metagenom-Analysen: Von mikrobiellen Weltkarten bis zur Rettung von historischen GebäudenAm 21. Juni ist es wieder soweit: Am Global City Sampling Day swabben Forscherin Alexandra Graf und Studierende im Masterstudium Bioinformatik wieder in der Wiener U-Bahn - sie entnehmen mit dem Wattestäbchen Proben von Sitzflächen und Haltegriffen und entdecken dabei eine Vielzahl völlig unbekannter Spezies. Als Teil der internationalen Forschungsinitiative MetaSUB sind sie Bakterien, Pilze, mikroskopischen Lebewesen, dem Mikrobiom der Stadt auf der Spur, um eine mikrobielle Weltkarte zu erstellen. Die junge Wissenschaft der Metagenomik analysiert das Zusammenspiel der Mikroorganismen in der Gemeinschaft und gibt Aufschluss über den Einfluss des Mikrobioms auf unsere Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Auch für den Kunstbereich sind die Erkenntnisse wertvoll: Sie können helfen, Kunstgemälde zu erhalten oder auch Gebäude. Im Herbst unterstützt Alexandra Graf das interdisziplinären Forschungsprojekt Pretty in Pink zur Restaurierung der Virgilkapelle in Wien.
Der wichtigste Job der nächsten Dekade – mit Dr. Tim Wiegels, VP Data Free Now
Wenn du Daten bei Free Now brauchst, gehst du zu Tim, denn er hat Bioinformatik & Data Science studiert und leitet ein Team von 65-70 Mitarbeitern. Free Now sitzt in über 10 verschiedenen Ländern und die Entscheidungen des Unternehmens basiert auf Daten. Gut, dass Tim vorher bei Good Games Studios z.B. Empire for Kingdoms TV Tracking aufgebaut, App Store Features out of Home Performance basiert getrackt hat und Incubator for Incubatoren war. Er ist der Meinung, die Größe der Firma ist und die Größe des Data Teams ist irrelevant, setze den Fokus erst einmal auf Data Engineering, wenn du starten willst. Neben neuen technischen Herausforderungen wie des IOS Updates 14.4, teilt er mit Christoph, wie er neue Mitarbeiter einstellt und Talente erkennt. Wer sich für Daten interessiert, ist in dieser Folge goldrichtig. Tim Wiegels auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/timwiegels Christoph auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/christophburseg/ Kontaktiere uns über Instagram: www.instagram.com/vodafonebusinessde/ Und wenn Du mehr zu unseren Business Cases erfahren möchtest, besuche diesen Link: www.vodafone.de/business/featured-digitale-vorreiter/business-cases/ Email für Feedback: digitalevorreiter@podstars.de
#02 mit Free Now CMO Thomas Zimmermann und VP Data Dr. Tim Wiegels
Datenkasper - Der Selbsthilfe Podcast für alle Daten-Betroffenen
Zu Gast in der zweiten Episode des Datenkasper Podcasts sind diesmal gleich zwei spannende Persönlichkeiten: Free Now CMO Thomas Zimmermann und VP Data Dr. Tim Wiegels. Free Now ist ein Hamburger Mobilitätsanbieter, der neben dem klassischen Taxi auch auch Scooter, E-Bikes, Roller und Carsharing über seine App anbietet. Wieso Real-time bei Free Now kein Buzzword, sondern extrem wichtig ist, wie man vom Doktor der Bioinformatik zum Daten-Experten wird und welche Fähigkeiten ein CMO heutzutage mitbringen muss, das erfahrt ihr im Datenkasper Podcast mit Thomas Zimmermann und Dr. Tim Wiegels.
Im eHealth-Podcast sprechen wir ganz viel über Themen aus der Medizinsichen Informatik. In den letzten Jahren hat darüber hinaus die Bioinformatik immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aber was genau ist eigentlich Bioinformatik? Um welche Fragestellungen geht es da? Welche Kenntnisse brauche ich dazu? Wie trägt die Bioinformatik zu Erforschung von Krankheiten bei und was hat es mit der Entwicklung von neuen Technologien, wie z. B. CRISPR auf sich. Darüber spricht Bernhard mit der Bioinformatikerin Katja Hebestreit, die aus den USA zugeschaltet ist. Tolle Werbung für ein hochinterdisziplinäres Studienfach mit vielen offenen Fragen, wenn man Biologie mag :-) Shownotes https://www.linkedin.com/in/katja-hebestreit https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR https://cen.acs.org/biological-chemistry/gene-editing/CRISPR-genome-editing-2020-Nobel/98/i39 https://www.transgen.de/forschung/2564.crispr-genome-editing-pflanzen.html
WAI: Informatik als Wissenschaft an einer FH bzw. HAW
Herzlich Willkommen zu der ersten Episode „Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik“. In den Episoden, die mit Kürzel WAI ausgewiesen sind, geht es ausschließlich um das Wissenschaftliche Arbeiten in der Informatik. So heißt auch der Kurs, den ich an der Technischen Hochschule Mittelhessen unterrichte. Der Kurs richtet sich an meine Studierenden der Informatik und er schließt Studierende der Ingenieurinformatik und der Bioinformatik ein; sehr gerne sind alle Interessierten willkommen. Diese Podcast-Episoden zur Informatik verantworte ich selber. Sie werden bemerken, dass es darüber hinaus Podcast-Gespräche zum Wissenschaftlichen Arbeiten (WA) gibt, die Kathrin Gärtner, eine Kollegin aus Österreich, und ich miteinander führen. Auch dazu möchte ich Sie einladen. Diese Gespräche ergänzen das hier Gesagte, wie sie es auch vorbereiten. In unseren Gesprächen sind wir nicht auf die Informatik beschränkt, sondern wir weiten den Blick auf das Wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften. Wir beziehen uns nicht nur auf die Informatik, sondern auch auf die Ingenieurwissenschaften. Das Thema dieser Episode ist: Die Informatik als Wissenschaft an einer FH bzw. HAW Folienlink: https://drive.google.com/file/d/1ziShONhKN_zYlkGqn11f4vVY9o8B4qvS/view?usp=sharing
Denne podcast om bioinformatik handler om forskelle mellem kønnene, om alle de parametre i vores liv, som gør at vi overlever en krise på intensivafdelingen eller ej, om hvad der har mest indflydelse - livsstil, medicin eller gener, og hvorfor man er begyndt at give personnumre til danskere som er født for 200 år siden. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Københavns Universitet i dette tredie og sidste program, i en serie om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
30 Jahre Humangenomprojekt - Die unglaubliche Reise in den menschlichen Zellkern
Im Oktober 1990 machten sich Tausende Wissenschaftler aus aller Welt auf, das Erbgut des Menschen in über drei Milliarden Buchstaben zu entziffern, aus denen sich der Bauplan des Homo Sapiens zusammensetzt. Das Mammutprojekt war Grundlage für die moderne Bioinformatik und Molekulargenetik. Von Arndt Reuning und Michael Lange www.deutschlandfunk.de, Wissenschaft im Brennpunkt Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
30 Jahre Humangenomprojekt - Die unglaubliche Reise in den menschlichen Zellkern
Im Oktober 1990 machten sich Tausende Wissenschaftler aus aller Welt auf, das Erbgut des Menschen in über drei Milliarden Buchstaben zu entziffern, aus denen sich der Bauplan des Homo Sapiens zusammensetzt. Das Mammutprojekt war Grundlage für die moderne Bioinformatik und Molekulargenetik. Von Arndt Reuning und Michael Lange www.deutschlandfunk.de, Wissenschaft im Brennpunkt Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Det har vist sig at genernes funktioner er langt mere kompliceret end forskerne først troede. Nu ved vi at en funktion ikke nødvendigvis stammer fra et enket gen, men kan være en kombination af mange gener. Selv om man har alvorlige genfejl så kan de blive ophævet af særlige gener, som beskytter kroppens celler så fejlen ikke betyder noget. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Københavns Universitet i dette andet af tre programmer, der handler om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
Bioinformatik beskæftiger sig med at indsamle og undersøge data fra levende organismer. Virkelighedens virus som kan forårsage sygdomme, bygger på digital information og har på den måde mange ligheder med de elektroniske virus som inficerer vores computer. I dag er gensekventering blevet en industrialiseret proces, og prisen for at sekvensere et menneskes gener er faldet fra 20 milliarder kr. til under 6.000 kr. Den biologiske indsigt og de medicinske muligheder som er skabt ud fra denne eksplosion af information, er mangfoldige. Videnskabsjournalist Jens Degett fra Science Stories taler med Professor Søren Brunak fra Københavns Universitet i dette første af tre programmer, der handler om bioinformatik og systembiologi. Foto kredit: Chris Heller for Science Stories.
Tomáš Vinař - vedec, bioinformatik a pedagóg (12.5.2020 22:19)
Vedec, bioinformatik a pedagóg Tomáš Vinař bol hosťom Nočnej pyramídy v utorok 12. 5. Rozhovor vedie moderátorka Zuzana Šebestová. Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Rozhovor, interview vedie moderátor, hosť nemusí byť len „celebrita“. Respondent môže byť z najrôznejších oblastí, ako napr. umenie, kultúra, film, veda, šport, technika.
Vom 30. Mai - 2. Juni 2019 fand im ZKM und in der Hochschule für Gestaltung (HfG) die GPN19 statt. Dort traf Sebastian auf Carina Haupt, die schon auf der GPN18 von der öffentlich finanzierten Wissenschaft forderte: Publish Your Research! Carina Haupt studierte Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Aktuell befasst Sie sich wissenschaftlich mit Forschungssoftware, die meist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur geringfügiger Kenntnis von Softwaretechnik oder unter Aspekten von Nachhaltigkeit entwickelt wird, da die Software nur als Mittel zum Zweck gesehen wird. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es schließlich Forschung zu betreiben und nicht Software zu entwickeln. Dabei zeigt die anhaltende Replication Crisis, die darin besteht, dass etliche publizierte wissenschaftliche Arbeiten nicht reproduzierbar sind, und somit alle abgeleiteten Arbeiten auf unsicheren Füßen stehen und eigentlich unter den geänderten Voraussetzungen wiederholt werden müssten. Eine Herausforderung ist, dass für viele Forschende, wie beispielsweise in der Mathematik, oft die Software nur zur Verifikation der eigentlichen wissenschaftlichen Aussagen verwendet wird, und daher eine deutlich geringere Wertschätzung erfährt. Auch wird ein Reputationsverlust befürchtet, wenn die Softwarequalität nicht den Ansprüchen im Kernbereich der Forschung entspricht, so dass oft von einer veröffentlichung des Source Codes und der Daten abgesehen wird. Dabei muss die Offenlegung der verwendeten Verfahren und Daten ein Grundanliegen ernsthafter Forschung sein und eine Kennzeichnung von Software beispielsweise als Proof-of-Concept sollte einen angemessenen Anspruch an die Software sicherstellen. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), leitet Carina eine Gruppe zum Software Engineering und ist dort mit ihren Kolleginnen und Kollegen für 40 Institute an 20 Standorten Ansprech- und Kooperationspartnerin für Softwareentwicklung unter anderem im wissenschaftlichen Umfeld von Luft- und Raumfahrt, Energie und Verkehr. Inzwischen ist dort ihr Enthusiasmus für Open Source, und Forschenden in der Softwareentwicklung zu unterstützen, zu ihrem eigenen Forschungsgebiet geworden. Bevor sie zum DLR kam, war sie beim Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI) im Bereich der Bioinformatik und dem Semantic Web, sowie in der Industrie und nebenberuflich bei der Froscon tätig, bis sie dem Ruf von Andreas Schreiber in ihre aktuelle Gruppe folgte. Um Außenstehenden einen schnellen und sehr unterhaltsamen Einstieg in und wichtige Motivation für das Software Engineering bei der DLR zu bieten, hat sie auf der GPN18 einen Vortrag Software-Fehler in der Raumfahrt: Disintegrating Rockets mit großem Anklang gehalten. Aber kann die Publikation von Forschungsdaten bei Auswirkungen der Replikationskrise wie der Analyse, dass über die Hälfte von Psychologiepapern nicht nachvollzogen werden können, helfen? Auf jeden Fall hätte die Veröffentlichung schon frühere Diskussionen und Verbesserungen der Ergebnisse ermöglicht, da abgeleitete Arbeiten statt der geschriebenen Darstellung auf den echten Daten ihre erweiterten Analysen hätten durchführen können. Soweit die Theorie, praktisch muss man sich eingehend damit befassen, was genau erforderlich ist, um eine Reproduzierbarkeit schon auf Seiten der Daten und Software zu ermöglichen. Das Befassen mit diesen Themen führt von einer Erstellung einer Publikation zum Begriff der Open Science oder offener Wissenschaft, die unter anderem Open Access, Open Data als auch Open Source betrifft. Hier konzentriert sich Carina in ihrer Forschung besonders auf den letzten Teil, insbesondere wie Erkenntnisse aus der Softwaretechnik dazu beitragen können, dem großen Ziel der Reproduzierbarkeit auch über die Zeit hinweg zumindest näher zu kommen. Wichtig ist auch den Entstehensprozess von Software zu betrachten. Die Fernseh-Show Bares für Rares demonstriert, wie die Wertigkeit eines Objekts durch eine nachgewiesene Herkunft signifikant beeinflusst wird. Dies erfolgt durch Nachweis der sogenannten Provenience. Der Begriff Provenience bedeutet die Aufzeichnung der Geschichte der Entstehung eines Objektes. Dies läßt sich auf Software übertragen. Die Wertigkeit und Qualität von einer Software-Publikation könnte zum Beispiel dadruch evaluiert werden indem der Build- und Entwicklungsprozess aufgezeichnet, und mit dem PROV W3C-Standards dokumentiert. Neben der Dokumentation liegt der nächste Schritt für reproduzierbare Software (vgl. E. Heitlinger: Reproduzierbarkeit – Wissenschaftliche Arbeit als Software-Projekt) darin, die erforderlichen zusätzlichen Bestandteile auch zur Verfügung zu stellen. Die nachhaltige Softwareentwicklung befasst sich in besonderem Maße damit, dass die Software von anderen sowohl genutzt als auch in Zukunft weiterentwickelt werden kann. Natürlich sollten wissenschaftliche Veröffentlichungen grundsätzlich die Wissensgewinnung und Validierung genau beschreiben, nur ist dies im gängigen Rahmen und Form normaler Publikationsformen weder in Form noch im Umfang abzubilden. Daher fordern viele Journals und Konferenzen, die Daten und Methoden in der Form von ausführbaren, web-basierten Jupyter Notebooks zur Verfügung zu stellen. Ein neuer Ansatz ist eine "Software Zitierbarkeit" zu ermöglichen, also sowohl die Form mit Weblinks und Versionierung, also auch mit Infrastruktur wie dem Dienst Zenodo, das einen Digital Object Indentifier (DOI) für Software mit einem Langzeitarchiv bereitstellt. Das ist ein Service, der in etwas weniger spezialisierter Form für unterschiedliche Medien auch von vielen Hochschulbibliotheken angeboten wird. Am DLR widmet sich die Software Engineering Initiative mit vielen Ansätzen, um Forschenden zu helfen nachhaltige Software zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil sind hier Trainings, wie beispielsweise Repositories verwendet werden sollten: Hinweise für sinnvolle Commit-Messages verwenden. Wie sollten Versionen vergeben werden? Neben den eigentlichen Sourcen sollte auch der Build-Prozess und Testdaten im Repository sein Sinnvolle Struktur von Dateibäumen und sprechende Bennenung von Dateien Jedes Repository sollte eine README-Datei haben, die am Anfang kurz die Funktion der Sourcen beschreibt und in welchem Scope und in welchen Constraints die Ziele erreicht werden sollen, wie sie installiert, ausgeführt und getestet wird und wie sollte die Software zitiert werden? Unter welcher Lizenz steht die Software? Unterstützung gibt es auch durch zentrale Infrastruktur, die vom DLR beispielsweise durch eine eigene GitLab bald zur Verfügung stehen wird, und allen Forschenden einen eigenen persönlichen Bereich anbieten, sowie Projekten sofort entsprechende Strukturen bereitstellen. Die im Gespräch erwähnte SHA1-Kollision Shattered hatte einen Stillstand der für mehrere Browser grundlegende WebKit-Entwicklung zur Folge, da deren Subversion-Repository nicht mit der Hash-Kollision zurecht gekommen ist. Es gibt vielseitige Motivationsgründe für Forschende die Unterstützung der Software Engineering Initiative anzunehmen: Entweder sind sie aus einem füngeren universitären Umfeld schon mit der Thematik vertraut, oder haben Probleme durch fehlene Softwarequalität schon kennengelernt, lassen sich von Beispielen überzeugen oder Qualitätsanforderungen überreden, oder es wird ihnen durch Vorgesetzte nahe gelegt. Ein Mittel zur Motivation sind insbesondere die am DLR entwickelten Software Engineering Guidelines, die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt werden können. Darin sind sowohl Begründungen für das Vorgehen, aber auch einfach zur verfolgende Entscheidungsbäume und Checklisten, die je nach Größe und Kritikalität von Projekt unterschiedlich aufwendige Empfehlungen vorschlagen. Dies kann von einer TODO-Datei bis zur Integration eines vollständigen Issue-Tracker gehen, der in der höchsten Qualitätsstufe auch mit dem kompletten Code-Management integriert werden sollte. Diese Guidelines sind am DLR in eine Qualitätsinitiative integriert, bei der in jedem Institut ein Qualitätsbeauftragter oder eine Qualitätsbeauftragte zumindest erfassen sollte, warum bestimmte Empfehlungen nicht entsprochen wird, oder idealerweise das Institut dabei dazu zu motivieren diese einfach genau so umsetzen. Die erforderliche Bereitstellung digitaler Infrastruktur durch Organisationen spielt für Hochschulen neben den Bereichen des Software Engineerings auch in der Lehre eine wichtige Rolle: "Wenn technische Möglichkeiten wie Vorlesungsaufzeichnungen auch im Rahmen obligatorischer Lehrveranstaltungen genutzt werden sollen, müssen Hochschulen daher auch aus datenschutzrechtlichen Gründen entweder eine eigene Infrastruktur aufbauen oder datenschutzkonforme Dienstleistungen gegen Entgelt in Anspruch nehmen." A. Lauber-Rönsberg in Videocampus Sachsen – Machbarkeitsuntersuchung. Was alles bei der Nutzung mit Software-Repositories am Beispiel von GIT passieren kann, erzählt Sujeevan Vijayakumaran im GPN19-Vortrag Dämliche Dinge mit git anstellen. Grundlage für viele Aktivitäten der Software Engineering Group basieren auf Software Carpentries, beispielsweise mit einer GIT Einführung, die auch auf die Nachhaltigkeit abzielt. In der Helmholtz-Gesellschaft wurde das HIFIS-Projekt (Helmholtz Infrastructure for Federated ICT Services) gestartet, um die Initiativen und Erfahrungen in der Bereitstellung von Infrastrukturen innerhalb der Helmholtz Gesellschaft zu bündeln. Hier geht es nicht nur um den Betrieb der Software, sondern auch um das Training für die Services und im Allgemeinen. Dazu sollen Communities für Software Engineering und weiteren Themen gebildet werden, damit der Austausch über Erfahrungen und Wissen leichter ablaufen kann. Die Initiativen im Bereich der Research Software Engineers werden im neu gegründeten Verein DE-RSE e.V. gegründet, der vom 4.-6. Juni im Potsdam die erste Konferenz für ForschungssoftwareentwicklerInnen in Deutschland deRSE19 veranstaltet. Der Ursprung dieser Initiative liegt im WSSSPE Workshop (Working towards sustainable software for science: practice and experiences) und der Konferenz der Research Software Egineers Association. Die #deRSE19 wird auch besonders durch die TIB, dem Leibniz-Informationszentrum, Technik und Naturwissenschaften, Universitätsbibliothek, unterstützt. In der Zukunft muss es auch darum gehen, Infrastrukturen bereit zu stellen, über gute Verfahren zu informieren und auch Anreize für Forschenden zu schaffen, die verschiedenen Ansätze aufnehmen. Der Verein und das HIFIS-Projekt möchten hier mit unterschiedlichen Ansätzen dazu beitragen die Situation zu verbessern, und insbesondere die aktuelle Dynamik in Richtung Open Journals, Open Data, Open Source und Open Science zu nutzen. Für einzelne Gruppen und Instituten sollte die Wichtigkeit sich mit Open Source Lizenzen nicht unterschätzt werden: Es kann sonst zu Inkopatibilitäten zwischen verschiedenen Lizenzen kommen, oder es fehlen Einverständniserklärungen von einzelnen, nicht vertraglich verbundenen Personen. Diese können beispielsweise Studierende sein, die im Rahmen einer Abschlussarbeit an einem Projekt mitgearbeitet haben. Hier muss ein Contributor Licence Agreement bereit sein, die von sonst nicht vertraglich gebunden Beitragenden unterschrieben werden kann. Literatur und weiterführende Informationen C. Haupt, T. Schlauch: The Software Engineering Community at DLR—How We Got Where We Are, Proceedings of the Workshop on Sustainable Software for Science: Practice and Experiences (WSSSPE5. 1), 2017. A. Schreiber, C. Haupt: Raising awareness about open source licensing at the German aerospace center, 2018 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2018. D. A. Almeida, G. C. Murphy, G. Wilson, M. Hoye: Do software developers understand open source licenses?, Proceedings of the 25th International Conference on Program Comprehension (pp. 1-11), IEEE Press, 2017. R. Krishnamurthy, M. Meinel, C. Haupt, A. Schreiber, P. Mäder: DLR secure software engineering: position and vision paper. Proceedings of the 1st International Workshop on Security Awareness from Design to Deployment (pp. 49-50). ACM, 2018. Podcasts M. Fromm, K. Förstner: Open Science Radio C. Haupt, S. Janosch, K. Förstner: Voices from de-RSE Conference 2019, Open Science Radio, OSR171, 2019. C. Haupt, S. Druskat, K. Förstner: de-RSE Association and Conference for Research Software Engineers in Germany, Open Science Radio, OSR140, 2019. S. Janosch, K. Förstner: Forschungssoftware in Deutschland, Open Science Radio, OSR091, 2017. GPN19 Special P. Packmohr, S. Ritterbusch: Neural Networks, Data Science Phil, Episode 16, 2019. P. Packmohr, S. Ritterbusch: Propensity Score Matching, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 207, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019. http://modellansatz.de/propensity-score-matching C. Haupt, S. Ritterbusch: Research Software Engineering, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 208, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019. http://modellansatz.de/research-software-engineering GPN18 Special D. Gnad, S. Ritterbusch: FPGA Seitenkanäle, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 177, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. http://modellansatz.de/fpga-seitenkanaele B. Sieker, S. Ritterbusch: Flugunfälle, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 175, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. http://modellansatz.de/flugunfaelle A. Rick, S. Ritterbusch: Erdbebensicheres Bauen, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 168, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. http://modellansatz.de/erdbebensicheres-bauen GPN17 Special Sibyllinische Neuigkeiten: GPN17, Folge 4 im Podcast des CCC Essen, 2017. A. Rick, S. Ritterbusch: Bézier Stabwerke, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 141, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. http://modellansatz.de/bezier-stabwerke F. Magin, S. Ritterbusch: Automated Binary Analysis, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 137, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. http://modellansatz.de/binary-analyis M. Lösch, S. Ritterbusch: Smart Meter Gateway, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 135, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. http://modellansatz.de/smart-meter GPN16 Special A. Krause, S. Ritterbusch: Adiabatische Quantencomputer, Gespräch im Modellansatz Podcast Folge 105, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/adiabatische-quantencomputer S. Ajuvo, S. Ritterbusch: Finanzen damalsTM, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 97, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/finanzen-damalstm M. Fürst, S. Ritterbusch: Probabilistische Robotik, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 95, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/probabilistische-robotik J. Breitner, S. Ritterbusch: Incredible Proof Machine, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 78, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/incredible-proof-machine
Anlässlich der Verleihung des Houska-Preises der B&C Privatstiftung - dem am höchsten dotierten privaten Forschungspreis Österreichs - diskutieren Voestalpine-Chef Wolfgang Eder und Sepp Hochreiter, Vorstand des Instituts für Bioinformatik an der Johannes Kepler Universität Linz, über Künstliche Intelligenz und wie China und Amerika bei dieser zukünftigen Schlüsseltechnologie Europa hinter sich lassen.
Gudrun ist zu Gast bei der Gleichstellungsbeauftragten der FU in Berlin, um über ihr MINToring-Projekt zu reden. Das ist seit einiger Zeit eine Einladung an Schülerinnen zum Einstieg in die Physik und Informatik. Das Projekt entwickelte dafür eine Reihe von Angeboten, nämlich: alle 2 Wochen werden verschiedene Workshops an der FU veranstaltet (ab der 7. Klasse); es werden Betriebspraktika in den Fachbereichen Physik und Informatik vermittelt und begleitet (ab der 9.Klasse); Tage an der Uni im Herbst, in denen man in Vorlesungen der Informatik, Physik und Bioinformatik hineinschnuppern kann Workshops an den Schulen Gudrun spricht außer mit der Frauenbeauftragten Mechthild Koreuber (Mathematikerin, promoviert in Wissenschaftsgeschichte) auch mit den beiden Koordinatorinnen des MINToring-Projekts Anette Dietrich (Koordinatorin Mathematik und Informatik) und Audrey Houillon (Koordination Physik). Audrey hat in München Physik studiert und in Paris am CNRS im Gebiet Neurowissenschaften promoviert. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsthema zwischen Physik, Informatik, Psychologie und Biologie. An der TU Berlin hat sie eine Zeit als Postdoc im Gebiet computational Neuroscience gearbeitet und ist dann in die Jugend- und politische Bildung gewechselt bevor sie die Koordinationsstelle an der FU übernahm. Anette ist am Institut für Informatik, hat in Erziehungswissenschaften über Geschlechter- und in der Rassismusforschung promoviert. Ausgangspunkt für die Projektidee war für Mechthild eine Erfahrung am Rande der Abiturfeier ihrer Tochter. Aus einem Physik Leistungskurs mit 50% Mädchen wollte damals keines Physik studieren oder hatte dies als Möglichkeit auch nur in Erwägung gezogen. Wieso? Sie dachte darüber nach, wie kann man junge Frauen und Mädchen motivieren, sich für diese Fächer zu entscheiden und konkret etwas gegen den niedrigen Frauenanteil in den MINT-Fächern tun? Sie stellte sich dabei zunächst ein Projekt vor, dass interessierte Mädchen in der Abiturstufe anspricht. Interesse würde sich z.B. über die Teilnahme an Leistungskursen herausfinden lassen. Das ist aber leider z.B. in der Informatik nicht durchführbar. weil es dort fast keine Leistungskurse gibt. Außerdem wurde schnell klar, dass man schon mit jüngeren Schülerinnen beginnen sollte, um den Übergang zu den Aktionen am Girls'day zu sichern, wo die FU für Schülerinnen der Klassenstufen 5-10 jährlich etwa 1000 Plätze in ungefähr 80 kleinen Gruppen anbietet. Ein zentrales und einzigartiges Werkzeug im MINToring Projekt ist die Möglichkeit zum Betriebspraktikum an der FU. So ein Praktikum ist in der 9. oder 10. Klasse für 2-3 Wochen für alle Berliner Schüler vorgesehen. Manche intessieren sich auch für ein freiwilliges Praktikum in den Sommerferien. Es ist unüblich, so ein Praktikum an einer Universität durchzuführen. Vor allem aus dem Grund, dass sich wenige Menschen vorstellen können, dass das geht. Das Projekt MINTOring bietet aber hierfür einen Rahmen und kann Schülerinnen deshalb direkt dafür einladen. Den Rahmen bilden Einführungskurse und andere Workshops (wie z.B. für Programmiersprachen) für eine kleine Gruppe Schülerinnen und ein Abschlussvortrag mit ausführlicher Auswertung und Einordnung der Erfahrungen. Zentral ist die Forschungsarbeit in den Arbeitsgruppen (2-5 Tage) im individuellen Zuschnitt auf das Interesse jeder Schülerin. In der Zeit erleben sich die Mädchen selbst als kompetent und ihre Arbeit würd wertgeschätzt. Das Feedback der Schülerinnen war bisher stets sehr positiv. Sie schätzen am Praktikum, dass sie neues gelernt haben, Erfahrung mit Forschung sammeln durften und in der Gruppe erlebt haben, dass sie mit ihren Interessen willkommen sind und geschätzt werden. Dazu kommen ganz besondere Erlebnisse, wie dass sich eine Professorin für sie ganz persönlich interessiert und im Kontakt bleiben möchte, was in Summe zu einer sehr emotionalen Erfahrung führt, die in Erinnerungen bleibt. Für so eine erfolgreiche Arbeit musste natürlich Skepsis überwunden werden. Es ist inzwischen leichter, Ideen für altersgerechte Forschungsprojekte zu finden, nachdem es viele gelungen Beispiele gibt. Trotzdem ist nach wie vor ein großer Anteil an Arbeitszeit für die Koordination des Projekts dadurch gebunden, dass Arbeitsgruppen für Schülerinnen gefunden werden. Es ist schön, wenn inzwischen auch schon Arbeitsgruppen auf das Projekt zukommen, die durch Kritik am schlechten Frauenanteil dazu gedrängt werden, selbst auch aktiv zu werden. Konkrete Projekte aus der jüngsten Vergangenheit sind: die Umsetzung eines Needleman-Wunsch-Algorithmus am Computer. Das ist ein Optimierungsalgorithmus aus der Bioinformatik, der zum Vergleich zweier Nukleotid- bzw. Aminosäuresequenzen eingesetzt wird. ein Bio-Informatik-Projekt, wo in enger Zusammenarbeit mit dem Juniorprofessor ein Datensatz zu Krebstumoren mit der Programmiersprache R analysiert wurde. Aber auch einen Betrag liefern zu können, um ein kaputtes Mikroskop zu reparieren, ändert das Verständnis davon, wie Forschung gemacht wird. Wenn Erwachsene sagen: Ich weiß das nicht, ich muss erst probieren, um eine Lösung zu finden, dann hinterlässt das einen Eindruck. Inzwischen gibt es tatsächlich schon mehr Interessentinnen für ein Praktikum, als aufgenommen werden können. Das Projekt wurde zuerst durch das Professorinnenprogramm und später durch das Chancengleichheitsprogramm finanziert. Inzwischen werden statt dieser Drittmittel Haushaltsmittel der FU eingesetzt. In der Zukunft wäre es wichtig, dass die Finanzierung der Koordinierungsstellen auf Dauer von der FU Berlin sichergestellt wird und sich auch andere Universitäten ein Beispiel nehmen. Eine Erweiterung auf andere Fächer ist auch im Moment schon in Arbeit. Zusätzlich zu dieser Art von Projekten muss sich in der Gesellschaft noch einiges ändern. In anderen Ländern ist es viel selbstverständlicher, dass Frauen in technische Fächer gehen. Es ist erstaunlich, wie stark das Selbstbewußtsein schon leidet, wenn die Entscheidung für ein MINT-Fach ständig durch die Umgebung in Frage gestellt wird. Hier wäre mehr Ermutigung in der Schule ein guter Anfang. Podcasts A. Sage, L. Schenk, G. Thäter: Studienbotschafterinnen, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 194, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019. B. Böttcher, G. Thäter: Meisterklasse, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 158, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. G. Thäter, K. Wohak: CAMMP, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 165, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. K. Wohak, M. Hattebuhr, E. Bastian, C. Beizinger, G. Thäter: CAMMP-Week, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 174, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. S. Schäfer, I. Häuser, G. Thäter: Schülermarketing, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 191, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. A. Mischau, M. Koreuber: Gender und Mathematik, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 142, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. M. Jungbauer-Gans: Frauen in der Wissenschaft – Gleiche Chancen, Ungleiche Voraussetzungen? Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung, Podcast Kombinat, Universität Marburg, 2016. E. Dittrich, G. Thäter: Schülerlabor, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 103, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016.
Der Facharzt in IT-Kunde? Die Digital Clinician Scientists in Berlin
Die Charité Universitätsmedizin Berlin startet gemeinsam mit dem Berlin Institute of Health das Programm des "Digital Clinician Scientist". Medizinerinnen und Mediziner sollen sich während ihrer Facharztausbildung mit den Themen Big Data, Bioinformatik und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und dazu forschen. Schaut Euch das Video an und erfahrt, worum genau es in dem Programm geht.
Hvis vi for alvor skal forstå de molekylære mekanismer bag udviklingen af kræft, og designe nye og bedre behandlingsformer, så bliver der brug for både bioinformatikere og meget kraftige supercomputere. Det har man indset hos Kræftens Bekæmpelse. Her har man udvidet forskningsafdelingen til også at omfatte en større gruppe bioinformatikere. som arbejder side om side med de eksperimentelle forskere. I denne podcast fortæller leder af Computational Biology hos Kræftens Bekæmpelse, Elena Papaleo, hvordan supercomputere hjælper kræftforskningen.Læs mere om Elena Papaleos forskningsgruppe på: https://www.cancer.dk/research/computational-biology-laboratory/Læs mere om supercomputeren Computerome på: https://www.deic.dk/da/computerome
Hvis vi for alvor skal forstå de molekylære mekanismer bag udviklingen af kræft, og designe nye og bedre behandlingsformer, så bliver der brug for både bioinformatikere og meget kraftige supercomputere. Det har man indset hos Kræftens Bekæmpelse. Her har man udvidet forskningsafdelingen til også at omfatte en større gruppe bioinformatikere. som arbejder side om side med de eksperimentelle forskere. I denne podcast fortæller leder af Computational Biology hos Kræftens Bekæmpelse, Elena Papaleo, hvordan supercomputere hjælper kræftforskningen.Læs mere om Elena Papaleos forskningsgruppe på: https://www.cancer.dk/research/computational-biology-laboratory/Læs mere om supercomputeren Computerome på: https://www.deic.dk/da/computerome
Das Galaxy-Projekt im Leistungszentrum zur Bioinformatik
An der Universität Freiburg entwickelt ein Team der Bioinformatik eine Plattform, die Gen-Forscherinnen und -Forschern einen Standard für die Datenerfassung und Analyse der Prozesse in den Zellkernen bietet.
Das Galaxy-Projekt im Leistungszentrum zur Bioinformatik
An der Universität Freiburg entwickelt ein Team der Bioinformatik eine Plattform, die Gen-Forscherinnen und -Forschern einen Standard für die Datenerfassung und Analyse der Prozesse in den Zellkernen bietet.
Ja, es ist schon wieder etwas her und es hat sich mal wieder ein ganzer Sack von News angesammelt. Erstaunlicherweise geht's in einer Reihe von Themen mal wieder etwas technischer zur Sache, denn wir haben nicht nur ein paar Tools im Gepäck, sondern schweifen auch immer wieder auf technisch getriebene Themen ab - nicht selten mit Bezug zu Konrad's Haus- und Hofthema, der Bioinformatik. Viel Spaß!
Computer können gut dazu verwendet werden hochkomplexe Systeme zu berechnen, zu analysieren, auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Der menschliche Körper beruht auf einem hochkomplexen System, dass berechnet, analysiert und vielleicht auch auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden soll. Mit einem Wort: Bioinformatik. Das aktuelle Chaosradio soll euch einen Einstieg in den Wissenschaftsbereich bieten, in dem die Fragestellungen der Biologie mit den Mitteln der Informatik bearbeitet werden. Was machen Bioinformatiker eigentlich? Wieviel wissen wir über Genome und was hat das mit Biogasanlagen zu tun? Wofür braucht man ein Massenspektrometer? Und wie schafft man den Einstieg in die Bioinformatik? Das alles klärt Marcus Richter mit Gästen aus dem CCC ab 22 Uhr im Chaosradio, live aus den Räumen des CCCB http://berlin.ccc.de/wiki/Chaos_Computer_Club_Berlin in der Marienstraße 11. Ihr seid wie immer eingeladen, live dabei zu sein. Alle anderen können die Sendung natürlich wie immer im Livestream http://streaming.media.ccc.de verfolgen.
Wenn ein Mathematiker mit Biologen in der Evolution gemeinsame Forschung betreibt, ergibt das eine spannende Verbindung. Der Mathematiker und Biologe Joachim Hermisson spricht über Evolution, Bioinformatik und mathematische Modelle der Biologie. Es ist die – mathematische – Arbeit mit existierenden Theorien im Bereich der Physik, aber eben auch im Bereich der Evolution, die Joachim Hermisson fasziniert. Gesprächspartner: Joachim Hermisson Professor for Mathematics and Biosciences University of Vienna Department for Mathematics http://www.mabs.at
Wir streifen ja in diversen Folgen immer mal wieder das Thema Biologie oder Bioinformatik. Zum einen natürlich weil aus dieser Fachrichtung sehr viel Open Science Aktivität kommt, zum anderen natürlich weil das Konrad's Haus- und Hofthema ist. Und am Rande haben wir sicher auch schon einmal die Open Bioinformatics Foundation (OBF) erwähnt. Pünktlich zur just an diesem Wochenende stattfindenden BOSC, der Annual Bioinformatics Open Source Conference 2014, haben wir uns mit Hilmar Lapp nicht nur den aktuellen Präsidenten der OBF eingeladen, sondern auch einen der Initiatoren der BOSC. Hilmar war so freundlich uns ein bißchen seiner Zeit zu schenken und wir haben mit ihm über seinen eng mit der OBF verknüpften Weg in der Open Source und Open Science Bewegung gesprochen.
Wir blicken in der heutigen Folge nochmal auf Themen aus vorangegangenen Episoden zurück. Wir greifen da im Speziellen die Malariabekämpfung und das Anthropozän nochmal auf. Bei den Wissenschaftsnachrichten haben wir diesmal aktuelle Publikationen und Neuigkeiten aus den Fachbereichen Sprach- & Kulturforschung, Paläontologie, Materialforschung zum Thema Graphen, Medizin/Immunologie und eine Studie zur Gesundheit von Honigbienen im Gepäck. Im Anschluss gibt Katrin noch Einblicke in ihre Sichtweise auf die Bioinformatik: die Tücken des wissenschaftlichen Alltags und das digitale Laborjournal. Und weil das hier eine Geburtstagsfolge ist, gibt es Kuchen. Naja, ohne Boden. Viel Spaß beim Hören!
MiRNA Bioinformatik als Werkzeug medizinischer Forschung – Etablierung eines Datenbank- und Zielvorhersagesystems zur Bearbeitung von miRNA-bezogenen Fragestellungen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Mit Beginn der Ära der Hochdurchsatz-Sequenzierung und Transkriptions-messungen ist das Angebot an genetischer Information in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Die Entdeckung der miRNAs als regulative Elemente mit weitreichendem Einfluss hat dabei eine Schlüsselrolle in der Erforschung von diagnostischen Möglichkeiten, pathogenetischen Prozessen und therapeutischen Konzepten vieler Krankheiten eingenommen. Mit der stetig wachsenden Informationsvielfalt steigt allerdings auch die Komplexität der Informationsverarbeitung und -aufbereitung. In der vorliegenden Arbeit wurde daher eine miRNA Datenbank konzipiert und evaluiert, die verfügbare Informationen handhabbar macht und bei der Generierung von Hypothesen hilft. Um Aussagen über die biologische Bedeutung von miRNAs treffen zu können, werden miRNA-mRNA-Interaktions-Vorhersagealgorithmen benutzt und so mögliche Ziel-mRNAs identifiziert. Aufgrund der beschriebenen Limitationen (Kapitel 2) wurde in dieser Arbeit ein Konsensusverfahren zur Ziel-Vorhersage etabliert und validiert, das das Prediction Agreement als Maß der Konfidenz einer Interaktion nutzt. Exemplarisch wurde dieses Verfahren eingesetzt, um vier miRNAs im Kontext der Apoptose-Signalkaskade zu beleuchten. Die Gene von zwei dieser vier miRNAs befinden sich in Introns proteinkodierender Gene (Host-Gene). Mithilfe der erstellten Datenbank ließen sich Charakteristika von Host-Genen extrahieren, die denen der Ziel-Gene ähneln. Die Summe der Beobachtungen erlaubt die Spekulation, dass die bislang biologisch wenig charakterisierten Host-Gene potentiell in funktionellem Zusammenhang zu den Ziel-Genen der miRNAs stehen. Am Beispiel von bei Sepsis differentiell exprimierten miRNAs konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, wie durch die Entwicklung einer bioinformatischen Datenbank schwer handhabbare Datenmengen und –strukturen genutzt werden können, um die Entwicklung klinisch relevanter Hypothesen zu leiten. Die Möglichkeiten eines solchen Systems sind allerdings nicht ausgeschöpft. Je nach Fragestellung können weitere Daten integriert (Informationen über Promotor-Bereiche, Sequenzen, Protein-Protein-Interaktionen, weitere miRNA-/mRNA-Expressionsmessungen) und direkt analysiert werden. Mit zunehmendem Fortschritt biologischer Forschung und Methodik wird auch die informationsverarbeitende Methodik einen immer größeren Stellenwert einnehmen und der Bedarf an Datenbanksystemen und Konzepten zur strukturierten Analyse und Eingrenzung der Informationsvielfalt wird stetig steigen.
Alternative Splicing and Protein Structure Evolution
Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/02
In den letzten Jahren gab es in verschiedensten Bereichen der Biologie einen dramatischen Anstieg verfügbarer, experimenteller Daten. Diese erlauben zum ersten Mal eine detailierte Analyse der Funktionsweisen von zellulären Komponenten wie Genen und Proteinen, die Analyse ihrer Verknüpfung in zellulären Netzwerken sowie der Geschichte ihrer Evolution. Insbesondere der Bioinformatik kommt hier eine wichtige Rolle in der Datenaufbereitung und ihrer biologischen Interpretation zu. In der vorliegenden Doktorarbeit werden zwei wichtige Bereiche der aktuellen bioinformatischen Forschung untersucht, nämlich die Analyse von Proteinstrukturevolution und Ähnlichkeiten zwischen Proteinstrukturen, sowie die Analyse von alternativem Splicing, einem integralen Prozess in eukaryotischen Zellen, der zur funktionellen Diversität beiträgt. Insbesondere führen wir mit dieser Arbeit die Idee einer kombinierten Analyse der beiden Mechanismen (Strukturevolution und Splicing) ein. Wir zeigen, dass sich durch eine kombinierte Betrachtung neue Einsichten gewinnen lassen, wie Strukturevolution und alternatives Splicing sowie eine Kopplung beider Mechanismen zu funktioneller und struktureller Komplexität in höheren Organismen beitragen. Die in der Arbeit vorgestellten Methoden, Hypothesen und Ergebnisse können dabei einen Beitrag zu unserem Verständnis der Funktionsweise von Strukturevolution und alternativem Splicing bei der Entstehung komplexer Organismen leisten wodurch beide, traditionell getrennte Bereiche der Bioinformatik in Zukunft voneinander profitieren können.