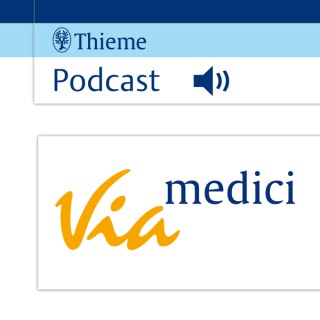Podcasts about hypothermie
- 37PODCASTS
- 41EPISODES
- 42mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Aug 1, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about hypothermie
Latest podcast episodes about hypothermie
Hypothermiebehandlung bei Neugeborenen mit Prof. Dr. Hemmen Sabir
In der aktuellen Folge haben wir Prof. Dr. Hemmen Sabir zu Gast und sprechen mit ihm über die Hypothermiebehandlung bei Neugeborenen.
Des profs nous découragent avec des demandes loufoques de parents!
Aujourd'hui dans la gang ➜ On revient sur le bon samaritain des canards de Sherbrooke! Harvey Austérité du public : les trucs de cheap gênants! Le gender reveal du bébé d'Emy ... en mode Hypothermie! Bonne écoute!
Le 3 janvier 1957, deux jeunes alpinistes de 23 et 24 ans sont décédés après s'être retrouvés coincés dans l'ascension du Mont-Blanc, haut de 4806 mètres. Partis à la fin du mois de décembre 1956, les deux grimpeurs, peu expérimentés, ont passé plusieurs jours immobilisés sur la montagne. Lorsque les conditions météorologiques se sont dégradées, les deux jeunes hommes ont décidé de redescendre à Chamonix par le chemin le plus court. Mais ils se sont retrouvés piégés en plein cœur du massif. Accrochés le long d'une paroi verticale de 300 mètres de haut, ils étaient dans une situation extrêmement périlleuse.Un hélicoptère a finalement réussi à les repérer et à leur larguer des vivres, mais l'appareil n'a pas pu se poser. Les deux alpinistes, dans un état de faiblesse extrême avec les jambes et les avant-bras gelés, ont alors tenté de survivre pendant près de dix jours dans des conditions de froid glacial, à -30 degrés.Le 31 décembre 1956, un hélicoptère de l'armée venu les aider s'est écrasé sur le Grand Plateau du Mont-Blanc, sans faire de victimes. Les sauveteurs ont alors installé les deux jeunes dans la carcasse de l'appareil, avant de les abandonner pour gagner le prochain refuge. Ils avaient promis de revenir les chercher le lendemain, mais cette promesse n'a jamais été tenue.Ce drame sur le Mont-Blanc a profondément marqué les esprits et a contribué à la création de véritables structures de secours en montagne. Aujourd'hui, près de 1000 sauvetages sont réalisés chaque année dans le massif du Mont-Blanc. Un épisode poignant qui montre la dangerosité de l'alpinisme et l'importance du travail des secours en montagne.Notre équipe a utilisé un outil d'Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.
L'épisode du jour parle du handicap, présent chez l'enfant dès la naissance. Il raconte l'histoire des parents de Mattia avec la voix de sa maman, Elisa. Elle évoque comment en fin de grossesse elle a dû accoucher d'une minute à l'autre suite au ralentissement des mouvements de son bébé dans son ventre, comment son bébé a ensuite été mis en hypothermie et le diagnostic qui tombe très rapidement : le cerveau de votre enfant est très endommagé, son pronostic vital est engagé, il ne lui reste plus qu'un temps très court à vivre, désolé Madame.C'est une histoire d'acceptation, de leçon de vie, de la vie chamboulée, et de comment défier les pronostics et continuant à croire en la vie.Bonne écoute !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Jonathan revient sur sa récente traversée des Alpes entre Turin et Nice. 700 km à dormir avec des limaces géantes, à se rincer la raie et à se glacer les os à plus de 2000 mètres d'altitude. Une expédition avec ses amis européens qui démontre aussi que les jambes et le mental comptent plus que le vélo. Envoyez-nous vos questions ou vos idées d'invités → @jonathanbroy et @espressosports. Pour plus d'informations sur les conférences de Jonathan : https://www.jonathanbroy.com/conferences
INVITÉ RTL - "On est tous en hypothermie, le corps s'est habitué", raconte Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"
Engagé sur la Ocean Globe Race, une course "à l'ancienne", l'équipage de "Triana" poursuit la deuxième étape dans les mers australes, "des mers très hostiles : ça fait quatre semaines qu'on est à 5 degrés", relate l'ancien dirigeant du groupe M6.
Nach einer längeren Phase der Stille ist es endlich wieder so weit: Maike und Timo treffen aufeinander, um sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen und haben dabei sämtliche Neuigkeiten für die bevorstehende Folge von NOTCAST aufbewahrt. In diesen anderthalb Stunden erfahrt ihr mehr über Maike's aktuelle Diagnose sowie das mysteriöse Phänomen der Hypothermie.
Lichtblick: Wie wir bei ME/CFS oder LC über die Körpertemperatur die Selbstheilung unterstützen können
Eine Körpertemperatur unter 36.7° kann zu zu vielen Erkrankungen und Problemen führen. Ein erwärmter Körper kann dagegen sehr heilend sein. Was hier genau passiert und wie wir konkret unsere Körpertemperatur erhöhen können (gerade in der kalten Jahreszeit), darum geht es in dieser Episode. Ein therapeutischer Hebel, an dem wir ohne Anstrengung drehen können.
„titriert“ Lawinenunfälle und akzidentielle Hypothermie
Paule lässt uns hinab in die Welt der Lawinenunfälle und erläutert, was bei Hypothermie zu tun ist! Der Beitrag „titriert“ Lawinenunfälle und akzidentielle Hypothermie erschien zuerst auf pin-up-docs - don't panic.
Ertrinken - Mit der Rettung aus dem Wasser ist es nicht getan
In dieser Episode von Rettungsdienst LUKS - Der Notfallmedizin Podcast tauchen wir tief in das Thema Ertrinken ein und räumen mit veralteten Begriffen wie dem "Trockenen Ertrinken" auf. Wir werfen einen faktenbasierten Blick auf die relevanten Aspekte, die für die Präklinik entscheidend sind. Und das ist gerade in der Pathophysiologie deutlich mehr als nur das Hauptproblem der Hypoxie.In dieser Folge: - Unter dem Meer: Das sagt die WHO zum Ertrinken- Hypoxie und andere Probleme durch die Immersion ins Wasser erklärt- Hypoxie und Hypothermie bestimmen die Strategie. So sehen die Massnahmen in der präklinischen Versorgung aus. Deine Meinung zum Podcast kannst du hier abgeben: https://info4660.survey.fm/rettungsdienst-luks-ertrinkenHomepage des Rettungsdienst LUKS: https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/rettungsdienst-und-sanitaetsnotruf-144-zentralschweizFolge zum Thema Hypothermie (und zu allen anderen Folgen):https://pod.link/1672980207Aus den Rettungsdienst LUKS Nachrichten:https://nerdfallmedizin.blog/2020/08/03/nerdfacts-folge-7-2020-tauchunfall/https://www.gtuem.org/https://news-papers.eu/?p=17268Alle Evidenzen zu dieser Folge findest du hier: Stuhr, M., Soltau, M., Wehrmann, A., Kerner, T. (2022). Notfallmedizinisches Vorgehen beim Ertrinkungsunfall. Notarzt 2022; 38: 95–103; Georg Thieme Verlag KG Stuttgard. DOI: 10.1055/a-1346-2170Amboss. (n.d.). Ertrinkungsunfall. Amboss SOP. Abgerufen am 12. Juni 2023, von https://www.amboss.com/de/wissen/ertrinkungsunfall-amboss-sop/Sirmed. (2022). Webinar – Wasserfälle - Notfälle im und unter Wasser. Abgerufen am 11. Juli 2023, von https://www.paraplegie.ch/sirmed/de/profis/wissen/webinare-und-booster-fuer-profis/Julius Hohmann. (31. August 2021). Ertrinken Folge 1 und 2 [Audio-Podcast]. Rettungsdienst FM. Abgerufen am 16. Juli 2023, von https://rettungsdienstfm.de/ertrinken-teil-1/Schramm M, Schröder S: Der Ertrinkungsunfall: Begriffe, Maßnahmen, Reanimation. In: Rettungsdienst. Band: 40, 2017, p.564-569
Der hypotherme Patient - Vom klinischen Bild bis zur Rea
"Nur ganz kurz da aufs Bett dann decken wir sie zu", In der Akutversorgung kritischer kranker Patienten haben wir durch Algorhitmen, Scores und Scales scheinbar alles im Griff. Wir sind CRM geschult und machen Debriefings. Nur, dass es unseren Patienten vielleicht kalt ist, das ignorieren wir gekonnt. Was hat es alles mit der Hypothermie auf sich und wie erkenne ich die klinischen Zeichen? Und was muss ich machen, wenn ich einen unterkühlten Patienten dann auch noch reanimieren muss? In dieser Folge:- Besonders gefährdete Personengruppen für die Hypothermie- Klinische Zeichen einer Hypothermie- Grenzen der präklinischen Temperaturmessung- Behandlungsempfehlungen des hypothermen Patienten - Reanimationsalgorhitmus und wie diese beim unterkühlten Patienten vom Standart abweicht Deine Meinung zum Podcast kannst du hier abgeben: https://de.surveymonkey.com/r/LHYWFQ7Homepage des Rettungsdienst LUKS: https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/rettungsdienst-und-sanitaetsnotruf-144-zentralschweizAlle Evidenzen zu dieser Folge findest du hier: https://www.msdmanuals.com/de/profi/verletzungen,-vergiftungen/verletzungen-durch-kälte/hypothermiehttps://www.amboss.com/de/wissen/Hypothermie_und_ErfrierungenErweiterte lebensrettende Massnahmen, Anwendermanual 7. Auflage, herausgegeben durch den European Resuscitation Council, Belgien, ISBN 9789492543387https://alpinmedizin.org/media/blog/pdfs/Musi_ME_Resuscitation_2021_Revised_Hypothermia_Staging.pdf?m=1625052946&
Hirn & Heinrich - Sauerstoffmangel: Neugeborene vor Hirnschäden bewahren
Eltern wünschen sich nichts mehr, als dass ihr Kind gesund zur Welt kommt. Doch selbst nach einer unkomplizierten Schwangerschaft, kann es unter der Geburt zu unerwarteten Risiken kommen. Sauerstoffmangel zählt zu den häufigsten, wenn auch sehr seltenen, Komplikationen. Der Neonatologe Prof. Dr. Hemmen Sabir spricht mit Sabine Heinrich über Ursachen, Therapien und Folgen von Sauerstoffmangel unter der Geburt. Sabir ist spezialisiert auf schwerkranke Neugeborene. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Untersuchung schädigender Ereignisse auf das Gehirn von Neugeborenen. Dazu zählen Sauerstoffmangel, Entzündungen (Inflammation) und Frühgeburtlichkeit. Der Oberarzt der Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin sowie Leiter Experimentelle Neonatologie am Universitätsklinikum Bonn und Forschungsgruppenleiter am DZNE erforscht mit einem internationalen Team neue Therapien zur Behandlung des noch unreifen geschädigten Gehirns. Im Podcast berichtet er von den hoffnungsvollen Forschungsergebnissen, die die bisherige Standardtherapie einer künstlichen Kühlung medikamentös unterstützen. Sein Ziel: Die weltweite Säuglingssterblichkeit zu reduzieren. Welche Rolle dabei die Bill & Melinda Gates Foundation spielt, erfahren Sie in diesem Podcast.
Hypothermie, Wärme, Effekte, Rundumschlag
Eine Unterkühlung wirkt per se immer über eine Reduktion von chemischen und zellulären Prozessen. Das betrifft die Zellfunktionen und auch die chemischen Reaktionen. Normalerweise ist alles in unserem Körper auf eine Standardtemperatur von um die 37°C „genormt“. Abweichungen nach unten verlangsamen den Stoffwechsel, Abweichungen nach oben beschleunigen ihn. Aber was gehört da jetzt alles … Weiterlesen
3. Is therapeutische hypothermie na reanimatie nog zinvol?
In deze aflevering van Intensief de Podcast gaan we het hebben over het huidige wetenschappelijke bewijs voor het koelen van patiënten na reanimatie.We bespreken de volgende onderwerpen:Wat is de prognose/mortaliteit van een reanimatie? Hoe doen we het in NL in vergelijking met de rest van de wereld?Moeten we direct een CAG uitvoeren bij patiënten na reanimatie? Wat zegt de COACT trial?Waarom zijn we ooit begonnen met het koelen van onze post-reanimatie patiënten?Welke literatuur is er beschikbaar?We bespreken de HACA trial, de TTM1 trial, de Hyperion trial, de TTM2 trial en de RINSE trial.Wat zijn de voor- en nadelen van hypothermie?Wat is uiteindelijk bewezen effectief voor onze patiënten?Bronnen:Cijfers hartstichting 2016Coronary Angiography after Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation (COACT trial Lemkes 2019)Meta-analysis of targeted temperature management in animal models of cardiac arrest Mild therapeutic hypothermia for survivors of cardiac arrest (Deranged Physiology)Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm (Hyperion trial)Hypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest (TTM2 trial)Effect of Prehospital Induction of Mild Hypothermia on Survival and Neurological Status Among Adults With Cardiac Arrest (RINSE trial)Therapeutic Hypothermia in Critically Ill Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of High Quality Randomized TrialsBedankt voor het luisteren!Volg @intensiefdepodcast op InstagramVragen? intensiefdepodcast@gmail.com
Passend zur kalten Jahreszeit geht es heute bei uns um die Hypothermie. Wie sieht dort unsere Behandlung aus?
Die Hypothermie ist ein weitverbreitetes Zustandsbild, welches – insbesondere in Bezug auf Traumapatient*innen – weitreichende Folgen für unsere Patient*innen haben kann. Dennoch gibt es hinsichtlich Hypothermie-Awareness noch viel Luft nach oben, meint Dr. Alexander Egger, Chefarzt des Österreichischen Bergrettungsdienstes. Welche Auswirkung die Hypothermie nicht NUR auf Traumapatient*innen haben kann, wie wir die Alu-Rettungsdecke richtig einsetzen und warum es eigentlich eine Clothes-Off-Zeit geben sollte: dazu mehr in dieser Folge des RESPonse Podcast – gute Unterhaltung.
In Teil 2 der Hypothermie-Reihe wird es wieder frostig! Über NEF-Fahrer mit übergrosser Supraspritze, aufgerissene RTW-Seitentüren und Sommerservietten. Der Beitrag Hypothermie – Teil 2 erschien zuerst auf Rettungsdienst FM.
#58 - Die Macht der Kälte. Ein Gespräch mit Julian Schreckenberg
Kälte: Sie lässt uns zittern, schneller atmen, unseren Herzschlag beschleunigen und unsere mittlere Körperkerntemperatur sinken. Kühlen wir weiter aus, kann dies lebensbedrohliche Folgen haben. Wie unser Körper aber genau auf fallende Temperaturen reagiert, ob diese auch positive Einflüsse auf unseren Körper haben können und was wir besonders zur jetzigen Jahreszeit tun können, um zum einen uns, aber auch unsere Mitmenschen davor zu schützen, erklärt uns heute Julian Schreckenberg. Kältebusse sind dazu da, um hilfsbedürftige Obdachlose vor Kälte zu schützen. Unter diesen Rufnummern nehmen sie auch gerne Hinweise von aufmerksamen Passanten entgegen: Hamburg 040 40178215 oder 040 428285000 München 089 20045930 Berlin 0178 5235838 Frankfurt am Main 069 431414 Düsseldorf 01578 3505152 Ob es auch in Eurer Stadt Kältebusse gibt, erfahrt ihr ganz einfach online.
Anna On The Rocks Frieren – Erfrieren – Gefrieren – Schein- tod Der Wecker klingelt, ihr geht in das Badezimmer und tretet barfüssig auf kalte Fliesen. Ziemlich unangenehm, oder?! Wie würde es nun sein, wenn man selbst in eine Situation käme, in welcher man unter einer dicken Eisschicht gefangen und final nur noch eine eigene … „Hypothermie – Teil 1“ weiterlesen Der Beitrag Hypothermie – Teil 1 erschien zuerst auf Rettungsdienst FM.
23 novembre 2020 - Son cœur s'arrête 45 minutes, puis il revient à la vie - Sur le pouce
Tous les soirs, retrouvez l'histoire du jour par l'édition du soir de Ouest-France. Crédit musique : Cuisine - Nctrnm / freearchivemusic.org (cc by 4.0) Crédits : REUTERS/Benoit Tessier
Description de l’épisode : Au Royaume-Uni, des chercheurs étudient les avantages scientifiques de la natation en eau froide pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Et les résultats préliminaires pourraient bien vous donner envie de vous y mettre, vous aussi! Avec Élise Jetté et Charles Trahan. Une production QUB radio Novembre 2020 Pour de l’information concernant l’utilisation de vos données personnelles - https://omnystudio.com/policies/listener/fr
Die kalten Jahreszeiten beginnen und da ist die Wahrscheinlichkeit einer Unterkühlung nicht ausgeschlossen. Was es da alles besonderes zu beachten gibt und was im Körper passiert hört ihr wie gewohnt in diesem Podcast. Viel Spaß beim hören und umsetzen. Folgt mir gerne auch auf meinen Social Media Kanälen (Instagram: kevinmaeckmeyer Tiktok: erste_hilfe_kanal) und besucht mich in meinem Phönix-Shop auf www.kevinmaeckmeyer.com
Im letzten Teil unserer zweiteiligen Reihe zur Temperatur erklärt uns Prof. Dr. Bräuer, DEAA, was wir tun können um peruoperative Hypothermien zu vermeiden und welche Möglichkeiten der Temperatursteuerung in der modernen Anästhesiologie zum Einsatz kommen. Prof. Bräuer ist Co-Autor der deutschsprachigen Leitlinien zur Vermeidung perioperativer Hypothermie und Verfasser ALLER Bücher zu diesem Thema. Fortbildungspunkte werden innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung der Episode erfasst und weitergeleitet. Dazu bitte wie immer das Formular auf der Homepage der Episode nutzen.
Baisse de la température en dessous de 35°C. Exposition au froid, intoxications, septicémie, causes cérébrales (AVC, tumeurs...), hypothyroïdie, brûlures, dermites bulleuses, malnutrition, iatrogène (bloc, réanimation), insuffisance rénale chronique...
Draussen wird es immer kälter, was machen wir dann mit dem Patienten?
Hypothermie Bevor die kalte Jahreszeit so richtig in Schwung kommt und uns die ersten Patienten mit Hypothermie beschert ein Podcast über die prä- und klinische Behandlung von Hypothermie. Zusatzmaterial: Algorithmus Hypothermie
Folge 2 - akute Psychosen und akzidentielle Hypothermie
In der zweiten Folge gibt es ein Interview mit Karin (Konsilliarpsychiaterin ) über akute Psychosen und einen Beitrag zur Hypothermie
Unsere neue Folge aus dem Monat April. Freut euch auf einen umfangreichen Journalclub, eine Übersicht zu akzidenteller Hypothermie, was ist eigentlich Delir, Patient-Blood-Management mit maschineller Autotransfusion, Antiinfektive Therapie der Pneumonie (Teil 1), Alpha-2 Agonisten und natürlich dem Kochrezept des Monats. Hört rein! Journal Club Landoni, Giovanni, et al. „Volatile Anesthetics versus Total Intravenous Anesthesia for Cardiac Surgery.“ New England Journal […] Der Beitrag Podcast April 2019 erschien zuerst auf pin-up-docs - don't panic.
Verträglichkeit einer mehrfach wiederholten Anästhesie mit Methadon, Alfaxalon und Isofluran während der Therapie des inoperablen felinen Fibrosarkoms mit in thermosensitiven Phosphatidyldiglycerin-Liposomen eingeschlossenem Doxorubicin in Kombination mit
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Ziel der Studie war es, die mehrfach wiederholte Anästhesie mit Methadon, Alfaxalon und Isofluran während der Therapie des inoperablen felinen Fibrosarkoms mit Doxorubicin-beladenen thermosensitiven Phosphatidyldiglycerin-Liposomen, die auf dem synthetischen 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphodiglycerol basieren (DPPG2-TSL-DOX), in Kombination mit regionaler Hyperthermie zu evaluieren. Des Weiteren wurde untersucht, ob im Rahmen der regionalen Hyperthermie eine systemische Hyperthermie auftritt. In die prospektive, experimentelle, observative Studie wurden 14 Katzen mit histologisch bestätigtem Fibrosarkom und einer Anästhesierisikoeinstufung in die Klassen 2 und 3 nach der American Society of Anesthesiologists aufgenommen. Neun Katzen beendeten die Studie. Bei fünf Katzen kam es zum Studienabbruch. Die Katzen wurden mit Methadon (Comfortan® Eurovet Animal Health BV., Ae Bladel, Niederlande) in einer Dosierung von 0,2 mg/kg intravenös prämediziert und mit Alfaxalon (Alfaxan®, Jurox (UK), London, Großbritannien) in einer Dosierung von 1,0 bis 4,0 mg/kg intravenös nach Effekt eingeleitet. Die Anästhesieerhaltung erfolgte mittels Inhalationsanästhesie mit Isofluran (IsoFlo®, Abbott Laboratories Ltd, Maidenhead Birkshire, England) in 100 % Sauerstoff. Die Studienteilnehmer wurden in vier Gruppen mit unterschiedlichen Doxorubicindosierungen von 0,1 bis 0,8 mg/kg eingeteilt. Pro Katze wurden sechs Therapiesitzungen im Abstand von zwei Wochen veranschlagt. Der Tumor wurde erhitzt und bei Erreichen der Zieltemperatur erfolgte die intravenöse Verabreichung des DPPG2-TSL-DOX über 15 Minuten sowie eine Fortführung der regionalen Hyperthermie-Behandlung über 60 Minuten. Während der Anästhesien wurden die Tiere kontinuierlich überwacht. Die Anästhesie mit Methadon, Alfaxalon und Isofluran erwies sich als praktikabel, war jedoch von nicht optimalen Begleiterscheinungen gekennzeichnet. In insgesamt 18 Sitzungen trat bei neun Tieren eine Bradykardie auf, die einer Gabe von Glycopyrroniumbromid bedurfte. Bei sechs Tieren in insgesamt neun Sitzungen wurde eine Tachykardie dokumentiert, die bei vier Katzen in insgesamt fünf Sitzungen während der Gabe des DPPG2-TSL-DOX auftrat. Von den tachykarden Katzen erhielt eine Katzen zuvor Glycopyrroniumbromid und vier Katzen Dopamin. Während insgesamt 49 Anästhesien wurde bei 13 Tieren eine Hypotension beobachtet, die zur Stabilisierung des Blutdruckes eine Dopamin-Dauertropfinfusion notwendig machte und in 39 Sitzungen bereits vor der DPPG2-TSL-DOX-Gabe dokumentiert wurde. Eine Hypertension, die in allen drei Fällen zum Zeitpunkt 5 Minuten nach Start der DPPG2-TSL-DOX-Gabe auftrat, wurde bei drei Tieren in insgesamt drei Sitzungen dokumentiert. Alle drei Katzen erhielten zum Zeitpunkt der Hypertension zugleich Dopamin. Bei keiner Katze wurde eine Hypoxämie oder eine Hyperkapnie beobachtet. Bei einer Katze kam es nach Einleitung zu einmaligem Erbrechen. Es verstarben keine Katzen im Verlauf der durchgeführten Anästhesien. Im Rahmen der Therapiesitzungen wurden neben den moderaten Veränderungen der oben genannten Parameter vereinzelt geringfügige Komplikationen dokumentiert. Diese Komplikationen, zu denen vereinzeltes Speicheln auf Methadongabe, eine einmalig auftretende Speichelansammlung in der Trachea, viermaliges Husten und zweimalige Schwellungen im Gesichtsbereich zählten, waren alle vorrübergehend und nicht eindeutig in direkten Zusammenhang mit der Anästhesie oder der DPPG2-TSL-DOX-Gabe zu bringen. Die regionale Hyperthermie hatte keine systemische Hyperthermie zur Folge. Bei allen Katzen wurde eine rektale und oesophageale Hypothermie unter 38,0 °C über den gesamten Anästhesiezeitraum dokumentiert, die trotz aktiver Erwärmung bei allen bis auf eine Katze bis zum Ende der Anästhesie vorhanden war. Des Weiteren wurden keine subjektiven Besonderheiten und Komplikationen im Rahmen der Studie beobachtet, die Nebenwirkungen der Anästhesie, der DPPG2-TSL-DOX-Applikation oder der regionalen Hyperthermie sein könnten. Es traten keine weiteren Nebenwirkungen auf, die auf eine anaphylaktische oder auf eine Hypersensitivitätsreaktion hinwiesen. Für eine bessere Differenzierung und Zuordnung der Auswirkungen von Anästhesie und DPPG2-TSL-DOX in Kombination mit regionaler Hyperthermie wäre die Einführung einer Kontrollgruppe sinnvoll.
Neuroprotektion durch moderate Hypothermie (33°C) nach experimenteller Subarachnoidalblutung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Thu, 7 May 2015 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/18236/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/18236/1/Toeroek_Elisabeth.pdf Toeroek, Elisabeth ddc:610, ddc:60
Im Rahmen des tragischen Unfalls um den Rennfahrer Michael Schumacher ist ein Verfahren zur zerebralen Protektion in den Fokus gerückt: die therapeutische Hypothermie. Besonders nach der kardio-pukmonalen Reanimation hat sich diese Technik des zerebralen Schutzes – zumindest an einigen Zentren – als Standard durchgesetzt. Wieso man mit Kälte das Gehirn vor Folgeschäden schützen kann, erklärt der Hallenser Intensivmediziner Privatdozent Dr. Harald G. Fritz, Chefarzt am Krankenhaus Martha-Maria in Halle (Saale).
Im Rahmen des tragischen Unfalls um den Rennfahrer Michael Schumacher ist ein Verfahren zur zerebralen Protektion in den Fokus gerückt: die therapeutische Hypothermie. Besonders nach der kardio-pukmonalen Reanimation hat sich diese Technik des zerebralen Schutzes – zumindest an einigen Zentren – als Standard durchgesetzt. Wieso man mit Kälte das Gehirn vor Folgeschäden schützen kann, erklärt der Hallenser Intensivmediziner Privatdozent Dr. Harald G. Fritz, Chefarzt am Krankenhaus Martha-Maria in Halle (Saale).
Therapie nach transienter zerebraler Ischämie und Reperfusion
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/06
Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss der postischämischen Hypothermie auf die Integrität der Mikrogefäße nach transienter fokaler zerebraler Ischämie mit anschließender Reperfusion zu untersuchen und mögliche protektive Mechanismen darzulegen. Der Einfluss der Hypothermie auf die Mikrogefäße soll dabei im Mausmodell an Knock-Out (KO) Mutanten des PPS unter normothermer und hypothermer Behandlung genauer untersucht werden. Als Ischämiemodell wurde das „transient middle cerebral artery occlusion“ Modell (tMCAO) mit einer 3-stündigen Ischämie und 24-stündigen Reperfusionsphase (I3R24) gewählt. Neben Wildtyptieren, die als Kontrolle dienten, wurden KO Mutanten (Plg-/-, tPA-/-, uPA-/- und PAI-1-/- Mäuse) aus dem PPS nach tMCAO untersucht. Postischämisch wurde durch extrakorporale Kühlung eine 24-stündige, milde bis moderate Hypothermie erzeugt und überwacht. Nach Beendigung der hypothermen oder normothermen Behandlung erfolgte nach Perfusion die Entnahme des Gehirns. Im weiteren Verlauf wurden Gehirnschnitte zur volumetrischen, immunohistochemischen und biochemischen Aufarbeitung und Auswertung erstellt. In dieser Arbeit zeigte sich, dass die hypotherme Therapie im Mausmodell eine wirkungsvolle physikalische Methode darstellt die Schädigungen (u.a. Reduzierung des Infarktvolumens, Verminderung der Blutung) nach einem Schlaganfall effektiv zu mindern. Die gewonnenen Ergebnisse aus den Hypothermiedaten belegen, dass die Reduzierung des ischämischen Schadens unter Hypothermie kein reiner Temperatureffekt ist. Dafür spricht unter anderem die starke Supprimierung der uPA Aktivität bei gleichbleibender tPA Aktivität unter hypothermer Therapie. Die stabilen Konzentrationen der Inhibitoren TIMP-1 und TIMP-2 bei gleichzeitig sinkender MMP-9 Konzentration, sprechen ebenso für die selektive Wirkung der Hypothermie. Somit wird das proteolytische Gleichgewicht aus Proteasen (MMPs) und den zu gehörigen Inhibitoren (TIMPs) in Richtung Inhibition verschoben. Mit Hilfe der hier verwendeten Knock-Out Mutanten im Ischämie-Reperfusionsmodell konnte bestätigt werden, dass die Proteasen des PPS entscheidend für den ischämischen Schaden sind. So wirkte sich vor allem die Deletion des Plasminogenaktivators uPA abschwächend auf den mikrovaskulären Schaden aus. Wird ein wichtiger Inhibitor des PPS, PAI-1, genetisch deletiert, so stieg der ischämische Schaden, gezeigt am Infarktvolumen und den geschädigten Mikrogefäßen, an. Die Hypothermiebehandlung an Knock-Out Tieren des PPS zeigten selektive Schutzmechanismen für die zerebralen Mikrogefäße. Der deutlichste Effekt konnte durch die Modulation des uPA erzielt werden. Hypothermie beeinflusst das schädigende uPA überproportional. tPA dagegen scheint während der Hypothermie eine protektive Wirkung auf das mikrovaskuläre System zu entfalten. So legen die Ergebnisse dieser Studie eine Wirkweise über die Regulation des MMP-Inducers EMMPRIN nahe; tPA ist möglicherweise verantwortlich für ein Reduzierung des EMMPRINs und damit für eine Reduzierung der Matrixmetalloproteasen. In dieser Arbeit konnte mit dem gewählten experimentellen Aufbau, der Kombination einer moderaten Hypothermie mit ausgewählten Knock-Out Mutanten des PPS, im Ischämie- Reperfusionsmodell eindeutig gezeigt werden, dass Hypothermie einen selektiven Schutz bei der Behandlung der zerebralen Ischämie bietet. Einige Mechanismen konnten aufgezeigt werden und bieten Ansatzpunkte für weitere, eventuell klinisch anwendbare Therapiemöglichkeiten.
Einfluss von Hypothermie und Kardioplegielösungen auf die alpha-Gal-Epitope auf porcinen Aortenendothelzellen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 12/19
Im Rahmen einer Invitro-Studie mit porcinene Aortenendothelzellen wurde der Einfluss von Hypothermie und den Kardioplegielösungen UW-Lösung und Bretschneider-Lösung auf die alpha-gal-Epitope untersucht. Zur Bestimmung des Einflusses von Hypothermie auf die alpha-gal-Epitope wurden die Zellen der Versuchsgruppen über 1h,4h und 6h bei 4°C gekühlt, die Zellen der Kontrollgruppen wurden über den entsprechenden Zeitraum bei 38°C inkubiert. Zur Bestimmung des Einflusses der Kardioplegielösungen wurden die Zellen der Versuchsgruppen über 4h bei 4°C unter Zusatz von Bretschneider- oder UW-Lösung gekühlt, während die Zellen der Kontrollgruppen über 4h bei 4°C ohne Zusatz der entsprechenden Lösung gekühlt wurden. Es zeigte sich kein signifikanter Einfluss der Hypothermie von 4°C auf die alpha-Gal-Epitope. Die Kardioplegielösungen aber führten zu einer signifikanten Reduktion der Epitope pro Zelle (UW-Lösung 50%, Bretschneider-Lösung 32%). Der hier nachgewiesene alpha-gal-Epitop reduzierende Effekt der Kardioplegielösungen könnte eine therapeutische Option zur Verhinderung der Abstoßungsreaktionen in der Xenotransplantation darstellen.
Einfluss der Organtemperatur auf den mikrovaskulären Ischämie-Reperfusionsschaden der Leber
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss der Organtemperatur während der Ischämie auf den mikrovaskulären Ischämie-Reperfusionsschaden systematisch zu analysieren. Um dies zu ermöglichen wurde im ersten Abschnitt der vorliegenden Arbeit ein geeignetes Tiermodell etabliert. Das entwickelte Modell ermöglichte eine reversible in situ Ischämie mit anschliessender Reperfusion des linken Leberlappens der Maus. Während der Ischämie konnte der ischämische Leberlappen genau auf die gewünschte Temperatur eingestellt und konstant gehalten werden. Abgesehen von der unterschiedlich eingestellten Organtemperatur, herrschten bei allen Versuchsgruppen gleiche Bedingungen. Weder bei der Körperkerntemperatur noch bei dem mittleren arteriellen Blutdruck gab es signifikante Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen. Nach darauffolgender Reperfusion ermöglichte das Modell eine intravitalmikroskopische Analyse der Mikrozirkulation und anschliessende ex vivo Messungen vieler Schadensparameter. Damit ist es gelungen, ein geeignetes Tiermodell zur systematischen in vivo Analyse des singulären Einflusses verschiedener Organtemperaturen auf den hepatischen Ischämie-Reperfusionsschaden der Maus, zu etablieren. Die Ergebnisse wiesen, in Übereinstimmung mit der Literatur, einen ausgeprägten Ischämie-Reperfusionsschaden nach normothermer Ischämie auf. Dabei war die sinusoidale Perfusionsrate signifikant reduziert, es trat eine deutliche Zunahme der Leukozyten-Endothelzell-Interaktion auf und es folgte eine massive Freisetzung der Leberenzyme AST/GOT und ALT/GPT. Erstaunlicherweise konnten bereits durch eine milde Hypothermie von 26°C sämtliche Schadensparameter auf das Niveau der Shamgruppe reduziert werden. Entgegen der Erwartung scheint es keinen linearen Zusammenhang zwischen Organtemperatur und Ausmaß des mikrovaskulären Schadens zu geben. Vergleichbar mit den Ergebnissen der Mikrozirkulation war nach normothermer Ischämie auch eine Vielzahl apoptotischer Zellen zu verzeichnen. Nahezu 17% der Hepatozyten waren TUNEL-positiv und die Aktivität der apoptose-spezifischen Caspase-3 nahm um etwa das vierfache zu. Auch hier bewirkte bereits ein mildes Abkühlen des ischämischen Leberlappens auf 31,5°C eine vollständige Protektion der Leberzellen vor Apoptose. Es zeigte sich damit auch hier kein linearer Zusammenhang zwischen Organtemperatur und Ausmaß einer Apoptoseinduktion. Der Verdacht auf eine durch Kälte induzierte Apoptose konnte sich in diesem Versuchsaufbau nicht erhärten. Nach 90-minütiger Ischämie bei 4°C waren, wie auch in der Shamgruppe, weniger als 1% TUNEL-positive Zellen zu verzeichnen und ein Anstieg der Caspase-3-Aktivität blieb vollständig aus. Bei der Betrachtung, ob es sich bei der Zellschädigung um nekrotischen oder um apoptotischen Zelltod handelt, ergaben die verwendeten Messmethoden deutliche Hinweise für beide Arten des Zelltodes.
Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran bei der experimentellen zerebralen Ischämie mit Reperfusion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Experimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass es beim Schlaganfall in der Reperfusionsphase zu einer Schädigung der Basalmembran und zu einem Zusammenbruch der mikrovaskulären Integrität kommt. Dies kann zu einer intrazerebralen Hämorrhagie mit zusätzlichen neurologischen Schäden führen. Die systemische Thrombolyse mit rekombinantem Gewebe-Plasminogen-Aktivator (rt-PA) zielt auf die Fibrinolyse des Thrombus, der das Hirngefäß verschließt, um den zerebralen Blutfluß wiederherzustellen und den Infarkt zu verkleinern. Jedoch haben klinische Studien gezeigt, dass die Thrombolyse die Gefahr einer intrazerebralen Blutung steigert. Klinische und experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass eine postischämische Hypothermie das Infarktvolumen verkleinern kann. Der postulierte Wirkungsmechanismus einer Hypothermie ist die Verminderung der Aktivität unspezifischer und spezifischer proteolytischer Systeme (z.B. endogene Plasminogenaktivatoren (u-PA und t-PA) oder die Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9). Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluß einer postischämischen Hypothermie auf die Basalmembran der Hirngefäße nach einer zerebralen Ischämie mit Reperfusion zu untersuchen und mögliche Schädigungsmechanismen darzulegen. Hierzu wurde bei narkotisierten, beatmeten Ratten eine 3-stündige transiente fokale zerebrale Ischämie mit 24-stündiger Reperfusion erzeugt. Postischämisch wurde durch extrakorporale Kühlung eine 24-stündige milde bis moderate Hypothermie erzeugt und mittels Temperatursonde ständig gemessen und überwacht. Nach Beendigung des Versuches wurden die Hirne entnommen und einer volumetrischen, immunohistochemischen und biochemischen Aufarbeitung und Auswertung zugeführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine postischämische Hypothermie die Degradation der Basalmembran zum großen Teil verhindert und die Infarktgröße signifikant reduziert. Gleichzeitig kommt es durch diesen strukturellen Erhalt der Basalmembran zu einem funktionellen Erhalt der Integrität und zu einer Verminderung der Extravasation von korpuskulären und nichtkorpuskulären Blutbestandteilen. Zusätzlich konnte eine mögliche Ursache für die Degradation der Basalmembran und den Verlust der mikrovaskulären Integrität aufgezeigt werden. Die postischämische Hypothermiebehandlung verhinderte die Steigerung der Aktivität der Plasminogen-Aktivatoren u-PA und t-PA und der Matrix-Metallo-Proteinasen MMP-2 und MMP-9. Wir schließen aus den vorliegenden Untersuchungen, dass eine postischämische Hypothermie das Risiko des Auftretens einer Hämorrhagie als gefürchtete Komplikation nach einer zerebralen Ischämie senken kann. Dies gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da die therapeutische Anwendung der systemischen Thrombolyse die Gefahr des Auftretens einer Hämorrhagie steigert. Eine systemische Thrombolyse in Kombination mit einer Hypothermie wäre eine mögliche Therapieoption, um die Gefahr des Auftretens einer intrazerebralen Blutung zu vermindern. Der genaue Pathomechanismus ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Deshalb sind vor der Anwendung beim Menschen noch weitere experimentelle und klinische Studien notwendig.
Zelluläre Verteilung und Einfluss von rtPA und Hypothermie auf die Calpainaktivität bei zerebraler Ischämie/Reperfusion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Charakterisierung der Protease Calpain und ihres zellulären Verteilungsmusters in Abhängigkeit von der Reperfusionsdauer. Steigender Anteil nicht-neuronaler Zellen, v.a. Endothelzellen und Mikroglia, mit zunehmender Dauer. Größte Fraktion stellen die Neuronen dar. Desweiteren Einfluß von rtPA und Hypothermie auf Calpainaktivität. rtPA führt dosisunabhängig nicht zu erhöhter Calpainaktivität, Hypothermie verringert die Aktivität signifikant, ebenso Kombination aus rtPA/Hypothermie.
Einfluß von Hypothermie auf die Volumenregulation von Gliazellen in vitro
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Thu, 10 Nov 2005 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4510/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4510/1/Euringer_Edith.pdf Euringer, Edith ddc:600, ddc:610, Medizinische Fak
Einfluss der Hypothermie auf die Expression der Apoptose-assoziierten Proteine nach inkompletter cerebraler Hemisphären-Ischämie bei der Ratte über einen Beobachtungszeitraum von 28 Tagen
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/07
Die vorliegenden Studie untersucht den Einfluss der Hypothermie auf die Expression der Apoptose-assoziierten Proteine Bax, p53, Bcl-2 und Mdm-2 nach Induktion einer inkompletten cerebralen Hemisphären-Ischämie mit anschließender Reperfusion bei der Ratte über einen Beobachtungszeitraum von 28 Tagen. Als Versuchstiere dienen 72 männliche Sprague-Dawley Ratten, die unter Halothan anästhesiert, intubiert und mit 2 Vol % Isofluran und N2O/O2 (FiO2=0,33) beatmet werden. Um eine arterielle Blutdruckmessung durchführen zu können und zur Blutentnahme und Applikation von Medikamenten katheterisiert man die rechte A. und V. femoralis und die rechte V. jugularis. Des Weiteren bringt man verschiedene Messsonden an, um einzelne physiologische Parameter genau zu dokumentieren (perikranielle Temperatur-messung, EKG, EEG, Messung der Hirndurchblutung). Nach Abschluss der Präparation werden die einzelnen Tiere randomisiert der Normothermie- (n=32), der Hypothermie-Gruppe (n=32) oder einer unbehandelten Nativ-Gruppe (n=8) zuge-wiesen. Als Ischämiemodell dient der rechtsseitige 45-minütige Verschluss der A. carotis communis unter gleichzeitiger Hypotension durch Blutentzug bis zur Absenkung des MAP auf 40 mmHg. Bei den Tieren der Hypothermie-Gruppe wird die perikranielle Temperatur durch Auflegen von Eisbeuteln innerhalb von 30 min auf 34 °C abgesenkt, hält für 1h die Tiere bei 34 °C und erwärmt sie anschließend innerhalb von 30 min wieder. Nach Ablauf des jeweiligen Beobachtungszeitraumes (1, 3, 7 oder 28 Tage) werden die Tiere getötet, das Gehirn entnommen, tiefgefroren und anschließend in Serie geschnitten oder für die Western-Blot-Analyse aufbereitet. Die Nativtiere tötet man ohne jegliche Manipulation unter Narkose, um für die anschließenden Analyseverfahren einen physiologischen Ausgangswert zu etablieren. Die Expression der Apoptose-assoziierten Proteine Bax, p53, Bcl-2 und Mdm-2 wird durch die Immunfluoreszenz-Färbung (konfokale Lasermikroskopie) und Western-Blot-Analyse untersucht. Für das pro-apoptotische Bax-Protein konnte in der Hypothermie-Gruppe eine signifikante Verminderung bis zu Tag 7 (Immunfluoreszenz-Färbung) bzw. 28 (Western-Blot-Analyse, ischämische Hemisphäre) nachgewiesen werden. Für das p53-Protein zeigt sich nur in der Western-Blot-Analyse eine signifikante Erhöhung in der Hypothermie-Gruppe am Tag 1 auf der nicht-ischämischen Hemisphäre. Das anti-apoptotische Bcl-2-Protein der Hypothermie-Gruppe (Immunfluoreszenz-Färbung) steigt signifikant in beiden Hemisphären am Tag 1 und 3 an. In der Western-Blot-Analyse zeigt sich nur auf der ischämischen Hemisphäre ein Effekt in der Hypothermie-Gruppe: Hier steigt die Menge des Bcl-2-Protein am Tag 1 und Tag 28. Die Expression des anti-apoptotischen Mdm-2-Proteins steigt signifikant in der Immunfluoreszenz-Färbung in beiden Hemisphären am Tag 1 an. In der Western-Blot-Analyse kann nur in der nicht-ischämischen Hemisphäre am Tag 1 ein signifikanter Anstieg in der Hypothermie- im Vergleich zur Normothermie-Gruppe nachgewiesen werden. Zu den übrigen Untersuchungszeitpunkten zeigen sich dahingehend Tendenzen. Die teilweise unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Analyseverfahren kann man durch die in der Probenaufbereitung begründeten unspezifischere Detektion der Western-Blot-Analyse im Vergleich zur Immunfluoreszenz-Färbung erklären. Zusammenfassend kann diese Studie zeigen, dass auch im Langzeiteffekt das Ausmaß des neurologischen Schadens nach einer induzierten cerebralen Ischämie durch Absenkung der perikraniellen Temperatur reduziert werden kann. Um die genauen Wirkmechanismen der Hypothermie näher zu erforschen und so neue Ansätze im klinischen Alltag zur Therapie ischämischer Insulte zu etablieren, müssen noch weitere umfassende Untersuchungen durchgeführt werden.
Mikrozirkulatorisches Monitoring mittels Orthogonal Polarisation Spectral Imaging (OPS) während herzchirurgischer Eingriffe unter extrakorporaler Zirkulation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Die moderne Ära der Herzchirurgie begann mit der Einführung der Herz- Lungen- Maschine in den frühen 50er Jahren. Die grundlegenden Veränderungen, welche durch die Anwendung der HLM initialisiert werden, sind Veränderung des pulsatilen Blutflusses, Exposition des Blutes an unphysiologische Oberflächenstrukturen und Scherkräfte, sowie Auslösung einer überschiessenden systemischen inflammatorischen Reaktion. Diese Veränderungen haben nicht nur makrohämodynamische Auswirkungen, sondern beeinflussen auch die Mikrozirkulation. Zum Monitoring der Mikrozirkulation wurde von unserer Arbeitsgruppe OPS imaging, eine neue Technik, welche mit polarisiertem Licht und Epi- Illumination ohne Einsatz von Fluoreszenzfarbstoffen arbeitet, eingesetzt. Im Mittelpunkt unseres Interesses stand die Frage nach Anwendbarkeit und Praktikabilität, sowie Sicherheit und diagnostischem Potential von OPS imaging. Da wir insbesondere nach Eingriffen im Kreislaufstillstand tiefgreifende mikrozirkulatorische Veränderungen erwarteten, unterteilten wir die Studiengruppe in 27 Patienten mit koronarer Bypassoperation bzw. Herzklappenersatz ohne Kreislaufstillstand (Gruppe 1) und in 5 Patienten mit Operationen im Kreislaufstillstand (Gruppe 2). In tiefer Hypothermie (28- 16∞C) und im Kreislaufstillstand werden Operationen von Aneurysmen des Aortenbogens operiert. Es wurden erythrozytäre Fliessgeschwindigkeit (Vel), venolärer Gefässdurchmesser (Dia) und Funktionelle Kapillardichte (FCD) zu 4 bzw. 5 verschiedenen Zeitpunkten bestimmt. Mittels OPS imaging konnten die ersten Mikrozirkulationsbilder der veränderten Perfusion unter Herz- Kreislaufstillstand und extrakorporaler Zirkulation erhoben werden. Wir konnten zeigen, dass die Mikrozirkulation während Eingriffen an der HLM aufrecht erhalten wird. In Gruppe 1 stieg die Vel lediglich in der späten Phase der HLM signifikant an. Bei Eingriffen im Kreislaufstillstand (Gruppe 2) zeigte sich ein signifikanten Abfall der Vel während der gesamten Messperiode unter extrakorporaler Zirkulation. Eine dramatische Reduktion der Vel um 74,6 % wurde in T after CA beobachtet. Da nach Beendigung der HLM Ausgangswerte erreicht wurden, ist anzunehmen, dass die nutritive Blutversorgung nach HLM und Kreislaufstillstand wieder hergestellt werden kann. Da während unkomplizierter HLM lediglich moderate Veränderungen der Vel, bei Eingriffen im Kreislaufstillstand aber eine signifikante Verminderung der Vel auftraten, müssen verschiedene Ursachen diskutiert werden. Eine entscheidende Rolle spielt die tiefe Hypothermie in Gruppe 2 mit Senkung der Körpertemperatur auf durchschnittlich 16,5∞C während des Stillstandes. In der Phase der Wiedererwärmung konnte eine rasche Erholung auf Initialwerte beobachtet werden. Auch die signifikante Verminderung des mittleren arteriellen Drucks während der HLM in beiden Gruppen, ausgeprägter jedoch in Gruppe 2 hat Einflüsse auf die Mikrozirkulation. Der Druckabfall mit Beginn der extrakorporalen Zirkulation wird durch eine Verminderung des systemischen Gefässwiderstands, bedingt durch eine erniedrigte Blutviskosität infolge Hämodilution, Dilution zirkulierender Katecholamine und temporärer Hypoxämie, verursacht. Die Hämodilution war in beiden Gruppen ausgeprägt. Die Abnahme der Hb-Konzentration betrug in Gruppe 1 –33 % und in Gruppe 2 –39 % (in T2). Es zeigte sich weder in Gruppe 1, noch Gruppe 2 eine signifikanten Veränderung des postkapillären Venolendurchmessers. Die FCD, als Indikator für den nutritiven Blutfluss war in Gruppe 1 unverändert. In Gruppe 2 mit Eingriffen im Kreislaufstillstand konnte ein signifikanter Abfall der FCD innerhalb 10 Minuten nach Beendigung des Kreislaufstillstandes auf 23 %, verglichen zum Ausgangswert beobachtet werden. Da die FCD in beiden Gruppen nach Beendigung der HLM Ausgangswerte zeigte, ist anzunehmen, dass die nutritive Blutversorgung sowohl nach unkomplizierter HLM, als auch nach Eingriffen im Kreislaufstillstand wieder hergestellt werden kann. Wir konnten in Übereinstimmung mit anderen Gruppen zeigen, dass durch die HLM eine systemische Entzündungsreaktion mit Leukozytenaktivierung und Expression von Adhäsionsmolekülen ausgelöst wird. In 8 Patienten der Gruppe 1 wurden die aktivierten Leukozyten und die Adhäsionsmoleküle CD 18 und CD 62L bestimmt. Die aktivierten Leukozyten wiesen in der späten Phase der HLM einen 3- fachen und eine Stunde nach Reperfusion einen 6,6- fachen Anstieg verglichen zum Ausgangswert auf. Die Adhäsionsmoleküle CD 62L zeigten keine signifikanten Veränderungen. CD 18 stieg in der späten Phase der Reperfusion um 31 % an. Auch in Gruppe 2 konnten wir Hinweise für einen Ischämie- Reperfusionsschaden finden. Wir konnten ein Laktatanstieg in T3 und T4 und ein Gewebeödem als indirekter Hinweis auf eine erhöhte Permeabilität der Endothelbarriere mit „capillary leak“ Syndrom erkennen. Durch die Veränderung des Blutflusses während HLM und die erhöhte Rigidität der Erythrozyten beobachteten wir vor allem innerhalb 10 Minuten nach Reperfusion eine Heterogenität der Perfusion, eine Verminderung der Vel mit Bildung von Mikroaggregaten und eine reduzierte FCD. Diese Verminderung der FCD wird auch als postischämisches „no reflow“ Phänomen bezeichnet. Zusammenfassend ist festzustellen, dass wir mit OPS imaging Mikrozirkulationsstörungen, hervorgerufen durch HLM und Kreislaufstillstand nachweisen konnten. Veränderungen im Sinne einer systemischen inflammatorischen Reaktion und eines Ischämie- Reperfusionsschadens konnten mittels OPS imaging visualisiert werden.
Magnesium, Tirilazad und Hypothermie - Neuroprotektive Wirksamkeit einer Kombinationstherapie bei temporärer und permanenter fokaler zerebraler Ischämie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Thu, 10 Jul 2003 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/1102/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/1102/1/Schoeller_Karsten.pdf Schöller, Karsten