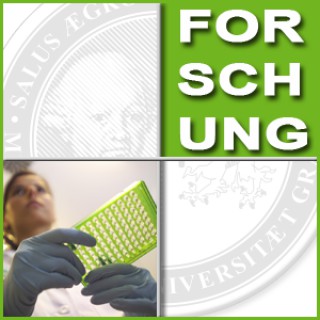Podcasts about am institut
- 25PODCASTS
- 26EPISODES
- 31mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Aug 11, 2025LATEST
POPULARITY
Latest news about am institut
- Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) Tübingen AWOL - The Ancient World Online - Jul 26, 2025
Latest podcast episodes about am institut
Sternschnuppen im Stahltank helfen in der Raumfahrt
Um Sternschnuppen ganz nah zu sein, muss man nicht in den Weltraum fliegen. Es reicht die Fahrt nach Stuttgart. Am Institut für Raumfahrtsysteme steht ein sogenannter Plasmawindkanal. In großen Stahltanks lassen die Forschenden mit viel Geschick Sternschnuppen aufleuchten. Christine Langer im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD Wissenschaftsredaktion
Neues Forschungszentrum für Bauernhöfe der Zukunft
Die Ostschweizer Fachhochschule OST hat im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Kantons Thurgau in Tänikon ein neues Institut aufgebaut und eröffnet. Am Institut wird im Bereich von intelligenten System für Bauernhöfe geforscht. Weitere Themen: · Kanton Graubünden will weitere Gemeinden ans Glasfasernetz bringen. · Industriegruppe Aebi Schmidt übernimmt Fahrzeugbauer aus Deutschland. · In Kreuzlingen gibts neu ein «Heimweg-Telefon». · St. Galler Regierung will mehr Freiheiten für Kaminfegerinnen und Kaminfeger.
Ob nun ein Blinddarm, eine Stuhlprobe oder ein PAP-Abstrich. Am Institut für klinische Pathologie, Mikrobiologie und molekulare Diagnostik am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried kommt vieles unter das Mikroskop. Teamarbeit zwischen den Ärzt*innen und Biomedizinischen Analytiker*innen ist hierbei gefragt. Wie so ein klassischer Arbeitsalltag am Institut aussieht, erzählen Prim. Dr. Milo Halabi und BMA Kornelia Walser.
Ausstellung „Kunst und Fälschung – Aus dem Falschen das Richtige lernen“ gibt seltenen Einblick in das Handwerk der Fälscher
Fälschung oder Original? Das ist oft gar nicht leicht zu erkennen, auch nicht für Experten. Gefälscht wird alles, was am Markt Geld bringt – das ist in der Kunstwelt nicht anders! Immer wieder wurden und werden spektakuläre Fälle von Kunstfälschungen bekannt – und sicher viele niemals entlarvt. Am Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg forschen Prof. Henry Keazor und seine Studierenden zum Thema Kunstfälschungen an wahren Fällen. Normalerweise findet diese Forschung im Verborgenen statt und die Fälschungen verlassen nur selten die Asservatenkammern der Polizei. Erstmals präsentiert das Forschungsteam jetzt interessante und kuriose Fälle in einer Ausstellung.
Tue, 02 Jan 2024 08:00:00 +0000 https://frischandiearbeit.podigee.io/167-new-episode 849aa14b7d249cd8e6dc8bc3ffff00b2 „Wir können das Krebsrisiko ganz stark durch unser Verhalten beeinflussen, auch durch unsere Ernährung“, sagt der Ernährungswissenschaftler Martin Smollich im Podcast Frisch an die Arbeit. Am Institut für Ernährungsmedizin in Lübeck erforscht er, wie Lebensmittel wirken. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, in dem er erklärt, welches Essen schwere Krankheiten verhindern kann. “Essen Sie möglichst viel Pflanzliches” lautet eine seiner drei Grundregeln. Martin Smollich studierte Biologie und Pharmazie. Nach dem Studium erforschte er, wodurch das Risiko für Brustkrebs gesenkt werden kann. Schnell stellte er fest: Die richtige Ernährung ist entscheidend, nicht nur bei Brustkrebs, sondern auch um andere Krankheiten wie Demenz oder Bluthochdruck zu verhindern. Seit 2018 forscht und lehrt er in Lübeck. Im Podcast erzählt er, warum ihm das Thema Ernährung so wichtig ist, welche Ratgeber man nicht lesen sollte und wieso ein Stück Sahnetorte manchmal guttut. Außerdem verrät er, welche Gerichte wirklich gesund sind – und was er selbst jeden Tag isst. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER full no ZEIT ONLINE
Maria Helfgott über das Zentrum für Orgelforschung.
Am Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik der mdw - der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien - wird Orgel gespielt, gelehrt und geforscht! Musikchefin Ursula Magnes hat die Leiterin des Zentrums für Orgelforschung Maria Helfgott zum Gespräch getroffen.
Merete Peetz, Universität Greifswald, Forschungsprojekt „Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee“
Neutral geht gar nicht - Debattenpodcast der Politischen Meinung
Flucht über die Ostsee. Viele haben es nicht geschafft. Einst tabuisiert, heute fast vergessen. Im September 1989, kurz vor dem Fall der Mauer, gelang dem letzten DDR-Bürger die Flucht über die Ostsee: Mario Wächtler kraulte in die Freiheit! An den ostdeutschen Stränden erinnert heute nichts mehr an die über 5.000 Menschen, die von hier aus versucht haben, die DDR zu verlassen. Die meisten wurden verhaftet und verschwanden im Gefängnis. Für viele endete die Flucht tödlich. Am Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Greifswald gibt es seit 2019 das Forschungsprojekt „Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee“. Wir sprechen mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Merete Peetz, über ein besonders trauriges Kapitel der deutsch-deutschen Vergangenheit.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass körperliche Aktivität nicht nur bei den weit verbreiteten Zivilisationskrankheiten wie Herzkrankheiten, Übergewicht oder Diabetes hilft, sondern auch bei Krankheiten wie Krebs oder Demenz. An der Deutschen Sporthochschule Köln sammeln Wissenschaftler:innen Daten dazu, warum Sport so gut ist. Einer von ihnen ist Prof. Hans-Georg Predel. Am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin untersucht er jedes Jahr um die 1.000 Leistungsathlet:innen. Die kleinsten Veränderungen im Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselsystem, die bei ihnen unter hoher Belastung sichtbar werden, kann Predel auch auf den Freizeit- und Gesundheitssport übertragen. Im Podcast erklärt er was Bewegung gesund macht, was sie im Körper verändert und ob es auch ein „zu viel“ an Sport geben kann. Außerdem gibt er Tipps, wie man mit dem Sport anfangen kann und worauf man dabei achten sollte. Ein Podcast-Spezial zum Weltgesundheitstag. 00:00:00-00:01:38 – Intro: die Themen der Folge 00:01:38-00:16:15 – Was bewirkt Sport im Körper? 00:16:15-00:34:01 – 11 Minuten oder 10.000 Schritte: Wie häufig sollten wir uns bewegen? 00:34:01-00:41:14 – Welche Art von Sport wirkt sich besonders positiv aus? 00:41:14-00:58:31 – Kann Sport auch ungesund sein? 00:58:31-01:03:24 – Funktioniert Prävention durch Sport? Einblick in die PräFord-Studie 01:03:24-01:09:45 – Wie schafft man den Einstieg in den Sport und wie hält sich Prof. Predel als Sportmediziner fit? 01:09:45-01:10:09 – Outro Informationen: https://www.dshs-koeln.de/einerundemit
Fußballübertragungen zählen zu den quotenstärksten Fernsehsendungen. Auch wenn die Fußball-WM in Katar, die aktuell läuft, noch so kritisch gesehen wird…viele Millionen Zuschauer*innen verfolgen die Spiele. Warum ist das so und welche Macht geht von Zuschauerquoten aus? Jan-Hendrik Raffler spricht mit Sport- und Medienwissenschaftler Dr. Christoph Bertling. Christoph Bertling hat mehr als zehn Jahre lang als Journalist – unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, Spiegel Online und der Deutschen Welle – gearbeitet. Am Institut für Kommunikations- und Medienforschung der Sporthochschule befasst er sich sei fast 20 Jahren mit Sportberichterstattung, Massenmedien und Kommunikationsstrategien. Wie hat sich der Sportjournalismus gewandelt? Wo liegt die Gefahr der sogenannten Filterblasen und welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Berichterstattung? Über diese und weitere Themen sprechen wir bei „Eine Runde mit…“. 00:00:00-00:01:58: Intro: Die Themen der Folge 00:01:58-00:19:13: Zuschauermagnet Fußball: Was macht 22 Spieler und einen Ball auch jetzt bei der WM in Katar für Menschen und Medien so interessant? 00:19:13-00:49:39: Medienwirkungsforschung: Berichterstattung zwischen Unterhaltung und Verantwortung 00:49:39-00:55:23: Künstliche Intelligenz: Wie könnte die Sportberichterstattung der Zukunft aussehen und wie beeinflusst KI schon jetzt unsere Mediennutzung? 00:55:23-01:10:25: Es wird persönlich: Warum Robby Hunke Dr. Christoph Bertling als „Perle“ bezeichnet und wie man es schaffen kann, als junger Sportstudent einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu veröffentlichen 01:10:25-01:11:14: Outro Weitere Informationen: https://www.dshs-koeln.de/einerundemit
Klimafolgenforscherin Kira Vinke - Klimaschutz ist Menschenschutz
Am Institut für Klimafolgenforschung untersucht Kira Vinke, wie sich steigende Meeresspiegel, zunehmende Dürren und Stürme auf Menschen auswirken. Als Beraterin der Bundesregierung setzt sie sich dafür ein, dass Wissen auch in die Tat umgesetzt wird. Moderation: Britta Bürgerwww.deutschlandfunkkultur.de, Im GesprächDirekter Link zur Audiodatei
Rund um den Globus sind die Kurse an den Finanzmärkten ins Minus gerutscht: Der Krieg in der Ukraine, hohe Teuerungsraten und Lieferengpässe drücken auf die Stimmung an den Börsen. Der Finanzexperte Thorsten Hens sagt: «Wir erleben gerade eine Zeitenwende an den Finanzmärkten.» «An den Börsen geht die Angst um» oder «Weltwirtschaft droht perfekter Sturm.» So lauten die Schlagzeilen aus der Finanzwelt in den letzten Tagen. Die Schweizer Börse steht mit einem Minus von elf Prozent seit Anfang Jahr noch vergleichsweise gut da. Andere Finanzplätze hat es noch schlimmer erwischt. Hohe Tagesverluste wecken bereits Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 oder an die geplatzte Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends. Thorsten Hens forscht zu den Ursachen der aktuell ruppigen Börsenzeiten und möglichen Folgen für die Finanzwelt. Am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich untersucht der Finanzprofessor die Psychologie des Investierens. Hens ist zudem außerordentlicher Professor für Finanzen an der Norwegischen Handelshochschule in Bergen, Norwegen.
Ich hör, ich hör, was du nicht hörst: Ein Ausflug in die Welt des Schalls – MAKROMIKRO #60
Viele von uns kennen ihn – den Cocktailparty-Effekt. Eine Menge an Menschen, die alle unterschiedliche Gespräche miteinander führen, ein großes akustisches Tohuwabohu. Und doch ist es uns möglich, unserem jeweiligen Gesprächspartner zu folgen. Indem wir selektiv hören, blenden wir alle nicht-relevanten Geräusche aus und konzentrieren uns auf eine bestimmte Schallquelle. Wie gut wir hören, hängt nämlich nicht nur von der Anatomie und Funktion unserer Ohren ab – wie die akustischen Signale, die uns von außen erreichen, im Gehirn verarbeitet werden, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) wird rund ums Thema Hören geforscht: Wie kann man das Hören mit Neuroprothesen wie z.B. Cochlea-Implantaten verbessern? Wie steht es um unsere akustische Aufmerksamkeit? Wie nimmt man Raumklang wahr? Und was macht eigentlich Lärm mit uns? In dieser Podcastfolge sprechen wir mit Schallforscher*innen und Psychoakustiker*innen über diese und viele weitere Themen rund um Schall. Mit Martin Lindenbeck, Bernhard Laback, Diane Baier, Piotr Majdak und Robert Baumgartner. ---------- Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Gestaltung und Moderation: Julia Grillmayr Sound: Axel Hirn Bild: © Unsplash/Franco Antonio Giovanella
Sandro Wefel forscht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Am Institut für Informatik beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Fragen von Cybersicherheit und Cyberabwehr. Wir haben ihn zur aktuellen Situation in der Ukraine, aber auch in Deutschland gefragt, wo es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld … Der Beitrag Interview mit Sandro Wefel zur Cybersicherheit | Podcast erschien zuerst auf #Onlinegeister.
#21 Isabella Eckerle: Wie kommen wir durch die 4. Welle?
DIE IDEE ist ein Podcast des NDR. In dieser Folge geht es darum, wie wir in diese Corona-Situation in der vierten Welle gekommen sind. Und wir sprechen darüber, was wir alle jetzt unternehmen können, damit wir wieder rauskommen. Gast: Isabella Eckerle ist Virologin und leitet an den Universitätskliniken Genf das Zentrum für neuartige Viruserkrankungen. Sie ist Mitglied der Europäischen High Level Experten Gruppe der WHO für die Covid-19 Pandemie. Isabella Eckerle hat an der Universität Heidelberg Medizin studiert, am Zentrum für Infektiologie in Heidelberg gearbeitet – und dabei intensiv an Krankheitserregern zoonotischen Ursprungs gearbeitet. In ihrem Twitter-Profil steht unter Interessen: Bats and Birds - also Fledermäuse und Vögel. Am Institut für Virologie in Bonn hat sie mit Christian Drosten zusammengearbeitet. Seit 2018 ist sie Professorin in Genf. Bewertet uns gern auf den Plattformen. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns persönlich und auf Social Media weiter mit dem Hashtag #ndrdieidee. Gebt uns Feedback per Mail unter dieidee@ndr.de. Team: Producer: Marvin Leesch und Klaus Wehmeyer. Danke an N-JOY: Dennis Bangert Zeitmarken: 00:03:40 Hätten Sie gedacht, dass der Winter so wird, wie er jetzt ist? 00:06:44 Was ist die richtige Kennzahl zur Bewertung der Pandemie? 00:19:03 Funktionieren Kontaktbeschränkungen? 00:34:50 Was interessiert Sie an Fledermäusen? 00:52:00 Welchen Impfstoff würden Sie nehmen? 00:56:30 Wie können Kinder geschützt werden? 01:13:00 Welches Buch hat Sie am meisten geprägt? Podcast-Tipps: „Raus aus der Depression“ mit Harald Schmidt von NDR Info „Alles Bio“ vom NDR. Ihr findet diese Podcasts in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.
Katharina Mader erforscht, was die neoklassische Ökonomie übersieht. Am Institut für Heterodoxe Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien beschäftigt sie sich insbesondere mit der unbezahlten Arbeit, die meist von Frauen geleistet wird. In dieser Folge schauen wir mit ihr über den neoklassischen Tellerrand hinaus und erhalten wichtige Einblicke in die feministische Ökonomie.
Warum ist Politische Bildung gerade jetzt so wichtig? "Gerade in Zeiten von alternativen Fakten, aufkeimenden Extremismen und antidemokratischen Strömungen ist es umso wichtiger, unseren Jugendlichen eine fundierte Medien- und Politikkompetenz weiterzugeben", meint Hayek. Politische Bildung und die damit zusammenhängende Medienbildung können helfen, sich in der heutigen Informationsflut zurecht zu finden. Am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck hat Politische Bildung eine lange Tradition: "Wir betreiben Politische Bildung in der universitären Lehre, in der Fachdidaktikausbildung für zukünftige Lehrer*innen; wir nehmen an Schulprojekten teil wie zum Beispiel an der Demokratielandschaft des Tiroler Landtages, und wir forschen natürlich auch zu Politischer Bildung und publizieren in wissenschaftlichen Journals." Diese Bemühungen sollen nun verstärkt werden, denn: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hilfe einer Kooperation mit dem Tiroler Landtag eine neue Doktorand*innenstelle im Bereich Politische Bildung besetzen können." ----- Music by Lost Harmonies. This podcast gives the views of the author(s), and not the position of the Department of Political Science. This work by the Department of Political Science is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
Welt der Werkstoffe - talk, Folge 5, Wolfgang Potthast: Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen bei Werkstoffen im Sport
Das Jahr 2021 startet bei Welt der Werkstoffe – talk sportlich. Unser Gast, Prof. Wolfgang Potthast vom Institut für Biomechanik und Orthopädie der Deutschen Sporthochschule, hat sich mit Prof. Bonnet unterhalten. Die Deutsche Sporthochschule ist die einzige Universität in Deutschland, die sich ausschließlich mit Sport beschäftigt. Am Institut für Biomechanik und Orthopädie beschäftigt man sich mit Kräften die auf oder in biologischen Systemen wirken und welche Wirkung diese Kräfte hervorrufen. Es geht also um die Interaktion zwischen Mensch und Sportgerät. Im speziellen geht es heute zum Beispiel um Böden, insbesondere Kunstrasen, Fahrräder, Laufschuhe und Prothesen. Und natürlich um Werkstoffe! Starten Sie das Jahr sportlich, mit Welt der Werkstoffe! Wir wünschen viel Spaß und ein gesundes und frohes Jahr 2021 an alle Zuhörer!
Das Coronavirus kann man nachbauen. Ergebnis ist ein möglicher Impfstoff, der sicherer sein soll als andere. An der BOKU läuft ein erster Versuch. Es ist ein bisschen wie Lego. Protein für Protein wird eine Kugel sequenziert - darauf die charakteristischen "Spike"-Proteine des Sars-Cov-2. Und das alles kommt dann in unsere Nase. Am Institut für "Synthetische Bioarchitekturen" an der Universität für Bodenkultur (BOKU) wird das Coronavirus nachgebaut. Die Bausteine sind teilweise andere als beim Virus. Unser Körper soll sie trotzdem erkennen. Bei einer Infektion mit dem echten "Corona", kann er dann schneller reagieren. Dieser Impfstoff ist anders als die anderen. Denn er ist komplett synthetisch hergestellt. Möglich macht das die Genetik und ein Grundbaustein der Nanotechnologie: Das S-Layer-Protein. Wir reisen in die Welt der Nanometer und sehen uns an wie man ein "braves" Virus baut.
Henning Mohr - Institut für Kulturpolitik
Heute ist Henning Mohr zu Gast, der seit Januar das traditionsreiche Institut für Kulturpolitik in Bonn leitet. Er ruft schon seit einiger Zeit mit klarer Stimme und bisweilen zugespitzten Formulierungen nach mehr Dynamik, Agilität, Veränderungswille in der Kulturszene in Deutschland. Am Institut für Kulturpolitik wird er sich nun mit der Frage befassen, welche Rolle die Kulturpolitik dabei spielen kann, die anstehenden Transformationen zu unterstützen. Ich werde mit ihm auch darüber sprechen und ihn fragen, wie er den Digitalisierungsschub dieser Tage erlebt und für wie nachhaltig er die Aktivitäten in der Krise langfristig hält.
Apotheker in Film und Fernsehen – Redmann über seine Promotion
Apotheker Christian Redmann ist Inhaber der Stadt-Apotheke Ebermannstadt und hat sich – im laufenden Betrieb – in eine Promotion gestürzt. Am Institut für Geschichte der Pharmazie der Philipps-Universität zu Marburg hat er jetzt mit der Arbeit „Apotheker in Film und Fernsehen – Zum Fremdbild des Apothekers in den Medien“ seinen Doktortitel erlangt. Redaktion: APOTHEKE ADHOC Musik: Bojan Assenov & Ellen-Jane Austin
Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was heißt das eigentlich konkret? Bedeutet Rücksicht auf die Umwelt und Nachwelt zu nehmen, grundsätzlich Verzicht? In jedem Fall sind dicke Bretter zu bohren, denn es geht um nichts weniger als einen Kulturwandel, der sich in vielen kleinen Schritten vollzieht. Einen umfassenden Ansatz probiert man nun im Maßstab eines Karlsruher Stadtteils ganz praktisch aus. Dazu weiß Oliver Parodi mehr. Am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), das zum Karlsruher Institut für Technologie KIT gehört, beschäftigt er sich vor allem mit Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung. In einem „Reallabor“ wollen Wissenschaftler und Stadtentwickler gemeinsam mit Bürgern eine umfassende nachhaltige Entwicklung der Karlsruher Oststadt auf den Weg bringen, und zwar für die Themen Energie, Mobilität, sozialer Raum und Konsum. In dem von Parodi geleiteten Reallabor werden also Praktiker aus Kommunen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft von Anfang an in den Forschungsprozess einbezogen und arbeiten miteinander auf Augenhöhe, um konkret die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Das Projekt erhielt 2019 den Forschungspreis Transformative Wissenschaft, den das Wuppertal Institut gemeinsam mit der Zempelin-Stiftung im Stifterverband verleiht. Oliver Parodi vereint selbst verschiedene wissenschaftliche Welten in seiner Person. Ursprünglich hat er Bauingenieurwesen studiert und sollte eine der Familie gehörende Baufirma übernehmen. Doch dann schloss er lieber ein Studium der Angewandten Kulturwissenschaft an. Heute will er an der zum KIT gehörenden Karlsruher Schule der Nachhaltigkeit durch transdisziplinäre Ausbildung die Ansprüche von Mensch, Technik und Umwelt zusammenführen.
Am Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz beschäftigen sich Forschende aktuell mit dem Thema Schläfrigkeit beim Autofahren. Langfristiges Ziel ist die Entwicklung automatisierter Systeme, die das Einschlafen am Steuer zuverlässig und rechtzeitig erkennen. Der Beitrag Unterschätzte Gefahr erschien zuerst auf AirCampus.
Diese Folge ist eine Einführung zum Thema Gender Pay Gap für alle, die glauben, sich mit Ökonomie nicht auszukennen. Eine solche Person bin ich nämlich auch. Als Mädchen habe ich schon früh gelernt, dass Zahlen, Mathematik und in weiterer Folge Ökonomie nichts sind, wo ich mitreden sollte, weil ich mich sowieso nicht damit auskennen kann. Zahlen sollen lieber den männlichen Experten überlassen werden, die uns dann auch gleich erklären können, warum ökonomische Benachteiligungen entweder eingebildet oder individuell selbstverschuldet sind. Wie wichtig es ist, dass Frauen sehr wohl mitreden, wenn es um Wirtschaft geht, erklärt uns heute Katharina Mader. Katharina Mader ist Feministin, Ökonomin, Wirtschaftswissenschafterin, letztjährige Gewinnerin des Wiener Frauenpreises und Mutter. Am Institut für Institutionelle und Heterodoxe Ökonomie forscht und lehrt sie zu Geschlechterverhältnissen in der Ökonomie: von Gender Budgeting über Care-Ökonomie bis hin zu Gender Pay und Wealth Gaps. Aktuell ist sie in Karenz. Ich durfte sie zum Thema Gender Pay Gap befragen. Katharina Maders Publikationen findet ihr hier: https://bach.wu.ac.at/d/research/ma/9165/#publications. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das hier: https://patron.podbean.com/grossetoechter Podcast-Empfehlung: https://www.jeannedrach.com/jeannes-heldinnen/
Krebstherapien sollen in Zukunft durch einfache Blutanalysen optimiert werden. Am Institut für Humangenetik der Med Uni Graz haben ForscherInnen eine neue Prognosemethode entwickelt, die voraussagen soll, wie aktiv ein Tumor ist. Dadurch kann die Behandlung an mögliche Mutationen des Tumors angepasst werden.
„Gene sind die Grundlage des Lebens.“ Die Gene von Pflanzen zu erforschen und anhand derer Mehrwerte für uns Menschen zu schaffen ist die Aufgabe von Pflanzenbiotechnologen. Am Institut für Pflanzengenetik der LUH beschäftigen sich Studenten, Doktoranden und Professoren mit diesem teilweise umstrittenen Thema. Bei Ernst.FM erhaltet ihr einen Einblick in das Tätigkeitsfeld und den Studiengang Pflanzenbiotechnologie.
Denken während eines Beziehungs-Tornados führt zu Zugverspätungen
Szene A: Aber ich hab’ gedacht, du wolltest immer eine große Familie haben!?! Neee, wollte ich eigentlich nicht! Mir hätten ein Kind und vielleicht noch ein Hund völlig gereicht. Lea, Michi, Felix, Anna, Till - kommt wir gehen. Der Papa will uns nicht! Szene B: Ich hab’ gedacht, Du magst Musicals. Na ja, die ersten beiden waren ja auch noch ganz okay, aber als du dann vor drei Jahren mit der Dauerkarte um die Ecke kamst, war ich schon ziemlich geschockt. Aber wieso hast du denn in der ganzen Zeit nie was gesagt? Ja, weil ich dachte, dass du dann sauer bist, wenn du weißt, dass ich Musicals eigentlich total bescheuert finde. Soll das heißen, du findest mich bescheuert, weil ich Musicals mag? Siehst Du, genau deshalb hab’ ich nichts gesagt! Zugegeben: es mögen viele Gründe dafür existieren, warum man dem Gespräch mit seinem Partner so manches Mal aus dem Weg geht. Am Institut für Psychologie der Uni Göttingen hat man dieses Problem vor zwei Jahren mal etwas genauer unter die Lupe genommen und zwar, indem 18.000 Männer und Frauen zu ihrem Kommunikationsverhalten in der Partnerschaft befragt wurden. Und dabei kam heraus: erschreckende 82% scheuen sich vor wichtigen Gesprächen; das vermeintlich starke Geschlecht dabei deutlich öfter als die Damenwelt. Aber, ganz egal, ob nun in der Partnerschaft oder in ganz gewöhnlichen Alltagssituationen, die Form des mit sich selbst Kommunizierens - auch Denken genannt - bringt in vielen Fällen oft nur eins, nämlich: nichts. Ein Paradebeispiel für die völlig sinnlose Vermeidung eines Gesprächs bzw. im nachstehenden Fall einer simplen Frage, findet sich in einem Buch des inzwischen verstorbenen Kommunikationswissenschaftlers und Psychotherapeuten Paul Watzlawick, der sich - durch seine populärwissenschaftlich anmutenden Schriften - einer gewissen Bekanntheit erfreute (zumindest denke ich, dass er das tat). In ‚Anleitung zum Unglücklichsein’ erzählt Watzlawick die Geschichte eines Mannes, der zum Einschlagen eines Nagels einen Hammer benötigt, den er aber nicht im Hause hat. Also beschließt der Mann, seinen Nachbarn zu fragen, ob dieser ihm denn das Werkzeug leihen würde. Doch dann begeht unser hammerloser Heimwerker einen Fehler: er beginnt zu denken. Ihm fällt ein, der Nachbar habe ihn in letzter Zeit flüchtiger gegrüßt als sonst üblich. Vielleicht sei das ja ein Indiz dafür, dass dieser in Eile gewesen sei. Vielleicht stecke aber auch mehr dahinter und der Nachbar würde ihn - unseren Hammerlosen - nicht mögen und ihm womöglich auch gar keinen Hammer leihen wollen. In einer sich nun anschließenden - schier endlosen - Spirale des sich Hineinsteigerns in negatives Gedankengut, wähnt sich unser Denkender schließlich in einer ihm feindlich gesonnenen Welt. Mit dieser Überzeugung im Gepäck, klingelt er bei seinem Nachbar, dieser öffnet die Tür und bekommt sofort zu hören: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“. Und weil das mit Denken eine weit verbreitete Problematik zu sein scheint, hat man sich dieser natürlich auch schon filmisch angenommen. Im Katastrophenfilm ‚Twister’ beispielsweise wird ziemlich deutlich, was dabei herauskommt, wenn man beim Sich-gegenseitig-Kennenlernen aus gewissen Aussagen falsche Schlüsse zieht, weil man - genau - nicht nachgefragt hat.„Ich dachte, als du sagtest, du würdest Tornados jagen, das wäre nichts weiter als eine Metapher.“ Tja, wenn man diesen Satz sagt, mitten in besagtem Tornado drinsteckt und vielleicht kurz vorher auch noch beim Friseur war ... dann ist das schon ein bisschen doof! Eindeutlich mehr als doof ist es jedoch, wenn man dem Denken eine fatale Handlung folgen lässt, die für den Anderen unter Umständen mit einem nicht ganz so glückvollen Ende einhergeht, wie in der Komödie ‚Boomerang’: „Entschuldigung, dass ich sie erschossen habe, aber ich dachte sie wollten mich ausrauben!“. Keine Frage, so manches Mal kostet es viel Überwindung, gewisse Dinge anzusprechen - vor allem,