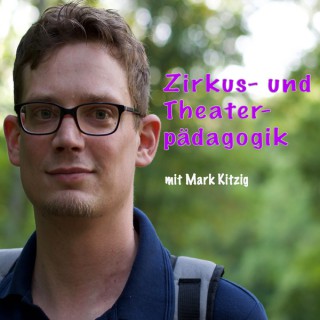Podcasts about gesamtgruppe
- 8PODCASTS
- 11EPISODES
- 7mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Oct 18, 2023LATEST
POPULARITY
Best podcasts about gesamtgruppe
Latest podcast episodes about gesamtgruppe
Die Themen im heutigen Versicherungsfunk Update sind: Über 230 Milliarden Euro Schaden durch Naturgefahren in 50 Jahren Die deutsche Versicherungswirtschaft hat in den vergangenen 50 Jahren deutlich mehr als 200 Milliarden Euro für die Beseitigung von Schäden geleistet, die durch Naturkatastrophen ausgelöst wurden. „Zusammengerechnet lag der entsprechende Schadenaufwand der Sach- und Kfz-Versicherer von 1973 bis 2022 bei genau 233 Milliarden Euro“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. Generation Z investiert nur unzureichend in betriebliche Altersversorgung Wie das bAV Monitoring 2023 der auf die Verwaltung von bAV-Verträgen spezialisierten DCS Deutsche Clearing-Stelle GmbH zeigt, sind die 18- bis 29-Jährigen innerhalb der Gesamtgruppe der Versicherungsnehmer mit einem Anteil von 8,7 Prozent deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil der 30- bis 42-Jährigen liegt immerhin bei 33,3 Prozent, wohingegen die 43- bis 58- Jährigen mit 58 Prozent klar vorn liegen. Bei der Beitragshöhe hingegen sind die Unterschiede merklich geringer ausgeprägt. Beim Blick auf die Geschlechter fällt auf, dass erheblich mehr Männer über eine bAV verfügen als Frauen. Münchener Verein mit neuer bKV Die Münchener Verein Krankenversicherung hat mit GemeinsamGesund eine neue betriebliche Krankenversicherung (bKV) auf den Markt gebracht. Das Produkt kann mit mindestens fünf Mitarbeitern in einem Kompakttarif, zwei stationären und vier Budget-Tarifen abgeschlossen werden. In allen bKV-Tarifen gibt es weder Wartezeiten noch eine Gesundheitsprüfung. Auch eine Beitragsbefreiung bei entgeltlosen Zeiten zum Beispiel während der Elternzeit ist möglich. Continentale will mit Sonderzahlungen Beiträge im Alter senken Die Continentale führt eine Beitragsentlastungskomponente ein. Dadurch sollen PKV-Kunden mit Sonderzahlungen die Beiträge ihrer privaten Krankenversicherung (PKV) im Alter senken können. Beitragsrückerstattungen oder Pauschalleistungen können auf Kundenwunsch voll oder anteilig umgewandelt werden. Zahnzusatzversicherung: Ergo seit Jahren Werbemarke Nummer eins Die Werbeausgaben für Zahnzusatzversicherungen belaufen sich innerhalb von zwölf Monaten auf 104 Millionen Euro. Damit ist das Werbevolumen in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Die Verbreitung der Werbebotschaft erfolgt beim Produkt Zahnzusatz stark über das Medium TV. Dessen Anteil liegt aktuell bei über 90 Prozent. Seit Jahren ist Ergo die werbestärkste Marke für Zahnzusatzversicherungen, Maxcare und Ottonova komplettieren aktuell das Topwerber-Trio. Das geht aus der Studie ‚Werbemarktanalyse Zahnzusatzversicherung 2023‘ von research tools hervor. Baloise mit neuem Finanzchef Christoph Wappler wurde zum neuen Vorstand Finanzen / Kapitalanlagen bei Baloise in Deutschland bestellt und übernimmt die Verantwortung für das Ressort damit von Julia Wiens, die der Berufung zur Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin folgt. Wappler ist seit Ende 2017 bei Baloise und leitete seitdem den Bereich Finanzielle Steuerung.
Ein Kurs sollte wie ein guter Aufsatz, mit Einleitung, Hauptteil und Schluss, aufgebaut sein. Bei der Einleitung, dem Warm Up, wollen wir einen klaren Start für unseren Kurs markieren. Das bedeutet, die Teilnehmer sollten sich nun im Klaren sein, dass wir jetzt anfangen. Außerdem dient das Warm-Up dem Kennen lernen und der notwendigen Konzentration. Erreicht werden kann dies mit Hilfe von verschiedenen Spielen. Beim Abschluss, dem Cool-Down, wollen wir ein klares Ende des Kurses setzten. Hier sollten wir entweder eine Entspannung einbauen oder spiele die das Wir-Gefühl der Gruppe stärken sollen mit einfließen lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir beim Cool-Down die Möglichkeit haben sollten, schwere Charaktere, die zum Beispiel starke Emotionen haben, hinter uns zulassen. Der Hauptteil besteht aus 5 Einheiten: 1. Ich alleine bei mir: Der Teilnehmer soll sich auf sich selbst konzentrieren. 2. ich bei einer Gruppe innerhalb der Kursgruppe: Der Teilnehmer soll sich auf andere Gruppenmitglieder einlassen können 3. ich bei einer anderen Person: Der Teilnehmer soll sich intensiv mit einer ihm ausgewählten anderen Person einlassen und Vertrauen aufbauen können. 4. Ich innerhalb der Gruppe Der Teilnehmer soll seinen Platz in der gesamten Gruppen finden können. 5. Ich vor allen anderen alleine: Der Teilnehmer soll sein Alleinstellungsmerkmal in der Gesamtgruppe finden und auch etwas alleine vor allen vorstellen können. Beim Zirkus ist der letzte Punkt einfacher, da es den Teilnehmern oft leichter fällt alleine Zirkus, als Theater vor einer Gruppe zuspielen.
Einfluss genetischer Variationen RNA-bindender Proteine auf die Alzheimer Demenz und relevante kognitive Endophänotypen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Die Alzheimer Demenz (AD) ist eine degenerative zerebrale Erkrankung, die klinisch durch den Verlust vielfältiger kognitiver Fähigkeiten gekennzeichnet ist. Ein geringer Prozentsatz (65 Jahre) erfolgte im Sinne einer homogeneren Subgruppierung und sollte eine aussagekräftigere Assoziation der genetischen Vulnerabilitätsmarker ermöglichen. In die Kontrollgruppe wurden ausschließlich gesunde Probanden ohne demenzielle Erkrankungen in der Familie eingeschlossen. Neben einer grundsätzlichen Assoziation mit der AD wurde in einem zweiten Schritt der Zusammenhang zwischen den 19 Polymorphismen und der individuellen Gedächtnisleistung als intermediärer Phänotyp untersucht. Die Gedächtnisleistung wurde mittels standardisierter Tests erhoben. Die 19 SNPs (rs4412638, rs12024093, rs12043872, rs3009113, rs913858, rs12113404, rs12672536, rs4722589, rs10998072, rs10998076, rs1162757, rs16925347, rs1162756, rs1683152, rs784566, rs11170562, rs784563, rs2249381, rs1716966) wurden mittels iPLEX-Verfahren genotypisiert und die massenspezifischen Produkte im MALDI-TOF Massenspektrometer ausgewertet. Signifikante Assoziationen konnten dabei insbesondere zwischen den drei Genen HNRNPA2B1, PCBP2, ELAVL4 und der Alzheimer Demenz, sowie der Gedächtnisleistung festgestellt werden. Auf diesen drei Genen zeigten sich fünf Marker mit dem Phänotyp der AD bzw. insbesondere mit der EOAD assoziierbar: Auf ELAVL4 ließen sich rs3009113 und rs12024093 in der Patienten-Gesamtgruppe, sowie im EOAD-Kollektiv mit der AD assoziieren; auf PCBP2 waren rs784563 und rs2249381 in der Gesamtgruppe der Patienten auffällig; auf HNRNPA2B1 ließ sich rs4722589 mit der EOAD assoziieren. Diese und weitere Polymorphismen der angeführten drei Gene konnten sowohl in der EOAD- als auch in der LOAD-Gruppe mit einer verminderten Gedächtnisleistung assoziiert werden. In der Haplotypanalyse ließen sich diese Befunde grundsätzlich bestätigen. Zusammenfassend lassen die Resultate der vorliegenden Untersuchung einen Zusammenhang zwischen drei der untersuchten RBPs (HNRNPA2B1, PCBP2 und ELAVL4) und dem Phänotyp Alzheimer Demenz, sowie dem intermediären Phänotyp Gedächtnisleistung vermuten. SNPs in intronischen Bereichen können regulatorische Sequenzen wie die Polyadenylierung- oder Spleißfaktorbindungsstellen beeinflussen und zu Veränderungen in der Transkriptionsrate oder im Spleißprozess führen. Zudem kann durch Muationen die natürliche Aggregationsbereitschaft RNA-bindender Proteine, sich in RNA-granules zusammenzulagern, verstärkt werden und damit direkt zellschädigend wirken. Da über Funktion und Struktur der untersuchten RBPs gegenwärtig noch relativ wenig bekannt ist und es bislang keine vergleichbaren Referenzstudien bezüglich Alzheimer gibt, ist weiterführende Forschungsarbeit zur abschließenden Interpretation der Ergebnisse notwendig. Aufgrund der bis dato vorliegenden Ergebnisse stellen RNA-bindende Proteine insgesamt einen interessanten Kandidaten für die Alzheimerforschung dar.
Klinische Verlaufsdokumentation der Enzymersatztherapie mit Alglucosidase alfa über ein Jahr bei 44 adulten Patienten mit Glykogenose Typ II
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Hintergrund: Die Glykogenose Typ II (Morbus Pompe) vom adulten Typ ist eine autosomal rezessiv vererbte, progressive, lysosomale Glykogenspeicherkrankheit, die durch den Mangel des lysosomalen Enzyms saure α-1,4-Glukosidase, durch Mutationen im Gen für dieses Enzym verursacht, geprägt ist. Klinisch ist sie charakterisiert durch eine Schwäche und Atrophie der Skelett- und Atemmuskulatur, resultierend in motorischer, v.a. Gehschwäche bis Rollstuhlpflichtigkeit und respiratorischer Einschränkung bis Insuffizienz. 2006 wurde das rekombinante humane Enzym alglucosidose alfa der Firma Genzyme zur Enzymersatztherapie (EET) für alle Formen des Morbus Pompe zugelassen. Methoden: In einer multizentrischen, offenen klinischen Beobachtungsstudie wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit der EET mit alglucosidase alfa in einem Patientenkollektiv von 44 adulten Morbus Pompe Patienten mit variablen Krankheitsausprägungen untersucht. Die zehn Untersuchungen bestanden aus einem Arm Function Test (AFT), dem Walton Gardner Medwin Scale (WGMS), den vier Timed Funktion Tests 10 Meter gehen, 4 Stufen Steigen, 6 Minuten Gehen und Aufstehen aus dem Liegen, der Erfassung des MRC-Summenscores, der Messung der Vitalkapazität in der Lungenfunktion, der Messung des CK-Serumlevels sowie dem selbstauszufüllenden Fragenbogen SF-36. Alle diese Tests wurden vor Beginn der EET sowie alle drei Monate und nach Abschluss eines Jahres der Therapie durchgeführt. Ergebnisse: Unter der EET kam es bei ca. 10 % der Patienten zu geringeren allergischen Reaktionen, die erfolgreich mit Antihistaminika und Kortikosteroiden behandelt werden konnten. Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Kein Patient brach die Therapie ab, kein Patient verstarb und kein Patient wurde neu beatmungspflichtig. Bei den meisten Tests zeigten sich keine signifikanten Veränderungen nach einem Jahr EET im Vergleich zur Anfangszeitpunkt. Ausnahmen waren das CK-Serumlevel, das sich signifikant in der Gesamtgruppe sowie besonders in der Untergruppe der Frauen verringerte, sowie die beiden Timed Funktion Tests Aufstehen aus dem Liegen und 6 Minuten Gehen, bei denen sich signifikant die Zeit verringerte bzw. die Gehstrecke verlängerte. Letzteres traf besonders auf eine Untergruppe von fünf gehfähigen Patienten zu, die während der EET auf einem Fahrradergometer trainierten. Fazit: Alglucosidase alfa stellt sich bisher als sichere Therapie für Patienten mit Glykogenose Typ II vom adulten Typ dar. Die klinischen Testergebnisse aus dieser 1-Jahres-Studie sowie aus anderen Studien deuten auf eine Stabilisierung der neuromuskulären Funktion mit milden funktionellen Verbesserungen, v.a. unter begleitendem Training, hin [Angelini et al., 2009; Van der Ploeg et al., 2010; Bembi et al., 2010]. Trotz der hohen Jahrestherapiekosten von ca. 500.000,- EUR sollte die EET bei Patienten mit gesicherter Glykogenose Typ II daher fortgeführt werden. Ausblick: In weiteren, länger angelegten Studien sind die langfristige Verträglichkeit sowie klinische Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum als ein bis zwei Jahre hinaus zu untersuchen. Außerdem ist die Rolle der Ernährung sowie des körperlichen Trainings unter EET bisher nicht bekannt. Ausblickend werden schließlich neue Therapieformen wie Chaperon-Therapie oder Gentherapie erforscht.
Veränderungen der Verordnungen von Antidepressiva durch niedergelassene Haus- und Fachärzte im Rahmen des „Nürnberger Bündnisses gegen Depression“
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Einleitung Während der letzten Jahre wurde in mehreren Studien zunehmend auf die große Bedeutung depressiver Erkrankungen aufmerksam gemacht. Nach wie vor existieren erhebliche Defizite bei der Diagnostik, Behandlung und Erforschung der depressiven Erkrankungen zugrunde liegenden Mechanismen, die der Thematik in Verbindung mit der hohen Prävalenz depressiver Erkrankungen eine besondere gesundheitspolitische Bedeutung verleihen. Obwohl seit längerem gut untersuchte und bewährte pharmakologische und psychotherapeutische Behandlungsverfahren vorliegen, erhalten nur etwa 10% der Betroffenen eine effektive Therapie. Auch bei politischen Entscheidungsträgern ist während der letzten Jahre eine steigende Bereitschaft zu erkennen, sich mit der zunehmenden Bedeutung psychischer und insbesondere depressiver Erkrankungen auseinanderzusetzen. In Deutschland spiegelt sich dies zum Beispiel in der Einrichtung des seit 1999 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kompetenznetzes „Depression, Suizidalität“ wider, in dessen Rahmen mehr als 20 Einzelstudien initiiert und durchgeführt wurden, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen der sich überlappenden Themengebiete „Depression“ und „Suizidalität“ befassen. Zahlreiche Projekte in unterschiedlichen Ländern haben sich in den vergangenen Jahren eine Verbesserung der Versorgung depressiver Menschen zum Ziel gesetzt. Die Ansätze reichen dabei von einfachen Fortbildungsinitiativen für Ärzte bis zu komplexen Interventionsprogrammen, die unterschiedliche Zielgruppen parallel adressiert haben. Antidepressiva kommt (neben psychotherapeutischen Verfahren) bei der Behandlung depressiver Erkrankungen eine Schlüsselrolle zu. Die Optimierung der Verordnungen von Antidepressiva stellt daher insbesondere vor dem Hintergrund der bekannten Versorgungsdefizite ein wichtiges (Teil-)Ziel vieler dieser Projekte dar. Fragestellung und Methodik Eingebettet in das Kompetenznetz „Depression, Suizidalität“ wurde in den Jahren 2001 und 2002 das „Nürnberger Bündnis gegen Depression“ als weltweit einmaliges Modellprojekt in Nürnberg durchgeführt. Aufbauend auf den Erfahrungen der schwedischen „Gotland-Studie“ und der englischen „Defeat Depression Campaign“, wurden in dieser Studie Interventionen auf vier parallelen Ebenen durchgeführt. Im Zentrum stand dabei eine Optimierung der Diagnose und Therapie in der Primärversorgung. Dazu wurden für die Nürnberger Hausärzte fachärztlich moderierte Schulungen durchgeführt und zahlreiche Informationsmaterialien an diese Ärzte ausgehändigt (Lehr- und Informationsvideos, Screening-Instrument). Daneben fand eine umfangreiche Informationskampagne statt (Plakate, Vorträge, Informationsflyer, Kinospot etc.), die von einer umfangreichen Berichterstattung in den Medien flankiert wurde. Darüber hinaus wurde mit zahlreichen Berufsgruppen kooperiert, die sekundär in die Versorgung depressiver Menschen eingebunden sind (z.B. Pastoren, Lehrer, Altenpflegekräfte, Mitarbeiter von Beratungsstellen etc.). Im Rahmen von Angeboten für Betroffene wurde eine Telefonhotline geschaltet, über die im Falle einer akuten Krise schnell Unterstützung erreichbar war. Schließlich wurden mehrere Selbsthilfegruppen initiiert und unterstützt. Neben dem Hauptoutcome-Kriterium der Studie (Reduktion der Zahl suizidaler Handlungen) und anderen sekundären Evaluationskriterien (Analyse der Berichterstattung in den Medien, Änderung von Wissen und Einstellungen in der Allgemeinbevölkerung), stellten Veränderungen der durch die Nürnberger Ärzte verordneten Mengen an Antidepressiva und anderen ausgewählten Psychopharmaka ein wichtiges Evaluationskriterium des „Nürnberger Bündnisses gegen Depression“ dar. Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der verordneten Mengen von Antidepressiva und anderer Medikamentengruppen in Nürnberg im Interventionszeitraum (2001/2002) im Vergleich zum Baselinejahr (2000) und einer Vergleichsregion (Restbayern) für verschiedene Arztgruppen. Ergänzend werden auch die Entwicklungen im ersten follow-up Jahr (2003) dargestellt. Grundlage für diese Analysen sind Abrechnungsdaten der bayerischen AOK, die von etwa 11.000 niedergelassen Ärzten in Bayern stammen. Die Haupthypothesen zielen auf die Klärung der Frage ab, ob das „Nürnberger Bündnis gegen Depressionen“ zu einer Zunahme der Verschreibung von Antidepressiva durch niedergelassene Haus- und Fachärzte in Nürnberg geführt hat, die stärker ausfällt als im Rest Bayerns. Ergänzende explorative Hypothesen widmen sich möglichen Veränderungen bei den Verordnungen ausgewählter anderer Medikamentengruppen wie Fluspirilen (z.B. „Imap“), Opipramol (z.B. „Insidon“) und Benzodiazepinen sowie der Analyse des Verordnungsverhaltens der Teilnehmer der im Rahmen des „Nürnberger Bündnisses gegen Depression“ durchgeführten Schulungen. Ergebnisse Der Vergleich der Entwicklungen für alle Antidepressiva und die Gesamtgruppe der niedergelassenen Ärzte ergibt für den Interventionszeitraum einen signifikanten Unterschied zwischen Nürnberg und Restbayern (p
Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Acamprosat und Naltrexon in der Entwöhnungsbehandlung alkoholabhängiger Patienten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Ziel der Meta-Analyse ist eine aktualisierte Bewertung klinischer Studien zu Acamprosat und Naltrexon. Durch Einbeziehung unpublizierter Einzelbefunde konnte eine Kontrolle von Bias-Effekten erfolgen und die Wirkprofile beider Substanzen vervollständigt werden. Beide Substanzen erweisen sich in der Gesamtgruppe aller alkoholabhängigen Patienten als wirksam. Zur Aufrechterhaltung der Abstinenz ist Acamprosat das Mittel der Wahl. In der Subgruppe nicht-abstinenter Patienten erweist sich dagegen ausschließlich Naltrexon als geeignet, einen exzessiven Alkoholkonsum nach Abstinenzverstoß vorzubeugen.
Klinische Verschleißanalyse mittels Lasertriangulation am Beispiel von Visio Gem-Inlays
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Ziel dieser Arbeit war es ein neuartiges optisches Meßsystem zu testen und für eine klinische Verschleißanalyse von Kompositinlays (Visio Gem® Fa Espe®) einzusetzen. Im Rahmen einer ausführlichen Literaturstudie entstand eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Verfahren für In-vivo-Verschleißanalysen. Auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Meßsysteme wird eingegangen. Bei dem eingesetzten 3D Meßsystem handelt es sich um einen Lichtschnittsensor, der nach dem Triangulationsverfahren arbeitet. Ein Laserstrahl wird als Lichtlinie auf das Messobjekt abgebildet. Mit einem CCD-Chip wird diese Linie erfasst. Der seitliche Versatz der Linie beinhaltet in Abhängigkeit vom Triangulationswinkel die Höheninformation. Zu Beginn existierte nur ein Prototyp des optischen 3D-Sensors. Durch größere Umbauten und durch Automatisierung wurde der Sensor bis zur Serienreife weiterentwickelt. Die Überlagerung der zu vermessenden Bilder erfolgt referenzpunktfrei mittels einer eigens entwickelten Matching-Software. Die Probenbefestigung im Prototyp des Sensors stellte ein erhebliches Problem dar, weil zur Vermessung die unterschiedlichsten Formen und Größen positioniert werden mussten. Zur Datenerhebung standen Einzelzahn, Quadranten- und ganze Kiefer- Modelle an. Die ersten Sensoren besaßen obendrein nur eine Kamera-Optik-Einheit. Alle Abtastungen, die Verschattungen aufwiesen, mussten daher von zwei Seiten aufgenommen werden, um abschattungsfreie Okklusalflächen generieren zu können. Daher wurde ein geeigneter Objektträger mit einem Aufsatz, der um 180° umzusetzen ist, entwickelt. Der industriell gefertigte Träger kann alle Objektgrößen (Einzelzahn-, Quadranten-, Kiefer- Modelle) aufnehmen. Testreihen zur Qualitätssicherung deckten einige Probleme der Software auf. Durch Korrektur einiger Parameter bzw. Implementierung neuer Programmteile in die Auswertungssoftware konnten diese beseitigt werden. Aus der Validierung des Gesamtsystems konnten die folgenden technischen Daten für den 3D-Laserscanner ermittelt werden: Auflösung in der x-Achse (seitlich; CCD-Chip) 25 µm Auflösung in der y-Achse (längs der Abtastrichtung; Schrittmotor) > 2 µm Auflösung in der z-Achse (Höhe) 5 µm Messzeit :40 ms/Linie (512 Messpunkte) 5.000 – 10.000 Oberflächenpunkte / sec. Tiefenmessbereich 15 mm Reproduziergenauigkeit 1 µm +/- 1 Gesamtgenauigkeit 10 µm +/- 3 Der Prototyp konnte durch die Weiterentwicklung (ab Sensor 2) für die Erhebung größerer Datenmengen eingesetzt werden. Durch die Verbesserung der Software bzw. die Entwicklung eines eigenen „matching“-Programms (match 3d) durch Gloger (1993) (KUNZELMANN 1998; S. 30-35) kann die Auswertung der gewonnenen Daten schnell und komfortabel erfolgen. Erstmals wurde der Laser-Scanner für die Auswertung klinischer Daten verwendet. Die Auswertung des Verschleißes von Kompositinlays aus Visio Gem® erfolgte an Gipsmodellen (New Fuji Rock®). Für die Untersuchung standen 32 Zähne bzw. Inlays zur Verfügung, 14 Prämolaren und 18 Molaren. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 48,8 Monate, bei den Prämolaren allein 47,4 Monate und bei den Molaren allein 49,8 Monate. Bei 13 Zähnen war eine Ausmessung der Inlaygrösse möglich. Sie betrug im Durchschnitt 45% der sichtbaren Fläche, bei den Prämolaren 51%, bei den Molaren 39%. Die Bilddaten wurden in zwei Gruppen ausgewertet. Zum einen die Gesamtgruppe aus 32 Zähnen, zum anderen eine Auswahl der besten, bestehend aus sechs Molaren und 3 Prämolaren. Der Mittelwert der Standardabweichungen betrug 158 [µm] (Gruppe2: 88 [µm]). Genauer: Prämolaren 110 [µm] (Gruppe2: 85 [µm]), Molaren 196 [µm] (Gruppe2: 91 [µm]). Die Anforderungen der ADA (1989) für Seitenzahnfüllungen der Klasse II erfüllen die Visio Gem®-Inlays nicht.
Die Behandlung des Akustikusneurinoms mit dem Gamma-Knife
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Das Akustikusneurinom ist mit ca. 6% der häufigste intrakranielle Tumor und hat eine jährliche Inzidenz von 1:100000. Die durchschnittliche Wachstumsrate beträgt 2 mm pro Jahr, wobei es auch Akustikusneurinome gibt, die sehr viel schneller wachsen können. Bei der Behandlung des Schwannoms stehen uns zwei Modalitäten zur Verfügung. Die konventionelle Chirurgie und die stereotaktische Radiochirurgie, zu der die Gamma-Knife Therapie und der Linearbeschleuniger zählen. Sorgfältig ausgesuchte Patienten können unter regelmäßiger Kontrolle beobachtet werden, das sogenannte „watch and wait“. Im Falle einer Größenprogredienz wäre eine der o.g. Therapiemodalitäten indiziert. Unter stereotaktischer Radiochirurgie versteht man die hochpräzise und punktförmig geführte Strahlenbehandlung mit einer sehr hohen Einzeldosis auf einen bestimmten Punkt, das Isozentrum. Aufgrund der speziellen und hochpräzisen Strahlenführung ist das Risiko der Verletzung gesunder Strukturen trotz Anwendung hoher Strahlendosen gering. Im Gegensatz zur Operation, bei der das Tumorgewebe entfernt wird, wird in der Strahlenchirurgie dosisabhängig Tumorgewebe inaktiviert, nekrotisiert bzw. durch Induktion charakteristischer, molekularer Prozesse, wie z. B. Apoptose eine Inaktivierung bzw. funktionelle Ausschaltung des Tumors erzielt. Als limitierender Faktor gilt ein maximaler Tumordurchmesser von 4 cm. Von 1994 bis 2000 wurden 182 Patienten im Gamma-Knife Zentrum München stereotaktisch behandelt. Das Follow-up endete im Juni 2004. 123 Patienten mit einem einseitigen Akustikusneurinom wurden primär stereotaktisch behandelt (Gruppe A). 59 Patienten waren primär mikrochirurgisch vorbehandelt und erhielten im Verlauf aufgrund eines Rezidives oder aufgrund anderer chirurgischer Umstände eine Gamma-Knife Bestrahlung (Gruppe B). Ziel dieser Arbeit war der Vergleich des Gehörs, der Fazialisfunktion, der Beeinträchtigung des N. trigeminus und des Auftretens von Tinnitus und Schwindel vor und nach einer Gamma-Knife Behandlung und die Auswertung des Verfahrens hinsichtlich der allgemeinen Behandlungsparameter. Patienten mit einer Neurofibromatose Typ II wurden nicht mit in die Auswertung einbezogen. Die Analyse ergab für die Gruppe A, dass sich bei 68,3% der Patienten das Gehör im Hauptsprachbereich durchschnittlich um 6 dBHL verschlechtert hatte. Bei 15 Patienten (23,8%) lag der Hörverlust über 20 dBHL. Patienten mit einem kleinen und intrameatal gelegenen AKN wiesen den größten Hörverlust auf. Bei keinem der Patienten hatte sich die Fazialisfunktion, ermittelt über die House-Brackmann Einteilung, verschlechtert. Sieben Patienten (5,8%) berichteten nach der Gamma-Knife Behandlung über ein neuaufgetretenes Trigeminusreizsymptom. Je größer der Tumor, umso wahrscheinlicher war eine Beteiligung des Nervus trigeminus. 4,2% der untersuchten Personen entwickelten einen Tinnitus nach der Bestrahlung. In 13,3% der Fälle trat ein Schwindel erstmalig nach der Behandlung auf, wobei das Alter der Patienten als Prädispositionsfaktor anzusehen war. Für die Gruppe B ergab die Analyse, dass sowohl im Tiefton-, als auch im Breitbandbereich der größte Hörverlust mit 20 dBHL bzw. 23 dBHL bei den intrameatal gelegenen Akustikusneurinomen lag. Bei zwei Patienten ist nach der Gamma-Knife Therapie eine Einschränkung des Nervus trigeminus beschrieben. Die Größe des Tumors, die Maximaldosis und die Anzahl der Zielpunkte bei diesen beiden Patienten lagen jeweils über dem Median der Gesamtgruppe. Nur bei einer Patienten ist nach der Bestrahlung das Symptom Schwindel neu aufgetreten. Die Funktion des Nervus fazialis hatte sich bei drei Patienten jeweils um eine Stufe nach House Brackmann verschlechtert. Die Operation ist gegenüber der Radiochirurgie wirksamer, da sie unabhängig von der Tumorgröße eingesetzt werden kann, wobei jedoch ein höheres Behandlungsrisiko akzeptiert werden muss. Die Radiochirurgie hat bei kleinen Akustikusneurinomen den Vorteil eines ambulanten, nicht invasiven Verfahrens, bei dem das Risiko von Fazialisparesen und Trigeminusreizsymptomen sehr gering ist. Betrachtet man den ökonomischen Aspekt, so ergeben sich für die Radiochirurgie deutlich niedrigere Kosten und eine schnellere Rückführung in das Berufsleben, als bei der Mikrochirurgie. Die Radiochirurgie bietet ebenso wie die Operation eine Chance, die Hörfähigkeit zu erhalten.
Th1/Th2 imbalance in schizophrenia
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Die Schizophrenie ist eine komplexe Erkrankung, bei der neben einer genetischen Komponente äußere Einflussfaktoren eine wichtige Rolle spielen. Epidemiologische Studien weisen auf eine mögliche Rolle von Virusinfektionen als Umwelt-Faktor in der Ätiologie der Schizophrenie hin. Eine Verschiebung der spezifischen Immunantwort in Richtung T-helfer-2-Antwort (ein sogenannter Th2-shift) wurde bei verschiedenen Virusinfektionen beobachtet. Einige immunologische Untersuchungen weisen auch zumindest bei einer Subgruppe der Schizophrenie auf einen Th2-shift hin. (1) Ziele: Diese Studie dient (a) der Untersuchung der Th1/Th2-Balance der spezifischen Immunantwort unter Berücksichtigung der Effekte verschiedener endokrinologischer Parameter und (b) der Identifizierung der möglichen Ursachen des gestörten Th1/Th2-Gleichgewichts; die hier untersuchten Einflussgrößen beziehen sich auf unterschiedliche Hormone. (2) Fragestellungen: (a) Lässt sich eine Th2-Verschiebung bei einer Subgruppe der Schizophrenie beobachten, nachdem die Einflüsse diverser endokrinologischer Parameter mitberücksichtigt worden sind? (b) Wenn ja, ist diese Subgruppe durch klinische oder epidemiologische Variablen charakterisierbar? (c) Wenn ja, welcher oder welche der untersuchten immunologischen und endokrinologischen Parameter tragen zur Streuung des Th1/Th2-Verhältnises bei schizophrenen Patienten bei? (3) Hypothese: (a) Zur Frage (2a) ist eine Th2-Verschiebung angenommen; d.h., die Th1/Th2-Quotienten sind deutlich reduziert. Die Quotienten IFN-g/IL-4, IFN-g/IL-10 und IFN-g/IL-13 wurden als Indikatoren der Th1/Th2-Balance betrachtet. (b) Frage (2b) und (2c) sind offene Fragen, weshalb keine Hypothese im Bezug auf diese beiden Fragen gestellt wurde. (4) Methoden: (a) Analyse-Materialien schließen Serum, Voll-Blut und isolierte Lymphozyten ein. „Vollständige Serum-Daten“ bedeutet, dass alle Daten für Serum-Zytokin-Konzentrationen, Serum Th1/Th2-Quotienten, Hormone, SHBG (Sexhormon-bindendes Globulin), Geschlecht und Alter vorhanden waren. Ebenso bedeutet „vollständige Voll-Blut-Daten“, dass alle Daten bezüglich der in vitro Zytokin-Produktion im Voll-Blut nach einer 46-stündigen PHA-Stimulation, Voll-Blut-Th1/Th2 Quotienten, Hormone, SHBG, Geschlecht und Alter erhoben wurden. „Vollständige Lymphozyten-Daten“ bedeutet, dass alle Daten hinsichtlich der in-vitro Zytokin-Freisetzung bei Lymphozyten, Th1/Th2-Quotienten, Hormone, Geschlecht und Alter verfügbar waren. (b) Studien-Teilnehmer: Insgesamt nahmen 114 schizophrene Patienten und 101 gesunde Probanden an die Studie teil. Unter ihnen hatten 76 schizophrene Patienten und 75 Kontrollen vollständige Serum-Daten, 44 Patienten und 76 normale Kontrollen hatten vollständige Voll-Blut-Daten, 72 schizophrene Patienten und 98 gesunde Teilnehmer hatten vollständige Lymphozyten-Daten. (c) Variablen umfassen hauptsächlich immunologische, endokrinologische und verschiedene klinische Parameter. Die immunologischen Variablen bestehen aus Th1-Zytokinen wie IFN-g, IL-12, IL-2, TNF-a und Th2-Zytokinen einschließlich IL-4, IL-10, IL-13 und IL-6. Die endokrinologischen Kenngrößen setzen sich aus den folgenden Parametern zusammen: zwei Stress-Hormone Cortisol und Prolactin, zwei Geschlechts-Hormone Östradiol und Testosteron, sowie das Geschlechts-Hormon-bindende Globulin (SHBG). Die erhobenen klinischen Daten schließen die Folgenden ein: klinische diagnostische Subgruppen, Familienanamnese bezüglich psychiatrischer Erkrankungen, Medikation vor der Aufnahme, Krankheitsepisode, Antipsychotika-frei/Antipsychotika-naiv, Wash-out-Periode, Erstmanifestationsalter der Erkrankung, Krankheitsdauer, CGI-Werte bei der Aufnahme und Entlassung (CGI = Clinical Global Impressions), sowie die verschieden PANSS Subskalen (Negativ-Symptomatik, Positiv-Symptomatik und Globale Symtpomatik; PANSS = Posivtive and Negative Syndrome Scale). (d) Analyse-Methoden enthalten Cytometric Bead Array (CBA), ELISA und ELISPOT. CBA wurde zur Messung von IFN-g, IL-2, TNF-a, IL-4, IL-10 und IL-6 im Zellkulturüberstand des Voll-Blut-Assays und im Serum verwendet, ELISA wurde zur Bestimmung der IL-12- und IL-13-Produktion im PHA-stimulierten Voll-Blut-Assay eingesetzt, während ELISPOT zum Erfassen der in-vitro-Produktion von IFN-g, IL-12, IL-4, IL-13 und IL-10 bei Lymphozyten benutzt wurde. Die Serumkonzentrationen der Hormone Prolactin, Cortisol, Östradiol, Testosteron, sowie SHBG wurden mit entsprechenden Reagenzienkits am Analysenautomaten Elecsys 2010 erhoben. (e) Auswertung: Die schizophrenen Patienten wurden zuerst als eine ganze Gruppe untersucht, danach nach Geschlecht und verschiedenen klinischen Eigenschaften in unterschiedliche Subgruppen eingeteilt; die so gebildeten verschiedenen Subgruppen sind die unabhängigen Variablen. Die wichtigen abhängigen Variablen sind Th1/Th2-Quotienten einschließlich IFN-g/IL-4, IFN-g/IL-10 (Serum, Voll-Blut-Assay, Lymphozyten) und IFN-g/IL-13 (Lymphozyten). Bei auffälligen Unterschied(en) bezüglich Alter, oder Hormonkonzentrationen und SHBG zwischen einer schizophrenen Subgruppe und den entsprechenden Kontrollen wurden diese Parameter als Kovarianten in die Analyse eingeschlossen, um ihre Effekte auf die Th1/Th2-Balance bei den zu vergleichenden Gruppen zu kontrollieren. (f) Statistik: MAN(C)OVA und Multiple Regression. MAN(C)OVA wurde verwendet, um die Fragestellung (2a) und (2b) zu untersuchen, während Multiple Regression zur Beantwortung der Fragestellung (2c) diente. (5) Primäre Ergebnisse: (a) Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen unsere Hypothese einer Th2-Verschiebung zumindest bei einer Subgruppe der Schizophrenie. (b) Befunde bezüglich der Th1/Th2-Balance in Schizophrenie (Resultate der MAN(C)OVA): · Die Serum-Daten deuteten auf eine eindeutige Th2-Verschiebung bei schizophrenen Patienten als Gesamtgruppe hin, nachdem die Effekte von Alter und verschiedener Hormone (insbesondere Prolactin) ausgeschlossen worden waren. · Die Th2-Verschiebung im Serum scheint Schizophrenie-spezifisch zu sein, wie die Daten der Patienten mit schizophrenie-ähnlicher Symptomatik zeigen. · Im geschlechts-spezifischen Vergleich zu gesunden Probanden hatten weibliche schizophrene Patienten signifikant reduzierte Quotient sowohl für Serum IFN-g/IL-4 als auch für IFN-g/IL-10, während männliche Patienten ausschließlich einen deutlich verminderten Serum IFN-g/IL-10 Quotient zeigten. · Reduzierte Serum IFN-g/IL-4- und IFN-g/IL-10-Quotienten wurden ebenfalls bei diversen klinischen Subgruppen beobachtet außer bei schizophrenen Patienten mit vorwiegender Positivsymptomatik. · Ein deutlich reduzierter IFN-g/IL-10-Quotient im PHA-stimulierten Voll-Blut wurde (a) bei Nicht-Paranoid oder chronischen schizophrenen Patienten gezeigt, bei Patienten, die (b) eine positive psychiatrische Familienanamnese hatten und (c) vor Einschluss in die Studie länger als 3 Monate Antipsychotika-frei gewesen waren oder (d) bei Aufnahme in die stationär-psychiatrische Behandlung niedrigere Werte auf der PANSS-Negativ-Skala hatten. Bemerkenswerter weise zeigten auch Antipsychotika-naive Patienten mit Schizophrenie tendenziell einen beträchtlich reduzierten IFN-g/IL-10-Quotient im Voll-Blut. · Die schizophrenen Patienten, deren Symptome nach einer 8-wöchigen Behandlung fast unverändert blieben, hatten auffallend niedrigere IFN-g/IL-4- und IFN-g/IL-10-Quotienten im Voll-Blut als die gesunden Probanden. · Die schizophrenen Patienten mit einem frühen Krankheitsausbruch hatten außergewöhnlich reduzierte Serum IFN-g/IL-4- und IFN-g/IL-10-Quotienten, aber einen erhöhten IFN-g/IL-4 und IFN-g/IL-13 in PHA-stimulierten Lymphozyten. Im Gegensatz zeigten diejenigen mit einem späten Ausbruch keine Änderung der beiden Serum Th1/Th2-Quotienten, jedoch auffallend reduzierte IFN-g/IL-4- und IFN-g/IL-13-Quotienten bei in-vitro stimulierten Lymphozyten. (c) Die möglichen Ursachen der Th1/Th2-Dysbalance bei Schizophrenie-Patienten (Ergebnisse von Multiple-Regression): · Für die schizophrenen Patienten als ganze Gruppe waren vorwiegend IFN-g, IL-4 und IL-10 an die Balance zwischen dem Th1- und Th2-System beteiligt. IL-6 und TNF-a könnten zur Balance zwischen IFN-g und IL-4 im PHA-stimulierten Voll-Blut beigetragen haben, während IL-4 und das Alter offensichtliche Einflüsse auf die Balance zwischen IFN-g und IL-10 im Voll-Blut bei Patienten mit Schizophrenie gehabt haben dürften. · Für die schizophrenen Patientinnen wurde keine eindeutige Quelle für das Ausbalancieren zwischen Serum IFN-g und IL-4 gefunden, obwohl die gemessenen Variablen in der Lage waren, die IFN-g/IL-4-Varianz zuverlässig vorherzusagen (d.h. ³67% oder 2/3 der Varianz waren dadurch erklärbar). Das Abgleichen zwischen IFN-g und IL-4 im Voll-Blut nach PHA-Stimulation wurde eher von den komplexen wechselseitigen Korrelationen unter IFN-g, IL-4, TNF-a, IL-6, Prolactin, Östradiol, Testosteron und Alter beeinflusst. Ähnlich komplexe Inter-Korrelationen unter diesen obengenannten Kenngrößen wurden ebenfalls beim Ausgleichen zwischen IFN-g und IL-10 sowohl im Serum als auch im PHA-stimulierten Voll-Blut beobachtet. · Für männliche schizophrene Patienten gab es vermutlich einige andere entscheidende Faktoren, welche in dieser Studie nicht geprüft worden waren, die jedoch an der Balancierung zwischen IFN-g und IL-10 im Voll-Blut beteiligt gewesen waren. Im Gegensatz zu gesunden Probanden könnten Alter, Prolactin und Östradiol zusätzlich am Abgleichen von Serum IFN-g/IL-10 beteiligt gewesen sein. Hingegen war IL-6 am Abgleichen von IFN-g/IL-10 Voll-Blut-Assay bei männlichen schizophrenen Patienten beteiligt. Beachtenswerte Beiträge von Testosteron, SHBG und Östradiol zur Balancierung vom Voll-Blut IFN-g/IL-10 wie im Fall der Kontrollen waren bei männlichen Patienten mit Schizophrenie nicht zu beobachten. (d) Psychopathologie und Th1/Th2-Quotienten: Der durchschnittliche Messwert auf der PANSS-Negativ-Skala korrelierte positiv mit Voll-Blut-Assay IFN-g/IL-4 und IFN-g/IL-10. Außerdem war der Mittelwert auf der PANSS Global Skala ebenfalls positiv mit Voll-Blut IFN-g/IL-4 assoziiert. (6) Schlussfolgerung und Diskussion: (a) Die Ergebnisse dieser Studie zeigen deutliche Th2-Verschiebungen im Serum bei verschiedenen schizophrenen Subgruppen und bieten einen eher unterstützenden Hinweis für die Hypothese der Th2-Verschiebung von Schizophrenie. (b) Th2-Verschiebungen bei schizophrenen Patienten scheinen eine komplexe Folge von Wechselwirkungen von Krankheitsprozess, Hormonen und antipsychotischer Medikation, jedoch wahrscheinlich nicht nur ein Resultat der antipsychotischen Behandlung oder der durch Alterung ausgelösten Veränderungen zu sein.
Funktionelle Magnetresonanztomographie zur Darstellung zerebraler Aktivierungen bei thermischen Schmerzreizen ohne Medikation sowie nach Gabe von Remifentanil und Metamizol
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Ziel. Thema der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der zerebralen Schmerzverarbeitung. Mit der Methode der funktionellen Magnetresonanztomographie sollten Kortexareale lokalisiert werden, die bei thermischer Schmerzreizung am linken Vorfuß eine Aktivitätszunahme zeigen. Ziel war es, diese unter standardisierten Bedingungen reproduzierbar nachzuweisen und damit die Voraussetzung zu schaffen, Veränderungen dieser Aktivierungen bei Sauerstoff- und Analgetikagabe zu erfassen. Methodik. Zunächst wurden die physikalischen Grundlagen der Bilderzeugung mittels Magnetresonanztomographie vorgestellt. Dabei wurde insbesondere auf die funktionelle Bildgebung und die zugrunde liegende Physiologie eingegangen. Im speziellen Methodikteil wurden das untersuchte Kollektiv (6 gesunde Probanden) und der Versuchsablauf beschrieben. An einem 1,5 Tesla Magnetresonanztomographen wurden mit Hilfe von T2*-gewichteten Sequenzen funktionelle Bilddaten der Probandengehirne bei schmerzhafter und neutraler thermischer Stimulation am linken Fußrücken aufgezeichnet. An vier der Probanden wurden diese Messungen jeweils viermal wiederholt, um schmerzspezifische zerebrale Aktivierungen zu erfassen und deren intra- und interindividuelle Variabilität zu überprüfen. Im Anschluss wurden diese funktionellen Messungen an allen Probanden ohne und mit Gabe von Sauerstoff durchgeführt, um einen denkbaren negativen Effekt der bei Analgetikagabe erforderlichen Sauerstoffapplikation auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen auszuschließen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die Auswirkungen von Schmerzmedikamenten auf die zerebrale Aktivität bei Schmerzreizen zu untersuchen. In einem Pilotversuch wurde die beschriebene Messmethodik bei drei Probanden unter Gabe von Remifentanil, Metamizol und Kochsalzlösung in randomisierter Abfolge eingesetzt. Die Auswertung der funktionellen Bilddaten erfolgte anhand des General Linear Model (Softwarepaket FSL). Hiermit konnten sowohl individuelle zerebrale Aktivierungen erfasst, als auch Gruppenanalysen durchgeführt werden. Ergebnisse. Bei den Experimenten zur Lokalisation der zerebralen Aktivierungen konnten bei schmerzhafter Stimulation aktivierte Areale am häufigsten im frontalen Operculum und benachbarten Inselkortex, im dorsolateralen präfrontalen Kortex, im Gyrus frontalis medius, im anterioren Cingulum und im parietalen Operculum/SII Kortex nachgewiesen werden. Weniger häufig konnten Aktivierungen im primären somatosensorischen Kortex, im Thalamus, im Temporallappen, in den Basalganglien und im Hirnstamm nachgewiesen werden. Diese waren meist beidseits vorhanden, zeigten jedoch eine Betonung der kontralateral zur stimulierten Körperhälfte gelegenen Hirnhemisphäre. Im Vergleich mit der Neutralmessung stellten sich die aktivierten Areale im frontalen Operculum und der vorderen Inselregion, im anterioren Cingulum und in den Basalganglien als schmerzspezifisch dar. Die Aktivierungen im parietalen Operculum/SII Kortex konnten erst bei niedrigerem Signifikanzniveau nachgewiesen werden. Der interindividuelle Vergleich zeigte bei zwei der Probanden eine gute Übereinstimmung mit den zerebralen Aktivierungen der Gesamtgruppe. Zwei weitere Probanden wiesen jedoch ein deutlich unterschiedliches Aktivierungsmuster auf. Bei der intraindividuellen Analyse zeigte sich eine gute Reproduzierbarkeit der aktivierten Areale. Bei den Experimenten mit Sauerstoffgabe konnte ein negativer Effekt auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen ausgeschlossen werden. Bei Gabe von Remifentanil konnte der aus der klinischen Erfahrung bekannte ausgeprägte analgetische Effekt der Substanz beobachtet werden. In der funktionellen MRT ließen sich nach Gabe von Remifentanil keine zerebralen schmerzspezifischen Aktivierungen darstellen. Allerdings ergaben Kontrollmessungen bei visueller Stimulation ebenfalls eine Abnahme der zerebralen Aktivierungen. Bei Gabe von Metamizol konnte unter den gewählten Versuchsbedingungen kein analgetischer Effekt registriert werden. Als Erklärung kommt einerseits die niedrig gewählte Dosierung, andererseits die Pharmakokinetik der Substanz in Betracht. Eine Änderung des zerebralen Aktivierungsmusters konnte bei den drei untersuchten Probanden nicht objektiviert werden. Schlussfolgerung. Mit der funktionellen Magnetresonanztomographie war es möglich, durch Schmerzreize ausgelöste zerebrale Aktivierungen darzustellen. Diese Daten können als Grundlage für weitere Experimente mit schmerzmodulierenden Medikamenten dienen. Die gewählten Rahmenbedingungen der fMRT-Messungen gewährleisten die notwendige Sicherheit der Probanden während der Applikation von Schmerzmedikamenten, ohne die Darstellbarkeit der zerebralen Aktivierungen zu beeinträchtigen. Aussagen über die Wirkung von opioidartigen und nichtopioidartigen Analgetika müssen jedoch noch an einer größeren Gruppe von Probanden evaluiert werden.
Die neuen Dosisabschätzungen für Hiroshima und Nagasaki mit den Konsequenzen für die niedrig Exponierten aus der Gesamtgruppe
Tue, 1 Jan 1985 12:00:00 +0100 https://epub.ub.uni-muenchen.de/8790/1/8790.pdf Kellerer, Albrecht M.