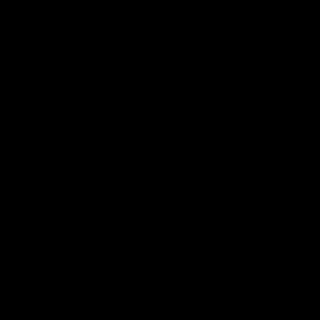Podcasts about operationsmethoden
- 22PODCASTS
- 26EPISODES
- 37mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 27, 2024LATEST
POPULARITY
Best podcasts about operationsmethoden
Latest podcast episodes about operationsmethoden
Wie sollte der elektive Bauchdeckenverschluss vorgenommen werden? 3-Jahres-Daten der ESTOIH-Studie
In dieser Folge spreche ich mit Prof. René Fortelny am Rande des Treffens der International Endohernia Society (IEHS) in Hainan über die 3-Jahres-Nachbeobachtung der ESTOIH-Studie. Diese randomisierte, kontrollierte Studie verglich die kurze mit der langen Nahttechnik bei der elektiven Verschlussoperation der mittleren Bauchwand. Wir diskutieren, warum sich die Rate von Narbenhernien in den ersten drei Jahren nach der Operation fast verdoppelte, welche Rolle Nahtmaterialien und -techniken dabei spielen und welche Impulse aus China die Debatte um innovative Operationsmethoden bereichern. Viel Freude beim Hören Moderation: Christoph Paasch Gast: Prof. Dr. med. René Fortelny (Wien) Besprochene Publikation: Fortelny RH, Hofmann A, Baumann P, et al. Three-year follow-up analysis of the short-stitch versus long-stitch technique for elective midline abdominal closure randomized-controlled (ESTOIH) trial. Hernia. 2024;28:1283-1291. doi: 10.1007/s10029-024-03025-9. Unter folgendem Link können bei der Landesärztekammer Brandenburg 2 Fortbildungspunkte erworben werden. Der Kursinhalt umfasst stets 3 Folgen: https://lernportal.laekb.de/goto.php?target=crs_3487&client_id=laekb.
#120 - Dr. Jørn Jørgensen, Founder & CEO von EuroEyes: Von Kurzsicht zur Klarheit – Eine Augenklinik auf Erfolgskurs
In dieser spannenden Podcast-Folge haben wir einen besonderen Gast: Dr. Jørn Slot Jørgensen, CEO und Gründer von EuroEyes. Er teilt seine beeindruckende Reise von der Gründung der ersten Klinik bis hin zur internationalen Expansion und wie er dabei Tausenden von Menschen zu einer klaren Sicht verholfen hat, darunter auch unserem Host Thomas Derksen.Dr. Jørgensen spricht über die Herausforderungen und Erfolge auf diesem Weg, die Technologien, die bei EuroEyes eingesetzt werden und die Bedeutung von Vertrauen und exzellenter Patientenbetreuung. Er gibt Einblicke in die verschiedenen Operationsmethoden, die den Patienten ein brillenfreies Leben ermöglichen, und erläutert, warum China ein so bedeutender Markt für das Unternehmen geworden ist.Egal, ob du selbst eine Augenoperation in Erwägung ziehst oder einfach mehr über die faszinierende Welt der Augenchirurgie erfahren möchtst – diese Episode bietet wertvolle Informationen und inspirierende Geschichten.Unbedingt mitmachen - Unsere Diskussionsfrage für die nächste Woche:In Deutschland gibt es Unverständnis für die Menge an Werbung von chinesischen Marken bei der EM. Schließlich sei es ja eine EUROPA-Meisterschaft. Wahrscheinlich haben diese Leute keine Ahnung davon, wie viele Millionen Chinesen mitten in der Nacht aus dem Bett steigen, um zu schauen, wie Deutschland, Italien und Schottland sich schlagen. Was ist eure Meinung dazu, dass man überall BYD, Alipay und Hisense sieht?So kannst du teilnehmen:Nimm eine Sprachnachricht auf, in der du deine Meinung zur Frage der Woche äußerst.Schicke die Sprachnachricht an +49 155 102 483 27.Mit etwas Glück wird deine Nachricht in der nächsten Folge unseres Podcasts zu hören sein!Wir freuen uns auf deine Beiträge und sind gespannt, was du davon hältst!Du möchtest dich bei EuroEyes bewerben? https://www.euroeyes.de/karriere-bei-euroeyes/Hier geht es zu unseren LinkedIn-Accounts: DamianThomasDr. JørgensenSend us a Text Message.
Der Beruf der Chirurgin/des Chirurgen unterliegt einem kontinuierlichen Wandel. Die einzelnen Fachgebiete haben sich spezialisiert und die Operationsmethoden stetig weiterentwickelt. Prim.Dr. Bernhard Furtmüller, Abteilungsleiter der Allgemeinen, Viszeral- und Gefäß-Chirurgie, erzählt über das Roboterassistierte DaVinci System, wie er sich auf mehrstündige Operationen vorbereitet und welche Haltung er zur künstlichen Intelligenz im OP- Saal hat.
#35 Meet the Maker: Zusammenarbeit, Fortschritt und Wandel
Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Chirurgen und den Tüftlern aus der Industrie ist sehr wichtig für den Fortschritt und die Innovationen in der Medizintechnik für bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken und für die Behandlung der Patienten. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Klinikseite: Wie sieht die Zusammenarbeit aus, wie wirken sich Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen auf den Klinikalltag aus, wie ändern sich Operationsmethoden, wohin gehend wandelt sich das Berufsbild der Chirurgen, wie ist der Umgang mit neuen Technologien und wie sieht der OP der Zukunft aus? Auf all diese Fragen findet Dr. Silke Mertmann Antworten in unserem Podcast MedTalk ON AIR.
Therapie & Training Talk #132 - TWUP #239 - Die Geschichte der Supplementierung
Thomas und Wolfgang sprechen über die Geschichte der Supplementierung, die Entwicklung von Operationsmethoden in der Gastroenterologie, übermässigen Konsum von Fruktose als Stressor für den Darm, eine kritische Betrachtung des Sissy Squats und warum mineralische Weine aus Chablis eine bessere Kaufentscheidung sind als eine Sissy Squat Maschine.
#65 Knorpelschaden Teil 2/2 - OP-Methoden und Ansätze für die Rehabilitation (mit Barbara Wondrasch)
Sportphysio Talk - Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie
In der heutigen Folge, Teil 2 von Knorpelschäden, gebe ich gemeinsam mit Babsi Wondrasch Einblicke über gängige Operationsmethoden, sowie Ansätze für die Rehabilitation von Knorpelschäden. Viel Spaß mit der Folge 65! Euer Chris #sportphysiotalk #podcast #sportphysiotherapie #letstalk #sportphysio #podcasts #podcastsösterreich #podcastsdeutschland #knorpel #knorpelschaden #cartilage #arthrose #chondropathie
Lipödem, welche operativen Möglichkeiten gibt es? Dr. Michel klärt auf!
Viele Frauen, die an Lipödem leiden, entscheiden sich für eine Liposuktion. Eine Operation, bei der das schmerzhafte und kranke Fettgewebe an betroffenen Stellen, wie z. B. an den Beinen, abgesaugt wird. Das Ziel solch einer OP ist die Linderung oder im besten Fall Beseitigung von Beschwerden, wie Druckempfindlichkeit, Spannungsgefühle, schweren Beinen, aber auch das Wiederherstellen der körperlichen Mobilität und nicht zuletzt der mentalen Stabilität ist ein großer Wunsch, den Betroffene damit verbinden. Aber welcher Arzt/welche Ärztin ist hierfür richtig? Welche Operationsmöglichkeiten gibt es? Welche wird vor allem bei Lipödem empfohlen? Wird eine Liposuktion in Vollnarkose gemacht oder ist es auch unter in Lokalanästhesie möglich? Wie ist das mit der Haut im Anschluss? Was, wenn sie sich nicht zurückbildet? Welche Straffungsmethoden gibt es, wenn man keine chirurgische Straffung möchte?! Wie lange setzt mich eine Fettabsaugung bei Lipödem außer Gefecht? Fragen über Fragen und deshalb habe ich mir in dieser Folge Dr. med. Sebastian Michel, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, an meine Seit geholt. Er ist nicht nur in Deutschland, um genau zu sein in Leipzig anzufinden, sondern auch in Dubai. Dr. Michel erläutert die verschiedenen Operationsmethoden bei Lipödem, wann welche Methode angewandt wird und welche Vor- und Nachteile jede Operation mit sich bring. Er verrät auch, welche der Methoden aus jahrelanger Erfahrung für ihn nicht nur die schonendste Methode, sondern auch die effektivste ist. Außerdem sprechen wir auch über die Unterschiede, die Dr. Michel bei betroffenen Frauen mit Lipödem in Dubai und Deutschland erlebt. Für mich war das zunächst eher unverständlich, aber im Nachhinein total einleuchtend. —--------------------------------------- Weitere Informationen Dr. med. Sebastian Michel, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Leipzig findest du auch über: aesthetic-leipzig@kopfzentrum-gruppe.de oder www.michel-aesthetics.de Natürlich kannst du Dr. Michel auch über Instagram folgen: dr.michel_aesthetics
#44 ARZTSPRECHSTUNDE - Schwerpunkt Schulter Teil1 (mit Dr. Georg Bézard)
Sportphysio Talk - Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie
Mit meinem heutigen Gast Dr. Georg Bezard spreche ich über das Thema Schulter. Es geht um diagnostische Ansätze aus Sicht des Arztes. Aber auch Operationsmethoden werden besprochen. In Teil 1 geht es um traumatische Schulterverletzungen. Viel Spaß mit der Folge 44! Euer Chris #sportphysiotalk #podcast #sportphysiotherapie #letstalk #sportphysio #podcasts #podcastsösterreich #podcastsdeutschland #Drbezard #orthopädie #medizin #medicine #schulterschmerzen #sporttraumatologie #rotatorenmanschette #bicepssehne #schulter #shoulder
Soraya möchte sich als eines der jüngsten trans Mädchen der Schweiz vor dem 18. Lebensjahr operieren lassen. Der lästige Penis soll weg. In einer Langzeitbeobachtung dokumentiert SRF DOK Sorayas Weg. Dass es kein einfacher Weg werden würde, war Soraya von Anfang an bewusst. Doch dass ihr grosses Ziel – die Operation – derart lange auf sich warten lassen würde, empfindet Soraya als Belastung. Für sie gibt es kein richtiges Leben im falschen Körper. Im zweiten Teil des «DOK»-Filmes prüfen Soraya und ihre Eltern verschiedene Operationsmethoden. Thailand, Zürich und München stehen als Ort zur Debatte. Dazu muss Soraya eine schwierige, medizinische Entscheidung treffen. Sie macht dabei die Rechnung ohne ihre Krankenkasse. Diese will den Eingriff zunächst nicht bezahlen. Sechs Jahre lang mit der Kamera begleitet Nicht nur medizinische, auch gesellschaftliche Hürden muss Soraya überwinden. Ausgrenzung und Vorurteile lassen sich nicht wegoperieren. Ebenso wenig die Ungeduld und die innere Wut der Teenagerin. Mehr als sechs Jahre begleiten Filmemacher Daniel Stadelmann und Kameramann Otmar Schmid Soraya und ihre Familie, dokumentieren innere Veränderungen und äusserlichen Fortschritt. Entstanden ist ein einzigartiger und berührender, zweiteiliger «DOK»-Film über einen Menschen, der allen Widrigkeiten zum Trotz den eigenen Platz im Leben sucht. Ein Film, der über das Einzelschicksal hinaus einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte über den Umgang mit Transidentität und Homophobie leisten kann. «Ich würde mit all meinen Freundinnen tauschen», sagt Soraya an einer Stelle des Filmes über ihr Leben. Man möchte es Soraya am liebsten nicht glauben.
Der erfolgreiche Kampf um die Sehkraft
Sie ist eine der ältesten Operationsmethoden in der Geschichte der Menschheit: der sogenannte „Starstich“. Mit diesem mehr als 3000 Jahre alten Eingriff wurde der Graue Star behandelt. Wie, das erklärt Schauspieler Ulrich Noethen, der die Geschichte Revue passieren lässt und Sie dabei in das alte Rom und das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg mitnimmt. Was sich in der Augenheilkunde bis hin zur Gegenwart alles getan hat und weshalb für manche Operationen auch Zähne gezogen werden müssen (Sie haben richtig gelesen), wird in dieser Folge erzählt.
Peter Vajkoczy: Kopfarbeit - ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod
Der international renommierte Neurochirurg erzählt über seine Arbeit, neue Operationsmethoden aber auch die Grenzen der Medizin.
Die digitale Sprechstunde: Schaufensterkrankheit
Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios
Schaufensterkrankheit - was so harmlos klingt, ist eine schwere Durchblutungsstörung, die schlimmstenfalls mit dem soggenanten Raucherbein und einer Amputation endet. Wer besonders gefährdet ist, was im Frühstadium hilft und wie sich die Operationsmethoden in den vergangenen Jahren verbessert haben, das verrät Dr. Harald Daum, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg, in einer neuen Folge der "Digitalen Sprechstunde", dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. "Man muss das Gefäßsystem wie ein Organ begreifen. Oft sind die Betroffenen von den Hacken bis zum Nacken erkrankt."
Wenn das Öffnen einer Flasche zum Problem wird, dann handelt es sich meistens um Abnutzung des Daumensattelgelenks. Ein Team aus Forschenden der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie der Med Uni Graz hat sich auf neue Operationsmethoden im Bereich der Handchirurgie spezialisiert. Der Beitrag Handfest erschien zuerst auf AirCampus.
Wenn das Öffnen einer Flasche zum Problem wird, dann handelt es sich meistens um Abnutzung des Daumensattelgelenks. Ein Team aus Forschenden der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie der Med Uni Graz hat sich auf neue Operationsmethoden im Bereich der Handchirurgie spezialisiert.
Die Behandlung der Epilepsie hat in jüngster Zeit deutliche Fortschritte gemacht: Vor allem Patienten mit schweren Formen profitieren von Gendiagnostik, verbesserten Operationsmethoden und neuen Wirkstoffen.
Evans-Osteotomie kombiniert mit modifizierter Müller-Niederecker-Sehnenverlagerung bei juvenilem Plattfuß
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
Der juvenile Plattfuß ist die häufigste Fußfehlstellung und Gegenstand aktueller Diskussionen. Treten therapieresistente Schmerzen auf, besteht häufig die Indikation zur Operation. Hier gibt es eine Vielzahl verschiedener Methoden. Ziel der durchgeführten Untersuchung war es, die Evans-Osteotomie kombiniert mit modifizierter Müller-Niederecker-Sehnenverlagerung zu evaluieren. Dafür wurden in dieser retrospektiven Studie 26 Patienten (46 Füße), die im Alter von 6 bis 16 (11,3 ± 2,2) Jahren operiert wurden, nach durchschnittlich 32,4 Monaten nachuntersucht. Gemäß der Pathogenese der Fußdeformität wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A mit primärem Knickplattfuß, Gruppe B mit sekundärem bei infantiler Cerebralparese. Es wurden klinische und radiologische Untersuchungen sowie eine kinetische und kinematische Ganganalyse mit Kontrollgruppe durchgeführt. Postoperativ zeigte sich ein signifikanter Rückgang der Schmerzsymptomatik auf durchschnittlich 0,1 Punkte der numerischen Rating-Skala. 88,5% der Patienten waren „sehr zufrieden“ mit ihrer Lebensqualität. Bei der klinischen Ankle-Hindfoot Scale konnte in Gruppe A ein Durchschnittswert von 94,5 (82-100 min.-max.) erreicht werden, beim Maryland Foot Score 95,5 (82-100 min.-max.). Komplikationen traten in unserem Patientenkollektiv nicht auf. In der Röntgenun-tersuchung zeigte sich eine signifikante Verbesserung bei folgenden Winkeln: Kalkaneus-Boden-Winkel (20,4°, 9-36° min.-max.), Talus-Neigungswinkel (22,7°, 13-31° min.-max.), Kuboid-Abduktionswinkel (0,8°, -17-17° min.-max.), dorsoplantarer Talus-Kalkaneus-Winkel (19,8°, 10-30° min.-max.), lateraler Talus-Metatarsale-I-Winkel (2,7°, -23-27° min.-max.). Bei 19,6% der Füße waren radiologisch osteophytäre Anbauten im Kalkaneo-Kuboid-Gelenk sichtbar. In der Ganganalyse konnten vor allem im Hinblick auf die Verlagerung der Sehne des M. tibialis anterior lediglich geringfügige Unterschiede von wenigen Grad zwischen Gruppe A und Kontrollgruppe detektiert werden, die keine Auswirkung auf ein physiologisches Gangbild zu haben scheinen. Vielmehr sollte in zukünftigen Studien überprüft werden, in wie weit sich das Gangbild durch die Korrektur der Deformität verbessert. Im Vergleich mit anderen Operationsmethoden zeigte sich, dass die Evans-Osteotomie in Kombination mit modifizierter Müller-Niederecker-Sehnenverlagerung sehr gute Ergebnisse bringt und dabei sehr komplikationsarm ist. Langzeitergebnisse, vor allem im Bezug auf arthrotische Veränderungen im Kalkaneo-Kuboid-Gelenk, sowie eine präoperative Ganganalyse sollten Gegenstand weiterer Untersuchungen werden.
Die koronare Herzerkrankung und die Aortenklappenstenose sind die häufigsten kardiologischen Erkrankungen. Durch die erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Herzchirurgen konnten in den letzten Jahren wesentliche Erfolge erzielt werden. Der Kardiologe Univ.- Prof. Dr. Franz Weidinger moderiert am 27.05.2009 gemeinsam mit dem Herzchirurgen Univ.-Prof. Dr. Günther Laufer in der Gesellschaft der Ärzte in Wien eine wissenschaftliche Sitzung zu diesen Themen, und fasst in der vorliegenden Billrothhaus-News die Schwerpunkte wie folgt zusammen: 1. Bei der Behandlung der koronaren Herzerkrankung zeigen rezente Studienergebnisse, dass auch mit einem konservativen medikamentösen Vorgehen ein der chirurgischen Intervention vergleichbares Endpunktergebnis erzielt werden kann. 2. Mehrgefässerkrankungen mit koronarem Hauptstammbefall waren bisher die Domäne der Bypass-Operation und der PCI deutlich überlegen. Die Ergebnisse der soeben publizierten SYNTAX Studie (New England Journal of Medicine, 2009)stellen diese Leitlinie in Frage, da mit medikamenten-beschichteten Stents annähernd gleiche Endpunktverbesserungen erzielt werden können. Die Studie führt naturgemäss zu Kritik und Diskussionen, für die im Rahmen der Sitzung ausreichend Gelegenheit gegeben ist. 3. Die perkutane Aortenklappen-Implantation zählt zu den bedeutensten Innovationen in der kardiovaskulären Medizin der letzten Jahre. Die zwei wesentlichen, auch für ältere und co-morbide Patienten anwendbare, Operationsmethoden werden gegenübergestellt. Die genannte Veranstaltung wird zur Gänze aufgezeichnet und wird ab 1.6.2009 als DFP E-learning Kurs zur Verfügung stehen ( für Mitglieder kostenlos).
Umstellungsosteotomie am Metatarsalknochen zur Heilung und Prophylaxe diabetisch- neuropathischer Schwielen und Ulzerationen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Die periphere Neuropathie, die am häufigsten beim Diabetes vorkommt, führt über die Beeinträchtigung der Motorik und der Sensibilität zu einer Dysbalance der Fußmuskulatur. Sie begünstigt Fußfehlstellungen wie Hallux valgus, Hammerzehenstellung und das Tiefertreten der Mittelfußköpfchen. Daraus resultiert eine Störung der Abrollbewegung. Bleiben tief stehende Metatarsalköpfchen über längere Zeit bestehen, entwickeln sich zunächst plantare Druckschwielen und später Ulzerationen. Diese führen zu Infektionen des Fußes, die eine Amputation erforderlich machen können. Konservative Behandlungsmethoden können zur Ulkusheilung führen, haben aber eine hohe Rezidivrate. Die operativen Verfahren bestanden bislang v. a. in Resektionen. Diese führen zur Überlastung der Nachbarknochen. Es entstehen an diesen Stellen neue Läsionen, sog. Transferulzerationen. Ziel dieser Arbeit war es, druckentlastende Operationsmethoden mit Erhalt der Metatarsalknochen auf Ulkusheilung und Operationskomplikationen zu untersuchen. Es wurde bei 14 Patienten mit 9 Schwielen und 9 Ulzerationen eine gelenkerhaltende Umstellungsosteotomie am Metatarsale zur Druckreduktion durchgeführt. Alle Läsionen heilten in einem Zeitraum von 2 bis 8 Wochen ab. Postoperative Heilungskomplikationen traten nicht auf. Die Ergebnisse zeigen, dass Neuropathie bedingte Ulzerationen durch druckentlastende Osteotomien an den Mittelfußknochen zur Heilung gebracht werden können, wenn konservative Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben.
Die ventrale Stabilisierung thorakolumbaler Wirbelkörperfrakturen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
In dieser Kohortenstudie mit prospektiver radiologischer Betrachtung wurden Patienten mit einer traumatischen Wirbelkörperfraktur, die von dorsoventral stabilisiert und im Städtischen Krankenhaus München Harlaching in den Jahren 2000 bis 2002 operiert worden waren, in einer Nachuntersuchung reevaluiert, zu ihrem Gesundheitszustand befragt und körperlich untersucht, wobei der Frage nach Unterschieden im Bezug auf das klinisch-funktionelle, sozioökonomische und radiologische Ergebnis der Patienten nachgegangen wurde. Das Patientenkollektiv bestand aus drei Behandlungsgruppen, die jeweils einen unterschiedlichen ventralen Wirbelkörperersatz therapeutisch erhalten hatten. 20 Patienten mit einem Timeshed Cage, 18 mit einem Synex™ Cage und 30 mit einem Knochenspan bildeten das Patientenkollektiv, welches mit der deutschen Version des SF-36-Fragebogens, eigenen Fragen, einer körperlichen Untersuchung und anhand der Auswertung röntgenologischen Datenmaterials untersucht, verglichen und statistisch mit dem SPSS-Statistikprogramm ausgewertet wurde. Außerdem wurde der Frage nach Unterschieden zwischen Arbeitsunfällen und privaten Unfällen nachgegangen. In den Ergebnissen zeigte sich eine signifikante Einschränkung des gesamten Patientenkollektivs (p
Ergebnisse dosierter Obliquus-inferior-Chirurgie zur Behandlung des einseitigen Strabismus sursoadductorius
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
In dieser an der Augenklinik der Universität München an 234 Patienten durchgeführten Studie wurden unterschiedliche Aspekte einer dosierten Rücklagerung des M. obliquus inferior bei Patienten mit einseitigem Strabismus sursoadductorius über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren untersucht. Anhand dieser Studie konnte die Effektivität der Rücklagerung bzw. der Rück-Vorverlagerung des M. obliquus inferior zur Behandlung eines Strabismus sursoadductorius gezeigt werden. Der Effekt der Operation auf die VD in Adduktion betrug zwischen 0,6 und 0,8°/mm Operationsstrecke. Der Effekt auf die ZD war in allen Blickrichtungen in etwa gleich und betrug zwischen 0,2 und 0,3°/mm Operationsstrecke. Die Auswirkung der Operation auf die HD ist vernachlässigbar. Es zeigte sich eine Dosis-Wirkungsbeziehung, die aber zum Teil auf die Abhängigkeit des Operationseffektes vom präoperativen Winkel zurückzuführen ist. Sowohl der Effekt der Rücklagerung bzw. Rück-Vorverlagerung auf die VD, als auch auf die ZD wird entscheidend durch die vor der Operation vorhandenen Winkel mitbestimmt. Der bei diesen Operationsmethoden, bei denen der hintere Teil des M. obliquus inferior am hinteren Hemmband belassen wird, vermutete selbstregulatorische Effekt bewirkt, daß bei einem größeren präoperativen Winkel auch eine stärkere Winkelreduktion statt findet. Bei einem Vergleich der präoperativen Untersuchungsergebnisse nach einer dreitägigen diagnostischen Okklusion nach MARLOW mit denen ohne eine solche Okklusion, war unter der Okklusion eine Abnahme der VD und eine Zunahme der ZD festzustellen. Zudem zeigte sich eine verringerte Inkomitanz der VD bei vertikalen Bewegungen in der Adduktion. Es wäre sinnvoll diese Untersuchung immer bei Verdacht auf einen atypischen Strabismus sursoadductorius durchzuführen, um eine Vorstellung von den Befunden ohne Gegenregulation der Augen zu erhalten und bei untypischen Befunden die Diagnose stellen zu können. Bezüglich der funktionellen Befunde (Asthenopie, Diplopie, Stereosehen, Binokularsehen, Kopfzwangshaltung) zeigte sich in den meisten Fällen eine Verbesserung durch die Operation, diese war aber nicht von der Dosierung der Rücklagerung und auch nicht von der Reduktion der Schielwinkel abhängig. Betrachtet man die Häufigkeit postoperativer Befunde, wie das Auftreten einer Hebungseinschränkung des operierten Auges (10-13 %) oder eines Strabismus Zusammenfassung 117 sursoadductorius auf der Gegenseite (5 %) bzw. eine verbliebene Überfunktion, die einer weiteren Operation bedarf (8 %), so ist das relativ seltene Vorkommen dieser unerwünschten Befunde ein weiterer Beleg für die Effektivität und das relativ geringe Risiko dieser Operationsmethoden. Die alleinige Operation am M. obliquus inferior in Form einer Rücklagerung dieses Muskels in Verlaufsrichtung bzw. einer Rück-Vorverlagerung an den lateralen Ansatz des M. rectus inferior stellt somit eine effektive und sichere Behandlungsmöglichkeit des Strabismus sursoadductorius dar, die zudem bei Erwachsenen keine Vollnarkose erfordert.
Die augmentierte Kreuzbandnaht
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/07
Die Rekonstruktion des rupturierten vorderen Kreuzbandes ist eine der häufigsten Knieoperationen. Viele Operationsmethoden und verschiedenste Implantatmaterialien wurden beschrieben und dennoch gibt es in der medizinischen Fachwelt keine Einigkeit über ein Operationsverfahren. Aufgrund der komplexen Anatomie konnte bis heute noch kein gleichwertiger Kreuzbandersatz gefunden werden. Eine Methode der Rekonstruktion stellen die autologen Sehnentransplantate dar, unter denen das Patellarsehnentransplantat als Goldstandard zählt. Jedoch birgt diese Methode Nachteile wie Verlust der sensomo torischen Funktion, Nachdehnung des Transplantates und reduzierte Reißfestigkeit. Die alleinige Primärnaht wird aufgrund unbefriedigender Ergebnisse nicht mehr empfohlen. Dies führte zur Verwendung von Augmentationen, die das heilende Ligament vor mechanis cher Überlastung schützen sollen. Unter den vielen Augmentationsmaterialien haben sich resorbierbare Kordeln durchgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wurde eine neu entwickelte resorbierbare Augmentationskordel für die temporäre Verstärkung einer Kreuzbandnaht im Tiermodell Schaf untersucht. Die Untersuchung sollte Aufschluss über die klinische Anwendbarkeit dieser langsam resorbierenden Augmentation aus Polylactid geben. Das Ziel war festzustellen, ob ihre Verwendung zu einer höheren Kniegelenkstabilität und damit zu einem besseren Operationsergebnis führt als die Implantation der bisher erhältlichen, schneller resorbierenden Kordel aus Polydioxanon. Im experimentellen Teil der Studie wurden insgesamt 32 Schafe in drei Gruppen eingeteilt. Bei den Gruppen I und II wurde das VKB an seinem femoralen Ursprung durchtrennt, um einen proximalen Riß zu simulieren. Anschließend wurde es mit transkondylären Nähten reinseriert. Gruppe I erhielt die neue PLA-Kordel als Augmentation. Gruppe II erhielt die bereits in der Klinik verwendete PDS-Kordel als Augmentation und diente als Vergleichsgruppe zu Gruppe I. Bei den Tieren der Gruppe III wurde eine Totalresektion des VKB vorgenommen und ein autologes Patellarsehnentransplantat eingesetzt. Diese Gruppe diente als Kontrollgruppe zu den Gruppen I und II. Die Standzeiten betrugen sechs Monate für die Gruppen I und II und zwölf Monate für die Gruppe III. Die makroskopische Untersuchung ergab, dass die operierten Kniegelenke aller Gruppen im Vergleich zur nicht operierten Kontrollseite vermehrt Knorpelschäden höheren Grades zeigten. Beim Gruppenvergleich hatte die PDS-Gruppe mehr Knorpelschäden als die PLAGruppe, die wenigsten Schäden traten bei der PT-Gruppe auf. Zusammenfassung 73 Die Schwerpunkte der biomechanischen und histologischen Untersuchungen waren Einfluss von mechanischem Schutz auf die Heilung und Reißfestigkeit des genähten VKB, Heilungsrate und Belastbarkeit der primären Kreuzbandnaht, In-vivo-Degradation der Augmentation und funktionelle Rekonstruktion des Kniegelenkes. Schubladentest und Reißtest ergaben, dass die Sehnentransplantate die besten Ergebnisse erzielten. Die Schubladen der Kniegelenke der PLA-augmentierten Gruppe waren größer als die der PDS-augmentierten Gruppe. Die vorderen Kreuzbänder der PLA-Gruppe zeigten eine geringfügig höhere Reißfestigkeit als die der PDS-Gruppe, erreichten aber nur 44 % der Reißkraft der Sehnentransplanate und nur 17 % der Reißkraft der nicht operierten Kontrollbänder. Keine der angewandten Operationsmethoden konnte eine Kniegelenkstabilität erreichen, die der Stabilität der nicht operierten kontralateralen Kniegelenke nahe kam. Die PLA-Kordel selbst hatte in neun von elf Fällen eine Teil- oder Totalruptur erfahren. Dies wurde auf die hohe mechanische Belastung an den Bohrkanaleingängen zurückgeführt, die durch Abrieb, Reibung und Biegung entsteht. Histologisch zeigte die PLA-Augmentation eine gute Gewebeverträglichkeit, gute Knochenintegration in den Bohrkanälen und eine langsame Resorption. Die Organisationsstruktur der reinserierten Kreuzbänder war nicht mehr vorhanden. Sie zeigten eine höhere Zelldichte und mehr Blutgefäße als die nicht operierten Kontrollen. Die Studie hat gezeigt, dass eine weitere Verbesserung der mechanischen Eigenschaften der PLA-Kordel notwendig ist, um ihr frühzeitiges Reißen zu vermeiden. Erst dann ist es möglich, eine Aussage über die Auswirkung einer langsam resorbierenden Augmentation auf ein genähtes Kreuzband zu machen. Momentan stellt diese Art der VKB-Reparatur keine Alternative zum Sehnentransplantat dar.
Muskelentspannende Eingriffe am Hüftgelenk des infantilen Zerebralparetikers
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Einleitung/Ziel: In den letzten 50 Jahren wurden über 20 verschiedene weichteilentspannende Operationsmethoden für die Hüfte des infantilen Cerebralparetikers entwickelt, die zum einen dessen Funktion bessern und zum anderen die spastische Hüftluxation verhindern sollen. Ziel der präsentierten Untersuchung war es, alle in der zugänglichen Literatur erfaßbaren isolierten Weichteileingriffe an der spastischen Hüfte zu sammeln und die Validität der zugehörigen Veröffentlichungen im Sinne einer systematischen Übersichtsarbeit zu bewerten. Ausdrücklich betont sei, dass damit nur die Ernsthaftigkeit der überprüften Arbeiten und nicht die Sinnhaftigkeit der publizierten OP-Methode beurteilt werden kann. Methode+Untersuchungsgut: 68 Arbeiten des deutsch- und englischsprachigen Raumes ab 1957-2000 wurden über die Internet-Literaturrecherche PubMed gesammelt und ausgewertet. Als Validierungsgrundlage diente ein eigens hierfür entwickelter Schlüssel in Anlehnung an definierte Standards von M. Goldberg. Dabei wurden als betonte Gütekriterien ein prospektives Studiendesign, eine hohe Nachbeobachtungsrate, ein detailliert untersuchter Funktionsstatus und, mit besonderem Gewicht, die Eindrücke und Erfahrungen der mittelbar und unmittelbar Betroffenen, Patienten, Eltern, Physiotherapeuten, gewertet. Gute technische Untersuchungen wurden zur Aufnahme in die Wertung vorausgesetzt und entsprechend geringer bewertet. Ergebnisse: Keine der Veröffentlichungen konnte die Maximalansprüche, die dieser Schlüssel an das Studiendesign stellt (Kat. A), erfüllen.5 Beiträge (7,4%) erreichten über 66% der Maximalpunktzahl (Kat. B). 24 Beiträge (35,3%) kamen auf mindestens 50% der zu erreichenden Punkte (Kat C). 24 Veröffentlichungen (35,3%) erzielten über 33,3% (Kat D). 15 Arbeiten (22,1%) blieben unter 33,3% (E). Der Durchschnitt aller ausgewerteten Veröffentlichungen lag bei 13,10 Punkte, das entspricht 43,68%. Dabei wurde deutlich, daß die Angaben zum subjektiven Befinden lediglich bei knapp über 20% der Publikationen festgehalten sind. Die technischen Angaben sind größtenteils in zufriedenstellender Form gemacht worden. Schlußfolgerung: Trotz erkennbarer Verbesserungen in den letzten zehn Jahren gibt es derzeit noch wenige prospektive Studien, die den Qualitätskriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen. Die in der Operation erreichten technischen Ergebnisse und der mit der Operation erreichbare funktionelle Zugewinn wurden zufriedenstellend, die subjektive Einschätzung des Patienten und seines Umfeldes nicht genügend berücksichtigt.
Retrograde Endopyelotomie als Therapie der Ureterabgangsenge
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
1. Einleitung Die Ureterabgangsenge ist eine in den meisten Fällen bereits kongenital angelegte, morphologische Abweichung des pyeloureteralen Übergangs, deren pathogene Bedeu-tung in jedem Alter klinisch manifest werden kann (Gillenwater 1991, Park und Bloom 1998). Es handelt sich hierbei um eine anatomische und/oder funktionelle Obstruktion. Die urodynamische Relevanz dieser Obstruktion unterliegt offensichtlich einer eigenen Entwicklung, sodass das rechtzeitige Erkennen und die Beseitigung des Abflusshinder-nisses vor dem Auftreten eines irreversiblen Funktionsverlusts der Niere von entschei-dender Bedeutung sind (Gillenwater 1991, Jacobs et al. 1979, Novic und Streem 1998). Lange Zeit war die offene Nierenbeckenplastik die Therapie der Wahl bei Ureterab-gangsengen. Der allgemeine Trend zu minimal invasiven Operationsmethoden hat in den achtziger Jahren neues Interesse für die bereits 1943 von Davis veröffentlichte Ure-terotomie geweckt (Van Cangh und Nesa 1998, Davis 1943). Dabei handelt es sich um eine komplette Inzision aller Wandschichten im Bereich des stenosierten Segmentes mit anschließender Ureterschienung. Die Entwicklung und Verbesserung der endoskopi-schen Instrumente und Operationstechniken erlauben heute einen endoskopischen, mi-nimal invasiven Zugang zum pyeloureteralen Übergang. Es wurden spezielle Endopye-lotomie-Katheter ent-wickelt, sowohl für den perkutanen Zugang bei der antegraden Pyelotomie (Perez et al. 1992, Van Cangh et al. 1994, Brannen et al. 1988, Van Cangh und Nesa 1998, Motola et al. 1993 A, Kletscher et al. 1995) als auch für den transu-rethralen Zugang bei der retrograden Endopyelotomie (Schwartz und Stoller 1999, Tawfiek et al. 1998, Faerber et al. 1997, Preminger et al. 1997, Nadler et al. 1996). Be-züglich der Langzeitergebnisse ist die Endopyelotomie derzeit der offenen Pyeloplastik noch unterlegen. Für die Patienten ist die Endopyelotomie jedoch mit einer sehr viel geringeren Morbidität und einem kürzeren Krankenhausaufenthalt verbunden (Brooks et al. 1995). Um die Erfolgsrate zu evaluieren, sollen nun Nachuntersuchungen von Patienten nach Endopyelotomien wichtige Informationen liefern.Die folgende Arbeit beinhaltet eine Fallstudie mit postoperativer Kontrolle von 33 Pati-enten, die mittels retrograder Endopyelotomie bei Ureterabgangsengen behandelt wur-den. Die Datenerhebung und Datenauswertung erfolgte teilweise retrospektiv, zum ü-ber-wiegenden Anteil jedoch prospektiv, begleitend zu Operationen und Kontroll-Untersuchungen im Klinikum München-Bogenhausen. Vor diesem Hintergrund soll letztlich die Frage beantwortet werden, ob und in welchen Fällen die retrograde Endo-pyelotomie die konventionelle Pyeloplastik in Zukunft ersetzen könnte.
Diagnose und Therapie erworbener Vaginalstenosen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen systematischen Überblick über Ursachen und Behandlung erworbener Vaginalstenosen zu geben und die Evidenzstärke therapeutisch/prophylaktischer Massnahmen zu bewerten. Wie schon Richter zitiert (Richter und Terruhn 1982) sehen Frauen weniger im Uterus als in der Scheide ihre Weiblichkeit verkörpert. Es wird deutlich, dass nicht-kongenitale Verengungen der Vagina bei betroffenen Frauen zu erheblichen Störungen der physischen und psychischen Integrität führen können, obschon nicht zwangsläufig mit subjektiven Beschwerden einhergehen müssen. Die Sichtung des Studienmaterials zum Thema ergibt nur sehr wenige prospektiv randomisiert placebokontrollierte Studien zur Behandlung der Vaginalstenose (Evidenzgrad Ib oder höher). In vielen Fällen handelt es sich um kleine Fallzahlen oder retrospektive Betrachtungen mit geringer Evidenzstärke. Angaben zur Inzidenz variieren erheblich, abhängig davon, ob vaginale Veränderungen im Rahmen der Gesamtmorbidität einer Erkrankung oder isoliert betrachtet wurden. Auch die klinische Absicherung einer Vaginalstenose wurde nicht einheitlich vorgenommen. Dies erschwert eine Vergleichbarkeit der Studien. Untersuchungen zur sexuellen Funktionsstörung nach Erkrankungen, die zu einer Beeinträchtigung der vulvovaginalen Anatomie führen können, wurden im Rahmen dieser Arbeit wiederholt betrachtet, da hier häufig auch eine differenzierte Untersuchung des Vaginaltraktes erfolgte. Vaginale Folgen des Lichen sclerosus, des Lichen planus, des Lyell-Syndromes und des Stevens-Johnson-Syndromes sind selten. Im Rahmen gyäkologischer Operationen, Bestrahlungen wegen eines gynäkologischen Karzinoms des Genitaltraktes oder einer cGVHD muß häufig mit stenosierenden Beschwerden gerechnet werden. Trotz zahlreicher Behandlungsansätze liegen gesicherte Erkenntnisse zu der Prävention vulvovaginaler Spätfolgen wie Synechien und Stenosierungen für die genannten Ursachen nicht vor. Lediglich die Wirksamkeit von topischen Östrogenen auf vulvovaginale Spätfolgen einer Strahlentherapie ist in prospektiv randomisierten Studien belegt (Ib, A). Behandlungsregime wie frühzeitige lokale Applikation von Kortikosteroiden, Einlage eines kortisonbeschichteten Obturators bereits im akuten Krankheitsstadium, frühzeitige Wiederaufnahme von Geschlechtsverkehr sind rein empirisch und bedürfen der Absicherung durch prospektive Untersuchungen. Dies dürfte bei der Seltenheit genannter Erkrankungen mühsam und langwierig sein. Die erhöhte Inzidenz von Vaginalstenosen in Studien, die gezielt vulvovaginale Veränderungen betrachteten und die geringe Gesamtzahl kontrollierter Studien machen deutlich, dass vulvovaginale Folgen bislang zu wenig untersucht sind. Eine operative Therapie der vulvovaginalen Schädigung ist nur selten notwendig, dann aber häufig technisch sehr anspruchsvoll. Es stehen eine Reihe von Operationsverfahren zu Verfügung, die für die Behandlung sowohl narbiger Strikturen als auch Gewebedefekte geeignet sind. Die Fülle der Methoden spiegelt die Schwierigkeiten wider, ein wirklich befriedigendes Behandlungsergebnis zu erreichen. Vorliegendes Datenmaterial inkludiert nur relativ geringe Fallzahlen. Es gibt keine prospektiven Untersuchungen, die Operationsmethoden gegeneinander vergleichen. Dies dürfte bei der geringen Zahl an operationsbedürftigen Befunden und der konsekutiven Entwicklung einer präferierten Operationstechnik einzelner Zentren auch schwierig durchzuführen sein.
Ergebnisse zweier Operationsmethoden zur Behandlung der weiblichen Stressinkontinenz
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Aufgabenstellung: Ziel der empirischen Studie war es, zwei Operationsmethoden zur Behandlung der weiblichen Stressinkontinenz hinsichtlich der klinischen Verläufe und der durch die Patientinnen bewerteten Ergebnisse darzustellen. Hierzu wurden Daten von 35 Patientinnen erhoben, die wegen Stressinkontinenz nach der endoskopischen Blasenhalssuspension (BHS) am Krankenhaus Moabit/Berlin versorgt worden waren. Als Vergleichgruppe dienten fünfzehn Patientinnen, die wegen Stressinkontinenz eine Faszienzügelplastik nach Fischer an der Fachklinik St. Joseph II/Berlin erhalten hatten. Methode: Als historische Kohortenstudie angelegt, wurde nach einem Follow-up von mindestens drei Monaten an alle Patientinnen, die am Krankenhaus Moabit im Zeitraum 1989-93 und am St. Josephkrankenhaus im Zeitraum 1987-1992 behandelt worden waren, ein Fragebogen zur aktuellen Symptomatik der Stressinkontinenz und zur präoperativen, perioperativen und aktuellen Lebensqualität verschickt. Klinische Daten zum präoperativen Status und zum perioperativen Verlauf wurden aus den Krankenakten der Patientinnen entnommen. Ergebnisse: In die Studie konnten 75 % aller Frauen, die die Einschlusskriterien erfüllten, einbezogen werden. In der BHS-Gruppe betrug die Heilungsrate/Besserungsrate bezogen auf den Inkontinenzgrad nach einer mittleren Beobachtungszeit von zehn Monaten 43 % bzw. 51 %. In der FZP-Gruppe lag die Erfolgsrate nach durchschnittlich drei Jahren bei 27 % bzw. 53%. In dieser Gruppe befanden sich fünf Rezidivpatientinnen bezogen auf eine vorangegangene Inkontinenzoperation. Vier von ihnen profitierten von dem Eingriff. Es kam in beiden Gruppen zu einer signifikanten Besserung der mittleren Lebensqualität (p