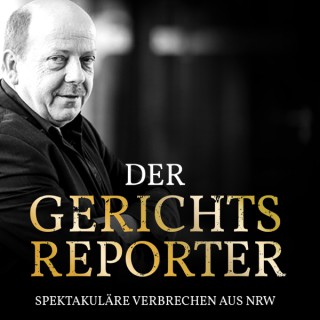Podcasts about millionen dm
- 16PODCASTS
- 21EPISODES
- 27mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- May 7, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about millionen dm
Latest podcast episodes about millionen dm
Geboren wird Johann Scheerer im November 1982 in Henstedt-Ulzburg im Süden Schleswig-Holsteins. Seitdem lebt und arbeitet Scheerer in Hamburg.Seine Biografie kommt nie ohne den Umstand aus, dass sein Vater Jan Philipp Reemtsma 1996 entführt und nach Zahlung von vielen Millionen DM wieder freigelassen wurde.Für den damals noch 13-jährigen Scheerer ein einschneidendes Erlebnis. Später wird er die Ereignisse im Roman „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ verarbeiten, die Zeit danach in einem weiteren namens „Unheimlich nah“.Seit den 90ern hat sich Scheerer vornehmlich der Musik verschrieben. Er spielt selbst immer wieder in Bands, beginnt aber schon früh, zu produzieren und aufzunehmen.Seit 2006 tut er das im komplett analogen Tonstudio Clouds Hill Recordings, idyllisch in einem alten Hafengebäude am Elbpark in der Billwerder Bucht gelegen.Zu den vielen Künstler*innen und Bands, die dort ein- und ausgegangen sind, gehören Pete Doherty, Omar Rodriguez-Lopez mit seinen Bands At The Drive-In, The Mars Volta und Bosnian Rainbows und die Krautrock-Avantgarde-Pioniere Faust.Scheerer arbeitet obendrein als Verleger, Label-Macher, hat mehrere Dokumentationen und Musikfilme mitproduziert und ist Vater von vier Kindern.Im April ist sein drittes Buch „Play“ erschienen, das – erneut autobiografisch geprägt – die Geschichte eines Musikmanagers erzählt, der zwischen Tourleben, Kunstarbeit und Familie balanciert. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
#48 Die Geiseln von Berlin-Zehlendorf
27. Juni 1995, 10.15 Uhr. Vor der Commerzbank-Filiale im Berliner Stadtteil Zehlendorf fährt ein weißer Lieferwagen vor. Vier maskierte Männer mit Maschinenpistolen bewaffnet springen heraus, stürmen die Bank und nehmen 16 Kunden und Angestellte als Geiseln. Sie verdunkeln die Fenster, legen die Überwachungskameras lahm und deponieren Handgranaten vor der Tür. Ihre Forderung: 17 Millionen Mark Lösegeld bis 17 Uhr, einen Hubschrauber und ein Fluchtfahrzeug. Die Polizei sperrt das Viertel ab und fordert das Spezialeinsatzkommando an. Was folgt, sind Telefonate, Verhandlungen, endloses Warten und weitere Verhandlungen, während sich draußen auf der Straße Schaulustige und Medienvertreter drängeln. Der Sender Freies Berlin (heute RBB) berichtet damals live. Die Polizei treibt 5,6 Millionen DM auf, die sie in fünf blauen Plastiksäcken vor das Gebäude bringt. Dafür erreicht sie eine Verlängerung des Ultimatums auf 3 Uhr morgens. Doch die Geiselnehmer stellen neue Forderungen. Sie verlangen, dass eine Beetumrandung aus Metall direkt vor dem Eingang der Bank verschwinden soll, damit der Fluchtwagen dort halten kann. Dieses wird gleich darauf von den Einsatzkräften weggeflext. Doch nach Mitternacht melden sich die Geißelnehmer immer seltener. Dann herrscht plötzlich Funkstille. Was passiert in den Räumen der Bank? Sind die Geiseln noch am Leben? Erster Kriminalhauptkommissar Ralf Kahlbau, ehemaliger Leiter der Ermittlungen, berichtet Rudi Cerne und Conny Neumeyer von den dramatischen Szenen, die sich während der Geiselnahme ereignet haben. So drohten die Täter, einem der Geiseln im Schaufenster ins Knie zu schießen, falls das Ultimatum ergebnislos verstreichen sollte. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Die Geiseln waren nur ein großes Ablenkungsmanöver für einen ganz anderen, bis ins kleinste Detail ausgetüftelten Plan. Außerdem im Interview: Polizeidirektor Manfred Textor, ehemaliger Chef der Berliner Spezialeinheiten beim Landeskriminalamt Berlin. Als Kopf des SEK, MEK und der VG (Verhandlungsgruppe) ist er unter anderem durch den Fall Dagobert prominent geworden (Podcast-Folge mit dem Titel: Der Erpresser Dagobert). Er weiß, wie traumatisch es für Opfer werden kann, wenn so eine Spezialeinheit zum Einsatz kommt. *** Wenn ihr Kritik oder Anregungen zu Fällen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an xy@zdf.de. Die aktuelle Sendung und mehr findet ihr in der ZDFmediathek: aktenzeichenxy.zdf.de. *** Moderation: Rudi Cerne, Conny Neumeyer Gäste & Experten: EKHK Ralf Kahlbau, LKA Berlin, Martin Textor, PD a.D., LKA Berlin Autorin dieser Folge: Eva Marel Jura Audioproduktion: Christina Maier Technik: Anja Rieß Produktionsleitung Securitel: Marion Biefeld Produktionsleitung Bumm Film: Melanie Graf, Nina Kuhn Produktionsmanagement ZDF: Julian Best Leitung Digitale Redaktion Securitel: Nicola Haenisch-Korus Redaktion Securitel: Corinna Prinz, Erich Grünbacher Produzent Securitel: René Carl Produzent Bumm Film: Nico Krappweis Redaktion ZDF: Sonja Roy, Kirsten Schönig Regie Bumm Film: Alexa Waschkau
Der Podcast zum Hörspiel: "Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen". Die neuen Folgen. In Staffel 3 kommen Hörspiele und Podcasts immer gleichzeitig - verfügbar auf allen Streaming-Plattformen! Der Kölner Dom ist ein Bauwerk der Rekorde. Und rekordverdächtig war auch der spektakuläre Einbruch in die Domschatzkammer im November 1975. Goldene Kreuze, Ringe, edelsteinbesetzte Monstranzen – insgesamt wurden Kunstgegenstände im Wert von 10 Millionen DM gestohlen. David, Jonas und Emma erzählen euch in allen Einzelheiten, wie der Einbruch durchgeführt wurde und welche verrückten Pannen und spektakulären Erfolge bei den monatelangen Ermittlungen der Polizei passierten. Klar ist jedenfalls: Den Dom beklaut man nicht! Wenn ihr miterleben wollt, wie David, Jonas und Emma leibhaftig beim Domraub dabei waren und was es mit ihrem geheimnisvollen Zauberbuch auf sich hat, dann hört euch das dazugehörige Hörspiel an: Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Folge 15: Der Kölner Domraub – Das Hörspiel! Jetzt auf allen Streaming-Plattformen. Mehr Infos unter erwischt-zeitreise.de Jonas, David und Emma findet ihr auch unter: www.instagram.com/erwischt_die_podcaster Gesamtleitung: KB&B Family Marketing Experts und Leonine Kids Buch & Regie: Wolfgang Adenberg Aufnahme, Schnitt, Sounddesign & Mix: Superhearo Audio Musik: Tom Steinbrecher Schlagzeug: Marc Nathaniel Es sprechen: David: Julian Greis Jonas: Tim Kreuer Emma: Katharina Gast
Die Geschichte des Dritten Reiches müsse umgeschrieben werden, meinte man. Schließlich hatte man nicht weniger entdeckt als die Tagebücher von Adolf Hitler. Doch die waren gefälscht - von Konrad Kujau. Der "Stern" bezahlte damals 62 Bände gefälschter Tagebücher für 9,3 Millionen DM.
110 Mio DM Schaden! Ammerländer mit dem ultimativen Betrug #16
In den 1990er Jahren sorgte der Bad Zwischenahner Volker R. mit dem ultimativen Schneeball-System für Schlagzeilen. Mit seiner Firma Cash & Cash hat er Zehntausende Menschen in ganz Deutschland um richtig viel Geld gebracht. Das Gericht spricht von einem Schaden in Höhe von 110 Millionen DM – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Der neue Fall des True-Crime-Podcasts Tatort Nordwesten ist ein Lehrstück menschlicher Gier, unkontrollierten Methoden und dreisten Betrügereien.
Im März 1996 wird Tabak-Konzern Erbe Jan Philipp Reemtsma entführt. Seine Erpresser fordern für seine Freilassung 30 Millionen DM.
Zwischen-Fall 4 - Konrad Kujau - Die gefälschten Hitler-Tagebücher
Der Podcast zur Hörspielserie "Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen". Überall, wo es Hörspiele gibt! In den Zwischen-Fällen erfahrt ihr spannende Hintergründe zu wahren Verbrechen, die noch gar nicht lange zurückliegen. Diesmal: Konrad Kujau - Die gefälschten Hitler-Tagebücher 1983. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Stern glaubte, es hätte eine Sensation entdeckt: 62 Tagebücher von Adolf Hitler, dem verbrecherischen Diktator, der die Menschheit in den 2. Weltkrieg gestürzt hat. Der Stern zahlte fast 10 Millionen DM für die Tagebücher – und merkte zu spät, dass alles nur eine Fälschung des gerissenen Betrügers Konrad Kujau war. Wie das alles kam und wie Kujau eigentlich selbst in den Jahrhundertbetrug hineingeschlittert ist, erfährst du in dieser Folge. Wenn du miterleben willst, wie David, Jonas und Emma viele spannende Verbrechen am eigenen Leib erleben und dazu durch die Zeit reisen, dann hör dir die dazugehörige Hörspielserie an! Mehr Infos unter www.erwischt-zeitreise.de David, Jonas und Emma findest du auch unter: www.instagram.com/erwischt_die_podcaster Gesamtleitung: KB&B Family Marketing Experts und Leonine Kids Buch & Regie: Wolfgang Adenberg Aufnahme, Schnitt, Sounddesign & Mix: Superhearo Audio Musik: Tom Steinbrecher Schlagzeug: Marc Nathaniel Es sprachen: David: Julian Greis Jonas: Tim Kreuer Emma: Katharina Gast
9,34 Millionen DM für Tagebücher =^_^=
496 Millionen DM, 7 Jahre Vorbereitung und das alles für nur 17 Tage Olympische Sommerspiele. Tage, die in die Geschichte eingingen. Nicht nur als die heiteren Spiele, die Spiele des Friedens – sondern auch gezeichnet durch die Auswirkungen des Attentats am 05. September. Im internationalen Ansehen Deutschlands, aber auch für die Stadt München selbst hatten die Spiele trotzdem einen wesentlichen Push-Effekt. Was in diesen Jahren und den Tagen der Olympiade passierte, wieso München gerade deshalb unser geliebtes München ist und was das alles bitte heute mit 2022 noch zu tun hat.. – das haben sich Maximiliane Hoferer und Dennis Reinhart mit dem Historiker Prof. Dr. Kramer, dem Münchner Kulturreferenten Anton Biebl und unserer Zeitzeugin Friedl genauer angeschaut. ----------- **M94.5 TO GO** ist ein M94.5-Podcast. Konzept: Jonas Bayer & Moritz Batscheider © [M94.5 - ein Angebot der MEDIASCHOOL BAYERN.](https://www.m945.de/) Lust auf mehr junge & frische Formate?
Eine einzige Rote Karte in einem ganzen Fußball-Leben – Uwe Seelers Karriere ist eine besondere. 1936 als Sohn einer Sportlerfamilie geboren begann er mit neun Jahren beim HSV Fußball zu spielen. Mit 17 Jahren bestritt er das erste Länderspiel, später wurde er Kapitän der Nationalmannschaft. Keine der vier Weltmeisterschaften, an denen er teilnahm, ging für ihn torlos aus. Heute ist Uwe Seeler Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Uns' Uwe - ein aufrichtiger, gradliniger Mann aus einfachen Verhältnissen, alles andere als käuflich: einen Wechsel zu Inter Mailand lehnte er ab, trotz des Angebots von 1,2 Millionen DM. Das war 1961. Ein aufsehenerregender Betrag. Bescheidenheit und Fairness - Uwe Seeler ist Phänomen und Idol zugleich, beispielhaft für ideales Fußballerverhalten. Und eben für einen Spieler dieses Formats ungewöhnlich, denn Skandale, Allüren kennt er nicht. Wer ist „Uns' Uwe“? Eine Begegnung und ein Glückwunsch zum 85. Geburtstag. Ein Feature von Jürgen Kopp und Patric Seibel Mit: Peter Lohmeyer, Anne Moll und Philipp von Issendorff Technische Realisation: Evelyn Peper Regie: Wibke Starck Produktion: NDR 2006 ndr.de/radiokunst
Vor 35 Jahren: Opel Ascona erstes deutsches Auto mit für Europa entwickeltem Katalysator
Auto - Rund ums Auto. Fahrberichte, Gespräche und Informationen
Mal ehrlich. Erinnern Sie sich noch dran, als die ersten Autos mit Katalysator auf den Markt kamen? Heute ist das selbstverständlich, damals war es eine kleine Revolution. Bei Opel begann die Ära des Katalysators im Jahr 1985. Heute ist er bei modernen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht mehr wegzudenken!Darum geht es diesmal!Vor 35 Jahren begann bei Opel die Ära des Katalysators. 1985 war der Opel Ascona 1.8i das erste deutsche Auto mit einem speziell für den europäischen Markt entwickelten Katalysator. Zuvor wurden lediglich modifizierte Katalysatoren aus den USA eingebaut. Bereits am 7. Dezember 1984 nahm die Polizei in Rheinland-Pfalz den ersten produzierten Ascona 1.8i mit geregeltem Dreiwegekatalysator in Empfang. Im Laufe des folgenden Jahres führte Opel Katalysatoren für die gesamte Modellpalette ein – von Corsa, Kadett und Ascona bis zu Rekord, Monza und Senator. Fahrzeuge, an die sich viele gerne erinnern. Der deutsche Hersteller war die erste europäische Marke, die Dreiwegekatalysatoren als Serienausstattung anbot. Power und Drive! Katalysatoren sind nicht alle gleich. So war den Opel-Ingenieuren von der ersten Minute an klar, dass die europäischen Verkehrsverhältnisse auch für Europa maßgeschneiderte Technologien erforderten. Sie entwickelten daher einen Katalysator speziell für europäische Fahrbedingungen – genau wie bei Karosserie, Federung, Motoren und Bremsen längst üblich. Für Opel ging es um mehr als nur den Einbau eines Katalysators in die Abgasanlage. Die Reduzierung der Emissionen über einen Katalysator war auch eine komplizierte Operation an den „inneren Organen“ des Autos. Dafür hat der Rüsselsheimer Autohersteller damals mehr als eine Milliarde Deutsche Mark (DM) investiert sowie Hunderte von Ingenieuren für die Entwicklung von Katalysatoren und emissionsarmen Antrieben eingestellt. Das Unternehmen steckte allein 100 Millionen DM in neue Prüfstände und Prüfgeräte für Haltbarkeits- und Hochgeschwindigkeitstests.Im Vergleich zu einem herkömmlichen Auto erforderte die Konstruktion eines Fahrzeugs mit Katalysator zahlreiche Änderungen. Beispielsweise strahlt der Konverter reichlich Wärme ab, wenn er seine Betriebstemperatur von 600 Grad Celsius erreicht. Wärmeempfindliche Komponenten und der Fahrgastraum mussten daher durch Hitzeschilde geschützt werden. Damit der Katalysator effizient arbeiten konnte, waren eine elektronisch geregelte Einspritzung sowie eine Vielzahl von Steuerungen nötig, was weitere Modifikationen erforderlich machte. Sogar der Einfüllstutzen des Kraftstofftanks musste neu konstruiert werden, um zu verhindern, dass Fahrer versehentlich bleihaltiges statt bleifreies Benzin tanken. Diesen Beitrag können Sie nachhören oder downloaden unter:
Bandenchef Petras Dominas dirigiert eine erfolgreiche Bande von Juwelenräubern, erbeutet rund 1,5 Millionen DM und erschießt bei Lünen in einer Fernfahrerraststätte den Pächter „Onkel Albrecht“. Die Waffen bekommt er von seiner Essener Strafverteidigerin. Sie lädt er sogar nach Amsterdam zu einem seiner Überfälle als Zuschauerin ein: „Und Action!“, er bietet der Anwältin und ihrer älteren Tochter eine regelrechte Show. Doch dieser Coup ist gleichzeitig der Schlussakt, denn es sollte der letzte Coup für Dominas und seine Bande sein. Alle zwei Wochen gibt es montags eine neue Podcast-Folge. Alle Folgen auf: www.der-gerichtsreporter.de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCz4-RPLStyVLVzDSplaMKsA?view_as=subscriber Instagram: https://www.instagram.com/der_gerichtsreporter/ Mail: hallo@der-gerichtsreporter.de Moderation: Brinja Bormann und Stefan Wette; Redaktion: Theresa Langwald; Produktion: Brinja Bormann
Ein Mord als Geschäftsidee einer echten GmbH in Recklinghausen. Und ein Opfer, das seinen Killer noch selbst mitbezahlte. Zwischendurch erpresst die „Mörder GmbH“ noch den damaligen Kölner Kardinal Höffner um vier Millionen DM, umgerechnet zwei Millionen Euro. Doch nach schon zwei Jahren Geschäftsaktivität endet die neue Recklinghäuser Firma mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Chef. Er hatte schließlich einen Mord in Auftrag gegeben – und nicht nur das. Der tatsächliche Killer allerdings bleibt auf freiem Fuß. Alle zwei Wochen gibt es montags eine neue Folge. Mehr Infos auf: www.der-gerichtsreporter.de. YouTube: Der Gerichtsreporter richtig so? Instagram: @der_gerichtsreporter Mail: hallo@der-gerichtsreporter.de Moderation: Brinja Bormann und Stefan Wette; Redaktion: Theresa Langwald; Produktion: Brinja Bormann
Am 10. April 1970 zahlt der Pharma-Hersteller Grünenthal 100 Millionen DM in eine Stiftung, die sich bis heute um Entschädigungsleistungen für Contergan-Opfer kümmert.
9,34 Millionen DM für Tagebücher
#04 - Wie man 1 Millionen DM Schulden tilgt - Mit Udo Herrmann
Werde Teil der UC und verdopple mit uns Deinen Umsatz: www.Die-Unternehmer-Community.com __________ Zu Gast im UC-Podcast: Udo Herrmann Udo Herrmann ist Schreinermeister und Inhaber der Firma HERRMANN Parket.Möbel.Räume. Im Jahr 2000 übernahm der damals 30jährige Unternehmer den elterlichen Handwerksbetrieb mit 1 Millionen DM Schulden und dem Ziel, diese innerhalb von 10 Jahren zu tilgen. Wie ihm das gelang und welche Hürden er auf diesem Weg zu überwinden hatte, erfährst Du in dieser Folge. Seine Reminder für mehr Erfolg und Wachstum: Klares Ziel mit klarem Termin Ein starkes "Warum" als Motor Ausreichend Zeitpuffer für Familie und die eigene Weiterentwicklung __________ Erfahre mehr über HERRMANN Parket.Möbel.Räume.: http://www.herrmann-parkett.de Dir gefällt unser Unternehmer-Podcast? Dann freuen wir uns über Deine Rezension auf iTunes.
1984: Interview mit Wolfgang Petersen
"Ich glaube, dass die Autoren immer ein zwiespältiges Verhältnis zum Film haben" - Wolfgang Petersen über seine literarischen Vorlagen und deren Urheber Es gibt nicht viele unter den Regisseuren Hollywoods, die das Privileg des "final cut" – auch "Director’s Cut" genannt - haben, doch er hat das Recht selbst zu bestimmen, in welcher Schnittfassung seine Filme auf der Leinwand zu sehen sind. Wolfgang Petersen ist bereits eine Film-Legende, die für ihre erfolgreichen Streifen mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt wurde. Bester Nachwuchsregisseur Wolfgang Petersen kam am 14.3.41 im ostfriesischen Emden zur Welt. Seine Kindheit verbrachte er in Hamburg, wo er auch das Abitur machte. Schon sehr früh, bereits als Zehnjähriger, fühlte er sich vom Kino magisch angezogen. Der "Zeit" vom 8.4.83 verriet er unter anderem: „Ich war wie besessen darauf, ins Kino zu gehen“. Nach dem Abitur absolvierte Wolfgang Petersen eine Schauspielausbildung und begann schließlich als einer der ersten Studenten eine Ausbildung an der soeben gegründeten Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, die am 17.9.66 vom damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt offiziell eröffnet wurde. Nach der Ausbildung stand der Weg zu einer internationalen Karriere als Regisseur offen. Nach einigen Kurzfilmen inszenierte Wolfgang Petersen als Abschlussarbeit an der Filmakademie den Film "Ich werde dich töten, Wolf" und fand zunächst seine Auftraggeber beim Fernsehen. Die Krimireihe "Tatort" sollte schließlich das Talent des jungen Regisseurs zeigen. Es folgten mehrere Filme der "Tatort"-Serie unter der Regie von Wolfgang Petersen, darunter auch die schon als legendär bezeichnete Folge "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski. Inzwischen sollten auch die ersten Preise an den Regisseur verliehen werden. So wurde er 1973 für seinen Öko-Thriller „Smog“ unter anderem mit dem „Prix Italia“ ausgezeichnet und 1974 für seinen ersten Kinofilm "Einer von uns beiden" mit dem Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsregisseur. Doch große und erfolgreiche Kinofilme von Wolfgang Petersen sollten noch kommen. Sechs Oscarnominierungen Das Jahr 1980 markierte für Wolfgang Petersen einen Meilenstein in seiner Karriere. Für rund 25 Millionen DM drehte der Regisseur den Streifen "Das Boot". Trotz anfänglicher Zurückhaltung der Kritik wurde der Film zu einem Riesenerfolg – bis 1983 spielte dieses U-Boot-Opus150 Millionen DM ein und wurde auch für den Oscar in sechs Kategorien nominiert. Diesem internationalen Erfolg folgte ein weiterer Kassenschlager von Wolfgang Petersen: 1984 kam die Verfilmung der "Unendlichen Geschichte" in die Kinos, die auf dem Bestseller von Michael Ende basierte. Mit Produktionskosten von rund 60 Millionen DM wurde damals der Film zum teuersten Streifen in der deutschen Filmgeschichte. Doch auch dieser Film erwies sich als Publikumsmagnet und spielte über 100 Millionen US Dollar ein. Als Konsequenz aus diesen Erfolgen kam schließlich der Ruf nach Hollywood. Auch hier sollte bald unter der Regie von Wolfgang Petersen großes Kino entstehen. Karriere in Hollywood 1985 wurde nun der erste Hollywood-Film von Wolfgang Petersen gedreht: das Science-Fiction-Drama "Enemy Mine". Es folgten weitere Arbeiten des Star-Regisseurs, die sich als große Kassenerfolge herausstellten. So etwa der Thriller "In the Line of Fire“ mit Clint Eastwood, der nicht nur in den USA, sondern auch in Europa für ein Millionenpublikum sorgte. Auch der Streifen "Outbreak" mit Dustin Hoffman als Colonel Sam Daniels wurde zu einem großen Erfolg. Mit Harrison Ford drehte Wolfgang Petersen den Welterfolg "Air Force One", der auch zwei Oscarnominierungen erhielt. Die Liste seiner Erfolge setzte der Regisseur mit weiteren großen Filmen fort, wie etwa „The Perfect Storm“ mit George Clooney oder "Troja" mit Brad Pitt, dessen Produktion rund 200 Millionen Dollar verschlang. Der weltberühmte Regisseur wurde auch mehrfach mit Bambis und anderen Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2012 wurde er vom Bundesverband Regie mit dem Deutschen Regiepreis "Metropolis" für sein Lebenswerk geehrt. Im April 1984 sprach DW-Redakteurin Cornelia Rabitz mit Wolfgang Petersen über seine Arbeit. Autor: Andreas Zemke Redaktion: Diana Redlich
Papst Johannes Paul II. besucht die Bundesrepublik Deutschland in den Tagen 15.-19.11.1980
"Ein Tausend gelb-weiße Fahnen müssen noch genäht werden" - die Vorbereitungen auf den Papstbesuch in Deutschland laufen auf vollen TourenNach knapp 200 Jahren ein Papst auf deutschem Boden „Ich bin in die Bundesrepublik Deutschland gerade in dem Jahr gekommen, in welchem unsere evangelischen Brüder und Schwestern das Gedächtnis an die vor 450 Jahren verkündete Confessio Augustana gefeiert haben. Möge hier, wo die Reformation ihren Anfang nahm, auch das Bemühen sich verdoppeln, in Treue zum einzigen Herren der Kirche und seiner Botschaft zu wirken“ – diese Worte sprach Papst Johannes Paul II. bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Köln / Bonn am 15. November 1980 aus. Es war der Auftakt einer Pastoralreise, der es an Brisanz durchaus nicht fehlte. Eine schwierige Mission? Denn mit Karol Wojtyla stand seit knapp 200 Jahren wieder ein Papst auf deutschem Boden. Und wie sich bei einer Umfrage des „Spiegels“ vom 10. November 1980 herausstellte, befürworteten lediglich 33 Prozent der befragten Bundesbürger den Papstbesuch. Für 57 Prozent der Befragten war die Visite von Johannes Paul II gleichgültig. Diese Gleichgültigkeit spiegelte sich auch in der Rangliste der Themen, die den Bundesbürgern wichtig erschienen: an erster Stelle beschäftigte man sich mit der Frage, ob das Öl nicht knapp wird oder mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 1980. Der Besuch aus dem Vatikan rangierte in der Aufmerksamkeit der Bundesbürger zu diesem Zeitpunkt lediglich an fünfter Stelle. Und es waren viele kontroverse Fragen, mit denen sich der Papst in Deutschland konfrontiert sah: etwa die Fragen der Abtreibung, der Pille, der Scheidung oder auch der Aufhebung des Zölibats. Alles Themen, zu denen sich die katholische Kirche von ihrer konservativen Haltung nicht abbringen lassen mochte. Eine große Austrittswelle aus der katholischen Kirche sollte zwar noch kommen (1992), aber bereits 1979 verzeichnete man schon eine Besorgnis erregende Tendenz: über 52 Tausend bundesdeutscher Katholiken kehrten in diesem Jahr der Kirche den Rücken – das Jahr des Papstbesuches sollte noch schlimmer ausfallen. Ein begeisterter Empfang, aber auch Worte der Kritik Und dennoch: da wo sich Johannes Paul II zeigte, wurde der Papst aus Polen von hunderttausenden Gläubigen umjubelt. „Papst trifft überall auf Begeisterung“ – schrieb etwa der „Kölner Stadt Anzeiger“ am 17. November 1980, ähnlich berichteten auch andere Blätter. Köln, Brühl, Osnabrück, Mainz - wo auch ein Treffen mit den Vertretern der Evangelischen Kirche stattfand - Fulda, Altötting und München waren die Stationen der ersten Deutschlandreise von Papst Johannes Paul II. Doch ausgerechnet in München, einer der Hochburgen des deutschen Katholizismus, musste der Papst auch einige Worte der Kritik hinnehmen. Barbara Engl, eine damals 29jährige Sprecherin der Deutschen Katholischen Jugend, verlas eine Erklärung, in der sie das Festklammern der Kirche an bestehenden Verhältnissen angeprangert hatte. Eine Antwort seitens des Papstes blieb aus. Der Besuch endete am 19. November 1980, blieb jedoch nicht der letzte. Die Kosten des Papstbesuches sollten sich auf mehr als 20 Millionen DM belaufen haben (Süddeutsche Zeitung, 25. November 1980). Zwei Wochen vor der Ankunft von Papst Johannes Paul II in Deutschland berichtete DW-Redaktuer Winfried Kurrath über Hintergründiges und die Vorbereitungen zu dieser Papstreise. Andreas Zemke Redaktion: Diana Redlich
Interview mit Bundesverkehrsminister Georg Leber zu Ostberliner Maßnahmen im Berlin-Verkehr
„Es bleibt bei dem Verkehr, wie er bisher auch gewesen ist“ – so die Einschätzung von Bundesverkehrsminister Georg Leber nach der Einführung der Pass- und Visapflicht durch die DDR-Regierung"Der Spiegel" machte am 17. Juni 1968 daraus seinen Aufmacher. "Pass-Zwang der DDR" und "Deutschland zum Ausland gestempelt" - so lauteten die Schlagzeilen der Titelseite. Den Anlass für diese Aufregung lieferte die DDR-Regierung: am 11. Juni 1968 beschloss die Volkskammer die Einführung der Pass- und Visapflicht für die Bundesdeutschen und die Westberliner für den Transitverkehr zwischen West-Berlin und der BRD, sowie für Besuche in der DDR. Die Devisen sollen „sprudeln“ Und das Ende der Fahnenstange war noch nicht erreicht. Denn das Visum war gebührenpflichtig - eine Fahrt durch die DDR nach West-Berlin kostete 5 Mark, Hin- und Rückfahrt folglich 10 Mark. Für ein Einreisevisum in den Bauern- und Arbeiterstaat waren 15 Mark zu entrichten. Der Mindestumtausch wurde ebenfalls angehoben. Und das SED-Regime hat noch eine weitere Einnahmequelle westlicher Devisen entdeckt: eine "Steuerausgleichsabgabe für Beförderungsleistungen westdeutscher und West-Berliner Unternehmen auf Straßen und Wasserstraßen der DDR" - kurzum eine nach Tonnage und Kilometer gestaffelte Maut für Waren und Produkte, mit denen West-Berlin versorgt wurde. Ein strenges Zollverfahren rundete dieses Paket der "Neuerungen" im deutsch-deutschen Verhältnis ab. Ein kostspieliges Verfahren für die Bundesregierung Eine Welle der Proteste seitens der bundesdeutschen Politik und der Gewerkschaften entflammte in der BRD - doch sie blieb von der DDR-Regierung unbeachtet. West-Berlin erwies sich noch mal als verletzliche Insel der deutschen Demokratie. Und diese Enklave der Freiheit hatte auch ihren Preis: nicht nur, dass sie die Bundesregierung acht Millionen DM täglich an Subventionen kostete, es kamen jetzt auch noch die Ausgaben für die Erstattung der Visakosten hinzu. Nur in der Zeit vom 1. Juli 1968 bis 30. Juni 1969 verzeichnete man rund sieben Millionen Berlin-Reisende und über eine Million DDR-Besucher. Einnahmen der DDR: knapp 51 Millionen DM an Visagebühren, von denen 36,5 Millionen Mark durch die Bundesregierung zurück erstattet wurden. Doch zunächst übertraf sich die deutschsprachige Presse mit Kommentaren über die jüngsten DDR-Maßnahmen. So schrieb etwa der "Kölner Stadt Anzeiger" am 12. Juni 1968 unter anderem: "Nur eine Feststellung sei erlaubt: Was Deutsche gegeneinander aushecken, das übertrifft an Dummheit und Bosheit alles, was fremde Völker einander antun." DW-Redakteur Hans Wendt sprach am 5. Juli 1968 mit dem damaligen Bundesverkehrsminister Georg Leber und befragte ihn zu den Ostberliner Maßnahmen im Berlin-Verkehr. Andreas Zemke Redaktion: Diana Redlich
Erinnerung als Aufgabe - 30 Jahre Beziehungen zwischen Deutschland und Israel
Viele kleine Schritte - Feature über die deutsch-israelischen BeziehungenKurt Birrenbach - der deutsche Unterhändler in Israel - befand sich gerade wieder auf dem Weg nach Jerusalem, als der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard am 7. März 1965 einen Entschluss fasste: mit voller Intensität sollte nun die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der BRD angestrebt werden. Diese Entscheidung tat Not, denn die Position der BRD war sowohl in der arabischen wie auch in der westlichen Welt geschwächt. Einerseits wurden von der "Frankfurter Rundschau" am 26. Oktober 1964 die bis dahin geheimen Waffenlieferungen an Israel aufgedeckt, auf der anderen Seite halfen deutsche Wissenschaftler in Ägypten die Rüstungsindustrie aufzubauen. Keine Waffen mehr für Israel Nach der Enthüllung der Waffenlieferungen drohten die arabischen Länder nun mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur BRD und stattdessen der Aufnahme solcher Beziehungen mit der DDR. Die Bundesregierung sah sich jetzt gezwungen, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, was sie am 12. Februar 1965 auch beschloss. Als Äquivalent für die ausbleibenden Waffenlieferungen sollten ca. 100 Millionen DM an Wirtschaftshilfe an Israel fließen. Diese Entscheidung gab wiederum der israelischen Regierung Anlass zu den heftigsten Protesten und zur Verärgerung. Eine "diplomatische Sackgasse" schien hier betreten, aus der man schnellstens hinaus wollte. Schnelle Einigung Von der überraschenden Entscheidung Ludwig Erhards, die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der BRD aufzunehmen, soll Kurt Birrenbach von seinen israelischen Gesprächspartnern erfahren haben. Da sowohl Israel als auch BRD an einer baldigen Einigung lag, wurde innerhalb kürzester Zeit über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zur BRD in der Knesset abgestimmt. Am 12. Mai 1965 war es nun so weit: beide Staaten - Israel und die BRD - vereinbarten die völkerrechtlich korrekte Aufnahme zwischenstaatlicher Beziehungen. Tags darauf wurde die Weltöffentlichkeit darüber informiert, doch die Reaktion auf diesen Schritt ließ nicht lange auf sich warten: neun arabische Länder brachen die Beziehungen zur BRD ab. Am 19. August traten die Botschafter beider Länder ihren Dienst an: Rolf Pauls in Israel und Asher Ben-Nathan in der BRD. In einem Feature erinnerte DW-Redakteur Peter Philipp im Mai 1995 an die Ereignisse dieser Zeit und skizzierte die deutsch-israelischen Beziehungen in den vergangenen 30 Jahren. Andreas Zemke Redaktion: Diana Redlich
"Zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichtet" - Rückblick auf 50 Jahre deutsch-israelisches Wiedergutmachungsabkommen
"Für Hunderttausende die Möglichkeit ein neues Leben anzufangen" - der Präsident der jüdischen Claims Conference Nahum Goldmann kommentiert das WiedergutmachungsabkommenDas Wiedergutmachungsabkommen, das am 10.9.52 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel geschlossen wurde, verfolgte die so genannte Wiedergutmachung der Holocaust-Verbrechen. Unterzeichnet wurde es durch Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem israelischen Außenminister Moshe Sharett im Luxemburger Rathaus und trat am 27.3.53 in Kraft. Die Unterzeichnungszeremonie beschreibt „Der Spiegel“ vom 17.9.52 als eine „düster-schweigsame Szene“. Denn einerseits, so berichtet „Der Spiegel“ weiter, standen sowohl die Verhandlungen wie auch deren Abschluss unter permanenter Furcht vor einem Attentat entweder jüdischer oder arabischer Extremisten. Andererseits bedeutete die Verständigung keineswegs die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der BRD. Finanzspritze dringend benötigt Dennoch brauchte der junge israelische Staat dringend finanzielle Mittel, um eine Wende in der prekären wirtschaftlichen Lage des Landes herbeizuführen. Und auch seitens der BRD bestand die Bereitschaft zur materiellen Wiedergutmachung jener Verbrechen, die von den Nazis im Namen des deutschen Volkes an den Juden begangen wurden - dies verkündete Bundeskanzler Konrad Adenauer vor dem Deutschen Bundestag bereits im September 1951. Und noch ein Aspekt war dem Bundeskanzler wichtig: während die Eingliederungskosten für überlebende jüdische Flüchtlinge als Maßstab der materiellen Wiedergutmachung an Israel galten - drei Milliarden DM bis 1965, Warenlieferungen und Dienstleistungen, verteilt auf 12 bis 14 Jahre – sollte das Abkommen nach Hoffnung Konrad Adenauers auch „einen Schritt zur seelischen Bereinigung unendlichen Leidens“ bedeuten. 450 Millionen DM gingen zudem an die jüdische Organisation „Conference on Jewish Material Claims against Germany“, die die Interessen einzelner verfolgter Juden vertrat und dessen Präsident Nahum Goldmann das Abkommen als Schaffung einer höheren moralischen Ebene lobte. Die ersten Schritte in Richtung deutsch-jüdischer Verständigung waren getan. Doch es fehlte auch nicht an kritischen Reaktionen auf beiden Seiten, wie dieses O-Ton-Feature der Deutsche Welle zum 50. Jahrestag des Wiedergutmachungsabkommens von Luxemburg zeigt. Michelle Kottemann / Andreas Zemke Redaktion: Diana Redlich