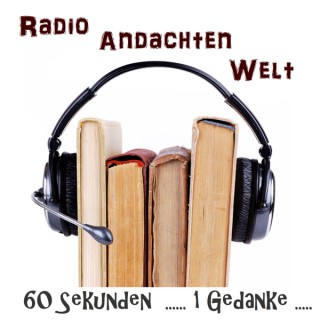Podcasts about schafherden
- 23PODCASTS
- 27EPISODES
- 27mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Dec 25, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about schafherden
Latest podcast episodes about schafherden
Über kein Tier wird in der Schweiz emotionaler diskutiert: Der Wolf ist Jäger und Gejagter, ein politischer Dauerbrenner. Der Hauptgrund dafür: Sein Speiseplan, der auch aus Schafen besteht. (Wiederholung) Wolfsrisse und Nutztiere, deren Leben im Magen eines Wolfs endet, beschäftigen die Schweizer Politik bis hin zum Bundesrat. Es geht um Geld, die Schweizer Landwirtschaft und die Natur, die ihre eigenen Gesetze hat. Dass sich manche Schafe vielleicht sogar beim Wolf bedanken würden, sagt Naturfotograf Peter Dettling, der seit Jahrzehnten Wölfe beobachtet. Denn dank der Präsenz des Raubtiers würde heute vielen Schafherden wieder besser geschaut. ____________________ Um keine Folge zu verpassen, abonniere den Podcast «News Plus Hintergründe». Fragen und Feedback gerne via newsplus@srf.ch. ____________________ Links zu weiteren Folgen: - Folge 1: https://www.srf.ch/audio/news-plus-hintergruende/guter-boeser-wolf-1-4-auge-in-auge?id=AUDI20250907_NR_0006 - Folge 3: https://www.srf.ch/audio/news-plus-hintergruende/guter-boeser-wolf-3-4-politdrama-zwischen-schutz-und-schuss?id=AUDI20250921_NR_0003 - Folge 4: https://www.srf.ch/audio/news-plus-hintergruende/guter-boeser-wolf-4-4-das-rotkaeppchen-trauma?id=AUDI20250928_NR_0004 ____________________ In dieser Episode zu hören: - Peter Dettling, Naturfotograf, Filmemacher und Buchautor aus Sedrun GR - Michael Baggenstos, Schäfer und ehemaliger Präsident der Schweizer Berufsschäferinnen und -schäfer - Heinrich Haller, Zoologe, Buchautor, ehemaliger Direktor des Schweizerischen Nationalparks ____________________ Team: - Host: Isabelle Maissen - Recherche und Produktion: Matthias Baumer (SRF Inlandredaktion), Isabelle Maissen, Céline Raval - Sounddesign und Titelmusik: Michael Studer ____________________ Das ist «News Plus Hintergründe»: Aufwändig recherchierte Geschichten, die in der Schweiz zu reden geben.
Korsika ist eine der gebirgigsten Inseln im Mittelmeer: Zwei Drittel der Fläche liegen über 500 Meter, der höchste Gipfel, der Monte Cinto, kommt mit seinen 2.706 Metern fast an Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, heran. Gleich mehrere Wanderwege durchziehen das hügelige Hinterland der „Île de Beauté“, der „Insel der Schönheit“, wie Korsika auf französisch gerne genannt wird. Die Routen führen über steile Berghänge, duftende Wiesen und durch verwunschene Wälder. Wer hier wandern will, sollte Höhen- und Hitzeerprobt sein, aber immerhin für Letzteres gibt es Abhilfe: Der nächste, eiskalte Wasserfall oder See ist garantiert nicht weit. In der Abgeschiedenheit der Berge haben sich Eigenheiten in Sprache, Musik und Lebensweise bewahrt. In den Bergen, so sagen die Einheimischen, ist die wahre korsische Seele zu finden. Lange Zeit spielte sich hier, und nicht an der heute beliebten Küste, das Leben ab: Denn am Wasser wütete die Malaria, es gab Attacken feindlicher Invasoren und kein Weideland für die Schafe und Ziege, die auf Korsika bis heute allgegenwärtig sind. Im Sommer zogen die Hirten mit ihren Tieren in die hohen Berge, um Hitze und Mücken zu entfliehen. Mancherorts wird die Wanderviehwirtschaft, die Transhumanz, noch heute praktiziert. Verena Carola Mayer ist den alten Hirtenwegen gefolgt: Sie war zu Fuß unterwegs auf dem „Sentier de la Transhumance“, der auf fünf Tagesetappen und knapp 80 Kilometern vom Landesinneren an die nordwestliche Küste führt. Anderer Wanderer traf sie unterwegs kaum – dafür Hüttenwirte, Sänger, Hirtinnen und Schafherden.
Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde. Mit einer Fläche von 2.724.900 Quadratkilometern ist es auch der größte Binnenstaat der Welt. Und dennoch wissen wir so wenig über das Land. Dabei kann das Land mit mehr als nur weiter Steppe und Bergen auftrumpfen. Allein ein Besuch der wohl verrücktesten Hauptstadt der Welt – Astana – lohnt sich. Vor drei Jahrzehnten verlagerte die autoritäre Regierung ihre Hauptstadt mitten ins Land. Dank hohen Erlösen aus Erdöl- und anderen Bodenschatzverkäufen investierte die Regierung Milliarden in moderne und futuristische Bauten, die symbolträchtig und monumental wirken. Prominente Architekten aus aller Welt haben die Verwaltungsneustadt entworfen. Das bekannteste Bauwerk ist der 100 Meter hohe Bajterek-Turm. Flair aber, sucht man hier vergeblich. Den hat dagegen die alte Hauptstadt Almaty behalten. Sie ist die Geburtsstadt des Apfels. Ihren Namen verdankt sie der Frucht: Alma-Ata heißt übersetzt „Vater der Äpfel.“ Der Urapfel läuft aber Gefahr auszusterben. Denn immer mehr Apfelwiesen müssen Bauprojekten weichen, denn die größte Stadt des Landes boomt weiter: Die Höhe der Hochhäuser ist wichtiger als die Menge der Äpfel. Und dennoch: Almaty wirkt gemütlich. Hier endet der Tag nicht, er klingt aus, während die Sonne langsam hinter der Silhouette der schneebedeckten Berge versinkt. Vor Cafés und Restaurants sitzen vor allem junge Menschen, trinken einen Kaffee oder einen Cocktail. Das Leben hier ist teurer als auf dem Land. Der Naturliebhaber findet hingegen anderswo im Land seine Höhepunkte: den Altin-Emel-Nationalpark mit viel Gestein und Sanddünen, den Scharyn-Canyon, er ist der kleine, kasachische Bruder des Grand Canyons. Im Sommer lassen grüne Berge rund um Saty die Besucher in eine andere Welt eintauchen. Freilaufende Pferde- und Schafherden vor traumhafter Bergkulisse strahlen eine nicht vermutete Magie aus. Auch das ist Kasachstan. Reportagen von Dennis Burk
Die Nachrichten des Tages aus Thüringen vom 06.08.2025
+++ Schafherden im Wartburgkreis angegriffen +++ Skiarena Silbersattel in Steinach bekommt neue Liftanlage +++ Bauern im Altenburger Land trotz Regens mit der bisherigen Ernte zufrieden +++
Predigt von Marc HaunschildIm Gegensatz zu Kapitel 10 spricht Kapitel 11 nicht mehr von Segen, sondern vom Gericht über Israel.Drastischer Themenwechsel – wie ein Weckruf: Gottes Geduld hat ein Ende.Zedern, Zypressen, Eichen als Sinnbilder für politische, religiöse und gesellschaftliche Eliten – alle Ebenen sind vom Gericht betroffen.Feuer steht für Gottes Zorn, das alle scheinbaren Sicherheiten vernichtet.Hirten (Leiter) jammern, weil ihre „Herrlichkeit“ verwüstet ist – Führungspersonal versagt.Dickicht des Jordan – Ort der Zuflucht – wird zerstört: Kein Schutz mehr vorhanden.Brüllende Junglöwen – feindliche Mächte dringen ins Land ein.Erfüllung dieser Prophetie im jüdisch-römischen Krieg (66–70 n. Chr.)Zerstörung Jerusalems und des Tempels, Zerstreuung des Volkes.Bezug auf Berichte von Flavius Josephus: Bürgerkrieg, Hungersnot, Massensterben.*Sach 11,6*: Gott überlässt das Volk sich selbst – Gewalt von innen und außen.Gott beauftragt Sacharja, symbolisch die Rolle eines Hirten einzunehmen.„Weide die Schlachtschafe“ – Israel ist geistlich am Ende, aber Gott bemüht sich dennoch.*Vers 7–8*: Der gute Hirte wird abgelehnt, die Schafe haben „Widerwillen“.*Vers 9*: Gericht folgt – Gott zieht seine Hirtenschaft zurück.Zerbrechen der Stäbe als Zeichen für das Ende des Bundes und der Einheit.Er liebt, kennt und ruft seine Schafe.Er wird abgelehnt – von den gleichen Menschen, für die er sich hingibt.Symbolischer Bezug: Jesus legt sein Leben nieder (Joh 10,11).Geistliche Leiter tragen große Verantwortung (Jakobus 3,1; Lukas 12,48).Gottes Geduld ist groß – aber nicht grenzenlos (Hebr 3,7).Auch heute sind Sicherheiten zerbrechlich – ohne Gottes Schutz bleibt nichts bestehen.Gebet nicht nur um Erleichterung, sondern um geistliche Stärke.Zitate über Gebet:„Gott wird dich vor nichts bewahren, was dich Jesus ähnlicher macht.“„Bete nicht um ein leichtes Leben. Bete darum, ein stärkerer Mensch zu werden.“Symbolische Gerichtsbilder (Sacharja 11,1–3):Historische Erfüllung:Gott als Hirte – und die Ablehnung seiner Fürsorge (Sach 11,4–14):* Jesus ist der gute Hirte (Johannes 10):Geistliche Anwendung für heute:
Irlands süße Seite –
„Dia dhuit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von *Erlebnis Irland* – dem Podcast, der euch die grüne Insel näherbringt, und zwar nicht nur mit Regen und Schafherden, sondern auch mit jeder Menge süßer Überraschungen! Ja, ihr habt richtig gehört: Heute wird es schokoladig! Wir nehmen euch mit in das malerische Kenmare, ein Ort, der nicht nur für seine atemberaubende Landschaft bekannt ist, sondern auch für einen ganz besonderen Schokoladenkünstler: den Chocolatier Lorge. Hier wird Schokolade nicht einfach nur hergestellt, hier wird sie zelebriert – und das schmeckt man in jedem einzelnen Stück. Ob klassisch, kreativ oder mit irischem Twist: Bei Lorge wird Schokolade zur Kunst. Ich hatte die große Freude, ein Interview mit dem Mann hinter der Schokolade zu führen – und weil Irland ja bekanntlich zweisprachig ist, wird es heute auch ein bisschen deutsch-englisch. Also, schnappt euch ein Stück Schokolade, lehnt euch zurück und genießt das Gespräch mit dem Chocolatier Lorge aus Kenmare. Los geht's!“
Dingle - die rauhe Schönheit Irlands
Es ist ein Stück Irland wie aus dem Bilderbuch: Ganz im Südwesten der grünen Insel reckt sich die Dingle-Halbinsel wie ein ausgestreckter Finger in den wilden Atlantik. Wer hier unterwegs ist, fühlt sich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen: Aufgereiht an der gewundenen Küstenstraße des Slea Head Drive liegen pittoreske alte Dörfer mit bunten Häusern, auf den Hängen der zerklüfteten Berglandschaft dahinter weiden Schafherden zwischen Feldsteinmauern und den Ruinen uralter keltischer Steinhütten. Die Menschen hier pflegen eine irische Kultur, die es so andernorts auf der Insel nur noch ansatzweise gibt. Gälisch ist als Sprache weit verbreitet. Die Sportart der Wahl auf den Dörfern ist der „Caid“, die irische Variante des Football. Und in den Pubs der Umgebung gibt es regelmäßig traditionelle irische Livemusik mit Geige und Gitarre. Schon seit Jahrzehnten ist der Landstrich mit seiner besonderen Atmosphäre Anziehungspunkt für Künstler und Lebenskünstler aus ganz Europa, die hier Freiheit, Nähe zur Natur und ein entschleunigtes Leben suchen. Viele von ihnen beschreiben die Halbinsel als einen einzigartigen, magischen Ort, wie es ihn nirgendwo anders auf der Welt gibt. Und tatsächlich - wer sich auf Dingle einlässt spürt schnell, dass die schmale grüne Landzunge im blauen Atlantik mit all ihren Facetten etwas Besonderes ist - ein Ort an dem sich alt und neu vermischen und alteingesessene Schafhirten mit neu zugewanderten Künstlern gemeinsam im Pub sitzen und gemeinsam ihr Pint trinken.
Border Collies - die intelligentesten Hütehunde der Welt im Dienst der englischen Schäfer
Wie schafft es ein Hütehund, über 1.000 Schafe zu kontrollieren und vor Bedrohungen wie Füchsen und Dachsen zu schützen? In dieser tierisch spannenden Episode tauchen Alexander-Klaus Stecher und Claus Beling tief in die Welt der englischen Hütehunde ein: Vor allem die Border Collies gelten als die intelligentesten und fleißigsten ihrer Art. Mit einer intensiven Ausbildung, die bis zu zwei Jahre dauern kann, lernen diese treuen Gefährten durch Training und Erfahrung, wie sie das Leben der Schäfer in den weiten englischen Landschaften erleichtern können. Unsere Abenteurer werfen einen Blick auf die Herausforderungen und die Kunst der Hundeausbildung, die über Generationen hinweg verfeinert wurde. Sie besuchen den berühmten Cotswolds Farmpark, wo die Sheepdog-Show eine beliebte Attraktion ist und sprechen über die faszinierende Geschichte dieser treuen Helfer, deren Wurzeln tief in der englischen Kultur verankert sind. BRITPOD, England at its best! -- WhatsApp: Du kannst Alexander und Claus direkt auf ihre Handys Nachrichten schicken! Welche Ecke Englands sollten die beiden mal besuchen? Zu welchen Themen wünschst Du Dir mehr Folgen? Warst Du schon mal in Great Britain und magst ein paar Fotos mit Claus und Alexander teilen? Probiere es gleich aus: +49 8152 989770 - einfach diese Nummer einspeichern und schon kannst Du BRITPOD per WhatsApp erreichen. -- Ein ALL EARS ON YOU Original Podcast.
Je länger der Gaza-Krieg andauert, umso grösser die Gefahr, dass er sich zum Nahost-Krieg ausweitet. Ob es so weit kommt, wird sich im libanesisch-israelischen Grenzgebiet zeigen. Seit drei Monaten liefern sich die israelische Armee und die schiitische Miliz Hisbollah dort Gefechte. Die Reportage. Die Fahrt vom Checkpoint quer durch die Pufferzone bis zur libanesisch-israelischen Demarkationslinie führt über Serpentinen hinauf auf karge, steinige Hochebenen, vorbei an leeren Dörfern und Höfen. Wie ausgestorben liegen sie da. Es ist spärlich bewachsenes Hügelland, über das Hirten mit ihren Schafherden ziehen. Wäre es nicht der Südlibanon, es wäre eine Idylle. «Eigentlich könnten wir hier ganz gut leben», sagt der Schafhirt Ibrahim. Doch die Gegend ist zu gefährlich geworden. Erst kürzlich wurden zwei Hirten auf dem Feld von einer Granate getötet. Ibrahim wird wegziehen zu Verwandten in die etwas entfernte Bekaa-Ebene. Rund fünfzigtausend Menschen haben das umkämpfte Grenzgebiet mittlerweile verlassen und im sichereren Hinterland Zuflucht gefunden. «Wir haben mit diesem Krieg nichts zu tun», sagt Ibrahim. «Wir wollen einfach nur leben». Doch die Miliz Hisbollah («Partei Gottes») hat in der Gegend ihre Stellungen. Und sie will mit einem Kleinkrieg über die Grenze gegen Israel Solidarität mit der Hamas demonstrieren. Die Hisbollah wurde in den Achtzigerjahren im libanesischen Bürgerkrieg von den iranischen Revolution-Garden gegründet, stark wurde sie im Guerillakampf gegen die einstige israelische Besatzung des Südlibanons. Seither präsentiert sie sich als die Beschützerin der schiitischen Minderheit im Libanon, zugleich als Vorkämpferin für die palästinensische Sache. Sie verfügt wohl über mehr als einhunderttausend Raketen, darunter weitreichende und präzise, gegen die – in Schwärmen verschossen - auch Israels «Iron Dome»-Schutzschild wenig ausrichten könnte. Kampferfahren und diszipliniert, wäre die Hisbollah im Ernstfall für Israel ein hochgefährlicher Gegner. Die Mehrheit der Libanesinnen und Libanesen lebt schon seit Jahren in einem Zustand permanenter Unsicherheit und Bedrohung, nun kommt noch die Kriegsangst dazu. «Wir sind wie ausgeliefert», sagt auch Leila in ihrem Lebensmittelgeschäft im Westen der Hauptstadt Beirut. «Hier kann dir alles passieren».
Je länger der Gaza-Krieg andauert, umso grösser die Gefahr, dass er sich zum Nahost-Krieg ausweitet. Ob es so weit kommt, wird sich im libanesisch-israelischen Grenzgebiet zeigen. Seit drei Monaten liefern sich die israelische Armee und die schiitische Miliz Hisbollah dort Gefechte. Die Reportage. Die Fahrt vom Checkpoint quer durch die Pufferzone bis zur libanesisch-israelischen Demarkationslinie führt über Serpentinen hinauf auf karge, steinige Hochebenen, vorbei an leeren Dörfern und Höfen. Wie ausgestorben liegen sie da. Es ist spärlich bewachsenes Hügelland, über das Hirten mit ihren Schafherden ziehen. Wäre es nicht der Südlibanon, es wäre eine Idylle. «Eigentlich könnten wir hier ganz gut leben», sagt der Schafhirt Ibrahim. Doch die Gegend ist zu gefährlich geworden. Erst kürzlich wurden zwei Hirten auf dem Feld von einer Granate getötet. Ibrahim wird wegziehen zu Verwandten in die etwas entfernte Bekaa-Ebene. Rund fünfzigtausend Menschen haben das umkämpfte Grenzgebiet mittlerweile verlassen und im sichereren Hinterland Zuflucht gefunden. «Wir haben mit diesem Krieg nichts zu tun», sagt Ibrahim. «Wir wollen einfach nur leben». Doch die Miliz Hisbollah («Partei Gottes») hat in der Gegend ihre Stellungen. Und sie will mit einem Kleinkrieg über die Grenze gegen Israel Solidarität mit der Hamas demonstrieren. Die Hisbollah wurde in den Achtzigerjahren im libanesischen Bürgerkrieg von den iranischen Revolution-Garden gegründet, stark wurde sie im Guerillakampf gegen die einstige israelische Besatzung des Südlibanons. Seither präsentiert sie sich als die Beschützerin der schiitischen Minderheit im Libanon, zugleich als Vorkämpferin für die palästinensische Sache. Sie verfügt wohl über mehr als einhunderttausend Raketen, darunter weitreichende und präzise, gegen die – in Schwärmen verschossen - auch Israels «Iron Dome»-Schutzschild wenig ausrichten könnte. Kampferfahren und diszipliniert, wäre die Hisbollah im Ernstfall für Israel ein hochgefährlicher Gegner. Die Mehrheit der Libanesinnen und Libanesen lebt schon seit Jahren in einem Zustand permanenter Unsicherheit und Bedrohung, nun kommt noch die Kriegsangst dazu. «Wir sind wie ausgeliefert», sagt auch Leila in ihrem Lebensmittelgeschäft im Westen der Hauptstadt Beirut. «Hier kann dir alles passieren».
Diesmal erzählen wir euch von unseren Top 3 Highlights während unserer Neuseelandreise - von Schafherden über Glühwürmchenhöhlen bis hin zum Helikopterflug. Es war Abenteuer pur. Hört gerne rein und lasst euch für eure Reise inspirieren. Viel Spaß beim Zuhören! Bei Feedback, Fragen oder Sonstiges, schreibt uns gerne über Instagram: instagram.com/backpacking_for_beginner Du möchtest beim nächsten Connecting Call dabei sein? Dann schreib uns einfach eine Nachricht über Instagram mit "#ConnectingCall". Sobald sich ein paar Leute gefunden haben, legen wir einen neuen Termin fest und benachrichtigen dich :) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/backpackingforbeginner/message
Grüne Klippen über dem Atlantik, heimelige Gästehäuser und Pubs, monumentale Strände und Küstenstraßen und grün grün grün. Endlich Irland! Endlich sind wir auf einer der schönsten Inseln der Welt, die so vielen Reisenden so viel bedeutet. Und wir versuchen in dieser Folge zu erklären warum. Wir reiten auf Bilderbuch-Stränden, werden inspiriert von verwunschenen Dörfern in spektakulärer Natur. Wir halten bei unserem Roadtrip für Schafherden, wir diskutieren in Pubs, besuchen Schweine auf einer Insel und sind schlichtweg erschlagen von der Schönheit dieses Landes, der Freundlichkeit der Menschen und vielleiiiiicht haben wir auch einige Geheimtipps für Euch Irland-Expertinnen und -Experten da draußen gefunden. Wandern, Fahrradfahren, Essen, Trinken, Singen, Staunen und: Durchatmen. Sei es auf der Küstenstraße Wild Atlantic Way oder auf den endlosen Fluss-Systemen - Irland ist mehr als ein Reiseziel. Irland ist eine Einstellung. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland.
"Der Schafe Biss und der goldene Tritt" – Ökologischer Wert der Schafhaltung | zu Gast: Falk Kirchner | Schäfer, Mainhausen
Schafherden pflegen die Landschaft, wo die mechanische Bearbeitung an ihre Grenzen stößt. Was tun die Tiere genau? Wie viel Arbeit macht es, Schafe zu halten? Und steht der Schäfer nur am Rand der Wiese und genießt den Ausblick?Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Falk Kirchner bewirtschaftet mit seinen Schafen einen 106 Hektar großen Betrieb im Landkreis Offenbach und ist aus der Ökomodell-Region Rhein-Main hier im Podcast zugeschaltet.Die Themen:Warum sind Schafe wichtig, was können sie besonders gut?Welche Vorteile bietet die Landschaftspflege mit Schafen, auch ökologisch?Eignen sich alle Schafe gleichermaßen gut zur Landschaftspflege?Was braucht so ein Schaf? Wie viel Arbeit macht es, Schafe zu halten?Kann man von Schafhaltung leben, wie sieht die Vermarktung aus?Gefördert durch: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzShownotes:Welche Themen willst Du hören? Schick uns Deinen Themenwunsch per E-Mail an OEML-Podcast@gutes-aus-hessen.deDen Betrieb von Falk Kirchner kannst du auch besuchen. Bei Interesse, schreib uns an OEML-Podcast@gutes-aus-hessen.deThis podcast uses the following third-party services for analysis: Chartable - https://chartable.com/privacy
Was haben Tokio, Jakobeny, Kapfenberg und Graz gemeinsam?
Das sind Orte, die für unseren heutigen Gast, Klaus Kabasser, eine wichtige Rolle spielen. In Tokio holte die Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer im Juli Olympiagold im Rad-Straßenrennen. Als Trainer und sportlicher Leiter des österreichischen Nationalteams hat er einen großen Anteil an diesem Erfolg. Was ihn neben Tokio mit Jakobeny, Kapfenberg und Graz verbindet und wie das mit Schafherden und Hirten ist, erzählt er uns in der August-Ausgabe.
Suzette Preiswerk da Mota-Veiga – Älteste Hundezüchterin Portugals
Suzette Preiswerk da Mota-Veiga wird bald 80 und sprudelt nur so vor Lebensenergie. Seit vielen Jahren züchtet die Baslerin portugiesische Hirtenhunde. Sogenannte «Cao Da Serra Da Estrela». Der imposante Herdenschutzhund verteidigt Schafherden mutig gegen Wölfe und Viehdiebe. Suzette Preiswerk da Mota-Veiga lebt schon seit über fünfzig Jahren in Portugal. Die Baslerin hat ein Anwesen in der Nähe der Kleinstadt Manteiga in der Serra da Estrela, in der Region Centro. Das Hochgebirge lockt Wandertouristen mit einsamen Wanderwegen, Wasserfällen, Schäferkultur und geschichtsträchtigen Dörfern. Die Zeit scheint dort stehen geblieben zu sein. Nicht so bei Suzette Preiswerk da Mota-Veiga. Immer in Bewegung Fünfzehn erwachsene Hunde tummeln sich im Gehege ihres Anwesens. «Sie haben grossen Freilauf und es hat viele Bäume», sagt Suzette Preiswerk da Mota-Veiga. Vor den mächtigen Tieren müsse man keine Angst haben: «Die Herdenhunde sind sehr umgänglich, aber keine Schosshunde.» Suzette Preiswerk da Mota-Veiga kam einst der Liebe wegen nach Portugal. Heute lebt sie zwar getrennt von ihrem Mann, aber die beiden haben immer noch einen sehr guten Draht zueinander: «Mein Mann hat mir sein Haus mit Umschwung vermacht. Wir sind ganz gute Freunde.»
Schafherden als Diakonieprojekt - Der gute Hirte fürs Moor
In der Bibel gehören Hirten zum Stammpersonal. Heute gelten sie als Sinnbild eines entschleunigten Lebens mit der Natur. Die Diakonie "Bethel im Norden" versucht die Verbindung beider Welten: Naturschutz im Namen des Herrn. Von Michael Hollenbach www.deutschlandfunkkultur.de, Religionen Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, 2 auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden, 3 den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des HERRN, dass er sich durch sie verherrlicht. 4 Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. 5 Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. 6 Ihr aber, ihr werdet Priester des HERRN genannt werden; Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. 7 Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen; ewige Freude wird ihnen zuteil. Jes. 61,1-7 Elb
Bei der Abstimmung über das Jagdgesetz geht es nicht nur um den Wolf, sondern auch um andere geschützte Tierarten wie den Steinbock und den Schwan. In der «Abstimmungskontroverse» diskutieren Ursula Schneider Schüttel, SP-Nationalrätin und Präsidentin von Pro Natura und CVP-Ständerat Stefan Engler. Auf der einen Seite: Bauern, die nicht mehr schlafen können, weil der Wolf jede Nacht um ihre Schafherden schleicht. Auf der anderen Seite: Tierschützer, die auf die Barrikaden gehen, weil es dem Wolf an den Kragen gehen soll. Das Raubtier bewegt und polarisiert. Am 27. September stimmen wir darüber ab, ob der Schutz des Wolfes gelockert werden soll. Der Bundesrat und die Parlamentsmehrheit sprechen sich für das neue Gesetz aus. Die SP, die Grünen und die Grünliberalen bekämpfen es. Über den Wolf und das revidierte Jagdgesetz debattieren Ursula Schneider Schüttel, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Freiburg und Präsidentin von Pro Natura. Die Umweltorganisation hat das Referendum gegen das neue Gesetz ergriffen und Stefan Engler, CVP-Ständerat aus dem Kanton Graubünden. Er hat die aktuelle Gesetzesrevision mit einem parlamentarischen Vorstoss angestossen. Die Diskussion leitet Inlandredaktor Rafael von Matt.
Seit 1995 gibt es Wölfe in der Schweiz. Zum ersten Mal ist im Sommer 2012 Nachwuchs eindeutig nachgewiesen worden. «NETZ NATUR» berichtet, wie man sich in der Schweiz auf die Rückkehr der Wölfe und Bären einstellt, welche Diskussionen sie auslösen und wie sie den Schafen Gutes tun. Wohl noch nie gab es so viele Wölfe in der Schweiz wie 2012. Mindestens in einem Gebiet der Schweiz, im Calanda-Massiv bei Chur, haben sie auch nachweislich Nachwuchs. Damit ist eingetreten, was Wolfsgegner schon lange befürchtet und Wolfsfreunde gehofft hatten: Es sind mehrere Wölfe unterwegs, die eine soziale Gemeinschaft bilden und gemeinsam jagen. Was bedeutet dies für die Schafherden auf den Alpen? Und wie stellen sich Jäger darauf ein, dass nicht nur sie Anspruch aufs Wild geltend machen? Muss man sich bald vor Wolfsrudeln in Acht nehmen? Bereits scheint vorgesorgt: Noch bevor sich Wölfe und Bären nach ihrer Ausrottung vor mehr als 100 Jahren tatsächlich in der Schweiz wieder etabliert haben, hat die Politik bereits beschlossen, dass die sogenannten Grossraubtiere dann «reguliert» werden können, wenn ein Kanton nach seiner Einschätzung zu hohe «Schäden» an jagdbaren Wildtieren oder an Haustieren erleidet. Dazu müsste die Schweiz zwar aus dem europäischen Artenschutz-Abkommen, der sogenannten Berner Konvention, austreten, denn beide Fleischfresser-Arten sind europaweit streng geschützt. Doch das Parlament hat dies grundsätzlich beschlossen. Vor allem der Wolf weckt immer noch hauptsächlich im Berggebiet irrationale Ängste und dadurch Widerstand gegen seine Präsenz im Land. Dies wird politisch geschickt genutzt. Doch weil es immer mehr Wölfe gibt, schützen auch immer mehr verantwortungsbewusste Schafhalter ihre Tiere während der mehr als dreimonatigen Alpzeit mit Hirten und mit Herdenschutzhunden. «NETZ NATUR» zeigt, ob dieser Herdenschutz im Sommer 2012 erfolgreich war. Und das Team spürt den Jägern nach, die in denselben Gebieten wie die Wölfe jagen. «NETZ NATUR» schaut auch über die Grenzen nach Italien, Frankreich und auch nach Osten, was sich dort bei den Wölfen tut. Von Nordosten, aus Deutschland, und aus Südosten, aus Slowenien, breitet sich nämlich eine zweite Wolfspopulation aus, die sich in absehbarer Zeit mit den italienischen Wölfen in der Schweiz treffen werden – auch in der Schweiz. Eine Wolfsfamilie beansprucht ein Revier von 150 – 250 Quadratkilometern, in dem es keine anderen Wölfe duldet. So verteidigt eine Wolfs-familie etwa ein Gebiet von der Fläche des Kantons Zug. Die Vermehrung wird dadurch begrenzt, dass nur ein Weibchen, die Mutter der ganzen Familie, Junge hat. Erwachsene Jungtiere wandern nach ein bis drei Jahren ab und ziehen manchmal sehr weit, um neue Gebiete zu besiedeln. Wird allerdings diese soziale Selbstregulation und das Familiensystem durch den Abschuss wichtiger Tiere gestört, reagieren die Tiere mit erhöhter Reproduktion. So kann es sein, dass es mehr Wölfe in einem Gebiet gibt als vorher. Mit «Wolf Schweiz: Wer braucht Schutz vor wem?» versucht NETZ NATUR aufzuzeigen, dass in der Natur nicht immer alles ist, wie wir uns denken, und warum der Wolf für die Schafe auch sein Gutes hat.
Seit 1995 gibt es Wölfe in der Schweiz. Zum ersten Mal ist im Sommer 2012 Nachwuchs eindeutig nachgewiesen worden. «NETZ NATUR» berichtet, wie man sich in der Schweiz auf die Rückkehr der Wölfe und Bären einstellt, welche Diskussionen sie auslösen und wie sie den Schafen Gutes tun. Wohl noch nie gab es so viele Wölfe in der Schweiz wie 2012. Mindestens in einem Gebiet der Schweiz, im Calanda-Massiv bei Chur, haben sie auch nachweislich Nachwuchs. Damit ist eingetreten, was Wolfsgegner schon lange befürchtet und Wolfsfreunde gehofft hatten: Es sind mehrere Wölfe unterwegs, die eine soziale Gemeinschaft bilden und gemeinsam jagen. Was bedeutet dies für die Schafherden auf den Alpen? Und wie stellen sich Jäger darauf ein, dass nicht nur sie Anspruch aufs Wild geltend machen? Muss man sich bald vor Wolfsrudeln in Acht nehmen? Bereits scheint vorgesorgt: Noch bevor sich Wölfe und Bären nach ihrer Ausrottung vor mehr als 100 Jahren tatsächlich in der Schweiz wieder etabliert haben, hat die Politik bereits beschlossen, dass die sogenannten Grossraubtiere dann «reguliert» werden können, wenn ein Kanton nach seiner Einschätzung zu hohe «Schäden» an jagdbaren Wildtieren oder an Haustieren erleidet. Dazu müsste die Schweiz zwar aus dem europäischen Artenschutz-Abkommen, der sogenannten Berner Konvention, austreten, denn beide Fleischfresser-Arten sind europaweit streng geschützt. Doch das Parlament hat dies grundsätzlich beschlossen. Vor allem der Wolf weckt immer noch hauptsächlich im Berggebiet irrationale Ängste und dadurch Widerstand gegen seine Präsenz im Land. Dies wird politisch geschickt genutzt. Doch weil es immer mehr Wölfe gibt, schützen auch immer mehr verantwortungsbewusste Schafhalter ihre Tiere während der mehr als dreimonatigen Alpzeit mit Hirten und mit Herdenschutzhunden. «NETZ NATUR» zeigt, ob dieser Herdenschutz im Sommer 2012 erfolgreich war. Und das Team spürt den Jägern nach, die in denselben Gebieten wie die Wölfe jagen. «NETZ NATUR» schaut auch über die Grenzen nach Italien, Frankreich und auch nach Osten, was sich dort bei den Wölfen tut. Von Nordosten, aus Deutschland, und aus Südosten, aus Slowenien, breitet sich nämlich eine zweite Wolfspopulation aus, die sich in absehbarer Zeit mit den italienischen Wölfen in der Schweiz treffen werden – auch in der Schweiz. Eine Wolfsfamilie beansprucht ein Revier von 150 – 250 Quadratkilometern, in dem es keine anderen Wölfe duldet. So verteidigt eine Wolfs-familie etwa ein Gebiet von der Fläche des Kantons Zug. Die Vermehrung wird dadurch begrenzt, dass nur ein Weibchen, die Mutter der ganzen Familie, Junge hat. Erwachsene Jungtiere wandern nach ein bis drei Jahren ab und ziehen manchmal sehr weit, um neue Gebiete zu besiedeln. Wird allerdings diese soziale Selbstregulation und das Familiensystem durch den Abschuss wichtiger Tiere gestört, reagieren die Tiere mit erhöhter Reproduktion. So kann es sein, dass es mehr Wölfe in einem Gebiet gibt als vorher. Mit «Wolf Schweiz: Wer braucht Schutz vor wem?» versucht NETZ NATUR aufzuzeigen, dass in der Natur nicht immer alles ist, wie wir uns denken, und warum der Wolf für die Schafe auch sein Gutes hat.
Andacht zum 16. Mai 2020: Nabal, der Geizkragen (Reihe: Die dümmsten Entscheidungen in der Bibel)
Guten Morgen, ich möchte Ihnen in dieser Woche die dümmsten Entscheidungen vorstellen, die Menschen in der Bibel getroffen haben.Zum Beispiel Nabal. Ein sehr wohlhabender Mann mit riesigen Schafherden. Aber er war auch ein geiziger Stoffel. Dachte nur an sich, und nie an andere.Einmal hats dann richtig gekracht: Der berühmte David, …
#037: Schottland Roadtrip - 1 Woche durch die Highlands und Edinburgh (Teil 2)
Traveloptimizer | Der Podcast über Reisen & Abenteuer trotz Fulltimejob
Unendliche weite Grashügel, Schafherden und Burgen. Ist das wirklich Schottland? Tom hat einen 8-tägigen Roadtrip durch Schottland unternommen. Er berichtet von Glasgow, Edinburgh und den Highlands. In dieser Podcastfolge erfährst du: (01:15) Überblick Folge 2 (01:48) Wanderung auf den Ben Nevis (Großbritanniens höchster Berg) (05:55) Isle of Skye Reisetipps (08:13) Wo sieht man Schottenröcke und hört Dudelsackmusik? (12:37) Inverness und Loch Ness (14:47) Edinburgh Sehenswürdigkeiten (bestes Hostel, bester Ausblick, ...) Eine ausführliche Zsuammenfassung der Podcastfolge findest du hier: https://www.traveloptimizer.de/podcast/schottland-roadtrip/
#036: Schottland Roadtrip - 1 Woche durch die Highlands und Edinburgh (Teil 1)
Traveloptimizer | Der Podcast über Reisen & Abenteuer trotz Fulltimejob
Unendliche weite Grashügel, Schafherden und Burgen. Ist das wirklich Schottland? Tom hat einen 8-tägigen Roadtrip durch Schottland unternommen. Er berichtet von Glasgow, Edinburgh und den Highlands. In dieser Podcastfolge erfährst du: (01:35) Überblick Folge 1 (02:08) Fakten über Schottland (Anreise, beste Reisezeit, Kosten, Mietwagentipps) (03:50) Warum sollte man sich in Acht nehmen vor "Midges"? (10:13) Route für 8 Tage Roadtrip durch Schottland (10:59) Highlights in Glasgow (12:45) Loch Lomond Reisetipps (13:58) Fort Williams (15:35) Zusammenfassung der besten Reisetipps für Glasgow, Loch Lomond und Fort Williams Eine ausführliche Zsuammenfassung der Podcastfolge findest du hier: https://www.traveloptimizer.de/podcast/schottland-roadtrip/
Furchtlose Schäfer in den Karpaten
Ihr Leben ist arm, archaisch und nicht ungefährlich. Ständig sind die rumänischen Hirten auf der Hut vor Wölfen und Braunbären, die ihre Herden angreifen. Doch die Wildtiere sind nicht die einzige Gefahr für die Schafherden.
Untersuchungen zur Prävalenz von Infektionen mit dem Ovinen Herpesvirus-2 (OvHV-2) in 20 Mischbetrieben mit Rindern und Schafen in Bayern
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/07
Das Ovine Herpesvirus-2 (OvHV-2) ist der Erreger des Schaf-assoziierten Bösartigen Katarrhalfiebers (SA-BKF), einer meist tödlich verlaufenden, lymphoproliferativen Erkrankung, die weltweit bei Rindern und anderen Ungulaten vorkommt. Die meisten der in Bayern beobachteten Fälle von SA-BKF bei Rindern sind auf eine gemeinsame Haltung mit Schafen zurückzuführen, die das Virusreservoir des OvHV-2 darstellen. Wie stark die Virusinfektion in bayerischen Schafherden verbreitet ist, konnte bisher nur vermutet werden. Für Rinder fehlten fundierte Daten über die Häufigkeit und Bedeutung möglicher subklinischer Infektionen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden in 20 bayerischen Mischbetrieben die jeweiligen Prävalenzen von OvHV-2-Infektionen im Schaf- und Rinderbestand mittels eines kompetitiven ELISA und einer seminested PCR ermittelt und umfassende anamnestische Daten zu den Betrieben erhoben. Es wurden zwei Studiengruppen zu je zehn Betrieben mit und entsprechend ohne klinische, virologisch bestätigte BKF-Fälle bei Rindern zwischen Januar 2007 und Dezember 2009 gebildet. Alle untersuchten Schafherden waren zu einem großen Anteil OvHV-2-infiziert. In Betrieben der Gruppe 1, in denen klinische Fälle von BKF bei Rindern auftraten, lag die mediane Seroprävalenz BKF-Virus-spezifischer Antikörper der einzelnen Schafherden bei 100 % und die Prävalenz der mittels Genomnachweis festgestellten OvHV-2-Infektionen betrug 92 %. In den Schafherden der Gruppe 2 wurden dagegen nur eine Seroprävalenz von 73 % und eine OvHV-2-Genom-Prävalenz von 58 % festgestellt. Ebenso ergaben die Untersuchungen der Rinder einen klaren Unterschied zwischen den beiden Studiengruppen. In Betrieben der Gruppe 1 lagen die Seroprävalenzen bei 24 % und ausschließlich in Betrieben dieser Gruppe war bei 13 Rindern OvHV-2-DNA im Blut nachweisbar. Die Rinderbestände der Gruppe 2 waren nur zu 16 % seropositiv für BKF-Erreger-spezifische Antikörper und das Blut keines der Tiere reagierte in der PCR. Dass vor allem in den untersuchten Mischbetrieben, in denen ein besonders enger und auch direkter Kontakt zwischen Schafen und Rindern bestand, sowohl die Seroprävalenzen bei den Rindern, als auch die Anzahl der Rinder mit nachweisbarer OvHV-2-DNA im Blut relativ hoch waren, lässt auf einen ursächlichen Zusammenhang schließen. Außerdem traten in diesen Mischbetrieben, die zudem sehr hohe OvHV-2-Prävalenzen in den Schafherden hatten, auch subklinische OvHV-2-Infektionen bei elf Rindern auf. Diese Tiere zeigten bei wiederholter Untersuchung auch bis zu eineinhalb Jahren nach initialer Diagnose keine mit BKF assoziierbaren klinischen Symptome. Der auf die Zellzahl normierte Gehalt an OvHV-2-Genomkopien in den Blutproben dieser Rinder, wie interessanterweise auch der Schafe, lag in einem Bereich von 1,7 x 10-4 bis 1,7 x 10-1 OvHV-2-Genomkopien. In Blutproben von Rindern mit klinischem BKF dagegen lag der relative OvHV-2-Genomgehalt deutlich höher. In den Organproben eines akut an BKF erkrankten Rindes schließlich wurde der höchste relative OvHV-2-Genomgehalt in den Lymphknoten und der Milz nachgewiesen. Der relative OvHV-2-Genomgehalt von in vitro kultivierten, mit Con A stimulierbaren Lymphozyten eines subklinisch infizierten Rindes stieg im Laufe von zehn Wochen deutlich an, fiel jedoch nach einem Peak bei 8,4 x 102 wieder ab. Durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen liegen erstmals Prävalenzdaten zu OvHV-2-Infektionen in selektierten bayerischen Rinder- und Schafherden vor. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten untersuchten Schafe tatsächlich mit OvHV-2 infiziert sind und dass subklinische OvHV-2-Infektionen des Rindes in Bayern durchaus vorkommen. Da über diese Form der Infektion bei Rindern noch wenig bekannt ist und generell das Vorkommen der OvHV-2-Infektionen in Bayern unterschätzt wird, besteht ein weiterer Forschungs- und Aufklärungsbedarf.