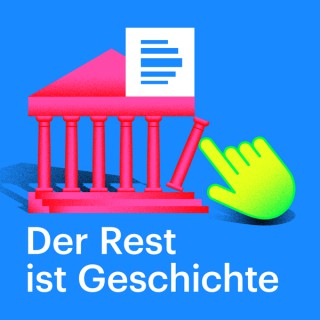Podcasts about bildungsreform
- 30PODCASTS
- 38EPISODES
- 34mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about bildungsreform
Latest podcast episodes about bildungsreform
Rücktritt statt Rückendeckung: Harald Mahrer verliert den Rückhalt – und muss nach der Gehaltsaffäre als Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten // Das Budgetloch wächst weiter: Finanzminister und Länder schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu // Pinke Gegensätze: Christoph Wiederkehr will mit seiner Bildungsreform punkten – doch bei Sepp Schellhorns Entbürokratisierungsprojekt heißt es weiter warten.
Magistrat Darmstadt beschließt umfangreiches Freiraumkonzept, Freie Wähler fordern radikale Reformen bei Hessens Bildung und schon tot geglaubte Getränkedose feiert fulminantes Comeback. Das und mehr heute im Podcast. Alle Hintergründe zu den Nachrichten des Tages finden Sie hier: https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/naherholung-stadt-will-bessere-wege-in-darmstadts-gruenzuege-5135079 https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/zukunft-von-darmstadts-wasserturm-bleibt-vorerst-ungewiss-5125936 https://www.echo-online.de/politik/politik-hessen/freie-waehler-fordern-radikale-reformen-bei-hessens-bildung-5141530 https://www.echo-online.de/wirtschaft/wirtschaft-deutschland/schon-tot-geglaubte-getraenkedose-feiert-fulminantes-comeback-5129791 https://www.echo-online.de/lokales/kreis-darmstadt-dieburg/gross-umstadt/kita-in-gross-umstadt-wird-abgeplant-5130469 Ein Angebot der VRM.
DK147: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Klimapolitik in Österreich
"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel. In Folge 147 geht es um die Politik! Aber auch um Bildung, Medien, Migration und was sonst noch alles im Rahmen der Klimapolitik eine Rolle spielt. Wir diskutieren, welche Möglichkeiten die Politik hat - und warum sie in Österreich nicht genutzt werden. Außerdem geht es um die Kosten der Transformation und die (viel höheren) Kosten des Nichtstuns. Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.
Adieu Frühfranzösisch, Einbürgerung trotz Vorstrafe, Bergsturz in Blatten
Adieu Frühfranzösisch: Bildungsreform oder kultureller Rückschritt?Einbürgerung trotz Vorstrafe: Recht auf Integration oder falsches Signal?Bergsturz in Blatten: Naturgefahr oder Folge des Klimawandels? Gäste:Tamara Funiciello, SP-Nationalrätin Kanton BernMarcel Dettling, SVP-Präsident und Nationalrat Kanton Schwyz Tiana Moser, GLP-Ständerätin Kanton Zürich Moderation: Patrik MüllerProduzent: Adrian Sutter
#339 deep dive: Je gebildeter, desto reicher? Mit Ludger Wößmann
Je gebildeter, desto reicher? Darüber habe ich mit dem Bildungsökonomen Ludger Wößmann gesprochen. Über die riesige Rendite von Bildung für Individuen – und die große Rolle, die Bildung für den Wohlstand von Nationen hat. Und: Wie wir das Bildungssystem für alle besser hinbekommen. Ein deep dive. Zur Person
Dr. Matthias Burchardt: Geistlose Traumfabriken und Phantasmagorien der Bildungsreform (Erstsendung: 19.12.2021)
Der Philosoph blickt kritisch auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen, aber auch auf die Akteure und internationalen Organisationen, welche für die Neuordnung der Bildung in Form von PISA und Bologna verantwortlich sind.
Bildungsreform in Estland: Kein russischsprachiger Unterricht mehr an Schulen
Schulz, Julia www.deutschlandfunk.de, Campus & Karriere
Geschichte der Schule - Hefte raus, Bildungsreform!
Die Schule ist ein Zankapfel: Was sollen Kinder lernen, wie sinnvoll sind Noten, welche Chancen haben Schüler aus armen Familien? Darüber streiten Politiker, Eltern, Experten. Neu ist das nicht. Manche Debatte wurde schon im 19. Jahrhundert geführt. Pulz, Magdalena
Gegen Antisemitismus - Seyran Ates: Brauchen radikale Bildungsreform
Die Schülerschaft habe sich verändert, sagt Seyran Ates, die sich seit Jahren gegen Antisemitismus und Rassismus an Schulen engagiert. Es sei wichtig, auf kulturelle und religiöse Besonderheiten einzugehen anstatt strikt nach Lehrplan vorzugehen. Ates, Seyranwww.deutschlandfunkkultur.de, Fazit
KP Haupt, unkonventioneller Physiklehrer und Bildungsreformer
Physik muss kein Horror-Schulfach sein - wenn man es richtig unterrichtet. Klaus-Peter Haupt hat als Lehrer seinen Schülern immer vertraut und sie selbst experimentieren lassen, mit großem Erfolg. Autorin: Andrea Lieblang Von Andrea Lieblang.
#125 Servant Politics im Gespräch mit Gudula Merchert-Werhahn (Diversity Advocate, Mentorin, Podcast Host)
Zur Person: Diversity Advocate, Mentorin, Podcast Host & Foundation Manager & Trustee "Politik wird von Menschen für Menschen gemacht" "Wir brauchen die Begeisterung aller für die Sache." "Wir alle sind Teil eines Puzzles und bestimmen mitunter die Farbe unseres eigenen Puzzle-Teils." Einige Highlights aus dem Podcast: - Bedürfnisse der Gesellschaft & das Wohl der Gemeinschaft - Politiker*innen als weise Menschen - Mit der Politik am Puls der Zeit - Die / unsere heterogene Gesellschaft und die Privilegierung in ihr - Der Platz in der Gesellschaft (z.B. die demografische Schere) - Zusammensetzung der Parlamente - Diskriminierung & Chancengleichheit - Ermutigung & Anregung für das Sich-Selbst-Einbringen - Bildungsreform => der Fächer-Kanon & Future Skills & vernetzter agieren - Brains als Rohstoffe - Demokratie-Erziehung - Wahlrecht für Kinder - ausgeübt von den Eltern der Kinder
#109 Servant Politics im Gespräch mit Jon Buchmüller (Schüler & Landes-Vorstands-Mitglied der liberalen Schüler in BW)
Zur Person: Schüler (16 Jahre) & Landes-Vorstands-Mitglied der liberalen Schüler in BW "Es ist mir sehr wichtig, dass wir in der Gesellschaft zu einem Miteinander kommen und gemeinsam wirken." "Sich auch anderen Positionen offen zeigen." Einige Highlights aus dem Podcast: - Beachtung junger Menschen in der Politik => Zuhören - Einbringsmöglichkeit junger Menschen, die sich keiner Partei zuordnen - Politik in der Schule - Aktualisierung des Bildungsplans - Schüler bei Bildungsreform mit einschließen - Zukunftskompetenzen in der Schule - Kollaboration & Medienkompetenz - Mut Entscheidungen zu treffen - Zielgruppen bei Entscheidungsfindung mit einbeziehen - Zielgruppenorientiert - Politiker*innen sollten ein Miteinander finden / realisieren => gemeinsames Verständnis - Frieden & Sicherheit global denken - Klimaschutz, Sicherheit und Frieden gemeinsam realisieren
#103 Servant Politics im Gespräch mit Dr. Uta Dany (Pädagogin aus Leidenschaft)
Zur Person: Pädagogin & Lehrerin / ehemalige Schulleiterin Einige Highlights aus dem Podcast: - Die Aufgabe der Schule als Institution für die Menschheit - Bildungspolitik & Chancengleichkeit -> Bildung der Zukunft - Den Verwaltungsapparat im Bildungswesen überdenken und dringend daran arbeiten - Die Menschen "vor Ort", d.h. an den Schulen, wissen was zu tun ist! - Die Kreativität vor Ort ist existent und muss vom Verwaltungsapparat erkannt & genutzt werden - Vernetzte Bildung ist wichtig - Schulen vor Ort müssen entscheiden können und dürfen! - Bedürfnisse der Kindern & Jugendlichen beachten! - Schule hat zuviele Aufgaben, die sie lösen soll ... Wo sind die Ressourcen dafür? - Schule MUSS sich ändern!!!!! - Politiker müssen in die Schulen gehen und mit Lehrer*innen und Schülern*innen sprechen!!!
100. Geburtstag der Karikaturistin - Marie Marcks und ihre feministischen Cartoons
Mit Berliner Witz kommentierte Marie Marcks den Zeitgeist der jungen Bundesrepublik. Ob mit Blick auf „Frauenfrage“, Bildungsreform oder Atomenergie entlarvte die Zeichnerin das Selbstbild der Deutschen. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden.Von Carmela Thielewww.deutschlandfunk.de, KalenderblattDirekter Link zur Audiodatei
"Wir haben verlernt, existenzielle Fragen zu stellen" | Kersten Reich u. a. über Erziehung zur Nachhaltigkeit
In Deutschland fand nie eine Bildungsreform statt - sagt Kersten Reich, Professor für Pädagogik. Anders als international regelt hierzulande immer noch das preußische System die Auslese - hoffnungslos rückständig meint der Pädagoge. Wie es anders gehen könnte, zeigt sich in der von ihm mitbegründeten Helios-Schule in Köln. Wie eine nachhaltige und ganzheitliche Schule funktionieren kann, erzählt Kersten Reich im "hr2- Doppelkopf".
Die bundesdeutsche Bildungsreform der 1960er- und 70er Jahre führte im Ruhrgebiet zur Gründung neuer Hochschulen. Die Soziologin Sigrid Metz-Göckel war Mitte 30, als sie den Ruf als Professorin an die neugegründete TU Dortmund erhielt. An der Etablierung der Frauen- und Geschlechterforschung als neues Wissenschaftsgebiet in Deutschland war sie maßgeblich beteiligt. Sigrid Metz-Göckel wurde 1940 in Klein Peterwitz in Oberschlesien geboren. Von Tina Hammesfahr.
Spontanes Thema, in dem man sich gut verlieren kann: Berufsorientierung an Schulen und was ist eigentlich Sinnvolles hängen geblieben bei uns? Nach einer aktuellen Story aus dem Leben eines frisch bestohlenen verlieren wir uns in diesem aktuellen Thema. Außerdem gibt es aktuelle Serienempfehlungen.
6. Dezember 2021: Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernennt den neuen Bundeskanzler von Österreich. Nach Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg ist Karl Nehammer der dritte Kanzler in nur 60 Tagen. Und das Land fragt sich, ob mit ihm jetzt endlich Ruhe eingekehrt ist? Doch für Ruhe ist keine Zeit. Die Pandemie wütet. Ein Teil der Bevölkerung radikalisiert sich zunehmend. Große Vorhaben wie die Klimawende und die Bildungsreform müssen vorangetrieben werden. Und all das, während die Korruptionsermittlungen gegen Nehammers eigene Regierungspartei, die ÖVP, in vollem Gange sind. In dieser Folge von "Inside Austria" wollen wir herausfinden, wie Österreichs neuer Mann an der Spitze tickt. Ob er den Kurs seines Vorvorgängers fortführen oder eigene Akzente als Bundeskanzler setzen will. Denn viele im Land haben nach den Skandalen rund um Sebastian Kurz das Vertrauen in die Regierung verloren. Wie will Nehammer dieses Vertrauen zurückgewinnen? Und was ist sein Plan für Österreich?
Die bundesdeutsche Bildungsreform der 1960er- und 70er Jahre führte im Ruhrgebiet zur Gründung neuer Hochschulen. Die Soziologin Sigrid Metz-Göckel war Mitte 30, als sie den Ruf als Professorin an die neugegründete TU Dortmund erhielt. An der Etablierung der Frauen- und Geschlechterforschung als neues Wissenschaftsgebiet in Deutschland war sie maßgeblich beteiligt. Sigrid Metz-Göckel wurde 1940 in Klein Peterwitz in Oberschlesien geboren.
Dr. Matthias Burchardt: Geistlose Traumfabriken und Fantasiemagorien der Bildungsreform
Philosoph blickt kritisch auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen, aber auch auf die Akteure und internationalen Organisationen, welche für die Neuordnung der Bildung in Form von PISA und Bologna verantwortlich sind.
Dr. Matthias Burchardt: Geistlose Traumfabriken und Fantasiemagorien der Bildungsreform
Philosoph blickt kritisch auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen, aber auch auf die Akteure und internationalen Organisationen, welche für die Neuordnung der Bildung in Form von PISA und Bologna verantwortlich sind.
Dr. Matthias Burchardt: Geistlose Traumfabriken und Fantasiemagorien der Bildungsreform
Philosoph blickt kritisch auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen, aber auch auf die Akteure und internationalen Organisationen, welche für die Neuordnung der Bildung in Form von PISA und Bologna verantwortlich sind.
Frechferkel und Eismuschel-Leugner aufgepasst, denn Casper und Drangsal sind mit einer neuen Folge Mit Verachtung zurück. In der mittlerweile 28. Folge besprechen die beiden ihre Hass-Liebe zum Thema Musikvideos. Außerdem startet Drangsal eine Petition zur Bildungsreform und lauscht Caspers feuchtfröhlicher Sauf-Story. Im Zuge dessen wird auch heiß über die besten Umzugsstrategien debattiert und das Pendant zur Scheiße-Schublade ins Leben gerufen: Die Ferkelkiste! Köstliche Musik landet zum Schluss natürlich wieder auf dem Grill. #teamschweigi
Nach eineinhalb Jahren Kampf gegen das Corona-Regime werden Abnutzungserscheinungen deutlich — wir können jedoch von älteren Bewegungen lernen.Ein Kommentar von Hermann Ploppa.Quo vadis, Demokratiebewegung? Anderthalb Jahre sind vergangen, in denen wir uns abgearbeitet haben an einem dekadenten Regime, für das der Name Merkel Synonym geworden ist. Wer hätte sich bei ihrem Amtsantritt vorstellen können, dass diese untersetzte, biedere Frau aus der Uckermark einmal für Monstrositäten der Superlative verantwortlich sein würde? Anfangs hatte es noch ein bisschen Spaß gemacht, denn wir dachten im sonnigen Sommer der Demokratie des Jahres 2020, der surreale Maskenspuk wäre bald vorbei. Dergleichen sei den Massen nicht mehr lange zu vermitteln. Als der Autor am 29. August 2020 in Berlin auf der Ballweg-Bühne stand und die unglaubliche Masse der Protestierenden sah, empfand er, dass diese der Machtanmaßungen einer kriminellen Politikerclique haushoch überlegen seien. Wir sind es in vieler Hinsicht noch immer. Aber dass mit primitivsten Gewaltmitteln, zu denen auch unhaltbare mediale Lügen gehörten, einfach weiter gepulvert wurde, bis das Land wirtschaftlich wie psychisch am Boden war, das überraschte uns alle. „Nach uns die Sintflut“ schien das Motto dieses Totalabrisses zu sein — offenbar nur dazu inszeniert, um die eigenen kranken, niederen Instinkte zu befriedigen, solange es irgendwie geht. Unsere Erschöpfung ist kein Zufall: Die Gegenseite führt einen ebenso banalen wie gewalttätigen Abnutzungskrieg gegen die eigene Bevölkerung, ohne Rücksicht auf Verluste.Wir sind ratlos. Zudem folgte auf das traumhafte Wetter des letzten Jahres ein meteorologisches Inferno, das die körpereigenen Glückshormone und die Immunität auch nicht gerade befördert. Viele Menschen haben so viel hilflose Wut in sich hineingefressen, dass die Gebote zur Friedfertigkeit in arge Bedrängnis geraten. Andere sind genervt von der Eitelkeit und dem Selbstdarstellungsdrang einiger Leittiere der Bewegung. Das Verdächtigungskarussell dreht sich immer schneller: Wer ist ein Maulwurf von der anderen Seite? Bewegungspromi A schickt Bewegungspromi B böse E-Mails mit vollkommen entbehrlichen Unterstellungen.Es wird eng. Denn neue Aktivisten sind in den letzten achtzehn Monaten kaum dazugekommen. Es sind immer noch dieselben Frontleute und dieselben Netzwerker im Hintergrund. Und viele von ihnen befinden sich in einem Lebensabschnitt, in dem man eigentlich eher seine Lebenserinnerungen niederschreibt. Viele haben schreckliche Erlebnisse mit einer völlig enthemmten Polizei oder einer vollkommen gesetzlos agierenden Justiz hinter sich. Nur zu verständlich, dass sie angegessen sind. Und nun wollen „die“ auch noch unsere Kinder zwangsimpfen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Mahatma Gandhi adé. Die sollen uns mal kennenlernen!Nein. Wir müssen ruhig und friedfertig bleiben. Denn nichts wünscht die Gegenseite sich so sehr, als dass wir die Ruhe verlieren und wie der wütende Stier in die gewetzte Klinge schnauben.Die Welt braucht uns. Wir müssen womöglich bald selber Verantwortung für das Schicksal unserer Gesellschaft übernehmen. Die Implosion kommt möglicherweise schneller als gedacht. Und dann müssen wir wissen, wie es weitergeht. Bevor es andere tun, die weit weniger Moral haben als wir.Man erinnere sich mal fleißig an das Jahr 1989. Die damalige Demokratiebewegung in der DDR wurde überrascht vom plötzlichen Machtverfall der SED. Bevor die authentischen Bürgerbewegungen begriffen, dass die Türen offenstanden, hatten sich schon längst kriminelle Räuberbanden aus dem Westen in die Schaltstellen der Macht hineingeschlichen. Mit fertigem Konzept. Mit perfiden Manipulationstricks gegen die Mehrheitsmeinung in der DDR. Müssen wir das wiederholen?Schwarmintelligenz nutzenEs gibt Wege, aus der Defensive zu kommen. Die viel zitierte Schwarmintelligenz; es gibt sie. Wir müssen sie nur nutzen. Wir müssen nicht im eigenen Verschleiß leise weinend implodieren. Wir können aus früheren Bewegungen und deren Fehlern viel lernen.Wenn man sich so umschaut nach Vergleichsparametern, dann bietet sich die Bewegung der außerparlamentarischen Opposition (APO) an, die im Jahre 1968 ihren Zenit erreichte. Denn auch jene APO war die Antwort auf Zumutungen der Herrschenden.Auch die APO war eine Sammelbewegung aus unterschiedlichsten Ecken. Auch damals speiste sich die Einigkeit gegensätzlicher Lager aus dem, was man gemeinsam entschieden ablehnte. So traf man sich in der kleinsten gemeinsamen Teilmenge. Und auch hier kann man sagen, dass eine Bewegung aus der Verneinung extrem zerbrechlich ist.Kommen wir kurz auf die Zumutungen der Eliten an ihr Volk in den 1960ern zu sprechen: Schon damals wollten die Eliten der Bundesrepublik Deutschland das politische System in autoritäre Bahnen lenken. Der Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, sprach von der „formierten Gesellschaft“ und bezeichnete Andersdenkende als „Pinscher“. Es sollten die sogenannten „Notstandsgesetze“ durchgepeitscht werden. Durch einen ausgerufenen Notstand könnte man dann die Demokratie mit einem Knopfdruck abschaffen.Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD peitschte die Notstandsgesetze im Bundestag unerbittlich durch. Die Politkaste in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn agierte immer selbstherrlicher, sodass selbst der konservative Philosoph Karl Jaspers in seinem Bestseller „Wohin treibt die Bundesrepublik?“ vor einer Transformation der Demokratie in eine Diktatur eindringlich warnte (1). Die Jugend, die nun als erste Generation in einem System aufgewachsen war, das von sich behauptete, eine Demokratie zu sein, war auf den Barrikaden, um eben diese Demokratie zu verteidigen und auszubauen.Den Jugendlichen standen unverhohlen von oben geförderten Neonazi-Organisationen, zum Beispiel der NPD, gegenüber, die ihre Interessen mit SA-ähnlichen Schlägertruppen durchzusetzen wussten. Diese ungenierte Nazi-Kumpanei der Eliten sensibilisierte die Bewegung für die Tatsache, dass eben diese Eliten eine beträchtliche Teilmenge mit den vergangenen Eliten der Nazi-Diktatur bildeten. Lange auch wurde der Holocaust in Westdeutschland unter den Teppich gekehrt.Als der Frankfurter Staatsanwalt Fritz Bauer endlich in der Mitte der 1960er Jahre Prozesse gegen die Auschwitzmörder erzwang, bekam wenigstens ein Teil der westdeutschen Bevölkerung überhaupt erst mit, was hier im deutschen Namen an monströsen Verbrechen begangen worden war.Der Glaube, in der besten aller Welten aufzuwachsen, bekam weitere Kratzer, als schockierende Bilder um die Welt gingen, wie unsere gütige Schutzmacht USA sich in Vietnam aufführte. Die verunsicherten Bildungsbürger trafen sich in evangelischen Akademien und diskutierten etliche Aschenbecher voll. Studenten forderten eine grundlegende Bildungsreform. Soziologiestudenten aus Berlin und Frankfurt transportierten Erkenntnisse über den antikolonialistischen Widerstand in der sogenannten Dritten Welt in die Diskussion (2).Überlebende Professoren aus der Weimarer Demokratie wie Ernst Bloch oder Herbert Marcuse belieferten die jungen Studenten mit hilfreicher Diagnose und Aufklärung über positive Zukunftsperspektiven, zum Beispiel mit Blochs Wälzer „Das Prinzip Hoffnung“ (3). Die Bewegung amalgamierte und erreichte für kurze Zeit ein hohes Maß an Reflexionsvermögen und Schwarmintelligenz. Radikaldemokraten, Sozialisten, Altkommunisten, Christen beider Konfessionen, Liberale und Vertreter alternativer Lebensformen zogen kurzfristig an einem Strang... hier weiterlesen: https://apolut.net/die-zweite-widerstandswelle-von-hermann-ploppaUnterstütze apolut:IBAN: DE40 8506 0000 1010 7380 26BIC: GENODEF1PR2Verwendungszweck: apolutKontoinhaber: apolut GmbHVolksbank Pirna eG_Patreon: https://www.patreon.com/apolutflattr: https://flattr.com/@apolutTipeee: https://de.tipeee.com/apolutInstagram: https://www.instagram.com/apolut_netFacebook: https://www.facebook.com/apolutTwitter: https://twitter.com/apolut_netOdysee: https://odysee.com/@apolut:a Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Johannes Schröder im BB RADIO Mitternachtstalk Kennt Ihr einen Lehrer der vor seinen Schülern für seinen Unterricht geliebt wird und der gleichzeitig auf den Comedy-Bühnen dieser Welt die Leute zum Lachen bringt und on top noch einen Bestseller nach dem anderen schreibt? Also ich kenne nur einen: Johannes Schröder, aka Herr Schröder, fka Korrekturensohn. Dieser Mann ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Nach seinem Studium auf Lehramt für Deutsch und Englisch und dem darauffolgenden zwölfjährigen Schuldienst entdeckte er den Hang zur Beurlaubung. Seitdem wechselt er zwischen den Berufen Lehrer, Comedian, Autor und professioneller Urlauber. Seine Comedy-Karriere hat allerdings nicht in Deutschland begonnen, sondern 2014 in Kanada. Der Versuch, es auch im eigenen Land zu versuchen, glückte. Seitdem gewann er mehrere Preise, schrieb mehrere Programme und lieferte einen Spiegel-Bestseller ab. Nach „World of Lehrkraft – Ein Pädagoge packt aus“ und ausverkaufte Live-Touren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz heißt sein neuestes Werk: „Instagrammatik“. Passend zum Buch gibt es wieder ein Programm und eine Live-Tour. Comedian Thomas Hermanns sagte über ihn: „Herr Schröder hat es geschafft, aus der eher klassischen Figur eines Lehrers etwas wildes Neues herauszuholen. Er ist der wild gewordene Bad Teacher, der alle ehemaligen Schüler on stage zur Rache aufruft. Und wer möchte sich nicht an seinen Lehrern rächen …“ Johannes Schröder, der etwas andere Lehrer, mit einem tollen Blick auf die Welt und einem Standpunkt zu wichtigen Themen, wie Bildungsreform, Beamtentum und dem Lehrer der Zukunft. Uneingeschränkt hörenswert und pädagogisch wertvoll.
COSMO Elliniko Randevou Ganze Sendung (24.01.2021)
Stellevertretende Bürgermeisterin in Solingen - Ioanna Zacharaki, Reportage Bildungsreform in Griechenland - Rodothea Seralidou, Kolumne Salzsäule Yiannis Valtis, Moderation Ioannis Skouras, Redaktion Andrea Mavroidis
(Engl.) Live-Unterricht via Google, Zoom und Co. – Über Bildung in Polen mit Joanna Juszczyk
(***englisches Interview***) Joanna Juszczyk ist seit 18 Jahren Englischlehrerin in Polen. Davon war sie die meiste Zeit an einer Mittelschule tätig. Seit drei Jahren arbeitet sie als Lehrerin an einer Grundschule. Vergangenes Jahr gewann sie den polnischen Wettbewerb „Brainly Educator of the Year 2020“ in der Kategorie Geisteswissenschaften. Im Podcast „School must go on“ spricht Joanna Juszczyk über das Schulsystem in Polen, wie dort derzeit der Unterricht stattfindet und über Tests. – Schulreform in Polen – Vor vier Jahren habe es in Polen eine große Bildungsreform gegeben. Zuvor seien Kinder zunächst auf eine Grundschule, dann auf eine Mittelschule und letztlich auf eine Oberschule gegangen. Im Rahmen der Reform wurde die Mittelschule jedoch abgeschafft und die Kinder verbringen nun acht Jahre auf der Grundschule. „Es ist nun genauso wie damals, als ich zur Schule gegangen bin, aber das ist halt mehr als 20 Jahre her“, merkt Joanna Juszczyk an. Es sei für die Reform nichts geplant gewesen, sodass die Grundschulen nun zu wenig Klassenräume und somit zu große Klassen haben. „Die Reform war nicht vorbereitet und sie wurde zu schnell eingeführt“, appelliert die Lehrerin. „Ich habe das Gefühl als Lehrerin, dass es sich nicht zum Guten für die Schüler/-innen verändert hat.“ – Über das ständige Testen und Benoten – Im polnischen Bildungssystem sei das Benoten der Kinder ein großer Bestandteil. Dadurch gebe es auch immer wieder und in allen Fächern Tests. „Die Lehrer/-innen können sich nicht vorstellen, Kinder zu unterrichten, ohne ihnen Tests zu geben“, erklärt Joanna Juszczyk. Der ganze Unterricht sei darauf ausgelegt, die Kinder auf die vielen Tests vorzubereiten und es bleibe keine Zeit für Konversationen oder Projekte. „Insbesondere in Englisch brauchen sie die Fähigkeit für ihr Leben, nicht für Tests. Sie müssen sprechen und die Sprache benutzen und nicht Tests schreiben“, erklärt die Grundschullehrerin. – Live-Unterricht während Corona – In Polen werde der Lehrplan und alles den Unterricht Betreffende durch das dortige Bildungsministerium vorgegeben. „Es gibt einen Lehrplan für das gesamte Land“, so die Pädagogin. Die lokalen Verwaltungen seien lediglich für organisatorische Aufgaben, wie das Renovieren von Schulgebäuden oder die Beschaffung von Computern zuständig. Anlässlich der ersten Schulschließungen im Frühjahr 2020 habe das Ministerium dann viel Autonomie und damit auch Verantwortung an die Schulen abgegeben. „Das war einerseits gut, weil es pragmatisch ist. Andererseits ging damit die ganze Verantwortung für die Dinge, die passieren und vielleicht auch nicht gut laufen, auf die Direktoren über“, erklärt Joanna Juszczyk. Nachdem der Unterricht während der ersten Schulschließungen noch viel aus dem Zusenden von Materialien bestanden habe, sei es mittlerweile üblich, den normalen Stundenplan als Live-Unterricht über Google, Zoom oder Microsoft abzuhalten und seine Schüler/-innen täglich zu sehen. „Die Direktoren haben über den Sommer gute Arbeit geleistet, was das Vorbereiten der Lehrkräfte und Organisieren des Unterrichts angeht“, lobt die Englischlehrerin. „Ich habe beobachtet, dass Kinder diesen Kontakt, wenn auch nur online, wirklich brauchen!“ Außerdem spricht Joanna Juszczyk über den Lehrkräftemangel in Polen, ihre Meinung zu Schulbüchern und was ihre Wünsche an das Bildungsministerium sind.
Spanien: Proteste gegen geplante Bildungsreform
Autor: Neuroth, Oliver Sendung: Campus & Karriere Hören bis: 19.01.2038 04:14
Campus und Karriere 23.11.2020, komplette Sendung
Autor: Maleike, Kate Sendung: Campus & Karriere Hören bis: 19.01.2038 04:14 Das Bildungsmagazin Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch Bundesgesundheitsminister Spahn schlägt Konzept für Schulen vor HörerInnen-Rubrik „Bildung unter Corona“ Eine Junglehrerin aus Baden-Württemberg erzählt Einheitliche Standards und klare Aussagen zur Pandemiebekämpfung Der Deutsche Kitaverband fordert Bundes- und Landesregierungen auf, einen nachvollziehbaren und transparenten „Winterfahrplan für Kindertagesstätten“ zu erlassen. Aufgezeichnetes Telefoninterview mit Waltraud Weegmann, Präsidentin des Dt. Kitaverbandes Studium in Corona-Zeiten: Noch mehr Hürden für Arbeiterkinder? Bei einer großen Online-Konferenz geht die Organisation ArbeiterKind.de der Frage nach, wie sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf die Bildungsgerechtigkeit auswirken Rubrik „International“: No! In Spanien gibt es Demonstrationen gegen die neue Bildungsreform, die ab nächstem Schuljahr in Kraft treten soll Am Mikrofon: Kate Maleike
Die neue Normalität - Wie Corona die Bildungswelt verändert
In unserer sechsten Folge behandeln wir das Thema “Zukunft der Bildung”, denn die Corona-Krise hat bekanntlich auch in der Bildungsbranche nachhaltige Veränderungen und Beschleunigungen verursacht. Auch in dieser Folge wieder mit hochkarätigen Gästen: Mila Cramer, Investment Managerin, Project A Ventures Daniel Zacharias, Gründer und CEO, Sdui Jenny Dreier, Investorin, EQT Ventures in Berlin Dazu Gastbeiträge von Sebastian Holtze ist Senior Manager und Prokurist bei PwC und Raffael Kaminski von der UX-Agentur Uxedo.
Warum verschlafen wir gerade die dringend nötige Bildungsreform, obwohl alle immer davon sprechen? Hilft Religion und Glaube im Alltag und im Leistungssport? Und was ist eigentlich in Thüringen los?In der 10. Folge (Yeah! Jubiläum!) von "Alles ist gut" sprechen wir über obige Fragen und Vieles mehr. Inhalt: (0:30) - Yeah! Jubiläumsfolge! (1:35) - Aufklärung EZB (5:53) - Politischer Wochenrückblick (21:29) - Steile These - Religion und Leistungsfähigkeit (31:53) - Thema der Woche - Bildung, Bildung, Bildung (1:26:05) - Die "nicht schlechte Nachricht" - Sturm Sabine (1:29:57) - Empfehlung der Woche
Was ist das Wichtigste, das man in der Schule lernen kann? Fehler machen!! Denn dann wächst das Gehirn. Erstklässler, die ihren ersten wissenschaftlichen Versuch mit Schokolade machen. Abiturienten, die 48 Stunden im Wald verbringen, um zu lernen, wie man Einsamkeit aushält. Siebtklässler, die überall im Land das gleiche Buch lesen, um auf Twitter darüber zu diskutieren. Und ein Schuldirektor, der jedes Kind morgens wie ein Gastgeber persönlich begrüßt. So geht Schule in Neuseeland und darüber spricht Julie in dieser Episode mit Verena Friederike Hasel, Psychologin, Journalistin und Autorin von u.a. „Der tanzende Direktor“. Mit Einblicken in ihre eigenen Erfahrungen tauschen sich die beiden Frauen ehrlich und offen zu unserem Bildungssystem aus. Sie fordern eine drastische Veränderung und dass wir uns alle aktiv für unsere Kinder einsetzen! Bildung darf nicht politischem Boden folgen, dafür ist es zu wichtig!
Wie ein Donnerhall wirkte die Antrittsrede, die der Philosoph, Humanist und Theologe am 28. August 1518 in Wittenberg hielt. Enthusiastisch forderte Melanchthon die Befreiung der Universitäten und des wissbegierigen Menschen aus den Fesseln der Scholastik und eine freie und rationale Wissenschaft. Seine Ideen sind aktueller denn je. Von Heike Schmoll
Diesmal erzählt Matthias von Hellfeld von Alkuin, einem Gelehrten am Hofe Karls des Großen. Alkuin hat im Frühmittelalter den Grundstein für eine Wissensgesellschaft gelegt und ist – unter anderem – verantwortlich für eine umfassende Bildungsreform, deretwegen wir heute die Schrift schreiben, die wir schreiben: Die karolingische Minuskel. Die passende Ausgabe von DRadio Wissens “Eine Stunde History” […]
WR547 Alkuin und die karolingische Minuskel
Diesmal erzählt Matthias von Hellfeld von Alkuin, einem Gelehrten am Hofe Karls des Großen. Alkuin hat im Frühmittelalter den Grundstein für eine Wissensgesellschaft gelegt und ist – unter anderem – verantwortlich für eine umfassende Bildungsreform, deretwegen wir heute die Schrift schreiben, die wir schreiben: Die karolingische Minuskel. Die passende Ausgabe von DRadio Wissens “Eine Stunde History” […]
Diesmal erzählt Matthias von Hellfeld von Alkuin, einem Gelehrten am Hofe Karls des Großen. Alkuin hat im Frühmittelalter den Grundstein für eine Wissensgesellschaft gelegt und ist – unter anderem – verantwortlich für eine umfassende Bildungsreform, deretwegen wir heute die Schrift schreiben, die wir schreiben: Die karolingische Minuskel. Die passende Ausgabe von DRadio Wissens “Eine Stunde History” […]
Nicht fürs Leben, sondern für die Sklaverei lernen die Amis
Kinder gehen in die Schule, um lesen, schreiben und rechnen – und neuerdings auch programmieren – zu lernen. Das meinen jedenfalls die Naiven, Nicht-Eingeweihten. Die mit dem Durchblick wissen: Die Schule ist dazu da, Propaganda zu verbreiten und aus Kindern willige Arbeitssklaven für die grossen Unternehmen zu produzieren. Erst so richtig schlimm wird das mit der neuen Bildungsreform namens «Common Core». Die verspricht Chancengleichheit, fördert aber bloss Kommunismus, Homosexualität und Umverteilung. Zum Glück haben die Amerikaner die Republikaner und die Tea-Party, die mutig gegen dergleichen antreten... Aus dem Morgomat vom 4. September 2014.
Nahtlos schließen wir an die letzte Folge an und sprechen über den Oberstufenunterricht im DDR-Schulsystem. Nach einem kurzen Abriss der Fächer beschäftigen wir uns ausführlich mit den verschiedenen Schulabschlüssen und gehen der Frage nach, ob nach der Schule im Arbeiter- und Bauernstaat jeder wirklich seinen Traumberuf ergreifen konnte. Außerdem klären wir besondere Arten der Talentförderung und erinnern an den Polytechnischen Unterricht. Gegen Ende wagen wir dann noch ein kleines Gedankenexperiment (angeregt durch einen Artikel aus der "Zeit"): Gab es positive Elemente der DDR-Schule, die selbst heute noch zur "Bildungsreform" taugen würden?