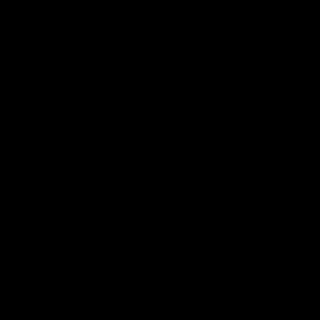Podcasts about augenklinik
- 32PODCASTS
- 41EPISODES
- 31mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Sep 30, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about augenklinik
Latest podcast episodes about augenklinik
Von A wie Altersweitsichtigkeit über G wie Grauer Star und K wie Kurzsichtigkeit bis zu T wie trockenes Auge - Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der LMU München, beantwortet alle Fragen zur Augenheilkunde.
Freiburger Kantonsparlament entscheidet über Mietvorlagen
Auch im Kanton Freiburg werden leere und günstige Wohnungen immer rarer. Auch wenn die Situation noch nicht so schlimm ist wie in anderen Kantonen, wurde im Grossen Rat über verschiedene Vorstösse diskutiert, welche dagegen vorgehen wollten. Weiter in der Sendung: · Die Strecke zwischen Täsch und Zermatt auf der Matterhorn-Gotthard Strecke bleibt wegen eines Steinschlages zu. · Der Kanton Bern stellt seine Kontrollschilder ab März 2026 in der Justizvollzugsanstalt Thorberg her. · Das Marie-Colinet-Haus, zukünftiges zuhause der Frauenklinik, der Augenklinik und der Neonatologie des Inselspitals, soll im Sommer 2026 eröffnet werden.
#120 - Dr. Jørn Jørgensen, Founder & CEO von EuroEyes: Von Kurzsicht zur Klarheit – Eine Augenklinik auf Erfolgskurs
In dieser spannenden Podcast-Folge haben wir einen besonderen Gast: Dr. Jørn Slot Jørgensen, CEO und Gründer von EuroEyes. Er teilt seine beeindruckende Reise von der Gründung der ersten Klinik bis hin zur internationalen Expansion und wie er dabei Tausenden von Menschen zu einer klaren Sicht verholfen hat, darunter auch unserem Host Thomas Derksen.Dr. Jørgensen spricht über die Herausforderungen und Erfolge auf diesem Weg, die Technologien, die bei EuroEyes eingesetzt werden und die Bedeutung von Vertrauen und exzellenter Patientenbetreuung. Er gibt Einblicke in die verschiedenen Operationsmethoden, die den Patienten ein brillenfreies Leben ermöglichen, und erläutert, warum China ein so bedeutender Markt für das Unternehmen geworden ist.Egal, ob du selbst eine Augenoperation in Erwägung ziehst oder einfach mehr über die faszinierende Welt der Augenchirurgie erfahren möchtst – diese Episode bietet wertvolle Informationen und inspirierende Geschichten.Unbedingt mitmachen - Unsere Diskussionsfrage für die nächste Woche:In Deutschland gibt es Unverständnis für die Menge an Werbung von chinesischen Marken bei der EM. Schließlich sei es ja eine EUROPA-Meisterschaft. Wahrscheinlich haben diese Leute keine Ahnung davon, wie viele Millionen Chinesen mitten in der Nacht aus dem Bett steigen, um zu schauen, wie Deutschland, Italien und Schottland sich schlagen. Was ist eure Meinung dazu, dass man überall BYD, Alipay und Hisense sieht?So kannst du teilnehmen:Nimm eine Sprachnachricht auf, in der du deine Meinung zur Frage der Woche äußerst.Schicke die Sprachnachricht an +49 155 102 483 27.Mit etwas Glück wird deine Nachricht in der nächsten Folge unseres Podcasts zu hören sein!Wir freuen uns auf deine Beiträge und sind gespannt, was du davon hältst!Du möchtest dich bei EuroEyes bewerben? https://www.euroeyes.de/karriere-bei-euroeyes/Hier geht es zu unseren LinkedIn-Accounts: DamianThomasDr. JørgensenSend us a Text Message.
Von A wie Altersweitsichtigkeit über G wie Grauer Star und K wie Kurzsichtigkeit bis zu T wie trockenes Auge - Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der LMU München, beantwortet alle Fragen zur Augenheilkunde.
Grüner Star: Durchbruch bei der Früherkennung
Glaukom – im Volksmund auch Grüner Star genannt – kann unbehandelt zur Erblindung führen. Grundsätzlich gilt: Je früher ein Glaukom erkannt wird, desto besser. Neue Methoden, die an der Uniklinik Mainz entwickelt werden, sollen die Früherkennung schneller und einfacher machen. Christine Langer im Gespräch Prof. Norbert Pfeiffer, Vorstandsmitglied der Stiftung Auge und Direktor der Augenklinik und Poliklinik an der Uniklinik Mainz.
Von A wie Altersweitsichtigkeit über G wie Grauer Star und K wie Kurzsichtigkeit bis zu T wie trockenes Auge - Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der LMU München, beantwortet alle Fragen zur Augenheilkunde.
KSBL schliesst Schmerzklinik beim Bruderholzspital
Ende Jahr wird die Klinik für Schmerztherapie des KSBL geschlossen. Der Betrieb der Klinik sei defizitär gewesen. Aus demselben Grund wurde vor einigen Wochen die Schliessung der Augenklinik in Liestal bekanntgegeben.
Von A wie Altersweitsichtigkeit über G wie Grauer Star und K wie Kurzsichtigkeit bis zu T wie trockenes Auge - Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der LMU München, beantwortet alle Fragen zur Augenheilkunde.
#22: Gut Sehen - Wie halte ich meine Augen gesund und welche sind die besten Laser-OPs?
Auf Herz und Nieren – Der Podcast für ein gutes Körpergefühl
Immer mehr Menschen werden kurzsichtig. Liegt das an der vielen Bildschirmarbeit? Und wie können wir gegensteuern? Darüber sprechen wir mit Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt uns auch, wie wir unsere Augen gesund halten können und welche Vor- und Nachteile Brillen, Kontaktlinsen und Laser-OPs haben. Außerdem beschreibt Augenoptikerin Tanja Kneisel zwei konkrete Übungen, wie wir unsere Augen bei langer Bildschirmarbeit entlasten können.
Uganda: Abenteuerlicher Foto-Auftrag für einen guten Zweck
Christian Beck ist nach Uganda gereist, um dort den Aufbau einer Augenklinik sowie die erste Operation in Bildern festzuhalten. Das Projekt geht auf eine Initiative des Vereins “Uganda Hilfe” und der Stiftung “Besseres Sehen” zurück. In diesem Interview erzählt der Redakteur des fotoforum-Magazins, was er auf der Reise nach Afrika erlebt hat und wie er die Arbeit vor Ort dokumentiert hat. Weitere Themen Christian erzählt, wie er an das visuelle Geschichtenerzählen in der Reportagefotografie herangeht und wie das konkret in Uganda ausgesehen hat. Eine Reise mit Langzeitwirkung: Christian schwärmt: “Afrika ist ein pures Abenteuer” Land & Leute: Welche Eindrücke hat Christian mitgenommen? Außerdem erzählt er viele Anekdoten. U.a. die Geschichte, warum eine Frau mit einem Huhn in der Sprechstunde der Augenklinik erschienen ist. In seinem Podcast radioRAW war Christians Uganda-Reise ebenso bereits Thema wie in einem Artikel in den Westfälischen Nachrichten. Einmal pro Jahr ist Christian auch als Referent einer Fotoreise in Island unterwegs. Die Shownotes und Bilder zu dieser Episode findest du unter: https://www.gatesieben.de/podcast/christian-beck --- Street Photography Workshop 2023 in Hamburg Street Photography ist nicht nur eines der abwechslungsreichsten Genres in der Fotografie – sondern auch eines der faszinierendsten. Auf der "Spielwiese der Reportage", wie wir sie gerne nennen, kann man sich herrlich austoben. Und Spaß haben. Das haben nicht zuletzt die beiden Street-Photography-Workshops am Rande der PHOTOPIA 2022 in Hamburg gezeigt. Grund genug, auch im kommenden Jahr wieder auf Streetfoto-Jagd rund um Elbe und Alster zu gehen. Der Termin: 20. September 2023. Die Premiere war wunderbar und dementsprechend groß ist auch schon die Vorfreude auf neue Motive und Erlebnisse. Bist du mit dabei? Dann kannst du dir hier deinen Platz sichern: https://shop.abenteuer-reportagefotografie.de/produkt/street-photography-workshop-in-hamburg-20-september-2023/ Wir freuen uns auf ein Wiedersehen (oder Kennenlernen) mit dir in Hamburg! Außerdem gibt es zwei weitere Workshops – in Helsinki und Lissabon. --- "Abenteuer Reportagefotografie" Wenn dich das Thema Storytelling und Geschichten in Bildern erzählen interessiert, dann ist der exklusive Podcast etwas für dich, den ich gemeinsam mit Thomas Jones von den Photologen im Rahmen unseres Projekts "Abenteuer Reportagefotografie" machen. Wie du ihn abonnieren kannst und was dich sonst noch alles erwartet, erfährst du auf www.abenteuer-reportagefotografie.de Wir würden uns sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust. --- Unser Buch: "Mit Bildern Geschichten erzählen: Wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt"
Die Abrissbirne begrüßt heute einen besonderen Gast: Dr. Motschmann, Chefarzt einer Augenklinik und im Widerstand gegen das C-Regime und die einrichtungsbezogene Impfpflicht der ersten Stunde. Ein Gespräch über die derzeitige Situation im Land, seine Handpuppen und ihre Propaganda-Zentralorgane. Hört selbst und Viel Spaß beim selbst denken! und auf Telegram: https://t.me/abrissbirneofficial Hier der Link, wenn Ihr Kommentare, Kritik oder Meinungen per Sprachnachricht senden wollt: https://anchor.fm/zwayne-mc/message Der Link zur Facebook-seite von Dr. Motschmann: https://fb.watch/gfYTpFiFhy/ Teil 2 der Corona-Trilogie: Sven Thiele, Die Corona-Krise. Wie Politik und Medien gemeinsam tricksen und manipulieren, der Link: https://amzn.to/3jJdeBZ Wenn Ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt Ihr das mit einer Schenkung tun: auf ko-fi.com/abrissbirne und Bitcoin: 3MSVxcgSkSGvBmjh7SPMCFjX6wMSQUykRf Wir sagen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/zwayne-mc/message
277 - Diabetisches Makulaödem oder wenn der Zucker auf die Augen geht
Zuckerjunkies - Ein Leben mit Diabetes Typ 1 vom Diabetiker für Diabetiker mit Sascha Schworm
[Werbung] Diese Podcastfolge entstand durch die freundliche Unterstützung von Novartis Pharma GmbH. [/Werbung] Show Notes https://www.novartis.com/de-de/ Herr PD Dr. med. Jakob Siedlecki, FEBO http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Augenklinik-und-Poliklinik/de/Klinik/Aerzte/prof_pd/siedlecki_jakob/index.html Frau Diana Droßel https://www.diabetesde.org/portraet-diana-drossel-stellvertretende-vorstandsvorsitzende
„Miteinander – füreinander“: Kölner Kirchenbank über die Gemeinschaftsstiftung Diakonie
Evangelisch Leben in Köln und Region - Die Kölner Kirchenbank
Miteinander – füreinander“: Das ist das Motto der Gemeinschaftsstiftung Diakonie in Köln. Diese Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Projekte zu fördern – da, wo Menschen friedlich miteinander zusammenleben oder zusammenarbeiten. Die Gemeinschaftsstiftung Diakonie versucht, Gelder einzusetzen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Was genau dahinter steht, erzählt Martina Schönhals heute auf der Kölner Kirchenbank Sammy Wintersohl. Martina Schönhals ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Gemeinschaftsstiftung: „Dahinter steckt der Evangelische Kirchenverband Köln und Region, der sich vor fast 25 Jahren vorgenommen hat, langfristig sozial diakonische Arbeit in Köln und Region zu fördern und darum diese Stiftung mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinden gegründet hat“, berichtet sie. „Gefördert werden diakonische Organisationen, die zum Beispiel Menschen beraten, die arbeitslos sind, die wohnungslos sind. Es werden aber auch ganz konkrete Projekte für Jugendliche, für Senioren und Projekte, die die Generationen verbinden, gefördert.“ „Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung Diakonie – das ist eine Gemeinschaftsstiftung – haben sich im Laufe der 25 Jahre verschiedene kleinere Stiftungen gegründet, die unterschiedliche Zwecke verfolgen. Aber es müssen immer soziale Zwecke sein, die das friedliche Miteinander fördern“, beschreibt sie. Im Moment seien es fünf Treuhandstiftungen. Wie das Ganze funktioniert? „Wir lassen das Geld arbeiten, um dann mit dem Geld, was wir erarbeiten, Gutes zu tun. Wir freuen uns über jede Spende, die kommt – aber das ist nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck ist, das Vermögen langfristig so anzulegen, dass ein Ertrag daraus hervorgeht, trotz niedriger Zinsen. Und dass wir mit diesen Erträgnissen dann die sozialen Projekte unterstützen können.“ Ein Beispiel? Eine Stifterin habe gesagt: „Mir liegt meine Kirchengemeinde so am Herzen, ich gebe jetzt mal einen Betrag und aus den Zinsen, Dividenden, soll die Jugendarbeit in meiner Kirchengemeinde vor Ort gefördert werden und auch die Seniorenarbeit.“ Und dann habe man ganz konkret überlegt, „wie können wir Jugend und Senioren verbinden, sind mit der Gemeinde ins Gespräch gekommen und da ist jetzt der Platz vor der Kirche so gestaltet worden, dass sich Jugendliche und Senioren dort gut treffen können – und das waren natürlich ganz im Sinne der Stifterin“, sagt Martina Schönhals. Eine andere Stifterin habe gesagt: „Meine Mutter ist früh erblindet und ich möchte mich für die Blindenforschung engagieren.“ Hier werden die Erträgnisse einem Förderverein der Augenklinik zum Beispiel für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. „Die Stiftung wird immer für die Ewigkeit angelegt“ Man könne sich sicher sein, dass das Geld nicht doch für andere Zwecke genutzt wird, erklärt Martina Schönhals: „Das ist verboten. Der Stifterwille ist das oberste Gebot einer jeden Stiftung. Die Stiftung wird immer für die Ewigkeit angelegt und oberstes Gebot ist es, den Willen des Stifters auf Ewigkeit umzusetzen.“ Es gebe nur eine einzige Ausnahme: Wenn der Stiftungszweck nicht mehr da ist. „Nehmen wir mal an, es gäbe keine Jugendlichen mehr in der Gemeinde, dann kann ich keine Jugendarbeit mehr fördern,“ erläutert sie. Sie betont: „Je größer das Stiftungsvermögen ist, desto besser kann man verhandeln mit den Banken, desto mehr kann man auch für den guten Zweck herauswirtschaften.“ Es sei eine schöne Sache, „an der alle nur gewinnen können“. Mehr Informationen auf: www.gemeinschaftsstiftung-diakonie.de
Kennst Du? - Alexandra Roth (Augenklinik Roth, NoK.O.)
Kennst Du? - Alexandra Roth (Augenklinik Roth, NoK.O.) Positiv, Mama, einfach ich Eine wundervolle junge Frau, Bonnerin und Bonna, lebensfroh und ideenreich, die wie ein Medienprofi mal eben locker vom Leder erzählt. Hat von Euch da draußen sonst noch jemand eine eigene Kita? Coole Sache Und als ihr was wirklich schlimmes geschieht, macht Sie noch was richtig gutes draus. Top Alex. Danke für alle die Du mit deiner Sache erreichst! *** 3 Sterne ***
Abrissbirne #235 vom 08.02.2022, Interview mit Dr. Markus Motschmann
Hier der Link, wenn Ihr Kommentare, Kritik oder Meinungen per Sprachnachricht senden wollt: https://anchor.fm/zwayne-mc/message Dr. Markus Motschmann ist seit 22 Jahren Chefarzt einer Augenklinik in Haldensleben und hat sich arbeitslos gemeldet, als der Bundestag die Impfpflicht im Gesundheitswesen beschloss. Respekt vor dieser Entscheidung! Und was Dr. Motschmann dazu bewegte, diesen Schritt zu tun, was er von der aktuellen Politik und ärztlicher Kunst in Zeiten von Corina hält, erfahrt Ihr heute im Interview mit ihm. Hört selbst und Viel Spaß beim selbst denken! und auf Telegram: https://t.me/abrissbirneofficial Link zur Webseite mit den kostenfreien Designs zum Herunterladen, ausdrucken, verteilen: www.gegenwind20xx.wordpress.com Teil 2 der Corona-Trilogie: Sven Thiele, Die Corona-Krise. Wie Politik und Medien gemeinsam tricksen und manipulieren, der Link: https://amzn.to/3jJdeBZ Wenn Ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt Ihr das mit einer Schenkung tun: auf ko-fi.com/abrissbirne und Bitcoin: 3MSVxcgSkSGvBmjh7SPMCFjX6wMSQUykRf Wir sagen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/zwayne-mc/message
Wie man im Alter „Adleraugen“ behält
Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist der häufigste Grund für eine Erblindung im Alter. Doch so weit müsse es nicht kommen, erklärt Privatdozent Dr. Ulrich Schaudig. Der Chefarzt der Augenklinik an der Asklepios Klinik Barmbek klärt über Diagnostik und Therapie („wir spritzen ins Auge!“) auf.
"Will ich wirklich wieder sehen können?"
"Will ich wirklich wieder sehen können?"Nicht nur Sehende fragen mich dies öfters, auch ich persönlich habe mich ganz oft mit der Frage auseinander gesetzt.Inspiriert von einem Podcast vom BR habe ich dieses Thema heute in der Episode verarbeitet.Meine Antwort: einfach reinhören.Den Link zum BR-Podcast findet ihr in den Shownotes
"Büroaugensyndrom": Chefarzt Prof. Josef Schmidbauer über Homeoffice, Homeschooling und die Folgen für unsere Augen
Bildschirmarbeit und Videokonferenzen: Im vergangenen Jahr haben viele durch Homeoffice und Homeschooling noch mehr Zeit vor Bildschirmen, Monitoren oder auch dem Handy-Display verbracht als früher. Das hat auch Auswirkungen auf's Sehen. Professor Josef Schmidbauer, Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Nürnberg, erklärt, was gegen trockene, gereizte und überanstrengte Augen hilft.
Von A wie Altersweitsichtigkeit über G wie Grauer Star und K wie Kurzsichtigkeit bis zu T wie trockenes Auge - Prof. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik der LMU München, beantwortet alle Fragen zur Augenheilkunde.
Kennst Du? - Alexandra Roth (Augenklinik Roth, NoK.O.)
Positiv, Mama, einfach ich Eine wundervolle junge Frau, Bonnerin und Bonna, lebensfroh und ideenreich, die wie ein Medienprofi mal eben locker vom Leder erzählt. Hat von Euch da draußen sonst noch jemand eine eigene Kita? Coole Sache Und als ihr was wirklich schlimmes geschieht, macht Sie noch was richtig gutes draus. Top Alex. Danke für alle die Du mit deiner Sache erreichst! *** 3 Sterne *** ------------------------------------------------------------------------------------- Hört rein bei: www.bonnfest.de Spotify: https://open.spotify.com/show/4TRIvZSLFd0Y6QxPyDF18o Deezer, Amazon Music, TuneIn, Google Podcast, Youtube,
010 | Der Mediziner Dr. Jens-Ulrich Rüffer über Gesundheitskompetenz, Kommunikation – und die drei Fragen, die jeder Pat
Privatdozent Dr. Jens-Ulrich Rüffer ist Mediziner, Menschenfreund und Tausendsassa. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatoonkologie, Vorsitzender der Deutschen Fatigue Gesellschaft, Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft und war über Jahre Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie (PSO). Außerdem ist er Autor, Filmemacher und Chef von Takepart-Media, einer Agentur für Medizinkommunikation. Vor 20 Jahren lehnte er mehrer lukrative Posten ab und verschrieb sich ganz seiner Mission: Die Medizin patientenfreundlicher und Kranke zu Spezialisten für ihre Erkrankung zu machen sowie Ärzt*innen für die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Patienten zu sensibilisieren. Denn Schema F führt oft nicht zu den besten Ergebnissen. Und bei mehreren Therapie-Optionen ist eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient*in in den allermeisten Fällen ein Garant für einen besseren Therapie-Erfolg – und eine größere Zufriedenheit bei Behandelnden und Behandelten. Shared Decisision Making (SDM) ist der Fachbegriff für diese Art der Kommunikation in Praxen und Kliniken. An der Uniklinik Schleswig-Holstein wird dieses System derzeit in allen Bereichen von der Augenklinik bis zur Zahnmedizin eingeführt, gefördert mit 14 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds der Bundesregierung. Ein tolles Projekt und ein toller Mensch – kölscher Jung dazu. Alle Zutaten für ein gutes Gespräch also... Shownotes: Agentur Takepart: https://takepart-media.de Shared Decision Making: https://www.uksh.de/sdm Buch: Wenn eine Begegnung alles verändert – Ärztinnen und Ärzte erzählen https://www.atp-verlag.de/publikationen/wenn-eine-begegnung-alles-veraendert-aerztinnen-und-aerzte-erzaehlen/
Noch genau ein Monat bis Weihnachten: Alleinunterhalter Rudi Vogel ist wieder auf Tour (dieses Jahr per Video) und singt seine wunderschönen Weihnachtslieder. Der beste Moment für eine Korrektur und ein Anruf in der Augenklinik.
Podcast: Diabetes und Augenerkrankungen – ein Interview
Es ist Zeit für eine weitere Podcast-Staffel aus der Reihe „Blood Sugar Lounge fragt nach“! Dabei spricht Antje mit verschiedenen Experten über Diabetes und Folgeerkrankungen. Heute geht es um Augenerkrankungen. Antjes Gesprächspartner ist der Augenarzt Prof. Dr. Focke Ziemssen, der am Universitätsklinikum Tübingen als stellvertretender Leiter der Augenklinik arbeitet. Weiterlesen... Der Beitrag Podcast: Diabetes und Augenerkrankungen – ein Interview erschien zuerst auf Blood Sugar Lounge.
Podcast: Diabetes und Augenerkrankungen – ein Interview
Es ist Zeit für eine weitere Podcast-Staffel aus der Reihe „Blood Sugar Lounge fragt nach“! Dabei spricht Antje mit verschiedenen Experten über Diabetes und Folgeerkrankungen. Heute geht es um Augenerkrankungen. Antjes Gesprächspartner ist der Augenarzt Prof. Dr. Focke Ziemssen, der am Universitätsklinikum Tübingen als stellvertretender Leiter der Augenklinik arbeitet. Weiterlesen... Der Beitrag Podcast: Diabetes und Augenerkrankungen – ein Interview erschien zuerst auf Blood Sugar Lounge.
Risikofaktoren für ein Hornhaut-Transplantatversagen bei perforierenden Keratoplastiken an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Thu, 17 Dec 2015 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19070/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19070/1/Kaiser_Michaela.pdf Kaiser, Michaela
Vortrag Basler Fortbildungstage 2014 – Retina update Augenklinik Universität Basel OCTlab
Anbei finden Sie für Ihren persönlichen Gebrauch, meinen Vortrag - gehalten an den Basler Fortbildungstagen 2014 der Augenklinik der Universität Basel, Schweiz. Ziel des Vortrages war es, mit einigen Tipps und Tricks auf Fehlerquellen hinzuweisen und diese zu vermeiden./Find enclosed my presentation about hints and tricks in the use of OCT (for personal use only). Dr. med. Peter Maloca, Luzern & University Basel, Switzerland. Download >Script OCT Tipps Tricks Uni Basel & Luzern Dr.med. Peter Maloca (PDF, 10MB)
Patientensymposium Glaukom - Dr. M. Universitaets-Augenklinik Wuerzburg
Patientensymposium Glaukom, Referentin: Dr. G. Kann, Universitäts-Augenklinik Würzburg
Altersbedingte Makuladegeneration - Dr. med. R. Krist - Oberarzt der Augenklinik Buergerhospital - Frankfurt
Altersbedingte Makuladegeneration, Dr. med. R. Krist, Oberarzt der Augenklinik Bürgerhospital, Frankfurt
Augapfelprellungen können eine Unfallfolge sein, wie uns der Chefarzt unserer Augenklinik, Herr Dr. med. Jörg Seewald erläutert. Typische Ursachen einer Augapfelprellung können Faustschläge, Sektkorken, Bälle oder auch wegspringende Holzscheite beim Holzhacken sein.
SP020 Das Gewinnspiel, Parkautomaten, mein Herzrasen und die Augenklinik
Weiter berichte ich euch von meinem erneuten Besuch in der Uni-Augenklinik und was es mit den Parkautomaten und meinem Herzrasen auf sich hat.
Raumforderungen im Bereich der Orbita an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in den Jahrgängen 1991-2000
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Die große Variationsbreite tumoröser Prozesse im anatomisch eng begrenzten Raum der Orbita stellt eine Herausforderung in der augenärztlichen Praxis dar. Das diagnostische und therapeutische Procedere gestaltet sich, je nach Grunderkrankung, höchst unterschiedlich, und ist für den weiteren Krankheitsverlauf und das “outcome“ von entscheidender Bedeutung. Bei der niedrigen Inzidenz von Orbitatumoren finden sich in der deutschen Literatur zu diesem Thema keine Erhebungen mit größeren Fallzahlen. Die publizierten internationalen Veröffentlichungen kommen, je nach geographischer Herkunft, erfassendem Zentrum und Studiendesign, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen (Albert et al 2003). Das Ziel dieser Arbeit ist die Erfassung von Häufigkeitsverteilung und diagnostischen Charakteristika der verschiedenen orbitalen Prozesse, die an der Augenklinik der Universität München von 1991 bis 2000 histologisch verifiziert wurden. Hierzu erfolgt retrospektiv die Auswertung von 149 Patientenakten. In Hinblick auf die Fallzahl stellt diese Arbeit unseres Wissens nach die umfangreichste bisher veröffentlichte deutsche Erhebung zu diesem Thema dar. Es können insgesamt 42 verschiedene Entitäten nachgewiesen werden. Fast zwei Drittel der Fälle (63,7%) machen Neoplasien aus, und Malignome bestehen bei knapp der Hälfte (71 Fälle, 47,6%) der Patienten. Die häufigsten Arten sind: Non-Hodkin-Lymphome (18,7%), Dakryoadenitis (10,7%), kavernöse Hämangiome (5,4%) und Dermoidzysten (5,4%), Plattenepithelkarzinome (von den Lidern ausgehend) (4%), pleomorphe Adenome (4%), Aderhautmelanome (mit orbitaler Ausdehnung) (3,3%), Basaliome (von den Lidern ausgehend) (3,3%), Metastasen (3,3%), der Pseudotumor orbitae (3,3%) und das Rhabdomyosarkom (3,3%). Mehr als 50% der Orbitatumoren treten innerhalb der sechsten bis achten Lebensdekade auf. Abhängig vom Lebensalter variiert die Prävalenz der verschiedenen Tumoren sehr deutlich. Die in diesem Kollektiv am häufigsten genannten klinischen Zeichen und Symptome sind: Tastbarer Tumor (53,7%), protusio bulbi (42,3%), Lidödem (35,5%), Schmerzen (32,8), eingeschränkte Motilität / Doppelbilder (32,1%), Ptosis (18,1%), Visusminderung (16,1%). Bei den Bildgebenden Verfahren besteht beim Ultraschall in 65% der Fälle, beim MRT in 47% der Fälle und beim CT in 41% der Fälle eine Übereinstimmung zwischen dem erhobenen Befund und der Histologie. Eine Exenteratio orbitae ist fast ausschließlich bei sekundären Orbitatumoren notwendig. Um diesen radikalen operativen Eingriff zu vermeiden, empfiehlt sich die Behandlung aller sekundären Orbitatumoren oder ihrer Vorstufen in einem frühen Stadium.
Verbesserte Gerätesicherheit bei Vitrektomie Presseinformation, Kongress Auftraggeber: Augenklinik, Autoren: Norbert F. Schrage, Pit Aretz Herstellung: 2003, Sprache: deutsch - Programmdauer: 2:30
Untersuchungen über die Folgen des Verlustes von retinalem Pigmentepithel nach chirurgischer Extraktion von chorioidalen Neovaskularisationen aufgrund altersbedingter Makuladegeneration
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Einleitung: Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist der führende Grund für Blindheit im Sinne des Gesetzes in den westlichen Industrienationen mit stark steigender Inzidenz und Prävalenz. Es gibt verschiedene Formen der AMD. Besonders die so genannte „feuchte Form“, die durch die Entstehung von chorioidalen Neovaskularisationsmembranen (CNV) am Ort des schärfsten Sehens gekennzeichnet ist, führt oft zu einem rasch progredienten Abfall des Visus. Für die Diagnostik solcher Neovaskularisationsmembranen dient neben der klinischen Untersuchung vor allem die Darstellung mittels Fluoreszenzangiographie (FLA), anhand derer auch eine weitere Einteilung von CNVs in verschiedene Typen (z.B. „klassische“ oder „okkulte“ Membranen) vorgenommen wird. Auch Defekte im retinalen Pigmentepithel, das topographisch der Netzhaut benachbart liegt, lassen sich diagnostisch mittels der FLA darstellen und quantifizieren. Bis dato stand als einzige aktive Therapieoption für diese Membranen die Verödung mittels Argon-Laser zur Verfügung, die allerdings auch unweigerlich mit einer Zerstörung der darüber liegenden neurosensorischen Netzhaut einhergeht. Daher wurde an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität der Weg der chirurgischen Intervention beschritten, bei dem nach einer Pars-Plana-Vitrektomie und Retinotomie die entsprechende subfoveal gelegene Membran oder Blutung aus dem Subretinalraum extrahiert wird. Zwangsweise kommt es – wie sich herausstellte – dabei durch die Membranstruktur bedingt jedoch auch immer zu einer Mitentfernung von retinalem Pigmentepithel (RPE), das für die Netzhaut eine trophische Funktion besitzt. Methodik: Bei der Nachbeobachtung der Patienten fiel auf, dass es zu Rezidiven von CNVs kam. Ausgangspunkt dieser Studie war die Fragestellung, ob ein Zusammenhang zwischen Größe der RPE-Defekte und Rezidivwahrscheinlichkeit besteht. Hierzu wurden retrospektiv die Krankenakten und Fluoreszenzangiographien von 51 operierten Patienten ausgewertet, die Größe der RPE-Defekte auf postoperativ angefertigten Angiographien ausgemessen und zum Auftreten eines Rezidives bzw. zum Rezidivzeitpunkt in Relation gesetzt. Ergebnisse: Dabei konnte festgestellt werden, dass kleinere RPE-Defekte mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sowohl für ein Auftreten eines Rezidives, als auch mit der für einen früheren Rezidivzeitpunkt einhergehen. Des weiteren ergab sich eine negative Korrelation zwischen der Größe des RPE-Defektes und dem bestkorrigierten Visus zu verschiedenen postoperativen Zeitpunkten während des ersten Jahres nach der Operation (bei einer Nachbeobachtungszeit von bis zu vier Jahren). Dementsprechend ergab sich auch eine positive Korrelation mit dem benötigten Vergrößerungsfaktor einiger Patienten. Zudem lässt sich eine Funktionsdiagnostik der Netzhaut, v.a. der Makula, mit Hilfe der Mikroperimetrie betreiben. Bei den mit dieser Diagnostikmöglichkeit untersuchten Patienten zeigten sich statistisch signifikante positive Korrelationen zwischen den RPE-Defekten und den gemessenen absoluten und relativen Skotomen. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Größe des RPE-Defektes und einer Visusverbesserung oder –verschlechterung konnte dabei nicht festgestellt werden, jedoch eine positive Korrelation zwischen präoperativen und dem besten postoperativ erreichten Visus. Diskussion: Mit Hilfe der chirurgischen Membranektomie lässt sich zwar eine Stabilisierung der Sehschärfe erreichen, die entstandenen RPE-Defekte sind aber Ursache des fehlenden Anstiegs des Visus. Andere Faktoren wie Vorschädigungen der Strukturen von Aderhaut, Bruch’scher Membran, RPE und Netzhaut durch den Krankheitsprozess spielen eine zusätzliche Rolle. Auch Lokalisation und Wachstumsmuster von Neovaskularisationen können einen Einfluss auf die postoperativ erreichten Sehschärfen haben. Dies zeigt sich insbesondere im Vergleich mit in der Literatur angegebenen Ergebnissen nach subfovealer Membranektomie bei anderen Erkrankungen, die mit der Bildung chorioidaler Neovaskularisationen einherge-hen. Die Beobachtung, dass kleinere RPE-Defekte mit einer erhöhten Rezidivrate einhergehen, lässt Rückschlüsse auf die mögliche Rolle des RPE bei der primären Krankheitsentstehung zu. Insbesondere unterstützt sie die These, dass zwischen zentralem und mittelperipherem retina-len Pigmentepithel Unterschiede bestehen z.B. in Bezug auf die Synthese von Wachstumsfak-toren, die bei der Entstehung solcher Membranen eine entscheidende Rolle spielen oder al-tersbedingte Unterschiede bezüglich der regenerativen Kapazität der RPE-Zellen. Für künfti-ge Therapieoptionen mit dem Resultat einer verbesserten Sehschärfe müssten Wege gefunden werden, den geschädigten Komplex von Bruch’scher Membran und RPE wiederherzustellen.
Ergebnisse dosierter Obliquus-inferior-Chirurgie zur Behandlung des einseitigen Strabismus sursoadductorius
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
In dieser an der Augenklinik der Universität München an 234 Patienten durchgeführten Studie wurden unterschiedliche Aspekte einer dosierten Rücklagerung des M. obliquus inferior bei Patienten mit einseitigem Strabismus sursoadductorius über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren untersucht. Anhand dieser Studie konnte die Effektivität der Rücklagerung bzw. der Rück-Vorverlagerung des M. obliquus inferior zur Behandlung eines Strabismus sursoadductorius gezeigt werden. Der Effekt der Operation auf die VD in Adduktion betrug zwischen 0,6 und 0,8°/mm Operationsstrecke. Der Effekt auf die ZD war in allen Blickrichtungen in etwa gleich und betrug zwischen 0,2 und 0,3°/mm Operationsstrecke. Die Auswirkung der Operation auf die HD ist vernachlässigbar. Es zeigte sich eine Dosis-Wirkungsbeziehung, die aber zum Teil auf die Abhängigkeit des Operationseffektes vom präoperativen Winkel zurückzuführen ist. Sowohl der Effekt der Rücklagerung bzw. Rück-Vorverlagerung auf die VD, als auch auf die ZD wird entscheidend durch die vor der Operation vorhandenen Winkel mitbestimmt. Der bei diesen Operationsmethoden, bei denen der hintere Teil des M. obliquus inferior am hinteren Hemmband belassen wird, vermutete selbstregulatorische Effekt bewirkt, daß bei einem größeren präoperativen Winkel auch eine stärkere Winkelreduktion statt findet. Bei einem Vergleich der präoperativen Untersuchungsergebnisse nach einer dreitägigen diagnostischen Okklusion nach MARLOW mit denen ohne eine solche Okklusion, war unter der Okklusion eine Abnahme der VD und eine Zunahme der ZD festzustellen. Zudem zeigte sich eine verringerte Inkomitanz der VD bei vertikalen Bewegungen in der Adduktion. Es wäre sinnvoll diese Untersuchung immer bei Verdacht auf einen atypischen Strabismus sursoadductorius durchzuführen, um eine Vorstellung von den Befunden ohne Gegenregulation der Augen zu erhalten und bei untypischen Befunden die Diagnose stellen zu können. Bezüglich der funktionellen Befunde (Asthenopie, Diplopie, Stereosehen, Binokularsehen, Kopfzwangshaltung) zeigte sich in den meisten Fällen eine Verbesserung durch die Operation, diese war aber nicht von der Dosierung der Rücklagerung und auch nicht von der Reduktion der Schielwinkel abhängig. Betrachtet man die Häufigkeit postoperativer Befunde, wie das Auftreten einer Hebungseinschränkung des operierten Auges (10-13 %) oder eines Strabismus Zusammenfassung 117 sursoadductorius auf der Gegenseite (5 %) bzw. eine verbliebene Überfunktion, die einer weiteren Operation bedarf (8 %), so ist das relativ seltene Vorkommen dieser unerwünschten Befunde ein weiterer Beleg für die Effektivität und das relativ geringe Risiko dieser Operationsmethoden. Die alleinige Operation am M. obliquus inferior in Form einer Rücklagerung dieses Muskels in Verlaufsrichtung bzw. einer Rück-Vorverlagerung an den lateralen Ansatz des M. rectus inferior stellt somit eine effektive und sichere Behandlungsmöglichkeit des Strabismus sursoadductorius dar, die zudem bei Erwachsenen keine Vollnarkose erfordert.
Vergleich von Tumorregression basierend auf Magnetresonanztomographie beziehungsweise Ultraschall nach stereotaktischer Präzisionsbestrahlung großer uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Die Therapie und Nachsorge von Patienten mit uvealem Melanom gehört zu einem der Schwerpunkte der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit Juni 1997 wurden insgesamt 100 Patienten (51 männlich, 49 weiblich) mit einseitigen uvealen Melanomen an der Augenklinik in Zusammenarbeit mit dem Gamma-Knife-Zentrum München nach einem standardisiertem Verfahren radiochirurgisch mit dem Gamma-Knife behandelt. In diese Studie wurden nur Patienten aufgenommen, die aufgrund der Tumorlokalisation und/oder der Tumorausdehnung (maximale apikale Tumorhöhe > 6mm, basaler Tumordurchmesser > 19mm) nicht mehr für eine konventionelle Brachytherapie geeignet waren. Durch die stereotaktische Präzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife konnte diesen 100 Patienten die sonst nötige Enukleation des Auges erspart werden. Das mediane Alter der Patienten lag bei Diagnosestellung bei 62 Jahren (95% Konfidenzintervall (KI): 31-82 Jahren). Dabei war der jüngste Patient 24 Jahre und älteste Patient 84 Jahre zum Zeitpunkt der Erstdiagnose alt. Bei 55 Patienten befanden sich die intraokulären Tumoren im rechten Auge (55%), bei 45 Patienten im linken Auge (45%). Die Tumoren zeigten bei den 100 Patienten folgende Verteilung der Lokalisation: 61 Tumoren (61%) waren am hinteren Pol, das bedeutet die Tumoren berühren entweder die Makula und /oder die Papille und /oder einen großen temporalen oder nasalen Gefäßbogen lokalisiert; 21 Tumoren (21%) lagen ausschließlich choroideal in der mittleren Peripherie und 18 Tumoren (18%) befanden sich anterior und bezogen den Ziliarkörper mit ein. Die präoperative maximale apikale Tumorhöhe dieser 100 Patienten lag im Ultraschall bei einem Median von 7,85 mm (95% Konfidenzintervall (KI): 7,3- 8,3 mm). Das im hochauflösenden MRT ermittelte präoperative Tumorvolumen dieser 100 Patienten betrug in der 3D-MPR-Gewichtung im median 735 mm3 (95% KI: 620-880 mm3) und in der T2w Wichtung im median 655 mm3 (95% KI: 560-760 mm3). Unseres Wissens ist diese Studie die Erste, bei der eine Tumorregression bei uvealen Melanomen nach der stereotaktischen Präzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife sowohl im hochauflösenden MRT als auch im Ultraschall untersucht und einander gegenüber gestellt wird. Eine signifikante Tumorregression wurde nur dann angenommen, wenn der Meßwert der Tumorgröße sich um mehr als zwei Standardabweichungen (2 SD) vom vorherigen Wert unterschied. Für die Ultraschalluntersuchung bedeutete dies, daß eine Tumorregression erst ab einer Größenänderung des Tumors von mehr als 0,36mm als sicher angenommen wurde. Im hochauflösenden MRT wurde in der MPR-3D Wichtung für ein sichere Tumorregression ein Größenänderung von >150mm3 vorausgesetzt, in der T2w Wichtung ein Änderung der Tumorgröße von >170mm3. Tumoren die nach einer kontinuierlichen Regression unter eine Tumorgröße von >0,36mm im Ultraschall und/ oder >150mm3 in der MPR-3D Wichtung beziehungsweise >170mm3 in der T2w Wichtung des hochauflösenden MRT schrumpften, wurden als nicht mehr sicher nachweisbar angesehen. 86 der 100 Patienten mit einem uvealen Melanom konnten in die weitere Untersuchung einer Tumorregression einbezogen werden. Insgesamt vier dieser 86 Patienten verstarben nach Tumorregression an der Fernmetastasierung des Primärtumors. Die Nachbeobachtungszeit dieser 86 Patienten seit der stereotaktischen Behandlung mit dem Gamma-Knife lag im median für das hochauflösende MRT (MPR-3D, T2w) bei 468,5 Tagen (95% KI: 347-611 Tagen) und im Ultraschall bei 528,5 Tagen (95% KI: 497,0- 595,0 Tagen). Bei 81 der 86 Patienten konnte eine signifikante Tumorregression nach der stereotaktischen Bestrahlung im hochauflösende MRT (MPR-3D, T2w) nachgewiesen werden. Nach einer Beobachtungszeit vom im median 73,0 Tagen (95% KI: 58,0- 84,0 Tage) zeigte sich in der MPR-3D gewichteten Sequenz des MRT eine signifikante Tumorregression. In der T2w gewichteten Sequenz betrug diese Zeit im median 78,0 Tage (95% KI: 61,0-92,0 Tage). Echographisch ließ bei 63 der 86 Patienten eine signifikante Tumorregression nach der sereotaktischen Präzisionsbestrahlung im Ultraschall nachweisen. Diese signifikante Tumorregression wurde im Ultraschall nach einer Nachbeobachtungszeit vom im median 137,0 Tagen (95% KI: 92,0- 182,0 Tagen) festgestellt. Der Unterschied bis zum Zeitpunkt (in Tagen) einer signifikanten Tumorregression zwischen hochauflösenden MRT(MPR-3D, T2w) und Ultraschall ist signifikant (p< 0,001). Bei 63 dieser 86 Patienten zeigte sich die Tumorregression nach der stereotaktischen Präzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife zuerst im hochauflösenden MRT(MPR-3D, T2w), bei 10 dieser 86 Patienten ließ sich diese zuerst im Ultraschall feststellen. Bei 89 dieser 100 Patienten konnte untersucht werden, ob und wann der Tumor nach kontinuierlicher Regression nicht mehr durch das hochauflösende MRT und/oder Ultraschall nachgewiesen werden kann. Insgesamt vier dieser 86 Patienten verstarben nach Tumorregression an Fernmetastasen des Primärtumors. Die Nachbeobachtungszeit dieser 89 Patienten betrug seit der stereotaktischen Behandlung mit dem Gamma-Knife im median für das hochauflösende MRT (MPR-3D, T2w) 431,0 Tagen (95% KI: 346,0- 609,0 Tagen) und im Ultraschall 531,0 Tagen (95% KI: 497,0-668,0 Tagen). Nach einer kontinuierlichen Tumorregression lag die geschrumpfte Tumorrestgröße bei 37 der 89 Patienten unter der sicheren Nachweisbarkeitsgrenze des hochauflösenden MRT in der 3D-MPR Wichtung. Die Beobachtungszeit bis die Tumorrestgröße unter die Nachweisbarkeit des hochauflösenden MRT in der 3D-MPR Wichtung fiel betrug dabei im median 284,0 Tage (95% KI: 202,0- 365,0 Tage). In der T2w Wichtung des hochauflösenden MRT fiel bei 38 der 89 Patienten die Tumorgröße nach der stereotaktischen Präzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife unter die Grenze der sicheren Nachweisbarkeit des Tumors. Dabei betrug die Zeit bis der Tumor nach kontinuierlicher Regression unter die Nachweisbarkeitsgrenze des hochauflösenden MRT in der T2w Wichtung fiel im median 279,5 Tage (95% KI: 186,0- 359,0 Tage). Im Gegensatz dazu ließ sich der Tumor nach kontinuierlicher Regression bei allen 89 Patienten mit dem Ultraschall nachweisen. Die maximale apikale Tumorhöhe der 37 Patienten, die sich mit dem MRT nicht mehr sicher nachweisen ließen, betrug im median 3,8mm (95% KI: 3,0- 4,6 mm). Bei den 38 Patienten, die nicht mehr sicher mit dem MRT in der T2w Wichtung nachgewiesen wurden, lag die maximale apikale Tumorhöhe im median bei 3,9 mm (95% KI: 3,0- 4,6 mm). Zusammenfassend ist somit festzuhalten, das ein Ansprechen von uvealen Melanom auf die stereotaktische Präzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife im Sinne einer Tumorregression zuerst im hochauflösenden MRT gesichert werden kann, bevor dies mit dem Ultraschall möglich ist. Anderseits können Regression- und / oder Vernarbungszeichen uveale Melanome mit dem Ultraschall in der weiteren Verlaufkontrolle noch nachgewiesen werden, während diese bereits mit dem hochauflösenden MRT nicht mehr sicher möglich ist.
Über Therapie und Prognose der Endophthalmitis dargestellt anhand des Patientengutes der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München von 1990 - 2001
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Thu, 23 Jun 2005 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3831/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3831/1/Kreutzer_Thomas.pdf Kreutzer, Thomas
Keratoplastiken an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München zwischen 1994 und 1998
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Ziel dieser Studie war eine retrospektive Analyse von 211 Keratoplastiken, die an der Universitäts-Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München im Zeitraum von 1994-1998 vorgenommen wurden. Die häufigsten Indikationen für eine Keratoplastik bildeten Keratokonus (35,6%), Endotheldekompensation nach CE/IOL (13,6%), Hornhautnarben (12,5%), Fuchs’sche Endotheldystrophie (11,0%) sowie ein perforiertes Hornhaut-Ulcus (8,4%). Es wurden 9,5% der Eingriffe als Re-Keratoplastiken vorgenommen. Der Anteil an Hochrisiko-Keratoplastiken betrug 28%. Der präoperative Visus lag bei über 70% aller Patienten unter 0,1. Sämtliche verwendeten Transplantate waren kurzzeitkonserviert, die Endothelzellzahl betrug in der Mehrzahl 2500-3000 Endothelzellen/mm², über 90 % aller verwendeten Transplantate wiesen eine gute bis sehr gute Qualität auf. Eine Transplantatabstoßung entwickelten 13,7% aller Transplantate. In der Gruppe der Transplantate mit einer Abstoßungsreaktion wurde eine endgültige Eintrübung des Transplantats signifikant häufiger beobachtet (48%) als in der Gruppe der Transplantate ohne eine Abstoßungsreaktion (11,5% ; p0-3dpt. Einen Astigmatismus >3-6dpt wiesen 41,8% der Patienten auf und bei 23,9% der Patienten überstieg der Astigmatismus 6 dpt. Zum letzten Untersuchungszeitpunkt waren 85% aller Transplantate klar. Ein Literaturvergleich ergab im Wesentlichen eine Übereinstimmung unserer Ergebnisse mit den Arbeiten anderer Autoren. Verbesserungspotential besteht in der Unterdrückung bzw. Abwendung von Transplantatabstoßungsreaktionen. Verstärkte Aufmerksamkeit sollte einer konsequenten Langzeitevaluation gelten.
Retrospektive Erfassung mikrobiologischer und klinischer Daten sowie der Behandlungsergebnisse von Dakryocystitis und Canaliculitis bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten der Universitäts-Augenklinik München in den Jahren 1990-1998
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Infektionen der Tränenwege können sowohl bei Kindern als auch beim Erwachsenen zum Problemfall in der niedergelassenen Praxis werden. Stenosen und Tränenstau, welche sich vor allem an den physiologischen Engstellen der Tränenwege entwickeln, bieten ideale Bedingungen für ein Bakterienwachstum. Es kann selbst bei adäquater Therapie oft zu langwierigen und rezidivierenden Verläufen kommen. Probleme treten vor allem dann auf, wenn ohne entsprechenden Erregernachweis antibiotisch behandelt wird oder eine bereits chronisch gewordene Entzündung einer operativen Therapie vorenthalten wird. Die vorliegende retrospektive Studie basiert auf den Daten von 144 Patienten, die zwischen 1990 und 1998 in der Universitäts-Augenklinik München behandelt wurden. Von den 144 Patienten litten 64 Patienten an einer Dakryocystitis, 43 Patienten litten an einer Canaliculitis und 37 waren Kinder, welche eine eitrig infizierte Tränenwegsstenose hatten. Noch vor einer weiteren Diagnostik wurden mikrobiologische Probenentnahmen vorgenommen, das entnommene Probenmaterial sofort im mikrobiologischen Forschungslabor der Universitäts-Augenklinik München auf Kulturmedien übertragen sowie beurteilt. Bei sämtlichen Kulturen wurden zusätzlich Resistenzbestimmungen für verschiedene Antibiotika und Antimykotika durchgeführt. In 140 von 144 Fällen konnten mit der gewählten Methode zur Probenentnahme positive mikrobiologische Ergebnisse erzielt werden. Das Erregerspektrum umfasste 193 Keime, 149 (77,3%) grampositive, 40 (20,8%) gramnegative und außerdem 3 (1,9%) Pilze. Der Anaerobieranteil betrug 16% (31Keime), wobei sich die meisten Anaerobier bei Canaliculitiden fanden. Auffällig waren auch hier die oft vorkommenden Aktinomyzeten-Infektionen. Bei den Kindern fielen die häufigen Infektionen mit penicillinresistenten vergrünenden Streptokokken auf und die insgesamt am häufigsten nachgewiesenen Keime waren koagulasenegative Staphylokokken, gefolgt von Staphylococcus aureus und vergrünenden Streptokokken. Mit Hilfe wiederholt durchgeführter Antibiogramme konnte eine medikamentöse Therapie auch beim Vorliegen von Erregern mit multiplen Resistenzen effizient und innerhalb kürzester Zeit eingeleitet werden und der Heilverlauf vor und nach operativen Eingriffen erregerspezifisch unterstützt werden. Nach Vorliegen der mikrobiologischen Ergebnisse in den Gruppen A, B, C erfolgte in 51%, 18% bzw. 35% eine Umstellung der antibiotischen Therapie. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig die Keimidentifizierung und Resistenzbestimmung bei der Behandlung von Tränenwegsinfektionen sind. Neben der Diagnose und der Erregeridentifikation wurde Alter, Geschlecht, die Dauer der Symptomatik, die vorangegangene Therapie und die anhand der mikrobiologischen Ergebnisse eingeleitete Behandlung dokumentiert und der Krankheitsverlauf evaluiert. Anderen Studien entsprechend überwog auch in dieser Untersuchung vor allem bei den Dakryocystitiden eindeutig das weibliche Geschlecht im postmenopausalen Alter. Bei den Kindern und Canaliculitiden konnte kein deutlich bevorzugtes Geschlecht festgestellt werden. Die Dauer der Symptomatik schwankte zwischen 5 Monaten (Median, Gruppe A), 6 Monaten (Median, Gruppe B) und sogar 24 Monaten (Median, GruppeC). Dies hing stark davon ab, ob es sich um einen akuten oder chronischen Prozess handelte. Die meisten (111 von 144 Patienten) der Patienten hatten bei der Vorstellung in der Klinik schon eine oder mehrere Vortherapien hinter sich. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um antibiotische Augentropfen und Spülungen und Sondierungen. Die in der Klinik angewendeten Therapien waren unterschiedlich erfolgreich. Konnten die angeborenen Stenosen gut durch Spülungen, Sondierungen und lokale Antibiotika behoben werden, so mussten bei den Dakryocystitiden meist systemische Antibiotika angewendet und operativ vorgegangen werden, um Beschwerdefreiheit zu erreichen. Das gleiche gilt für die Canaliculitiden, die nur durch eine operative Ausräumung der Tränenwege ausreichend therapiert werden konnten. Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Therapieempfehlungen ableiten: Im akuten Stadium der Tränenwegsinfektionen steht die Antibiose im Vordergrund und sollte bei schweren Krankheitsbildern systemisch, zum Beispiel mit einem Oralcephalosporin (Cefalexin), erfolgen. Dies wird durch eine lokale Behandlung unterstützt. Besonders zu empfehlen sind Substanzen mit einem breiten Wirkungsspektrum, etwa ein Gyrasehemmer oder eine Kombination aus Polymyxin B, Neomycin und Bacitracin. Nach Abklingen der Infektion und einer wegweisenden Diagnostik ist meist eine operative Sanierung der Tränenwege durch eine Dakryocystorhinostomie notwendig, um erneuten Rezidiven vorzubeugen. Eine Art Sonderfall stellt die chronische Canaliculitis dar, die in der Praxis nicht selten fehlgedeutet wird. Hier sollten die Tränenkanälchen operativ eröffnet werden, da sich meist nur dadrch ein dauerhafter Therapieerfolg erzielen lässt. Begleitend sollte eine lokale Antibiose und Antibiotika-Spülungen der Tränenwege erfolgen. Viele Erkenntnisse früherer Studien konnten anhand dieser Arbeit bestätigt werden, wenngleich bisher noch keine vergleichbare Publikation mit derart ausführlichen und erfolgreichen Erregernachweisen mit Resistenzenbestimmungen existiert. Durch diese sorgfältige mikrobiologische Analyse konnte bei der Mehrzahl der Patienten eine gezielte und erregerspezifische Therapie eingeleitet oder umgestellt werden, so dass die Effizienz der Behandlung bedeutend verbessert werden konnte. Es wurden auch kaum beachtete Tendenzen aufgezeigt, die zukünftig bei der Therapie von Infektionen der Tränenwege berücksichtigt werden sollten.