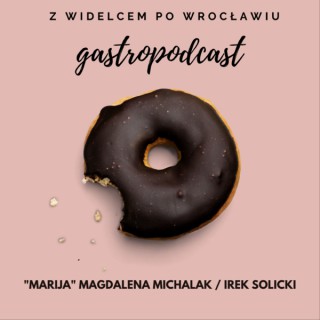Podcasts about projekt wie
- 30PODCASTS
- 31EPISODES
- 33mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Aug 29, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about projekt wie
Latest podcast episodes about projekt wie
Infos FOOTBALLEREI hautnah & ELF Debatte + GFL Analyse (#173)
00:00 News FootballEREI hautnah Projekt – Wie geht es weiter? 07:00 Martin in der Hall of Fame 10:30 NFL News 19:15 ELF Rückblick & Ausblick & News EFA 44:30 Infos Footballerei Show am Dienstag mit Martin 46:00 GFL Spiele & News ---- Infos Footballerei Show Dienstag 2.9. im Xperion Hamburg: Footballerei.show ---- Footballerei Hautnah Folge mit Shuan und Martin: · Spotify: https://open.spotify.com/episode/7Jsw2ZVd9pPahAwgwle3yq?si=028181f37a7847b5 · Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/footballerei-hautnah-das-erwartet-euch-in-der-nfl-saison/id1155632028?i=1000723607312 · Youtube: https://youtu.be/D3kHo4Xl-yM?feature=shared HIER kannst du den FOOTBALLEREI Podcast ABONNIEREN: https://shows.acast.com/footballerei · RSS-Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/footballerei · Spotify: https://open.spotify.com/show/7GuB1nBtJRtFRPBUmmQIOR?si=16b7174c76d04e83 · Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/footballerei/id1155632028 ---- Infos zu unserer Kooperation mit der "German Football Academy": - Instagram: https://www.instagram.com/germanfootball_academy - Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555741196921 - TikTok: https://www.tiktok.com/@germanfootball.ac -- Kontaktiere Martin direkt: mailto:info@martin-hanselmann.de -- Kontaktier uns (Johannes & Martin) per Mail: mailto:football.hautnah@martin-hanselmann.de -- Schicke uns gerne deine Fragen. Kontaktiere uns hier (auch via Sprachnachricht) & weitere Infos zu Martin und Johannes oder dem CTK Sportpark: https://linktr.ee/footballhautnah ----- Musik von Gvidon
Nach dem 7. Oktober: Das Comic-Projekt „Wie geht es dir?“
Schwyzer, Andrea www.deutschlandfunkkultur.de, Aus der jüdischen Welt
Wie geht es dir? Eine Frage möchte ich behaupten die die meisten von uns mehrmals täglich stellen und mehr oder weniger ehrlich beantworten. Einen Kölner Stadtteil fragt man diese Frage jedoch noch seltener. In ihrem neuen Projekt “Wie geht es dir Kalk?” tut genau das jedoch das Kollektiv Tun & Lassen. Bestehend aus Philine Herrlein und Jennifer Döring. kommen die beiden Choreographinnen eher aus dem tänzerischen Bereich. Diesen Samstag nehmen sie ihren Platz statt ganz klassisch gedacht auf der Bühne, im Kölner Stadtteil ein. Und wir dürfen dabei sein! Im Interview fragt Kölncampus-Moderatorin Rinske nach, wie das Ganze genau aussieht.
Elektrotechnik Podcast # 208: Fachgespräch Elektroniker f. Betriebstechnik? Lastenheft, Prüfprotokoll & Co – So erklärst Du Deinem Prüfer Dein Projekt wie ein Profi
Lastenheft? Pflichtenheft? Prüfprotokoll?In dieser Folge des Elektrotechnik-Podcasts bekommst Du die wichtigsten Antworten auf typische Fachgesprächsfragen aus der Abschlussprüfung Teil 2 – anschaulich erklärt mit greifbaren Beispielen aus der Praxis.
Exposom-Projekt: Wie Umwelteinflüsse den menschlichen Körper beeinflussen
Lange, Michael www.deutschlandfunk.de, Forschung aktuell
#019 - Was kostet mein Projekt? Wie budgetiert man richtig?
In dieser Episode von „Fundament – Der Baupodcast“ nehmen Jonas Betz und Thomas Krug Sie mit in die Welt der Baukosten und zeigen, wie Sie Ihr Bauprojekt richtig budgetieren. Eine saubere und durchdachte Budgetplanung ist der Schlüssel, um finanzielle Engpässe und unvorhergesehene Kosten zu vermeiden. Aber wie stellt man das an? Wir sprechen über die häufigsten Fehler, wie man sie vermeidet und welche Experten Ihnen helfen können.Für wen ist diese Folge?Diese Folge ist perfekt für Bauherren, die den Überblick über die Kosten behalten wollen, sowie für alle, die sich mit dem Thema Baufinanzierung auseinandersetzen. Egal ob Neubau oder Renovierung – hier bekommen Sie die Tools, um Ihr Budget im Griff zu behalten.Hören Sie rein und erfahren Sie, wie Sie Kostenfallen vermeiden und Ihr Bauprojekt finanziell sicher durchstartet. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen!Vielleicht interessierte Sie auch der folgende Link zur DIN 276, der "Kostenbibel" am Bau: DIN 276Werden Sie zum Kenner unter den Bauherren!+++++„Fundament - Der Bau-Podcast“ - und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Conwick GmbH. Lesen Sie hier weiter: www.conwick.de Produktion und Soundeffekte: https://sounzz.de
4.16 HeavyRAIN-Projekt: Wie Wetterdaten den Hochwasserschutz verbessern
Eine neue Folge des Digitale Stadtwerke Podcast:4.16 HeavyRAIN-Projekt: Wie Wetterdaten den Hochwasserschutz verbessern – Mit Dr. Thomas Einfalt von hydro & meteo
Thüringen-Projekt: Wie würden extreme Kräfte unsere Demokratie aushöhlen?
Das Thüringen-Projekt will mit einem Rollenspiel untersuchen, wie autoritär-populistische Parteien Schwachstellen der Demokratie ausnutzen könnten. Was haben sie vor? Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/zurueck-zum-thema >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/zurueck-zum-thema-thueringen-projekt
Zurück zum Thema | Thüringen-Projekt: Wie würden extreme Kräfte unsere Demokratie aushöhlen?
Das Thüringen-Projekt will mit einem Rollenspiel untersuchen, wie autoritär-populistische Parteien Schwachstellen der Demokratie ausnutzen könnten. Was haben sie vor? Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/zurueck-zum-thema >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/zurueck-zum-thema-thueringen-projekt
Thüringen-Projekt: Wie würden extreme Kräfte unsere Demokratie aushöhlen?
Das Thüringen-Projekt will mit einem Rollenspiel untersuchen, wie autoritär-populistische Parteien Schwachstellen der Demokratie ausnutzen könnten. Was haben sie vor? Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/zurueck-zum-thema >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/politik/zurueck-zum-thema-thueringen-projekt
Hi zusammen und herzlich willkommen zur Folge 077 – KLIMA.PROFIT. Christoph spricht mit Herrn Dr. Ulrich Eimer über sein Projekt: Wie kann man Unternehmen bei notwendigen klimaanpassungsmaßnahmen unterstützen. Was kostet die Teilnahme und was wird es bringen. Dr. Ulrich Eimer erläutert den Begriff "KLIMA.PROFIT" und erklärt, wie Unternehmen ökologische Nachhaltigkeit und finanziellen Erfolg verbinden können. Prost und viel Spaß beim Reinhören wünschen Christoph und Markus!
Das Jahrhundert-Projekt: Wie entsorgen wir verstrahlte Atommeiler?
Am 15. April 2023 gingen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Doch damit ist der Atomausstieg noch lange nicht am Ende. Die Dokumentation zeigt, was nach dem Ausstieg aus der Atomkraft folgt und bietet außergewöhnliche Einblicke in den extrem aufwendigen Prozess des Rückbaus.
Einbürgerung, Schulgesundheit und Sperrmülltage
Michael Grunst spricht über den Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern, erzählt von der Verleihung des Integrationspreises im Rahmen einer ergreifenden Einbürgerungsfeier am 3. Oktober, gratuliert den Preisträgerinnen des letzen Bezirkstalers, die sich um das Lichtenberger Foodsharing-Projekt verdient gemacht haben, kündigt den Start eines Modellprojekts für Schulgesundheitsfachkräfte an sechs Lichtenberger Schulen an sowie die nächste Phase der Bürger:innenbeteiligung am Urbanen Zentrum Hohenschönhausen, lädt zu den Sozialtagen ein, empfielt die BSR-Sperrmülltage im Oktober und wirbt für die Teilnahme am Projekt "Wie wollen wir leben" im Museum Lichtenberg.
125: So findest du die Zeit für ein so großes Projekt wie Online-Kurs
Sandra Holzes Business-Kick: Online-Marketing und Erfolgstipps für dein Business
Du bist ausgebucht und willst einen Online-Kurs erstellen. Hier sind 3 Wege, wie du die Zeit dafür findest. Die Ressourcen zu dieser Folge findest du unter sandraholze.com/125 Meld dich jetzt für mein 5-Tage Online-Kurs-Bootcamp an: sandraholze.com/ok-bootcamp
Unsere Themen: +++ Ost-Ukraine: "Schlimmer als 2014 kann es nicht werden" +++ Messengerdienst: Telegram sperrt Attila-Hildmann-Kanäle +++ Meinung: Burkhard Blienert, Drogenbeauftragter der Bundesregierung, für Bier und Wein ab 18 +++ Werbung: Wieso Adidas mit nackten Brüsten wirbt +++ Projekt: Wie die Müllabfuhr beim Aufspüren von Funklöchern hilft +++
#8 Jens Richter - Wie man als Architekt ein Projekt wie das Munch-Museum in Oslo umsetzt
Wer nach Oslo fährt, entdeckt in der Skyline das Bauwerk eines Kasselers: Jens Richter ist Architekt und hat das Munch-Museum in der norwegischen Hauptstadt entworfen. Dort ist seit Oktober 2021 die Kunst des Malers Edvard Munch ausgestellt (“Der Schrei”). Was Jens Richter gedacht hat, als er das fertige Museum zum ersten Mal sah, und welche Architektur ihm in Kassel besonders gefällt, verrät er im Gespräch. Informationen zum Munch-Museum in Oslo: https://www.visitoslo.com/de/ihr-oslo/oslos-neue-architektur/ausblick/lambda/ und https://www.munchmuseet.no/en/Jens Richter arbeitet in Madrid im Architekturbüro “Estudio Herreros”: https://estudioherreros.com/HNA-Artikel über Jens Richter: https://www.hna.de/kassel/munch-museum-in-oslo-wird-eroeffnet-ein-kasseler-hat-es-gebaut-91066025.html und https://www.hna.de/kassel/kasseler-architekt-weltweit-beachtet-jens-richter-hat-mit-neubau-des-munch-museums-in-oslo-fuer-furore-gesorgt-91205359.htmlDir gefällt der HNA-Podcast „Mensch, Kassel“ und du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere ihn und bleibe so auf dem aktuellen Stand. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Wenn du Feedback geben möchtest – egal ob Kritik, Lob, Fragen oder Anmerkungen – wende dich per Mail an uns: digitalteam@hna.deDer HNA-Podcast im Netz: https://www.hna.de/podcastDie HNA auf Facebook: https://www.facebook.com/HNA/Die HNA bei Instagram: https://www.instagram.com/hnanews/ Die HNA bei Twitter: https://twitter.com/hna_online?lang=de Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Minh-Khai Phan-Thi ist Schauspielerin, Autorin, Moderatorin und Kuratorin bei Hertha BSC. In den Neunzigern schrieb sie Musikfernsehgeschichte, zusammen mit Nilz bei VIVA. Nun treffen sich die beiden nach etlichen Jahren zum ersten Mal wieder. Und die beiden haben so viel zusammen erlebt, dass man gar nicht weiß, wer hier eigentlich wen interviewt. Inzwischen hostet Minh-Khai unter anderem ihren eigenen Podcast “anderssein”, in dem sie mit PoCs und Menschen aus der LGBTQIA* Community über Diskriminierungserfahrungen spricht. Und Nilz hat viele Fragen, nicht nur zu ihrem jüngsten Projekt: Wie ist es, als Teenager in Namibia zu modeln? Wie räumt man nun wirklich mit westlichen Vietnam-Klischees auf? Warum hörte Minh-Khai damals bei “Nachtschicht” auf? Und warum heuert man als Ruhrpott-Fußball-Fan bei Hertha BSC an? Minh-Khai verrät es euch in dieser Folge der NBE!
#12 Dr. Janina Schüller, General Manager Video Business & Operations bei der Bild GmbH in Berlin
Dr. Janina Schüller ist studierte Diplom-Medienwirtin. Sie startete bei ProSiebenSat.1 nach einem Volontariat ihre Karriere als Redakteurin und entschied sich dann im Bereich crossmediales Innovationsmanagement im TV zu promovieren. Im Anschluss an ihre Dissertation war sie zunächst Channel Managerin bei den Sendern kabel eins und Sixx und übernahm dann den Launch von kabel eins Doku. Bei dem Pay-TV-Sender Sky war sie als Head of Content Strategie für bereichsübergreifende Strategieprojekte und das Format „Babylon Berlin“ zuständig. Nach einigen Jahren der Content-Beratung in den Branchen FMCG, TelKo, Mobility und Luxury entschloss sich Janina, die Verantwortung für den Bewegtbildbereich bei der BILD GmbH zu übernehmen. Wir sprechen mit Janina darüber, wie es war, in verschiedenen Medienhäusern in Positionen einzusteigen. Außerdem wollen wir wissen, wie aufregend es ist, beim Launch eines TV-Senders mitzuwirken. Diese Fragen beschäftigen uns: Wie war es, Jobs zu übernehmen, von denen Du am Anfang nur wenig wusstest? Karriere in den Medien - Wie geht das? Inspiration für medienbegeisterte Einsteiger Der Aufbau eines TV-Senders erscheint von außen als gewaltiges Projekt – Wie klappt sowas? Riesige Projekte, großes Mitarbeiter-Team, straffe Ziele und trotzdem cool bleiben – Dein Geheimrezept Quellen der Inspiration, empfohlen von Dr. Janina Schüller Ted Talks Tagesschau-Zukunfts-Podcast Zukunft verstehen
Das Pegasus-Projekt: Wie recherchiert man einen internationalen Cyberangriff? (DIE ZEIT 30/2021)
Pegasus ist eine hocheffiziente Spionage-Software der israelischen Firma NSO. Sie wird als Cyberwaffe von Geheimdiensten und Polizeibehörden eingesetzt – allerdings nicht nur, um Terroristen zu überwachen, wie die Firma angibt. Zahlreiche Staaten haben damit die Handys von Menschenrechtlerinnen und Journalistinnen auslesen lassen. Das zeigen Recherchen des internationalen »Pegasus-Projekts«. Journalistinnen der ZEIT und von ZEIT ONLINE waren an der Recherche beteiligt. Sie dokumentieren den weitreichenden Einsatz des Überwachungssystems. Auf ZEIT ONLINE stehen in der Artikelserie »The Pegasus Project« https://www.zeit.de/pegasus seit dem 18. Juli 2021 erste Ergebnisse der Recherche. Sascha Venohr, Head of Data Journalism im Investigativ-Ressort von ZEIT und ZEIT ONLINE, war von Beginn an beim Pegasus-Projekt dabei. Im Podcast mit Sarah Schaschek erzählt er von einer Recherche, die auf großem Vertrauen innerhalb des Journalisten-Teams basiert – und verrät, wieso er sein Handy jetzt öfter vor seine Bürotür legt.
#13 - otwiera restaurację w trakcie pandemii / Marek Łoboda (Smoke - Pastrami & Street Food)
Czy otwieranie restauracji w obecnych czasach to szaleństwo? O to zapytaliśmy Marka Łobodę - współwłaściciela i Szefa Kuchni powstającego gastropubu Smoke. Jak zwykle rozmowa o jedzeniu poniosła nas daleko... także obiecuję, że nie będzie nudno! Z odcinka dowiecie się również co Smokowa ekipa przygotuje dla nas już w czerwcu przy ulicy Odrzańskiej. Aha! Jeśli zastanawiasz się skąd kojarzysz Marka, to pomagam: Projekt Wieża, La Folie, Monopol, Grape, Pogromcy czy Cześć Brat (to jego pastrami jesz w Kontynuacji :D). Miłego słuchania! Ekipa prowadząca: Magdalena Michalak (Z widelcem po Wrocławiu) i Irek Solicki (HORECA+)
Projekt - Wie Steuerbescheide verständlicher werden können
Steuerbescheid. Viele von euch bekommen bei dem Wort wahrscheinlich schlechte Laune. Vielleicht wird sich das in Zukunft (ein bisschen) ändern. Die Steuerverwaltung und das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache haben nämlich ein gemeinsames Projekt: Sie wollen Steuerbescheide verständlicher formulieren.
Der Tag mit Elisabeth Ruge - Zukunft der USA: Joe Biden und der starke Auftritt der Frauen
USA: Wie kann Präsident Biden die Nation wieder einen? Corona: Wie erklärt die Kanzlerin ihren Kurs durch die Pandemie? Patente: Wie können mehr Länder vom Impfstoff profitieren? Projekt: Wie kann Kinderarbeit beseitigt werden? Moderation: Anke Schaefer www.deutschlandfunkkultur.de, Studio 9 - Der Tag mit ... Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
MEGA Projekt - Wie ein Holz Beton Hybrid die Hafen City aufmischt.
Denkmal Immobilien - Vermögensaufbau und Steuer sparen durch Denkmalimmobilien
Lerne die Immobilien Masterclass kennen: https://marcelkeller.mykajabi.com/masterclass MEGA Projekt - Wie ein Holz Beton Hybrid die Hafen City aufmischt. Wie Dir dein Immobilien Ziel mit dem richtigen Mindset gelingt. Der Podcast für Immobilien, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung.
Mit 8 Jahren ist Madita Lang in die Wasserwacht Marktoberdorf (Bayern/Schwaben/Ostallgäu) eingetreten und dort bis heute unter anderem als Jugendleiterin und Ausbilderin tätig. Seit 2017 ist die 25-Jährige stellvertretende Vorsitzende der Wasserwacht Bayern. Im Gespräch geht es um ihren bisherigen Weg im Roten Kreuz, die Aufgaben der Wasserwacht, Umwelt- und Naturschutz, ihre Arbeit auf Landesebene und vor allem um das Projekt »Wasserwacht-Informations- und Steuerungssystem« (WISS), das sie als ehrenamtliche Projektleiterin begleitet hat. WISS ist ein System, das mit Daten aus verschiedenen Systemen gespeist wird und diese als Kennzahlen übersichtlich darstellt (z.B. Anzahl Mitglieder, Altersverteilung, Einsatzzahlen). Es soll den Leitungsgremien von der Orts- bis zur Landesebene eine umfassende strategische Steuerung ermöglichen. Wie kam es zu dem Projekt? Wie ist die Projektgruppe vorgegangen? Wie haben sie die unterschiedlichen Bedarfe in der Wasserwacht unter einen Hut bekommen? Wie nimmt man die Mitglieder und Beteiligten mit? Welche Probleme und Reaktionen gab es? Wie war die Zusammenarbeit mit Hauptamt und externen Partnern? Wie geht es jetzt weiter? War das Projekt erfolgreich? Lässt es sich auf andere Bereiche im Roten Kreuz erweitern? Was sind die nächsten Aufgaben, Ideen und Projekte? Neben diesen und vielen weiteren Fragen verrät sie auch, wie viel Zeit ihr Ehrenamt in Anspruch nimmt und warum sie sich überhaupt getraut hat, für die Landesleitung zu kandidieren.
Silodenken Herzlich willkommen zur neuen Folge von „Mittelmaß und Wahnsinn“, dem Podcast über den Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit in unseren Unternehmen, die stetig weiter werdende Lücke zwischen Reden und Realität. Heute – auf Wunsch eines einzelnen Hörers – ganz ohne Soundeffekte. Diesmal geht es um einen Mythos, nein um einen Unsinn, der sich seit langer, langer Zeit in unseren Chefetagen hält: den Unsinn von der Silo-Mentalität, seine Ursachen und Nebenwirkungen. Laut einer frischen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey beklagen 83% des leitenden Personals, dass in ihrer Organisation Silos existierten und 97% denken, dass diese Silos einen negativen Effekt haben. Ich musste schon ein wenig schmunzeln, dass gerade General Electrics in der Studie als Beispiel zitiert wird, wo Silo-Wände eingerissen werden und „Cross-Whatever“ Kollaborationen den Weg ins vernetzte Zeitalter weisen. Aber man muss dem Schaden ja nicht noch den Spott hinzufügen. Vielleicht ist GE ja gerade auf dem Weg aus der Misere, deren Wurzeln man selbst gepflanzt und lange, lange verherrlicht hat. Aber das ist gar nicht der Punkt. Fangen wir ganz vorne an. Im echten Leben. Beim echten Silo. Echte Silos Der Duden definiert „Silo“ folgendermaßen. „Silo: 1. [schacht- oder kastenförmiger] Speicher oder hoher Behälter zur Lagerung von Schüttgut, besonders Getreide, Erz, Kohle, Zement. 2. Grube oder hoher Behälter zum Einsäuern von Futter.“ Egal, welche Art von Silo man betrachtet, eines ist sicher: ein schöner Platz ist das nicht. Haben Sie schon einmal ein Silo gesehen, speziell von innen? In meiner Jugend waren wir öfter auf dem Bauernhof eines Freundes. Da war auch ein Silo, in das man durch eine kleine Öffnung schauen konnte. Die wesentlichen Merkmale, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind: eng, dunkel und … gefährlich. Silogase führen zu einem schnellen Erstickungstod und die Natur des Silos verhindert, dass Hilferufe gehört werden, wenn man erst einmal darin gefangen ist. Gruselig. Genau! Behalten Sie dieses Bild im Kopf und versuchen Sie, gleichzeitig den Gedanken darin zu halten, dass Sie mit 83-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den Augen Ihres Managements in genau so einem Silo sitzen und ihr Tagwerk leisten und vor allem: dass Sie gar nicht heraus wollen aus diesem Silo, dass Sie sich in der Enge, der Dunkelheit und dem üblen Mief eingekuschelt haben; dass Sie träge und immobil geworden sind unter dem Einfluss der Gase des gärenden Getreides. Und warum? – Weil Sie von Natur aus und per se veränderungsunwillig sind, weil Sie ohne Anstoß von außen oder wenigstens maßgeschneiderte Prozesse kaum zu bewegen sind und weil es allenfalls ihre aufstrebenden Leader sind, die Sie aus diesem Dämmerzustand reißen können und Sie über die Brücke schubsen, die ihr trauriges Silo mit dem nächsten verbindet, in dem Kolleginnen und Kollegen ein ähnlich deprimiertes Dasein fristen. Ja, ja, ja, ich weiß. Das ist eine völlige Überstrapazierung des Bildes vom Silo. In Wirklichkeit geht es eher um das Bild von außen, um hohe abgeschlossene Türme ohne Fenster und Türen. Wir nennen dergleichen auch gerne einmal „Kamin“ oder „Pillar“ oder – etwas weniger duster – „Gärtchen“. Es geht um die Behauptung, dass wir nur allzu gerne in unseren eigenen kleinen isolierten Kästchen sitzen und werkeln würden, während die eigentlichen Werte durch Vernetzungen geschaffen werden, zu denen der durchschnittliche Mitarbeiter unfähig oder zu träge ist. Oder beides. Aber ist das nicht auch schon ein Symptom? – Wir reden in Bildern, ohne diese Bilder gründlich zu erkunden. Von außen und von innen. Und dann beginnen diese Bilder, sich zu verselbständigen und sich zu lösen von ihrer eigenen Realität, wie auch von der Realität, die zu beschreiben sie ursprünglich ausgesucht wurden. Aber zurück zum Thema. Der Ausgang ist oben 83% des leitenden Personals wähnen weite Teile ihrer Organisation in Silos, die sie zu 97% für schädlich halten. Müßig zu sagen, dass sich diese 83% höchstwahrscheinlich außerhalb jener Silos sehen, die sie mit so großer Mehrheit bedauern, dass also diese 83% zu jenen glücklichen 17% gehören, die ihr Dasein nicht im Silo fristen müssen, sondern von der Spitze der Pyramide aus zu Weitblick und Zusammenarbeit fähig sind. Die erste Frage, die diese Statistik aufwirft ist, wo, wann und wie diese Manager der beklagten Benebelung durch die letalen Silogase entkommen sind. Rein praktisch betrachtet erscheint das schwer möglich. Wären wirklich 83% aller Organisationen in ihren Silos gefangen oder 83% einer jeden Organisation in Ihren eigenen kleinen ummauerten Gärten, dann würde es doch sehr wundern, dass überhaupt irgendjemand diesen Strukturen entkommt. Die Vorstellung scheint zu sein, dass man zu Beginn seiner Karriere einen dieser dunklen Container von ganz unten – mir fehlt das richtige Verb – „betritt“ und sich dann mühsam, Sprosse für Sprosse nach oben arbeitet bis man – endlich Executive – ganz oben die Luke in die Freiheit jenseits des Silos entdeckt. Herausgeklettert zwinkert man erst einmal die Augen zusammen im hellen Sonnenschein, blickt sich um und erkennt, wie vielfältig die Welt doch ist. Dann lässt man den Blick schweifen auf all die anderen Silos und fängt an zu klagen. Man winkt den vereinzelten anderen Gestalten, die – wie man selbst – auf den Dächern ihrer Silos sitzen; - nicht aber ohne vorher die Klappe durch die man gekommen ist, wieder fest hinter sich zu verschließen. Auch andere Interpretationen des Klage-Phänomens sind denkbar. Die erste ist, dass besagte Manager genauso im Silo sitzen wie alle anderen und es entweder von innen heraus beklagen oder einfach nicht zugeben wollen, dass sie auch Gefangene ihres eigenen Palastes sind. Eine andere Auflösung wäre, dass das Silo-Phänomen gar nicht so ausgeprägt ist und dass die Klage darüber entweder ein Medium ist, um sich „nach unten“ abzugrenzen oder einfach ein Nachzwitschern einer gerade populären Melodie. Vermutlich ist es am Ende ein wenig von allem. Das Silo sind immer die Anderen. Bevor ich zu dem Punkt komme, den ich an dieser Silo-Sache am wenigsten mag, eine andere Frage: Was ist eigentlich ein „Silo“? – Nein, diesmal nicht im echten Sinn des Wortes. Wir haben ja schon gesehen, dass es sich um ein Bild handelt, das sich verselbständigt hat. Das (nicht ganz so) böse Silo Was meint der moderne Manager oder Unternehmensberater, wenn er von „Silo“ spricht? Das Controlling-Wikider Hochschule Luzern definiert den Begriff „Silodenken“ so: „Der Begriff „Silodenken“ wird in der Literatur zur betriebswirtschaftlichen Organisationslehre dazu benutzt, nach innen orientierte Organisationsbereiche zu beschreiben, die externen Beziehungen zu wenig Beachtung schenken (Fenwick, Seville & Brunsdon, 2009, S. 4). Kommunikationsprobleme als auch die fehlende oder ungenügende Zusammenarbeit zwischen einzelnen Bereichen und weiteren Anspruchsgruppen sowie die Entwicklung einer eigenen Kultur gehören zu den typischen Merkmalen solcher Organisationseinheiten. Daraus können Rivalitäten resultieren, welche es bspw. innerhalb einer Business Unit oder innerhalb eines Konzerns verunmöglichen, die übergeordneten Zielsetzungen zu erreichen (Stone, 2004, S. 11). Synonym für diese in dezentralen Organisationsstrukturen verbreitete Dysfunktionalität lassen sich auch die Begriffe „Ressortdenken“, „Bereichsegoismen“ oder „Gärtchendenken“ benutzen (Vahs, 2015, S. 207-209).“ Ähnliche Definitionen findet man zuhauf und sie klingen alle bestürzend: Konkurrenzdenken, Mangel an Kommunikation, Egoismen, Subkulturen … . Das scheint kein Umfeld, das Freude macht und Ergebnisse schafft und so heißt das moderne Gegen-Paradigma „Kollaboration, Kollaboration, Kollaboration!“. Dieses Paradigma muss dann auch herhalten, um andere Dysfunktionen zu rechtfertigen: von der exzessiven Besprechungskultur bis hin zum Open Plan Office, das sich selbst pervertiert indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin auf Noise-Cancelling Techniken zurückgreifen, um sich konzentrieren zu können und per Chat kommunizieren, weil man sich sonst noch mehr gegenseitig stört. Praktisch niemand macht sich Mühe, dem bösen Silo etwas Positives abzugewinnen. – Es passte ja auch kaum ins düstere Bild … und erst recht nicht zum Zeitgeist. Wie wäre es beispielsweise mit Expertise, die man in einem Team von Experten besser entwickeln kann als in Dauermeetings mit gesund Halbwissenden? Oder mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit, das man in kleineren Strukturen viel eher und besser erreichen kann als im Moloch der globalen Korporation? Vielleicht bedeutet das auch, „Subkulturen“ zu umarmen. Wer glaubt schließlich wirklich an die einende Kraft eines per Definition weichgespülten Mission-Statements für einen Großkonzern nach dem Motto: „Wir streben mit all unserer Kraft danach, unseren Kunden die allerbesten Services und Produkte zu bieten und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hervorragendes Arbeitsumfeld. Wir bekennen uns dazu, unseren Shareholdern einen herausragenden Return zu liefern und sind und bleiben bei alldem integrer Bestandteil der Gesellschaft auf Basis solider moralischer Grundlagen.“ Oder – kürzer und moderner: „Wir wollen die Welt besser machen und dabei möglichst viel Geld verdienen!“. Es kann nur einen geben Schließlich die Frage des Konkurrenzdenkens. Im Silo-Kontext klingt der Begriff der „Konkurrenz“ geradezu böse. Das moderne Mantra lautet: Konkurrenz verhindert Kollaboration und nur durch Kollaboration lassen sich positive Ergebnisse erzielen. Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn die ganze Kollaboration auch noch Raum lässt für die Pflege von Expertise und wenn die Effizienz des Denkens und Handelns nicht im Dauer-Meeten aufgelöst wird. Der Punkt ist aber ein anderer. Fast alle unsere tradierten Methoden der Führung basieren geradezu auf dem Konkurrenzprinzip. Wenn man möchte, fängt es schon ganz global an. Mit dem Wettbewerb. Jenen gilt es zu schlagen. Mit fast allen Mitteln. Sonst – so das Mantra – werde das eigene Unternehmen entweder gänzlich verschwinden oder „gefressen“ werden von einem dieser Wettbewerber. Das größte Silo von allen – das des eigenen Unternehmens – steht also nicht in Frage und es ist selbstverständlich und völlig legitim, dieses Silo mit allen Mitteln abzugrenzen, zu verteidigen und auszubauen. Auch das ist nicht an sich falsch. Aber muss man sich wundern, wenn sich dieses Muster auch nach innen fortsetzt? – Silos in Silos in Silos … . Auf der anderen Seite des Spektrums sieht es eher noch dramatischer aus: beim Individuum. Anerkennung und Be- oder Entlohnung sind vollständig dominiert vom Konkurrenzprinzip. Wenn es um Beurteilung, Entwicklung und Bezahlung geht, ist es fast immer „ich oder jemand anders“. Dort, wo noch nach den Regeln der Gauß’schen Verteilung verteilt wird, ist das sogar mathematisch evident: für jeden „Guten“ muss es einen „Schlechten“ geben. Abgrenzung heißt also das Gebot. Etwas kompliziert wird die Sache dadurch, dass neuerdings an manchen Stellen „Kollaboration“ ein Teil der Definition von „Gut“ geworden ist. Der Trick ist also, sich in und durch Kollaboration als Einzelner abzugrenzen. Das ist zwar Paradox, aber der Homo Corporaticus quadriert auch diesen Kreis und seine Managerin oder sein Manager wird schon einen Weg finden, die Zusammenarbeiter im Team geeignet zu ranken.. Wenn aber „ganz oben“ und „ganz unten“ Konkurrenz das Erfolgsmuster definiert, wo soll dann Kollaboration anfangen? Geben wir uns keiner Illusion hin. Auch auf den Ebenen dazwischen regiert systematisch das Abgrenzungsprinzip: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten an mich? Wo hängt das strategische Projekt? Wie werden Budgtes und Kompetenzen verteilt? … Die Diskussion führt als auf zwei Erkenntnisse. Erstens: das „Silo“ ist teilweise gar nicht so böse, wie es das Bild vermitteln will. Richtig verstanden, fördert es Expertise und Zusammenhalt. Zweitens: wenn man wirklich etwas ändern möchte und sich nicht nur dem komfortablen Klagen ergeben, dann muss man einige fundamentale Paradigmen ändern. Man muss ran an die Erfolgsmuster, die die Organisation definieren. Man muss über signifikante Änderungen der Organisation und ihrer Prozesse nachdenken. Noch mehr „bereichsübergreifende“ Komitees und Aktivitäten werden nicht helfen. Warum? Schließlich zum größten Ärgernis, das das berühmte Silo-Bild beinhaltet: das Menschenbild, das ihm zugrunde liegt. Fast allen Theorien vom Veränderungsmanagement liegt eine Annahme zugrunde: der Mensch an sich sei veränderungsunwillig. Er oder sie kuschle sich am liebsten im Gewohnten ein in der gewohnten Umgebung, auch wenn diese Umgebung besagtes „Silo“ sei. Er oder sie strebe für gewöhnlich – sehen wir von den besagten erleuchtungsfähigen 17% oder weniger ab – nicht nach dem Weg heraus aus der Gewohnheit. Stattdessen mache es man sich halt bequem, schaffe sich eine „Komfortzone“ und tue fast alles, um diese nicht verlassen zu müssen. Um sie oder ihn aus dieser Komfortzone herauszubringen, brauche es für gewöhnlich eines straken Pushs, der von ganz oben kommen müsse, weil er sonst schon in der Lehmschicht des mittleren Managements sein Momentum fast ganz verlieren würde. Und so manifestierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre Silos und ihren Platz darin quasi von innen – zum Bedauern von 83% ihres höheren Managements, das diese Manifestation zu 97% für schädlich hält. Da stellt sich natürlich die Frage, was man außer Klagen tut, um die Situation zu verändern, denn das Thema ist keineswegs neu, sondern schon Jahrzehnte auf der Agenda … ohne dass die Klagen weniger würden. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm und die Klage einfach eine lieb gewonnene Gewohnheit. Eine ebensolche Gewohnheit ist das Bild vom veränderungsunwilligen Durchschnitt. Ich habe es schon an anderer Stelle geschrieben: Wir Menschen sind nicht intrinsisch veränderungsunwillig. Im Gegenteil, wir sind Entdecker und Helfer. Wir reisen, um Anderes zu erfahren. Wir gründen Familien. Wir engagieren uns in Vereinen, Schulen, Kindergärten … . Wir suchen neue Freunde, ziehen in andere Städte, … . Fast unabhängig von Alter und anderen Faktoren. Lediglich am Arbeitsplatz sagt man uns jene Trägheit nach, die den Push von ganz oben bräuchte, um überwunden zu werden. Dabei geht es fast nur um das „Warum“. Warum sollte ich den Kollegen aushelfen, wenn ich nur nach dem Erfolg „meines“ Projekts beurteilt werde? Warum sollte ich nicht um „mein“ Budget kämpfen, wenn mein Status dadurch definiert wird? Warum sollte ich nach getaner Arbeit noch „netzwerken“, wenn ich dafür meine Kinder nicht von der Kita abholen kann? 83% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beklagen, dass die Antworten auf diese Fragen für „bestenfalls abstrakt“ sind. 97% hielten sie für wichtig.
#28 AP - Markus Straßer: Produzent, Musiker, Videokünstler, Instrumentallehrer: Banjo Bavaria
Audiopreneur Podcast | Ton | Mikrofone | Mischpulte | Audio | Hifi
Markus Straßer: Produzent, Musiker, Videokünstler, Instrumentallehrer Wie bezeichnet man Dich? Wo kommst Du her? Was ist Dein neues Projekt? Wie bist Du darauf gekommen? Wie ist Dein Video entstanden? Wie lange habt Ihr am Video gearbeitet? So ein Video gab es noch nie - wurde es gewürdigt? Leute mit geringerem Budget können bei Dir Aufnehmen? Wie machst Du das? Welches Technik Setup hast Du? Wie funktioniert der Kontakt und der Service mit Dir? Pink Elephant - was war das für eine Aktion? Bei welchen Videowettbewerben hast Du mitgemacht? Was waren das für Comedy Figuren? Die Figur Jochen - wer war das? Für was hat Jochen geworben? Welche Instrumente lehrst Du? Gibt es Personen mit weniger Talent? Wie unterrichtest Du? Du verbessert auch Songs?
DNP108|Coaching Call mit André Thöne
Digitale Nomaden Podcast - Raus aus dem Hamsterrad. Rein in die Freiheit.
DNP108|Coaching Call mit André Thöne In Folge 108 ist André Thöne zu Gast. Er ist Online Marketer und startet am 15.03.2017 seinen ersten Podcast. Da er noch einige Fragen für den Start seines Podcastes hat, lässt er sich in dieser Folge von Sascha coachen. Sascha gibt exklusiv seine Tipps aus den letzten Monaten an André weiter. Inhalte dieser Folge: Wer ist André? Sein neues Projekt Wie würde Sascha mit seinem heutigen Wissen einen Podcast starten noch früher Hörer/Community einbinden Welche Austauschplattform nutzen Sascha und Timo mit der Community Welche Länge einer Folge ist entscheidend? Teste aus, was deine Hörer am Liebsten haben Es kommt immer auf die Zielgruppe an Erste Folge Wie erreicht man Kooperationen? Was würde Sascha anders machen? Tipp: Der Reichweitenmagnet sind eher unbekannte Menschen Wie viele Folgen pro Woche? Wie sieht es mit der Technik aus? Wie sieht es mit SEO aus? Der Podcast Launch: starte mit mehreren Episoden Geheimtipp: gehe in Gruppen in der sich die Zielgruppe aufhält Was würde Sascha seinem jüngeren Ich raten? Wann geht es bei André los: 15.03.2017 Was ist Andrés größte Angst? Wo sieht sich André in 5 Jahren mit seinem Podcast?
#15 AP - Die Soundstall Studios Schweiz - Michael Frey im Interview
Audiopreneur Podcast | Ton | Mikrofone | Mischpulte | Audio | Hifi
Die Soundstall Studios in Zug, Schweiz: Mitbegründer Michael Frey im Interview: Wie kam es, dass Du ein Studio gegründet hast? Das war ja ein Proberaum auf dem Bauernhof, oder? Du hast es dann umgebaut? Welches neues Equipment habt Ihr denn kürzlich erworben? Besteht die ursprüngliche Band noch? Wie hieß die Band? Ist das ein Mietstudio? Was bietest Du an? Was ist gefragt in der Schweiz? Rechnet sich so ein Studio in der Schweiz noch? Sind die Abonnenten Deiner Facebook Gruppe organisch entstanden? Machst Du die Facebookgruppe alleine? Wie lange gibt es denn die Gruppe schon? Was passiert in der Facebookgruppe? Wann musstest Du Gruppenrichtlinien aufstellen? Hat sich die Gruppe für Dich gelohnt? Dein Fazit? Was ist Dein nächstes Projekt? Wie lang ist für das Projekt geplant? Wie ist das im Konzerthaus? Wie ist die Qualität der Studioarbeit in der Schweiz? Wie ist die Funkmic/Funksender Situation in der Schweiz? Bist Du auch als Live-Mischer unterwegs? Welchen lustigen historischen Ausfall beim Live-Mixing gab es bei Dir? Wie kamst Du auf die SAE? Wie war für Dich die SAE-Ausbildung in Zürich? Wann war das? Da ist ja nicht immer alles rund gelaufen, oder? Welchen Grundstamm der Ausbildung hast Du mitgenommen? Wie schaut Dein weiterer Weg aus? Du bleibst auch weiterhin in der Galvanik? Machst Du weiter beides? Wie kann man Dich buchen? Wo findet man Dich?
Nerdfunk 371: Offener Datenverkehr mit den SBB
Ende letzten Jahres haben die SBB eine Open-Data-Plattform gestartet und stellen nun viele Betriebsdaten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Was ist die Absicht hinter diesem Projekt? Wie lassen sich...
Archiv-Aufnahme vom 9.10.2014: Im zweiten Teil meines Herbsturlaubs berichte ich über Kehl, eine besondere Stadtführung in Straßburg, Besuche in Freiburg und Colmar sowie über das Projekt „Wie klingt dein Tag“ von „Jörn Schaars feiner Seite“.