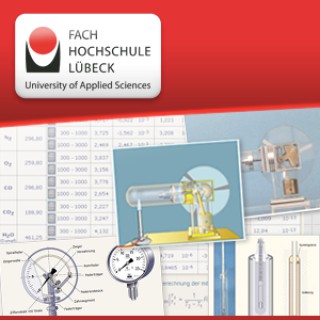Podcasts about gesamtsystems
- 11PODCASTS
- 11EPISODES
- 46mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- May 29, 2025LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about gesamtsystems
Fahrzeugrahmen/Fahrgestell aus Batterien - Das Potenzial von Strukturbatterien
Neben der Erhöhung der Energiedichte besteht eine weitere Strategie zur Verringerung des Batteriegewichts darin, Energiespeicher mit Multifunktionalität auszustatten, d. h. einen Energiespeicher zu schaffen, der in der Lage ist, strukturelle Lasten zu tragen und als Ersatz für strukturelle Komponenten zu dienen, so dass das Gewicht des Gesamtsystems verringert wird.
IWML #216 mit Hans Kratz und Alexander Gras von Gebhardt
Andreas hat in Folge 216 mit Hans Kratz und Alexander Gras von GEBHARDT zwei Fachexperten auf dem Gebiet der Cross Belt Sorter zu Gast. Gemeinsam habe sie unter anderem über die folgenden Fragen gesprochen: - Welche Vorteile bringt die Implementierung eines Sorters? - Was sind individuelle Herausforderungen und welche Verbesserungen hat GEBHARDT umgesetzt? - Was sind die Kernthemen bei der Konzipierung eines Gesamtsystems? - Ist ein Cross Belt Sorter redundant? - Was bietet die Galileo IoT Plattform und von wem wird die Plattform klassischerweise genutzt? - An welche Themen muss man bei der Wartung eines Sorters denken? Hört einfach mal rein! Bezahlte Partnerschaft.
Diese Folge entstand im Rahmen eines Projekts zur Modellbildungsvorlesung von Gudrun. Es ist eine Arbeit von Yannik Brenner, Bastian Hasenclever und Urs Malottke, die das Ziel haben, in einigen Jahren Mathematik und Physik am Gymnasium zu unterrichten. Außerdem macht Yannik selbst Musik und hat sich deshalb ganz praktisch mit Schwingungen an der Gitarre beschäftigt. Die drei hatten die Idee, dass man das Thema Schwingunge interessant für die Schule aufbereiten kann, wenn es dazu auch Hörbeispiele gibt. Deshalb haben Sie sich an einen Tisch gesetzt, das Gespräch und die Hörbeispiele aufgenommen und schließlich den Text dazu aufgeschrieben. Der harmonische Oszillator spielt eine wichtige Rolle zur Modellierung verschiedenster physikalischer Sachverhalte. Daher bietet es sich an, ihn schon in der Schule zu thematisieren, wo er auch in der Oberstufe im Bildungsplan zu finden ist. Während im Podcast der Versuch unternommen wurde, ein Grundverständnis für das Thema ohne formale Zusammenhänge zu entwickeln, sollen hier zusätzlich die mathematischen Hintergründe gemeinsam mit einigen Abbildungen ergänzt werden. Die didaktischen Aspekte, die in der Episode zur Sprache kommen, spielen im folgenden Text jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Grundlegendes Ein Oszillator ist ein System, das um einen bestimmten Punkt, in der Regel Ruhepunkt oder auch die Ruhelage genannt, schwingen kann. Befindet sich das System in Ruhe in dieser Ruhelage, passiert ohne die Einwirkung äußerer Kräfte nichts; wird das System von diesem Punkt ausgelenkt, wird es durch eine rückstellende Kraft wieder Richtung Ruhepunkt beschleunigt. Der Zusatz "harmonisch" bedeutet, dass die Rückstellkraft linear von der Auslenkung zum Ruhepunkt abhängt, also proportional zur Auslenkung zunimmt. Der Graph der Bewegungsfunktion ist eine Sinus- oder Cosinus-Kurve. Die einfachsten und wohl auch bekanntesten Beispiele eines Oszillators im Bereich der Mechanik sind das Faden- und das Federpendel. Beim Fadenpendel ist der niedrigste Punkt die Ruhelage und die Rückstellkraft resultiert aus der Gravitationskraft. Beim Federpendel stellt die Federkraft die rückstellende Kraft dar. Eigenschaften eines harmonischen Oszillators Ein schwingfähiges System besitzt verschiedene Eigenschaften, mit deren Hilfe das gesamte System beschrieben werden kann. Um den harmonischen Oszillator zu verstehen, kann man sich zuerst die Bewegungsgleichung ansehen, also die Gleichung, die die aktuelle Lage des Systems beschreibt. Ausgangspunkt ist die Rückstellkraft, die im mechanischen Fall linear von der Auslenkung zur Ruhelage, also dem aktuellen Ort, abhängt (auf nicht-mechanische Einsatzgebiete wird später eingegangen). Die Rückstellkraft kann mit einer Variablen , die von verschiedenen Merkmalen des Systems abhängt, gemeinsam mit dem Ort also als dargestellt werden. Die Kraft kann auch als Beschleunigung , also der zweifachen Ableitung des Ortes, mal der Masse ausgedrückt werden, wodurch die Formel auch folgendermaßen aussehen kann: Diese Art von Formeln, in der eine Größe gemeinsam mit einer ihrer Ableitungen auftritt, wird Differentialgleichung genannt. Das Erarbeiten einer Lösung ist leichter, wenn durch die Gleichung vereinfacht wird. wird die Eigenfrequenz des Systems genannt und gibt außerdem an, wie viele Schwingungen das System in einer bestimmten Zeit, oftmals einer Sekunde, macht, wenn keine anderen Kräfte vorliegen. Somit ergibt sich Die Lösung der Funktion für den Ort muss eine Funktion sein, die nach zweimaligem Ableiten bis auf einen Vorfaktor und das Vorzeichen wieder die Ursprungsfunktion ist. Deshalb sind Sinus- und Cosinus-Funktionen, oder die äquivalente Darstellung durch die e-Funktion (siehe Eulersche Formel), Lösungen. Werden nun gewählt, wobei und die Amplituden, also maximalen Auslenkungen der Schwingungen darstellen, kann mit den Ableitungsregeln überprüft werden, dass dies Lösungen für die Bewegungsgleichung sind. Als Summe zweier Lösungen ist auch Eine Lösung, die die allgemeine Lösung genannt wird. Die beiden Amplituden der einzelnen Sinus-/Kosinus-Funktion müssen dabei aus Anfangsbedingungen bestimmt werden. Man sieht, dass die Amplitude der beobachtbaren Schwingung sein muss, also der maximalen Auslenkung, die beim Zeitpunkt vorliegt, da die Gesamtschwingung zum Zeitpunkt diese Auslenkung annehmen muss und zu diesem Zeitpunkt der Sinus verschwindet: Die Amplitude der Sinus-Funktion bestimmt sich nach und spielt daher dann eine Rolle, wenn zum Zeitpunkt bereits eine Geschwindigkeit vorliegt, das System also nicht aus der Ruhe losgelassen, sondern angestoßen wird. Zu besprechen ist allerdings noch, wie die Gleichung bei einem anderen Pendel als dem Federpendel aussieht. Das Prinzip des Oszillators bleibt gleich und somit natürlich auch die Mathematik, die ihn beschreibt. Allerdings setzt sich bei anderen Pendeln anders zusammen, da bei ihnen andere Rückstellkräfte und andere Systemeigenschaften eine Rolle spielen und nicht die Federkonstante und Masse wie beim Federpendel. So gilt beim Fadenpendel wobei die klassische Gravitationskonstante ist, die beim Fadenpendel eine große Rolle für die Rückstellkraft einnimmt, und die Fadenlänge darstellt. Werden Oszillatoren außerhalb der Mechanik betrachtet, beispielsweise der elektrische Schwingkreis, ergibt sich aus den Eigenschaften, die dieses System beschreiben. Beim elektrischen Schwingkreis z.B. aus der Induktivität der Spule und der Kapazität des Kondensators: Um die Sinus-förmige Schwingung eines Oszillators zu beschreiben, werden noch weitere Begriffe verwendet, die jedoch aus den bisher vorgestellten Eigenschaften bestimmt werden können. So wird unter der Schwingungs- oder Periodendauer die Zeit verstanden, die das System für eine vollständige Schwingung benötigt. Da sie als Informationen die Anzahl an Schwingungen und eine Zeit enthält, muss sie eng mit der Eigenfrequenz zusammenhängen: Überblick über die wichtigsten Begriffe zur Beschreibung einer Schwingung (Quelle: leifiphysik.de) Ungedämpfter harmonischer Oszillator Immer dann, wenn ein schwingfähiges System mit der obigen Gleichung beschrieben werden kann, handelt es sich um einen ungedämpften harmonischen Oszillator. Denn an der Gleichung wird klar, dass die Amplitude, also die maximale Auslenkung, auch bei der 20ten, 100ten, 10.000ten Schwingung wieder erreicht wird. Da sich die Systemeigenschaften ohne äußere Einflüsse ebenfalls nicht ändern, ändert sich das Verhalten dieses Oszillators nie und er schwingt stets gleich um die Ruhelage. Nach der mathematischen Herleitung ist schon fast alles zum ungedämpften harmonischen Oszillator gesagt, denn: Reale Beispiele und Anwendungen gibt es nicht! In der Realität gibt es immer einen Widerstand, der den Oszillator ausbremst und die Auslenkung langsam kleiner werden lässt. Aus diesem Grund ist der ungedämpfte Oszillator nur zum Kennenlernen und Verstehen des Verhaltens sowie als Näherungslösung geeignet. Gedämpfter harmonischer Oszillator Beim gedämpften harmonischen Oszillator existiert eine bremsende Kraft. Das ändert die mathematische Beschreibung in der Differentialgleichung. Die Bewegungsgleichung des Federpendels (und äquivalent die Gleichungen anderer Oszillatoren) wird um einen Term ergänzt, der im einfachen Fall der Reibung in der Luft, also einem Reibungskoeffizienten und proportional zur Geschwindigkeit ist: Oft wird zu zusammengefasst, um das rechnen zu vereinfachen. Die zu lösende Differentialgleichung wird auf die gleiche Art gelöst, wird aber natürlich komplizierter. Als Lösungsansätze empfehlen sich wieder Sinus-, Cosinus- oder e-Funktion. Mit dem Ansatz ergeben sich Lösungen, wenn die folgende Gleichung erfüllt: Je nachdem, wie das Verhältnis von Dämpfung und Eigenfrequenz sind, werden verschiedene Fälle unterschieden: Schwach gedämpfter Fall Der schwach gedämpfte Fall tritt auf, wenn gilt. Somit ist die Zahl unter der Wurzel bei der Berechnung von negativ und die Wurzel selbst imaginär. Mit der verkürzten Schreibweise ergibt sich die allgemeine Lösung zu was im Vergleich mit der ungedämpften Schwingung eine Schwingung mit kleinerer Frequenz (da ) und einer mit der Zeit exponentiell abnehmenden Amplitude darstellt. Eine andere Darstellungsweise ist folgende: Hier ist die exponentielle Abnahme der Amplitude besser ersichtlich, allerdings ist dazu das Verständnis des Zusammenfassens zweier auftretender periodischer Funktionen mittels Phasenverschiebung nötig. Die Schwingung schwingt in diesem Fall weiterhin um die Ruhelage, allerdings wird, wie bereits gesagt, die maximale Auslenkung mit jeder Schwingung geringer. Die Einhüllende zu einer gedämpften Schwingung (Quelle: Wikipedia/Harmonischer-Oszillator) Aperiodischer Grenzfall In Anwendungen ist es oft gewollt, eine Schwingung schnellstmöglich zu stoppen und zur Ruhelage zurückzukehren. Wenn eine Dämpfung keine komplette Fixierung in einem Zustand beinhaltet, ist eine überstarke Dämpfung dabei aber nicht zielführend, wie intuitiv oft angenommen wird. Um die Schwingung schnellstmöglich zu stoppen, ist die Bedingung nötig. Somit verschwindet in der Berechnung von die Wurzel und es bleibt nur eine Lösung übrig, was für die Schwingung zu führt, wobei und aus den Anfangsbedingungen, also Auslenkung und Startgeschwindigkeit, bestimmt werden. Beim aperiodischen Grenzfall, manchmal auch mit kritischer Dämpfung bezeichnet, findet keine Schwingung mehr statt. Je nach Anfangsbedingungen kann die Ruhelage einmal durchlaufen werden, spätestens dann wird sich dieser allerdings exponentiell angenährt. Darstellung des aperiodischen Grenzfalls mit unterschiedlichen Startgeschwindigkeiten (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Aperiodischer_Grenzfall) Starke Dämpfung Zwar führt eine starke Dämpfung auch dazu, dass keine Schwingung stattfindet, allerdings braucht das System lange, um wieder in die Ruhelage zurückzukehren. Deshalb wird dieser Fall auch als Kriechfall bezeichnet. Mathematisch wird er mit der Bedingung beschrieben, was zu zwei reellen, negativen Ergebnissen für führt. Die Bewegungsgleichung ergibt damit vereinfacht wobei und wieder aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Vergleich des Kriechfalls mit dem aperiodischen Grenzfall Um zu zeigen, dass die vorgestellten Fälle alle von Nutzen sind, werden nun einige Anwendungsbeispiele vorgestellt. So ist der Fall der schwachen Dämpfung für Saiteninstrumente wichtig, da die einzelnen Saiten sich nicht sofort wieder in die Ruhelage begeben dürfen, sondern schwingen müssen, um überhaupt einen Ton erzeugen zu können. Der aperiodische Grenzfall ist beispielsweise für Autofahrer sehr wichtig, da die Stoßdämpfer nach diesem Prinzip funktionieren. Das hat den einfachen Grund, dass das Auto nach der Beanspruchung der Stoßdämpfer schnell wieder in die ideale Straßenlage kommen soll. Würde eine schwache Dämpfung verwendet werden, so würde das Auto noch für längere Zeit auf und ab wippen und die Fahrt eher einer Bootstour ähneln, was wenig komfortabel ist. Bei starker Dämpfung könnte es vorkommen, dass die nächste Beanspruchung nicht ausreichend abgefedert werden kann, da die Feder noch zu stark eingefedert ist. Aber auch die starke Dämpfung hat ihre Anwendungsgebiete. So sind beispielsweise viele Türen in öffentlichen Gebäuden stark gedämpft. Das sorgt für ein langsames und leises Schließen der Türen und verhindert, dass die Tür einer unaufmerksamen Person mit zu viel Geschwindigkeit entgegenfällt und diese eventuell verletzt. Getriebener Oszillator Bisher wurde der Oszillator ohne äußere Kräfte betrachtet. Liegt solch eine Kraft vor, muss diese in die Bewegungsgleichung integriert werden: Interessant ist dieser Fall besonders dann, wenn es sich bei der Kraft um eine periodische Kraft handelt, also . Dieser Fall ist sehr gut mit einem schaukelndem Kind zu vergleichen, welches immer zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen Kraft angeschubst wird. Durch diese von außen aufgebrachte Kraft wird aus der homogenen eine inhomogene Differentialgleichung. Um diese zu lösen muss die Lösung der homogenen Differentialgleichung, welche in dem Abschnitt zu dem gedämpften harmonische Oszillator zu finden ist, mit der sogenannten partikulären Lösung addiert werden. Die partikuläre Lösung lässt sich mit dem Ansatz des Typs der rechten Seite lösen und ergibt sich zu dabei handelt es sich bei um eine Phasenverschiebung zwischen der antreibenden Kraft und dem um den Ruhepunkt schwingenden Massepunkt. Von besonderem Interesse ist dabei das Verhalten des gesamten Systems für verschiedene Frequenzen der treibenden Kraft. Dabei werden drei verschiedene Fälle betrachtet. Niederfrequenter Bereich: Für den niederfrequenten Bereich gilt, dass die Frequenz der antreibenden Kraft sehr viel kleiner ist als die Eigenfrequenz des Oszillators. Aufgrund dessen ist die Amplitude der anregenden Kraft in etwa so groß wie die Amplitude des Massepunktes. Das Amplitudenverhältnis beträgt also ungefähr 1. Der Phasenunterschied zwischen den beiden Schwingungen ist in etwa 0. Resonanzfall: Von Resonanz wird gesprochen, wenn die Frequenz der antreibenden Kraft der Eigenfrequenz des Oszillators gleicht. Infolgedessen erhöht sich die Amplitude des Oszillators gegenüber der Amplitude des Erregers, sodass sich ein Amplitudenverhätnis ergibt, welches größer 1 ist. Die Phasendifferenz beträgt , wobei der Erreger dem Massepunkt vorauseilt. Hochfrequenter Bereich: Sollte die Frequenz der antreibenden Kraft viel größer sein als die Eigenfrequenz des Oszillators so fällt auch die Amplitude des Oszillators wesentlich kleiner aus. Es ergibt sich ein Amplitudenverhätnis, welches gegen 0 geht. Auch in diesem Fall gibt es eine Phasendifferenz , die Schwingungen laufen also fast gegenphasig ab. Auch diese Eigenschaften der Oszillatoren sind im Alltag von Bedeutung. So ist es für Autos wichtig, dass die Eigenfrequenz einzelner Teilsysteme oder des Gesamtsystems nicht im Bereich der Motorendrehzahl liegen um eine komfortable und sichere Fahrt zu gewährleisten. Insbesondere der Resonanzfall kann gefährliche Auswirkungen haben, da in diesem Fall das System immer weiter aufgeschaukelt wird und die Amplitude des Oszillators sich immer weiter erhöht. Falls das System nicht gedämpft ist, kann die Amplitude bis ins Unedliche steigen, was zur Zerstörung des Systems führt. Eine starke Dämpfung kann die maximale Amplitude zwar begrenzen, aber auch in diesem Fall komm es für den Resonanzfall zu einer starken Belastung des Systems, was in den meisten Fällen vermieden werden sollte. Ein gutes Beispiel für eine Resonanzkatastrophe ist die Tacoma Narrows Bridge, welche durch starke Winde in Schwingung versetzt wurde, welche sich dann selbsterregt immer weiter verstärkte, was den Einbruch der Brücke zur Folge hatte. Demgegenüber bleibt aber zu sagen, dass ohne Resonanz auch viele alltägliche Dinge nicht möglich wären, es also auch einen positiven Aspekt gibt. So würde Schaukeln nicht halb so viel Spaß machen, wenn es nicht möglich wäre seine eigene Schwingung zu verstärken und somit immer höher Schaukeln zu können. Ein weiteres typisches Beispiel für den getriebenen harmonischen Oszillator stellt der elektrische Schwingkreis da, der bei der drahtlosen Energieübertragung genutzt wird. Das System wird dabei ständig neu mit Energie aufgeladen, die es dann mittels sogenannter resonant induktiver Kopplung an einen Empfänger weitergeben kann, der so kabellos geladen wird. Weiterführendes Viele weiterführende Beispiele, die sich des Oszillators mit schwacher Dämpfung bedienen, sind in der Akustik respektive Musik zu finden, wie die Schwingung einer (Gitarren-)Seite, die nach einmaligem Anschlag möglichst lange klingen soll. Doch hier handelt es sich nicht um einen einfachen harmonischen Oszillator, sondern um ein komplexeres System. Literatur und weiterführende Informationen Viele Experimente und Material zum Fadenpendel für die Schule findet man z.B. auf leifiphysik.de Physik des Aufschaukelns Anschubsen K. Magnus: Schwingungen, Teubner 1976. Juan R. Sanmartin: O Botafumeiro: Parametric pumping in the Middle Ages Anwendung auf das Schwenken des berühmten Weihrauchfasses in der Kathedrale von Santiago de Compostela, 1984. Podcasts Helen: Schaukeln, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 114, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016.
#6 Menschen im Mittelpunkt - Ergonomie für Produkte und Arbeitsumwelt
Ergonomie betrifft uns alle. Sie ist wichtig, wenn es darum geht, Produkte und die Arbeitsumwelt menschengerecht zu gestalten. Das bedeutet z.B., dass Büromöbel so gebaut werden, dass sie den Körper unterstützen oder dass bei Software besonders auf die Gebrauchstauglichkeit geachtet wird. Ziel der ergonomischen Gestaltung von Produkten und Arbeitssystemen ist es, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren. Im Bereich Arbeitsschutz sind Ergonomie-Normen nicht wegzudenken. Wie waren die Anfänge der Ergonomienormung und was sind aktuelle Herausforderungen? Antworten gibt unser Interview mit Prof. Dr.-Ing. habil. Sascha Stowasser, Vorsitzender des DIN-Normenausschusses Ergonomie und Direktor des Institutes für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa). Wenn Sie Fragen oder Ideen für weitere Podcast-Themen haben, dann melden SIe sich gerne unter podcast@kan.de Ckecklisten des ifaa: Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit: https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Checklisten_Handlungshilfen/Checkliste_Mobile_Arbeit_Formular_2019_AR.pdf Checkliste Ergonomie: https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Downloads/Angebote_und_Produkte/Checklisten_Handlungshilfen/Checkliste_Ergonomie_Neuauflage_Formular_AR_01.pdf Informationen der KAN zum Thema Ergonomie: https://www.kan.de/arbeitsgebiete/ergonomie/ KAN-Praxis Module: Ergonomie lernen. https://ergonomie.kan-praxis.de/ KAN-Praxis NoRA: Normen recherchieren. Speziell für Ergonomienormen: https://nora.kan-praxis.de/ergonora KAN-Praxis Maschinen: Ergonomische Lösungen finden: https://maschinenergonomie.kan-praxis.de/ KAN-Praxis Ratgeber: Körpermaße anwenden: https://koerpermass.kan-praxis.de/
404: Die wichtigste Unternehmereigenschaft mit Boris Thomas
Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten.Das ist Folge 404 mit dem Unternehmer und Speaker Boris Thomas.Mein Name ist Rayk Hahne, Profisportler und Unternehmensberater.Jede Woche bekommst Du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit Du als Unternehmer noch besser wirst.Danke, dass Du Die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Wenn Dir die Folge gefällt teile Sie mit Deinen Freunden unter dem Link raykhahne.de/404. In der heutigen Folge geht es um die wichtigste Unternehmereigenschaft. Welche 3 wichtigen Punkte kannst Du Dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Wieso Du eine Feuertaufe brauchst. Wie Reflektion einfach geht. Warum Du ein System verlassen musst. Du kennst sicher jemanden für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie und hilf auch anderen Unternehmern ihre Herausforderungen zu überwinden. Der Link ist raykhahne.de/404. Bevor wir gleich mit der Folge starten, habe ich noch eine Empfehlung für Dich. Diesmal in eigener Sache. Egal ob das Deine erste oder Deine 404 Folge mit mir ist. Du hörst das hier um Dich unternehmerisch weiterzuentwickeln. Lass uns das noch besser machen! Unter raykhahne.de kannst Du Deinen Unternehmertest machen, und ganz schnell geben Dir mein Team und ich die für Dich passenden Werkzeuge mit an die Hand! Ganz gleich ob Du Gründer, Selbstständiger oder Unternehmer bist. Für jede Herausforderung haben wir die geeignete Lösung zusammengetragen. Besuche raykhahne.de und werde noch besser! Rayk:Willkommen Boris Thomas.Bist Du ready für die heutige Trainingseinheit? Gast: Unbedingt Rayk:Lass uns gleich starten!Was sind die drei wichtigsten Dinge die unsere Zuhörer über Dich wissen sollten? Gast: 1. Ich bin CEO und Inhaber von Lattoflex seit fast 30 Jahren 2. Ich habe drei Kinder die schon erwachsen sind und durch die Welt gehen 3. Ich bleibe neugierig, finde heraus was alles geht und gehe dann an die Grenzen und einen Schritt weiter Rayk:Du bist voll gut Unternehmer seit vielen Jahren und gibt's dieses Wissen jetzt weiter an Andere Punkt was war der Beweggrund dafür? Gast: Unternehmer sind eine unterschätzte Klasse in unserer Gesellschaft die kaum Beachtung findet. Die meisten sind Einzelkämpfer. Ich habe dann gesehen wie viele Fragen da sind und dass es viel Verunsicherung gibt. deshalb habe ich mich entschieden dieses Wissen weiterzugeben. Deshalb wollte ich auf die Bühne und mein Wissen aus der Praxis teilen Punkt ich bin weder Berater noch Coach. in dem Buch das ich geschrieben habe, “fang nie an aufzuhören”, spreche ich Klartext, es handelt auch von meinen Fehlschlägen, Krisen und Niederlagen Punkt darüber sprechen Unternehmer äußerst ungern. Rayk:Was war beruflich Deine Weltmeisterschaft? Was war Deine größte Herausforderung und wie hast Du diese überwunden? Gast: Als Unternehmer wirst du nie um Krisen herumkommen. Mein Buch ist gefüllt mit einer endlosen Anzahl von Fehlschlägen Krisen. Anfang der 2000er hat uns einen Lieferant im Stich gelassen, wodurch Umsätze massiv ein brachen und das Vertrauen in uns geschädigt wurde. Unsere Kunden stellten damals den Verkauf unserer Produkte ein. Ein sehr wichtiger Punkt für mich war die psychologische Komponente. Mit sich selber hadern und zweifeln. Nicht schlafen zu können weil du dich fragst wie du die Löhne gezahlt und Kosten gedeckt bekommst. Rayk:Was war dein wesentliches Werkzeug das wir kennen sollten und vielleicht noch nicht kennen? Was hat dir am meisten in den Krisenzeiten geholfen? Gast: Das ist die Reflektion, deshalb ist das auch das erste Kapitel in meinem Buch. Ich sehe es eher als ein regelmäßiges Training anstatt als Werkzeug. Sich regelmäßig darauf zu trainieren nicht auf alles sofort zu reagieren Sondern einen Schritt zurück zu machen und alles zu überdenken bevor man mit Schnellschüssen etwas zerstört. Meine Mutter hat immer gesagt schlaf mal eine Nacht darüber. Das fällt uns dann sehr schwer weil wir aus Angst und Emotionalität das Problem lösen wollen. Rayk:Hast du da ein praktisches Beispiel für so eine Situation wenn der dir das geholfen hat? Gast: Ja, gerade jetzt in der Corona Zeit. der März war eigentlich voll mit Reisen zu etlichen messen und Termine im Ausland welche innerhalb von einer Woche alle gestrichen wurden. So hatte ich den kompletten Monat für mich als Reflektionsmonat. Diese Zeit habe ich dann genutzt um mich Themen zu widmen für die ich keine Zeit hatte und auch Bücher zu lesen die ich schon immer lesen wollte. Daraus ist eine coole Marketingkampagne entstanden. Ich hätte sonst nie die Zeit gehabt mich so intensiv diesen Themen zu widmen. Daher bin ich sehr dankbar für die Corona Zeit, da ich ansonsten nie an diese Themen rangegangen wäre. Rayk:Wie viel Freiraum nimmst du dir normalerweise in einer normalen hektischen Arbeitswoche um solche Dinge auf den Weg zu bringen? Gast: Im Jahresmittel versuche ich mehr als 50% an meinem Unternehmen zu arbeiten und zuschauen wo soll das Unternehmen in 5 Jahren stehen. Wo laufen Dinge nicht gut und warum ist das so? Das zu verstehen ist ein Thema mit dem ich mich dann beschäftige. Wir schauen viel zu oft auf einer oberflächlichen Ebene nach Lösungen anstatt die Dinge wirklich in die Tiefe zu verstehen. Dazu ist für mich ein Anteil von mehr als 50% für diese Tätigkeit Pflichtprogramm für jeden Unternehmer. Rayk:Was wäre der erste Schritt um als Unternehmer in die Reflektion einzusteigen? Gast: Der erste Schritt ist ein sogenannter Musterbruch auf der körperlichen Ebene. Das heißt, verlasse den Raum und am besten dein Unternehmen. Egal ob Fitnessstudio, Wald, oder einfach joggen. Durchbricht das Muster des introvertiert seins. Da der Schreibtisch Bestandteil des Gesamtsystems ist wird es Dir sehr schwer fallen von deinem Schreibtisch aus dein Unternehmen von außen zu betrachten. Deshalb durchbricht das Muster und gehe raus aus dem System. Rayk:Was sind die ersten Muster die man nutzen kann um dann ruhiger zu werden z.b. nach hitzigen Debatten? Gast: Zuerst die eben besprochene Veränderung auf körperlicher Ebene und dann achte auf deine Atmung. Die Atmung ist ein sehr gutes Werkzeug um alles wieder in den Griff zu bekommen und der Geist wird dann dem Körper folgen. Als zweiten Schritt nimmt deine Gedanken erst einmal war. Sehe sie z.b. wie in dem Bild aus dem Zen Buddhismus, als Melonen die auf einem Fluss vorbei treiben. Dann sitze am Fluss und schaue deinen Gedanken zu wie sie vorbei treiben, gib ihnen aber möglichst wenig Bedeutung. Die Herausforderung ist immer die Bedeutung die wir den Gedanken geben, nicht der Gedanke selbst. Rayk:Kannst Du der Unternehmerwissen-Community kurz die 3 Schritte darstellen, mit denen Du das umsetzen würdest? Gast: 1. Gehe raus und betrachte das System von außen 2. Lasse es geschehen und nimm es als das an was es ist 3. Nimm dir den Raum den du brauchst und mache vielleicht auch mal etwas komplett anderes trotz dass die Hütte brennt Rayk:Grandios. Lass uns das Interview mit Deinem Spezial-Tipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, dem besten Weg mit Dir in Kontakt zu treten und dann verabschieden wir uns. Gast: Mein Buch ”Fang nie an aufzuhören” findest du überall da wo es Bücher gibt. Auf meiner Website boristhomas.de findest du auch meinen Podcast und alle Informationen zu meiner Tätigkeit als Redner. Natürlich auch auf Facebook und Instagram Rayk:Vielen Dank das Du Deine Erfahrungen und Dein Wissen mit uns geteilt hast. Gast: Vielen Dank. die Shownotes zu dieser Folge findest Du unter raykhahne.de/404 alle Links habe ich Dir dort aufbereitet und Du kannst die Inhalte der Folge noch einmal nachlesen Wenn Du als Unternehmer endlich weniger Arbeiten möchtest, dann gehe auf unternehmerfreiheit.online , einen ausgewählten Kreis werde ich bald zeigen, wie es möglich ist, mit mehreren Unternehmen gleichzeitig weniger als 30 Stunden die Woche zu arbeiten. unternehmerfreiheit.online 3 Sachen zum Ende Abonniere den Podcast unter raykhahne.de/podcast Wenn Du noch mehr erfahren möchtest besuche mich auf Facebook und Instagram Bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes Danke, dass Du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist vorbei, jetzt liegt es an Dir. Viel Spaß mit der Umsetzung.
In dieser Folge berichtet uns Torsten Mandry von seinen Erfahrungen mit dem Testen von Microservice-Systemen. Automatisiertes Testen ist in der Softwareentwicklung mittlerweile ein Standardvorgehen. Mit Hilfe von End-to-End Tests wird die gesamte Anwendung als Blackbox betrachtet und über ihre bereitgestellten Schnittstellen (UI, Rest API, Message Queue, …) verifiziert. Wie aber wird dann das Zusammenspiel der einzelnen Microservices getestet und sichergestellt? Die Idee, End-to-End Tests des Gesamtsystems zu erstellen, scheint naheliegend. Aber ist das wirklich sinnvoll, oder gibt es andere, besser geeignete Ansätze?
Der Geobiologe Reinhold Leinfelder vertritt die These, dass die Menschheit die Erde in ein neues geologisches Zeitalter geführt hat. Leinfelder gehört einem internationalen Expertengremium an, das empfohlen hat, das Erdzeitalter des Holozäns für beendet zu erklären. Nach dem Urteil der Wissenschaftler ist diese Epoche, die vor ca. 11.700 Jahren begann und stabilen Umweltbedingungen geprägt war, bereits um das Jahr 1950 einer neuen geologischen Ära gewichen, dem vom Menschen geprägten Anthropozän. Für die Etablierung einer neuen erdzeitlichen Epoche reicht die Einsicht nicht, dass der Mensch offensichtlich zu einem prägenden Faktor der Biosphäre geworden ist. Dieser prägende Einfluss muss sich durch eindeutig nachweisbare sedimentäre Befunde ausweisen lassen. Folgt man den Forschern, schlägt sich der menschliche Einfluss z.B. bei der Beschleunigung von Erosions- und Sedimentierungsprozessen, der Verbreitung von Plastik, Aluminium, künstlichen Radionukleiden und Flugasche oder durch Klimaveränderungen mit Auswirkungen auf den Meeresspiegel nieder. Wie geht es weiter mit dem Antropozän? Leinfelder sagt: „Sollten wir Menschen in einer Zeit, in der nicht nur die Umweltzerstörung, sondern auch das Wissen über die zugrundeliegenden Prozesse gestiegen ist, nicht dazu fähig sein, das Anthropozän so zu gestalten, dass die planetaren Grenzen des Erdsystems nicht gefährdet werden, indem wir uns als Teil eines Gesamtsystems verstehen, das es zu erhalten gilt?“
Folge15: IT Projektmanagement...was macht es so besonders Teil II
Worin liegt die eigentliche Rolle des Managements? Im intelligenten Reagieren auf Veränderungen. Jean-Jacques Servan-Schreiber Die Folge 15: IT Projektmanagement, was macht es eigentlich besonders…Teil II Herzlich willkommen zum Zweiten Teil unseres Podcastes in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, was IT Projektmanagement eigentlich so besonders macht. Dabei betrachteten wir Vorgehensmodelle, Methoden und deren Anwendung. Aber auch auf Rahmenbedinungen die zu beachten und klären sind um die richtigen Methoden und Vorgehensmodelle zu wählen. Die erste Folge dieses Podcasts endete mit der Betrachtung der unterschiedlichen IT Projektmanagementdiziplinen und deren Anforderungen an den Projektmanager. Betrachtet haben wir • Embedded System Entwicklung und • IT Infrastrukturprojekte Im Zweiten Teil dieser Folge möchte ich die begonnen Gedankengänge weiterführen und auch die anderen Arten betrachten: • Softwareevaluierungsprojekte • IT Rollout Projekte • Migrationsprojekte • Customizing Projekte • IT Umzugsprojekte • Oder Organisationsänderungsprojekte Softwareevaluierungsprojekte Bei dieser IT Projektart geht es primär um den Kauf eines Softwareproduktes und darum das am besten für die Anforderungen des Unternehmens geeignetste Produkt zu finden. Nehmen wir als Beispiel die Einführung eines CRM Systems im Unternehmen. Es gibt auf dem Markt eine Vielzahl von Systemen, mit einer großen Menge sich überschneidender Funktionen, aber auch Produkte die unterschiedliche Schwerpunkte setzten und damit unterschiedliche Stärken haben. Klassischerweise beginnt ein solches Projekt mit der Bedarfsermittlung in Form von Interviews. Die zukünftigen Anwender werden bezüglich ihrer Anforderungen befragt und deren Arbeitsablauf wie er heute ist dokumentiert oder sogar modelliert. Auf diese Weise erhält der Interviewer am Ende ein recht genaues Bild wo die Schwerpunkte liegen. Diese lassen sich dann beispielsweise auf eine Anforderungsmatrix übertragen. Zu den Anforderungen der zukünftigen Anwender kommen noch Anforderungen des Managements hinzu. Beispielsweise, kein Produkt, dessen Hersteller nicht wenigstens 200 Mitarbeiter hat, oder mindestens 2000 Referenz Installationen vorzuweisen hat, usw.. Im nächsten Schritt ist es wichtig, diese gesammelten Anforderungen zu gewichten. Denn nicht jede Anforderung ist gleich wichtig und ein Produkt wegen einer nebensächlichen Anforderung aus dem Raster fallen zu lassen, dient niemandem. Ist die Anforderungsarbeit geleistet, beginnt im nächsten Schritt die Marktsondierung. Zunächst im Groben- welche Produkte kommen aufgrund der Anforderungen überhaupt in die engere Wahl, welche sind maximal zweite Wahl und welche fallen ganz raus. Ist diese Arbeit getan und die Entscheidungen dazu dokumentiert, beginnt die Phase der Kontaktaufnahme mit den Produktherstellern. Es empfiehlt sich Referenzadressen zu Installationen mit vergleichbaren Anforderungen einzuholen. In der Regel sind diese Referenzadressen zumindest zu einem Telefongespräch- wenn nicht sogar zu einem Treffen bereit. Diese Termine und die Anwendererfahrungen sind sehr wertvoll und hier erhält man oftmals auch wertvolle Praxistipps. Als nächstes stehen die Präsentationstermine der Hersteller auf der Tagesordnung. Hier holt man sich eine komprimierte Einführung in das jeweilige Produkt, stellt gezielte Fragen und erhält ein Gefühl für die Bedienbarkeit des Produktes. Bei diesen Terminen sollten die Vertreter der zukünftigen Anwender dabei sein um deren Fragen zu klären und deren Meinungsbild am Ende mit zu berücksichtigen. Die Hersteller bekommen bei Bedarf am Ende noch einen Fragenkatalog zum Ausfüllen mit. der dann die einzelnen Produkte vergleichbarer macht. Mit Hilfe der Anforderungen und deren Gewichtung und der Erfüllung der einzelnen Hersteller, hat man am Ende ein valides Ergebnis mit einer Entscheidungsvorlage zur Produktbeschaffung. Anforderungen an den Projektmanager Bei dieser Projektart sollte der Projektmanager über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit verfügen, um bei den Interviews nicht nur die richtigen Fragen zu stellen, sondern auch um die Informationen und Hinweise zu erkennen, die sich hinter den Antworten verbergen. Ferner sollte er die fachlichen Hintergründe kennen und verstehen, die mit Hilfe der zu beschaffenden Software gelöst werden sollen. Der Projektmanager sollte zumindest grundsätzlich die am Markt befindlichen Softwareprodukte kennen. Idealerweise hat er eigene Erfahrungen mit den Produkten. Es ist aber unbedingt notwendig bei diesen Projekten Neutralität zu wahren. Der Knochen muss dem Hund schmecken- nicht dem Metzger. Es geht nicht darum, den Auftraggeber von der eigenen Lieblingssoftware zu überzeugen, sondern neutral, das gemäß Anforderungen beste Produkt für den Auftraggeber zu finden. IT Rollout Projekte Bei IT Rollout Projekten gibt es wiederum eine Reihe von Facetten. Häufig vermischen sich bei diesen Projekten auch die Grenzen zwischen Rollout und Migrationsprojekten. Vor wenigen Jahren gab es eine Phase in der ich teilweise mehrfach pro Monat zur Leitung von Windows 7 Rolloutprojekten angefragt wurde. Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen und damit Herangehensweisen. Die einfachste Variante wäre die Installation auf neuen Rechnern. Nachdem der neue Rechner vor Ort aufgebaut und angeschlossen ist, werden mit Hilfe von Netzwerkinstallationen Betriebssysteme- und mit Softwareverteilsystemen individuelle Softwareprodukte nachinstalliert. Alternativ können auch Festplattenimages auf die Rechner gespielt werden die dann per Powershell Scripte individuell konfiguriert werden. Das geht bis zu komplexen Installationen und Konfigurationen die, je nach Anforderung, pro Arbeitsplatz individuell händisch zu bearbeiten sind. Noch anspruchsvoller wird es, wenn alte Betriebssystemversionen upzudaten sind, sofern die Hardwareanforderungen dies zulassen. Bis zur Einstellung des Supports von Windows XP im April 2014 ist ein regelrechter Boom an Migrationsprojekten gestartet. Am 13. Januar 2015 wurde offiziell der sogenannte „Mainstream Support für Windows 7“ eingestellt. Microsoft garantiert allerdings den „extended Support für Windows 7“ noch bis zum 14. Januar 2020. Mit diesem extended Support werden zumindest wichtige Sicherheitsupdates weiterhin bereitgestellt. Momentan, also im März 2015, besteht also noch kein Grund um hektisch zu werden. Bleibt abzuwarten wie sich der „Windows 8“ Nachfolger „Windows 10“ am Markt behaupten wird. Gerade im Vorfeld solcher Projekte sind eine Reihe Fragen zu klären. • Ist alle Software, die unter dem alten Betriebssystem lief auch von deren Herstellern für das neue Betriebssystem freigegeben? • Sind Individualentwicklungen unter dem neuen Betriebssystem lauffähig? • Gibt es Treiber für Drucker, Scanner oder sonstige im Unternehmen befindliche Geräte? • Wenn nicht, stehen dann auch noch Neubeschaffungen an? • Gibt es alte Softwarelösungen die nicht unter dem neuen Betriebssystem lauffähig sind und die weder updatebar noch verzichtbar sind? • Können solche Systeme in eigenen DMZ (Demiliterized Zone) die also abgeschottet sind und keine Internetverbindung haben, laufen? Natürlich zählen in den letzten Jahren auch der Rollout von Mobile Devices, also Tablett PCs oder Smartphones mit in diese Kategorie von IT Projekten. BYOD Rollout, also „Bring your own Device“, stellt hier sicherlich eine weitere Unterkategorie von IT Rolloutprojekten dar. Gerade hierbei spielen Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Anforderungen an den Projektmanager Bei dieser Projektart sollte der Projektmanager über fundierte Produktkenntnisse verfügen. Alleine damit wird schon klar, dass sich auch hier wieder die Reihen der Spezialisten gabeln. Es erfordert einiges an Erfahrung, steht man vor der Herausforderung eine komplette Infrastruktur mit neuen Geräten auszustatten. Dies stellt Ansprüche sowohl an logistische Fähigkeiten, als auch an eine gründliche Anforderungsanalyse. Denn nur wenn klar ist, was in die Zielumgebung muss, wie vollständige Funktion dort getestet werden kann und dies auch ist, ist der Betrieb nach dem Rollout sichergestellt. Wie erwähnt müssen bei diesen Projekten IT Security Kenntnisse und gute Netzwerkkenntnisse vorhanden sein. Migrationsprojekte Jede Software hat nur eine begrenzte Halbwertszeit und soll beispielsweise wegen toller neuer Funktionalität, oder z.B. wegen geänderten gesetzlichen Regelungen durch eine neue Version abgelöst werden. Je nachdem wie diese Software bislang in die Systemlandschaft des Unternehmens eingebettet war, muss man sowohl das Produkt selbst, als auch das Umfeld und hier im Besonderen die Schnittstellen zum Umfeld betrachten. Sind neue Schnittstellen zu programmieren? Wurden individuelle Änderungen- also Customizings an der alten Software durchgeführt und müssen diese Änderungen nun an der neuen Software ebenfalls wieder programmiert werden? Eine besondere Herausforderung stellt die Datenübernahme in das neue System dar. Oftmals wird diese Datenübernahme dazu genutzt, sich von Altlasten, also Datenmüll zu trennen um das „neue System“ auf einem sauberen Datenstand aufzusetzen. Hieran erkennt man, dass Migrationsprojekte sehr schnell in einzelne Teilprojekte zerfallen müssen um die individuellen Anforderungen zu steuern. Anforderungen an den Projektmanager Zu den Herausforderungen wie sie sich aus einer klassischen Softwareentwicklung ergeben, kommen bei Migrationsprojekten noch dazu, dass der Projektmanager sowohl das abzulösende Produkt, also den Istzustand, als auch den Zielzustand kennen sollte. Je mehr Schnittstellen zu berücksichtigen sind, umso komplexer wird ein solches Projekt. Je mehr komplexe Datenstrukturen auf ein Zielsystem mit ganz anderen Datenstrukturen zu übertragen sind, umso höher sind die Anforderungen diese in das Zielsystem zu überführen. Customizing Projekte Klassisch fällt hier sicher ein großer Walldorfer Softwarehersteller ein, dessen Software nach der Basisinstallation individuell an die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden nach dessen Vorgaben angepasst werden. Diese Möglichkeit schafft die Symbiose eines Standardproduktes und die Flexibilität einer Individualentwicklung. Dieses Customizing muss allerdings gesteuert werden wie eine klassische Softwareentwicklung, allerdings mit dem Wissen, welche Funktionalität das Basispaket bereits enthält, welche Schnittstellen existieren und welche entwickelt werden müssen. Anforderungen an den Projektmanager Grundsätzlich handelt es sich auch hier wieder um Softwareentwicklung, allerdings in Bezug auf die Anpassungsmöglichkeiten des betreffenden Produktes. Der Projektmanager sollte das Produkt und die Möglichkeiten der Adaptierung zumindest in groben Zügen kennen. IT Umzugsprojekte Häufig werden IT Umzugsprojekte belächelt und als etwas abgetan, was man nebenbei mitmachen kann. Doch wer so denkt, unterschätzt die mögliche Komplexität eines Umzugsprojektes. Es beginnt bereits bei der Planung. Die Anforderungsanalyse an den Zielstandort ist ein zwingender Schritt, um den Umzug erfolgreich durchzuführen. Die Schaffung der notwendigen Infrastruktur am Zielstandort, angefangen von der notwendigen Stromversorgung, der Klimatisierung, der Datennetzanbindung, bis hin zu Zugangskontrolle und Brandmeldesysteme sind notwendige Voraussetzungen die vor dem eigentlichen Umzug zu schaffen sind. Abgesehen, ob der Umzug offline passieren darf, also ein System darf vom Netz gehen, oder Online passieren muss- das System muss trotz Umzug verfügbar sein, müssen ganz unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt werden. Für die einzelnen Systeme die auf der umzuziehenden Infrastruktur laufen, müssen Testpläne erstellt werden. Hierzu sind die Produkt- oder Systemowner zu befragen, sofern keine Testpläne vorliegen. Es ist ratsam, sich für den eigentlichen Transport ein spezialisiertes Unternehmen zu holen, dass auf den Umzug von IT Inftrastrukturkomponenten spezialisiert ist. Diese Firmen sind technisch in der Lage, ein Patchfeld oder die Patchung eines Switches zu dokumentieren, die Kabel zu entfernen, das Gerät aus dem Datenschrank auszubauen und transportsicher zu verpacken. Am Zielstandort werden die Geräte gemäß Planung verbaut und gemäß Dokumentation gepached. Bei diesen Umzugsfirmen handelt es sich also nicht um Hilfskräfte die Datenschränke schleppen, sondern um IT Umzugsprofis. Je nach Priorität gehen die Geräte nach mechanischer Montage wieder in Betrieb und die Systeme wieder ans Netz. Die im Vorfeld definierten Testpläne der einzelnen Systeme werden nun abgefahren um die Funktionalität der umgezogenen Systeme zu validieren. Anforderungen an den Projektmanager Der Projektmanager solcher Projekte sollte ohne Frage über logistische Erfahrungen verfügen. Das ist vor allem bei der Vorbereitung und bei der Koordination der einzelnen Arbeitsschritte wichtig. Die Priorisierung, was wann offline gehen kann, wie die Priorisierung zum Wideranlauf gestaltet wird und wie die Inbetriebnahme erfolgt, erfordert einiges an Verständnis des Gesamtsystems und vor allem Koordinations und Kommunikationskompetenzen um die unterschiedlichen (Teil-)Interessen in einem solchen Umzug miteinander zu vereinen. Organisationsänderungsprojekte Klassisch wäre hier beispielsweise die Einführung von ITIL Prozessen im Rechenzentrum zu nennen, oder eine Organisationsänderung im Unternehmen, die in Folge einer neuen Software notwendig ist. ITIL ist ein Framework mit best practice Prozessen für das IT Servicemanagement. Diese Prozesse sind heute Defacto Standard in Rechenzentren. Der Incidentmanagementprozess sieht beispielsweise einen Single Point of Contact (SPOC) vor, bei dem alle Incidents zentral gemeldet werden. Es handelt sich hierbei wohlgemerkt um eine Rolle die durchaus mehrfach besetzt sein kann. Aber alleine diese kleine Änderung ist bereits eine große Herausforderung an eine Unternehmensorganisation. War man doch gewohnt den Kollegen vom Clientmanagement direkt anzurufen wenn man ein Problemchen hat und jetzt soll man beim SPOC anrufen der nur ein Ticket aufmacht? Oder nehmen wir an, ein Unternehmen hat erkannt, welches Potenzial in der Einführung eines geregelten Lizenzmanagementprozesses steckt. Die bisher dezentral verstreut liegenden Softwarelizenzen werden nun zentral gehalten und automatisch abgeglichen. Das Lizenzmanagement muss in diesem Fall dem Einkauf vorgeschaltet werden. Soll Software beschafft werden, muss zunächst der Lizenzmanager prüfen, ob eine freie Lizenz für diese Anforderung genutzt werden kann, oder ob eine externe Beschaffung notwendig ist. Nur im letzten Fall geht die Anforderung an den Einkauf weiter. Anforderungen an den Projektmanager Der Projektmanager sollte die einzuführenden Prozesse sehr gut verstehen und idealerweise Kenntnisse über den Istzustand verfügen. Gerade bei Organisationsprojekten muss peinlich genau darauf geachtet werden, dass das Projekt in der Unternehmenshierachie „richtig aufgehängt“ ist. Das bedeutet, betreffen die Änderungen alle Abteilungen im Unternehmen, macht es keinen Sinn einen der Abteilungsleiter zum Projektauftraggeber zu bestimmen. In diesem Fall ist es erforderlich, das Projekt mindestens auf Bereichsleitungsebene anzusiedeln um überhaupt die notwendige Hebelwirkung zu erzielen. Die Aufzählung an IT Projektmanagementdisziplinen liese sich sicherlich noch weiter führen, aber ich denke wir können es an dieser Stelle damit belassen. Viele der Kollegen werden in der beruflichen Praxis häufig nur mit der einen, oder anderen dieser Herausforderungen konfrontiert. Doch die IT ist viel mehr und das ist es, was es so spannend macht und das ist es warum ich diesen Beruf so liebe. Das Managen von IT Projekten wird niemals zur Routine und gerade weil es so viele Facetten gibt, macht es Sinn sich innerhalb dieser zu spezialisieren. Denn das, was man immer wieder tut, beherrscht man irgendwann in Perfektion. Genau solche Menschen möchten wir von der Bundesvereinigung IT Projektmanagement gerne kennen lernen und Ihre Expertise vorstellen. Um die eingangs gestellte Frage noch einmal aufzugreifen: Gerade dieser Facettenreichtum, macht IT Projekte zu etwas ganz besonderem. Damit bedanke ich mich dass Sie auch heute wieder dabei waren und wünsche Ihnen in Ihren Projekten lauter grüne Meilensteine Ihr Andreas Haberer Weitere Informationen finden Sie unter www.Bundesvereinigung-ITPM.de
Diese Animation stammt aus dem Kurs Technische Wärmelehre im Online Wirtschaftsingenieurwesen Fernstudiengang Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=430 Sind die Grenzen eines Systems nicht nur für Materie undurchlässig, verhindern sie vielmehr jede Wechselwirkung (z. B. auch Energieaustausch) zwischen dem System und seiner Umgebung, spricht man von einem abgeschlossenen (oder isolierten) System. Ein solches System erhält man dadurch, dass man ein System und jene Teile seiner Umgebung, mit denen es in Wechselwirkung steht, zu einem abgeschlossenen Gesamtsystem zusammenfasst. Dies ist ein Beispiel für die grundsätzlich willkürliche Festlegung einer Systemgrenze. Man kann zwei Systeme als Teile eines Gesamtsystems oder als getrennte Systeme behandeln. Ebenso ist es häufig zweckmäßig, einen Teil eines großen Systems als besonderes System hervorzuheben, um die Wechselwirkungen zwischen diesem Teilsystem und dem Rest des größeren Systems zu untersuchen.
Unter dem Stichwort "Liquid Democracy" hat sich die Idee des sogegannten Delegated Voting (oder auch Proxy Voting) in der Netzszene in der letzten Zeit größere Aufmerksamkeit erarbeitet. Im Umfeld der Piratenpartei ist für die tägliche politische Arbeit dazu ein Werkzeug namens LiquidFeedback entstanden, dass diese (und andere) Konzepte umsetzt und das kollaborative Erarbeiten von Ideen, Vorschlägen, Meinungsbildern, Abstimmungsvorlagen und andere strittige Dinge erlaubt. Mit dem System können Teilnehmer ihre Stimme direkt oder delegiert einbringen und ihre Delegation jederzeit zuteilen oder entziehen. Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Jan Behrens die Motivation, Hintergründe und technischen Details von LiquidFeedback, an dem er als Programmierer maßgeblich zu beigetragen hat. Dabei kommen allgemeine Fragen zur Konfiguration des Systems als auch spezielle Aspekte der Nutzung, Best Practice und Erfahrungen mit dem System zur Sprache. Themen: Hintergründe von Liquid Democracy und Delegated Voting; wofür LiquidFeedback geeignet ist und wofür nicht; Aufteilung eines LF-Systems in Themenbereiche und andere Basiseinstellungen; wie man die Arbeit aufnimmt; an wen man delegiert und warum; Verfahrenstypen entwickeln und konfigurieren; Quoren für die Annahme von neuen Themen; Antragserarbeitung vs. freier Diskussion; Taktisches Abstimmen; Sinn und Aufgabe der mehrphasigen Antragsentwicklung; Unterstützung und bedingte Unterstützung von Anträgen; Delegation; Transparenz des Gesamtsystems; Abstimmungsquoren; Abstimmungen mit Präferenzen; wie Abstimmungen ausgezählt werden; Statistiken und Nutzerverhalten; Trollresistenz; Chancen und Risiken des Einsatzes von Online-Abstimmungsplattformen; Erkennen von Mißbrauch des Systems; Integration von LiquidFeedback in andere Umgebungen; andere und verwandte Abstimmungssysteme; Abstimmungspsychologie; Alternative Wahlsysteme; Wissenschaftliche Forschung an Wahlkonzepten.
Klinische Verschleißanalyse mittels Lasertriangulation am Beispiel von Visio Gem-Inlays
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Ziel dieser Arbeit war es ein neuartiges optisches Meßsystem zu testen und für eine klinische Verschleißanalyse von Kompositinlays (Visio Gem® Fa Espe®) einzusetzen. Im Rahmen einer ausführlichen Literaturstudie entstand eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Verfahren für In-vivo-Verschleißanalysen. Auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Meßsysteme wird eingegangen. Bei dem eingesetzten 3D Meßsystem handelt es sich um einen Lichtschnittsensor, der nach dem Triangulationsverfahren arbeitet. Ein Laserstrahl wird als Lichtlinie auf das Messobjekt abgebildet. Mit einem CCD-Chip wird diese Linie erfasst. Der seitliche Versatz der Linie beinhaltet in Abhängigkeit vom Triangulationswinkel die Höheninformation. Zu Beginn existierte nur ein Prototyp des optischen 3D-Sensors. Durch größere Umbauten und durch Automatisierung wurde der Sensor bis zur Serienreife weiterentwickelt. Die Überlagerung der zu vermessenden Bilder erfolgt referenzpunktfrei mittels einer eigens entwickelten Matching-Software. Die Probenbefestigung im Prototyp des Sensors stellte ein erhebliches Problem dar, weil zur Vermessung die unterschiedlichsten Formen und Größen positioniert werden mussten. Zur Datenerhebung standen Einzelzahn, Quadranten- und ganze Kiefer- Modelle an. Die ersten Sensoren besaßen obendrein nur eine Kamera-Optik-Einheit. Alle Abtastungen, die Verschattungen aufwiesen, mussten daher von zwei Seiten aufgenommen werden, um abschattungsfreie Okklusalflächen generieren zu können. Daher wurde ein geeigneter Objektträger mit einem Aufsatz, der um 180° umzusetzen ist, entwickelt. Der industriell gefertigte Träger kann alle Objektgrößen (Einzelzahn-, Quadranten-, Kiefer- Modelle) aufnehmen. Testreihen zur Qualitätssicherung deckten einige Probleme der Software auf. Durch Korrektur einiger Parameter bzw. Implementierung neuer Programmteile in die Auswertungssoftware konnten diese beseitigt werden. Aus der Validierung des Gesamtsystems konnten die folgenden technischen Daten für den 3D-Laserscanner ermittelt werden: Auflösung in der x-Achse (seitlich; CCD-Chip) 25 µm Auflösung in der y-Achse (längs der Abtastrichtung; Schrittmotor) > 2 µm Auflösung in der z-Achse (Höhe) 5 µm Messzeit :40 ms/Linie (512 Messpunkte) 5.000 – 10.000 Oberflächenpunkte / sec. Tiefenmessbereich 15 mm Reproduziergenauigkeit 1 µm +/- 1 Gesamtgenauigkeit 10 µm +/- 3 Der Prototyp konnte durch die Weiterentwicklung (ab Sensor 2) für die Erhebung größerer Datenmengen eingesetzt werden. Durch die Verbesserung der Software bzw. die Entwicklung eines eigenen „matching“-Programms (match 3d) durch Gloger (1993) (KUNZELMANN 1998; S. 30-35) kann die Auswertung der gewonnenen Daten schnell und komfortabel erfolgen. Erstmals wurde der Laser-Scanner für die Auswertung klinischer Daten verwendet. Die Auswertung des Verschleißes von Kompositinlays aus Visio Gem® erfolgte an Gipsmodellen (New Fuji Rock®). Für die Untersuchung standen 32 Zähne bzw. Inlays zur Verfügung, 14 Prämolaren und 18 Molaren. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 48,8 Monate, bei den Prämolaren allein 47,4 Monate und bei den Molaren allein 49,8 Monate. Bei 13 Zähnen war eine Ausmessung der Inlaygrösse möglich. Sie betrug im Durchschnitt 45% der sichtbaren Fläche, bei den Prämolaren 51%, bei den Molaren 39%. Die Bilddaten wurden in zwei Gruppen ausgewertet. Zum einen die Gesamtgruppe aus 32 Zähnen, zum anderen eine Auswahl der besten, bestehend aus sechs Molaren und 3 Prämolaren. Der Mittelwert der Standardabweichungen betrug 158 [µm] (Gruppe2: 88 [µm]). Genauer: Prämolaren 110 [µm] (Gruppe2: 85 [µm]), Molaren 196 [µm] (Gruppe2: 91 [µm]). Die Anforderungen der ADA (1989) für Seitenzahnfüllungen der Klasse II erfüllen die Visio Gem®-Inlays nicht.