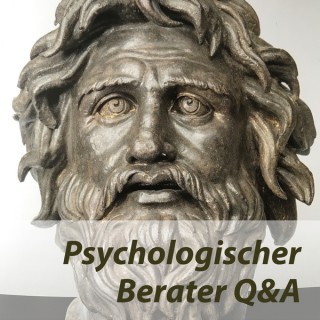Podcasts about analgetika
- 22PODCASTS
- 75EPISODES
- 47mAVG DURATION
- 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
- Jan 1, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about analgetika
Latest podcast episodes about analgetika
Folge 1 2026 Rettung aus denn Deutschland Höhen: Höhenmedizin
Gebirge sind eine spezielle Umgebung, wie gehen wir mit den Problemen in den Höhen um? Wir haben mit Enrico Staps uns über dieses Thema unterhalten. Welche Besonderheiten erwarten uns in den Höhen und welche Möglichkeiten gibt es für uns, diese in unsere Überlegungen und Ressourcenplanung einzubinden. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Höhe und Kälte sind nicht nur die einzigen Herausforderungen für die medizinische Versorgung im Gebirge und Hochgebirge. Mit Oberstabsfeldwebel Jan H. sprechen wir über die Ausstattung und die Behandlungsprinzipien, die unter diesen besonderen Bedingungen notwendig sind. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 12.1: Retten aus der Tiefe: Höhlenrettung in Deutschland
Höhlen sind Orte der Faszination und des Abenteuers, aber was machen, wenn es dort einen medizinischen Notfall gibt? Wir haben mit Nils Bräunig haben wir uns in die Tiefen unter Deutschland begeben. Er erzählt uns von den Herausforderungen und aus Einsätzen, die mit ganz ähnlichen Problemen wie die Taktische Medizin konfrontiert sind: Pronlonged Care, limitierte Ressourcen usw. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
11.2: Human Factors: Was bedeutet die Mensch-Menschbeziehung in der Notfallmedizin
Mit Dirk Zuschke sprechen wir über das spannende Feld der Human Factors in Medicine. Hierbei geht es um Fehlermanagement, Kommunikationsprobleme, Crew Ressource Management. Faktoren, die die tägliche Arbeit in der Notfallmedizin maßgeblich beeinflussen. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
11.1: Sanitätsdienst im Bundesheer: Wie läuft es im Nachbarland Österreich
Mit Manuel Eicher unterhalten wir uns über den Sanitätsdienst in Österreich. Welche Besonderheiten gibt es im Bundesheer, das mit einer jahrzehntelangen Erfahrung an verschiedensten Auslandseinsätzen teilgenommen hat. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Im zweiten Teil haben wir mit Zoi Netto-Kandylidou uns über Epilepsie und weitere neurologische Notfälle unterhalten, die wir im ersten Teil noch ausgelassen hatten. Viel Spaß mit dem Abschluss dieses breiten Einblicks in die Welt der Neuronen! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 10.2: Schlafen und schmerzfrei? Wie geht Narkose im Gefechtsfeld?
Narkose beim Traumapatienten ist schon Königsklasse. Im militärischen Umfeld ungleich schwieriger. Tips und Tricks für Narkoseeinleitung, Aufrechterhaltung, aber auch Übernahme und Transport von Beatmungspatienten habe ich mit FltlArzt Dr. Andreas Garcia-Bardon besprochen. Viele Kniffe sind für euch dabei und wir hoffen, dass ihr diese in eueren Alltag einbauen könnt. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Von ASS bis Fentanyl – Wie gefährlich sind Schmerzmittel wirklich?
Viele Menschen nehmen leichtfertig regelmäßig Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure oder Ibuprofen. Kommt die Sprache aber auf Opioide, schrecken sie oft zurück. Doch welche Analgetika sind wirklich gefährlich? In dieser Podcastfolge ordnet der Schmerzspezialist PD Dr. Kai-Uwe Kern im Gespräch mit Redakteurin Stefanie Menzel die wichtigsten Wirkstoffe ein: Wann helfen NSAR, Paracetamol und Metamizol – und wann nicht? Welche Risiken bestehen für Magen, Darm, Herz und Gefäße? Warum sind Opiode kein Allheilmittel? Wie wirken sich Schmerzmittel auf die Fahrtüchtigkeit aus? Der Experte bewertet außerdem das schmerzlindernde Potenzial von Alternativen wie Sport oder Cannabis. Zur Folgen-Übersicht: https://bit.ly/4hoYfbK
Neurologische Notfälle sind häufig, aber auch fordernd und häufig wie ein Chamäleon. Mit Zoi Netou-Kandylidou habe ich die Grundlagen der klinisch-neurologischen Untersuchung, die Kopfschmerzen und viele andere Themen besprochen, so dass wir gleich zwei Folgen daraus machen konnten! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 9.1: Was gibt es an neuen Erkenntnissen aus der Ukraine?
Wir besprechen die aktuellsten Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg, die wir aus den verschiedensten Kongressen, Veranstaltungen und Auswertungen zusammengetragen haben. Die Teilnahme am SOMA, der CMC und diversen NATO-Meetings hat uns geholfen, für euch diese Info´s zu sammeln. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Ethische Fragen beschäftigen uns im Alltag häufiger als gedacht. In der Triage und Katastrophe ist sie von besonderer Bedeutung. Mit Prof. Alena Buyx haben wir dieses sehr fordernde Thema besprechen können. Als ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat Sie uns viel wertvolle Hinweise geben können. Für uns ein besonderes und sehr emotionales Thema, eine Aufnahme die uns sehr bewegt hat. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 8.2 DGKM: Zivilschutz und Katastrophenmedizin in einer Fachgesellschaft
Was tun bei ABC/CBRN-Lagen im Rettungsdienst oder der Notaufnahme? Die Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin hat hierzu viele gute Tips. Mit Jürgen Schreiber sprechen wir über diese und viele weitere Themen aus dem Katastrophenschutz. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Wir wollten von Prof. Dr. Tim Piepho als Autor der S1-Leitlinie Atemwegsmanagement ganz genau wissen, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Devices haben. Wir betrachten die verschiedenen supraglottischen Hilfsmittel, aber widmen und auch sehr ausführlich den chirurgischen Techniken. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Taktische Medizin für unsere vierbeinigen Kameraden? Was können wir tun, wenn Diensthunde verwundet werden und worauf müssen wir achten? Mit Hauptfeldwebel L. sprechen wir über die Besonderheiten dieses Feldes der Taktischen Medizin und was auch der zivile Rettungsdienst beachten muss, um nicht gebissen zu werden. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Mit Yoyo sprechen wir über das Auswahlverfahren im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, wie es abläuft und wie man sich vorbereiten kann. Darüber hinaus gehen wir aber auch auf die Ausbildung zum Kommandosoldaten ein und was es bedeutet, als "Medic" in den Einheiten zu arbeiten. Freut euch auf den tiefen Einblick in diese herausfordernde Ausbildung. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Was tun, wenn die Betreuung von Verwundeten und Erkrankten sich zieht und kein Abtransport in Sicht ist? Mit Hauptfeldwebel Angelique V. sprechen wir über die Tips und Tricks aus der Pflege, um beim Prolonged Care unsere Patient:innen zu betreuen. Von Lagerung über Ernährung bis hin zum Entsorgen von Fäkalien ist alles dabei. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Nackenschmerzen – die neue S3-Leitlinie im Praxistest
Evidenz und Praxisrealität – im Idealfall sollte eine Leitlinie beides gut abbilden. Dafür haben wir in dieser Folge zwei Experten mit zwei Perspektiven: Leitlinienkoordinator Prof. Thomas Kötter fasst wichtige Empfehlungen zu Diagnostik, nicht-medikamentösen Maßnahmen und Analgetika bei Nackenschmerzen zusammen. Und Dr. Martin Bortz berichtet, wie praxistauglich sich die Empfehlungen der S3-Leitlinie erweisen.
Folge 5.1: Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes im exklusiven Interview
Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann bei uns zu Gast! Wir durften mit dem Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes und Wehrmedizinische Berater des Verteidigungsministers ausführlich über die Themen der Taktischen Medizin und den Herausforderungen für den Sanitätsdienst in der Zukunft sprechen und welche Schlüsse er in seiner herausgehobenen Position daraus zieht. Nicht nur für Soldatinnen und Soldaten spannend, sondern auch viele wichtige Informationen für unsere "zivilen" Zuhörende. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Was gehört alles in einen Rucksack für die taktische Medizin? Karl Heinz und Dennis stellen in dieser Folge vor, was alles hier benötigt wird und wofür man all die verschiedenen Produkte noch einsetzen kann. Dies ist nicht immer bestimmungskonform, aber taktische Medizin lebt von der Improvisation! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 4.2: Role 5 ? Die Rettungskette bis zum Ende gedacht.
Was passiert eigentlich nach der Verletzung / Verwundung? Wie geht es nach der Versorgung vor Ort, Transport, Krankenhaus eigentlich weiter? Wir stellen euch die Möglichkeiten und Herausforderungen der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit / Berufsfähigkeit vor. Hierzu haben wir mit Herrn Oberstarzt Dr. Lison und Frau Oberfeldarzt Dr. Lison zwei super kompetente Gesprächspartner gewonnen, die die "Role 5" der Rettungskette erklären. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, Computerhirn? Was bringt uns diese Technologie in der Taktischen Medizin? Können wir sie nutzen oder ist sie hinderlich? Wir haben uns mit zwei Experten zu diesem Thema unterhalten und versucht, Bits&Bytes verständlich zu machen. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
ZMZ ist mehr als nur die Abkürzung für zivil-militärische Zusammenarbeit. Im Rahmen der gesamtstaatlichen Verteidigung ist es umso wichtiger, Seit-an-Seit zu stehen. Mit Oberstarzt der Reserve Prof. Markus Ries sprechen wir über dieses Thema und die Auswirkungen für die Vorbereitungen auf Krise und Krieg. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 3.1: Gegen den größten kleinsten Gegner: Antibiotika und ihr Wirkungen
Bakterien und Infektionen sorgen seit jeher für die größten Verluste. Wie man dieses vermeiden kann besprechen wir mit Oberfeldarzt Dr. Dominic Rauschning und Oberstabsapotheker David Z. Beide sind ausgewiesene Experten im Antibiotic Stewartship und wir versuchen mit Ihnen zusammen, die komplizierte Welt der Antibiotika verständlich zu machen. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Dieses Mal geht es unter die Haut. Frau Dr. Podolska berichtet über ihre Erfahrungen aus inzwischen acht Einsätzen in einem Stabilisierungspunkt in der Ukraine. Sie erzählt von ihrem Arbeitsalltag, den Verwundeten, den Umständen und den täglichen Herausforderungen während dieser Einsätze. Für uns eine sehr bewegende Folge! Auf Ihre Bitte hin möchten wir auch gerne den Verein erwähnen, für den Diana regelmäßig Hilfsgüter in die Ukraine bringt, die Medizinische Nothilfe Ukraine. https://medizinische-nothilfe-ua.org. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
In dieser Folge sprechen Karl-Heinz und Dennis über ihre Erfahrungen und das aktuelle Vorgehen bei der Notfallnarkose in der taktischen Medizin. Welche Fallstricke gibt es und worauf müsst ihr achten. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Mit den Experten vom KSES sprechen wir über die Behandlung von C-Kampfstoffen und die damit zusammenhängenden Besonderheiten. Wir versuchen euch einen Einblick in dieses so komplexe Themenfeld zu geben und wir werden in diesem Jahr auch die anderen Buchstaben des Alphabets mit behandeln! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 1.1: ABC/CBRN/VLEP Buchstabensalat oder ernste Gefahr?
ABC/CBRN: Diese Buchstaben stehen für das große Feld der Kontamination und Dekontamination. Wir sprechen mit den Experten aus dem Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanität über die Herausforderungen der Dekontamination von Kampfstoffen und die Besonderheiten bei der Patientenversorgung dabei. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Oxygenierung ohne Atmung? Wie soll das funktionieren? Was bedeutet aventolatorischer Massenfluss und welche Bedeutung hat dies für die Notfallmedizin. Wir sprechen mit Oberstabsarzt Daniel S. über diese Thema und welche Lehren wir aus der aktuellen Forschung daraus ziehen können. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Heute geht es hoch und weit hinaus! Wie funktioniert eigentlich Medizin auf der ISS? Wie wäre es auf dem Mond oder sogar auf dem Mars? Mit Oberfeldarzt Prof. Dr. Sammito sprechen wir über die Herausforderungen in der Weltraummedizin und was wir daraus für die Erde und die Taktische Medizin lernen können. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 8.2: Bomben und Granaten: Wie wirken Sprengmittel?
Mit Oberleutnant Tobias U. von der Schule für Kampfmittelabwehr der Bundeswehr sprechen wir über die Wirkung von Sprengmitteln, Bomben, Granaten. Aber wir beleuchten auch selbstgebastelte Sprengfallen, auf die man im Einsatz treffen kann. Auch geben wir Verhaltensempfehlungen für den zivilen Rettungsdienst, wenn man auf solche Kampfmittel trifft. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Kinder und Taktische Medizin? Leider immer wieder. Mit Armin und Gordon vom Kinderanästhesietalk hatten wir die Möglichkeit, diese besonderen Herausforderungen zu besprechen. Diese wunderbaren Experten liefern uns spannende Einblicke und Tips im Umgang mit den kleinsten Patienten. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 7.2: Casualty Evacuation Care - Was tun auf dem Transport?
Mit HptFw Gino S. besprechen wir die Maßnahmen, die auf dem Transport im taktischen Umfeld notwendig sind. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
In dieser Folge sprechen wir mit Prof. Axel Heller über die Sichtung und Triage bei MANV/MANI. Wir erörtern die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Algorithmen und sprechen über die Besonderheiten bei dieser Aufgabe. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Schockraum kennen wir alle, aber was macht man eigentlich bei nicht-traumatologischen Notfällen? Mit dem Leiter der Notaufnahme des BwZKrhs Koblenz, OFArzt Dr. Bergmann sprechen wir über dieses neue Konzept der Schockraumversorgung. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Mit OFArzt PD Dr. Bieler sprechen wir über die Behandlung von Extremitätenverletzungen und die Vor- und Nachteile des Tourniquets. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Mit Oberstarzt Prof. Friemert sprechen wir über traumatologische Notfälle in der taktischen Medizin. Wie sollten wir bei Amputationen / Frakturen und sonstigen unfallchirurgischen Verletzungsmustern in den verschiedenen Versorgungsebenen handeln und was sind die Pitfalls. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Kampfretter sind eine spezialisierte Einheit der Bundeswehr, deren Aufgabe es ist, verschollene Besatzungen aus feindlichen Gebieten zu holen. Hierzu sind sie unter anderem im Combat Search and Rescue (CSAR) ausgebildet, können aber noch viel mehr. Wir haben uns mit einem Medic der Kampfretter über seine Ausbildung und seine Aufgaben unterhalten. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Wir besprechen mit einem Medic der GSG 9 die polizeiliche taktische Medizin und erhalten einen Einblick in die Arbeit der Operativen Einsatz Medizin (OEM) In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 4.1: Hämorrhagie: Was tun, wenn der Patient blutet?
Der Blutverlust ist weiterhin das größte Problem in der taktischen Medizin. Aber außerhalb von Druckverband, Packing und Tourniquet gibt es auch die Hämotherapie. Mit Frau Oberfeldarzt Dr. Sauer sprechen wir über die Behandlung der Hämorrhagie, Gerinnungsmanagement und Therapieoptionen. Neuigkeit: Diesmal haben wir uns entschieden, die Folgen einzeln zu veröffentlichen und nicht als lange 3-Stundenfolge. Bitte gebt uns hierzu ein Feedback! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Das Schädel-Hirntrauma ist eine der Haupttodesursachen im Gefechtsfeld und in der taktischen Medizin. Wir haben hierzu Oberstarzt Prof. Dr. Mauer gefragt, was von POI über den CCP bis hin zur Role 1 sinnvolles für die Patienten getan werden kann und welche Erfahrungen aus der Ukraine hierzu vorliegen. Neuigkeit: Diesmal haben wir uns entschieden, die Folgen einzeln zu veröffentlichen und nicht als lange 3-Stundenfolge. Bitte gebt uns hierzu ein Feedback! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Einsatzkräfte der BOS-Familie, Soldatinnen und Soldaten erfahren in ihrem Einsatzalltag häufig Stresslagen, Bedrohung und Extremsituationen. Hierunter kann die Psyche leiden. Mit Herrn Oberstarzt Prof. Dr. Zimmermann sprechen wir über Resilienz, Moral Injury und was man dagegen tun kann. Neuigkeit: Diesmal haben wir uns entschieden, die Folgen einzeln zu veröffentlichen und nicht als lange 3-Stundenfolge. Bitte gebt uns hierzu ein Feedback! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Folge 3: Prolonged Casualty Care, Antibiotikatherapie und Fachkraft für außerklinische Beatmung
In dieser Folge sprechen wir zuerst mit Oberstabsfeldwebel Markus H. über die Tactical Field Care Time und somit über den Bereich des Prolonged Casualty Care. Speziell hier ist der Gefechtsdruck sehr hoch und es muss mit minimalen Mitteln eine Stabilisierung von vielen Patienten erfolgen, bevor diese abtransportiert werden können. Ab 56:33 geht es weiter mit Oberstarzt Dr. Liebler. Oberstarzt Dr. Lieber gibt Tipps im Kampf mit dem tödlichsten und kleinsten Feind, mit dem wir es zu tun haben: Der Infektion. Wie können Kontanimation, Infektion und Hygiene auch unter Gefechtsbedingungen aufrechterhalten werden und welche Therapien sind hierzu empfehlen. Ab 1:32:38 geht es abschließend mit OBtsm Fariz A. über die Fachkraft außerklinische Beatmung. Was verbirgt sich hinter dieser neuen Zusatzqualifikation für Notfallsanitäter*Innen und weshalb ist das für die Bundeswehr wichtig. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Gefechtsfeldanalgesie, Recht im Rettungsdienst und taktische Vollblutspende: Was ist wichtig, wie geht es!
In dieser Folge haben wir erneut drei Themen, die wir euch vorstellen möchten: Im ersten Teil berichtet OFArzt Dr. Ritter über die verschiedenen Analgetika in der Taktischen Medizin und deren Wirkungsweise. Ebenfalls gibt er einen Ausblick über das potentielle neue Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im zweiten Teil (bei Minute 46:01) sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im Dritten Teil (ab 1:51:13) geht es um die Ausbildung für die Vollblutspende in der Bundeswehr. OFArzt Teufel erklärt die Ausbildung, deren Inhalte und das in Deutschland einmalige Konzept. Wir wünschen euch erneut viel Spaß beim Hören und freuen uns über Anregungen! In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
Unsere aktuelle Folge der Serie English for PTA beschäftigt sich mit Analgetika. Hören Sie den Dialog zwischen der PTA und einer Kundin, die sich zur Schmerztherapie einer älteren Angehörigen beraten lässt. Frischen Sie Ihre Englischkenntnisse für die Beratung im HV auf. Eingelesen haben den Dialog Native Speakerin Jane Funke und ihre Tochter. Listen and repeat! (04:14 Min) https://www.das-pta-magazin.de/news/podcast-pta-funk-einfach-englisch-lernen-analgesics-3500470.html
Welche Lehren für die Taktische Medizin zieht der Sanitätsdienst aus dem Krieg in der Ukraine und dem Krieg in Gaza
Grundlagen und Lehren für die Taktische Medizin aus dem Krieg in der Ukraine und dem Konflikt in Gaza. In dieser Folge könnt ihr wieder drei Beiträge hören: Im 1. Teil sprechen wir mit FltlArzt Dr. Otto über Recht im Rettungsdienst, speziell über invasive und invasivste Maßnahmen. Im 2. Teil stellt OFArzt Dr. Ritter die unterschiedlichen Analgetika vor, die in der taktischen Medizin zur Anwendung kommen können und gibt einen Ausblick über das zukünftige Gefechtsfeldanalgetikum der Bundeswehr. Im 3. Teil geht es um die Vollblutspende und wie sie ausgebildet wird. OFArzt Teufel stellt die Ausbildung und deren Inhalte vor, mit dem dieses in Deutschland einzigartige Konzept umgesetzt wird.
WSR067-Opioid-Analgetika: Von Morphin, Oxycodon und Fentanyl bis Ziconotid und Flupirtin
In dieser Episode sprechen Hans-Dieter Höltje und Bernd Rupp über Opioid-Analgetika und andere Wirkmechanismen zur Bekämpfung starker Schmerzen. Sie behandeln sowohl klassische Wirkstoffe wie Morphin als auch modernere Derivate wie Oxycodon und Fentanyl.
Dafür absolut alles über unsere Trennung bei Betontod, alte Bahnhöfe in Albersloh und globale Analgetika mit antiphlogistischer Wirkung. Musik: Someone Else's Memories by Revolution Void licensed under a Creative Commons Attribution License.
WSR064-Ibuprofen, ASS, Paracetamol und die Dreifaltigkeit der schwachen Analgetika
Diese Episode ist der erste Teil zu Schmerzmitteln. Hans-Dieter Höltje und Bernd Rupp sprechen über Wirkungsmechanismen und Strukturen wichtiger Analgetika, die häufig als schwache, leichte, periphere oder Nichtopioid-Analgetika bezeichnet werden.
Paracetamol steht drauf, verschiedene Antibiotika auch. Und natürlich Insulin. Wo drauf? Auf der EML, der WHO Model List of Essential Medicines.
Unsere aktuelle Folge der Serie English for PTA beschäftigt sich mit dem Volksleiden Rückenschmerzen. Eine Kunde sucht in der Apotheke Rat, um die Schmerzen im unteren Rücken zu lindern. Hören Sie den Dialog zwischen PTA und Kunde und frischen Sie Ihre Englischkenntnisse auf. (04:46 Min) https://www.das-pta-magazin.de/service-und-mehr/heftarchiv/artikel/serie-english-for-pta-backache-3328066.html
Erkältungsmedikamente und frei verkäufliche Pharmaka zur Fiebersenkung und Schmerzlinderung können deinen Blutdruck bedeutsam erhöhen! Selbst großflächig aufgetragen Salben sind da nicht ausgenommen!
PTA Sebastian Giemsch und Chefredakteurin Julia Pflegel podcasten zum Thema Schmerz und der richtigen Beratung zu rezeptfreien Schmerzmitteln in der Apotheke(16 min). Dossier Schmerz: www.das-pta-magazin.de/schmerz
Aus Abhängigkeit kann eine Erkrankung entstehen, die entweder psychische oder physische Ausprägung findet oder beides zugleich und Behandlung durch einen Arzt erfahren muß. Es gibt die verschiedensten Substanzklassen, die eine Abhängigkeit verursachen können. Dazu gehören Alkohol, Opiate, Cannabis, Benzodiazepin, Barbiturate, Analgetika, Kokain, Stimulanzien, Halluzinogene, Nikotin, Flüchtige Lösungsmittel. Es geht immer darum ein negatives Erleben zu dämpfen oder einfach zu ertragen. Hat sich eine psychotrope Substanz einmal als wirkungsvoll erwiesen, dann besteht die Gefahr, immer wieder darauf zuzugreifen. Es gibt aber auch nicht stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen wie Pyromanie, Kleptomanie und krankhaftes Glücksspiel. Ein weites und schwieriges Feld, aber hier wird über Erkrankungen gesprochen.
Schmerz ist eines der häufigsten geriatrischen Syndrome und dennoch wird es bei Patienten ab etwa 60 Jahren zunehmend schwierig mit der richtigen Diagnose. Daher steht dieses Thema neben dem Aspekt der individualisierte Therapie in diesem Jahr prominent auf der Agenda des Deutschen Schmerz- und Palliativtags. Dieser findet zwar in diesem Jahr komplett online statt – so wie viele andere Kongresse aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch. Das hat aber durchaus auch seine Vorteile, wie Dr. Johannes Horlemann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) und Leiter des Regionalen Schmerzzentrums Kevelaer im Gespräch erläutert. Dabei erzählt er außerdem, worauf es ihm bei der Therapie von älteren Patienten ankommt und wann bestimmte Analgetika trotz einer möglichen Erhöhung des Sturzrisikos durchaus Sinn machen können.
Analgetika- Definitionen und Gedankengänge Gerne kannst du deine Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Yogatherapie Weiterbildung findest du hier. Psychologische Yoga Therapie Weiterbildungen findest du hier. Dieser Audio-Lexikon-Beitrag zum Ameisensäure ist im Rahmen des Bewusst Leben Multimedia Lexikon von Yoga Vidya, Teil des umfassenden Lexikons zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Naturheilkunde, Spiritualität, Gesundheit, Philosophie, Religion und Psychologie. Dieser Vortrag ist ursprünglich konzipiert worden als Diktatgrundlage für den Wiki-Artikel. Wir haben uns aber entschlossen, diesen Vortrag allen auch als Audio zur Verfügung zu stellen. Diese Naturheilkunde Vorträge findest du als Podcast hier und abonnierbar hier. Hinweis: Die Infos und Tipps zu Gesundheit und Heilung sind nicht gedacht zur Selbstdiagnose und Selbsttherapie. Sie sind vielmehr allgemeine Informationen. Wenn du selbst erkrankt bist, solltest du einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Eventuell können dir die Anregungen in diesem Beitrag beim Gespräch mit Arzt oder Heilpraktiker hilfreich sein.
Analgetika- Definitionen und Gedankengänge Gerne kannst du deine Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Yogatherapie Weiterbildung findest du hier. Psychologische Yoga Therapie Weiterbildungen findest du hier. Dieser Audio-Lexikon-Beitrag zum Ameisensäure ist im Rahmen des Bewusst Leben Multimedia Lexikon von Yoga Vidya, Teil des umfassenden Lexikons zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Naturheilkunde, Spiritualität, Gesundheit, Philosophie, Religion und Psychologie. Dieser Vortrag ist ursprünglich konzipiert worden als Diktatgrundlage für den Wiki-Artikel. Wir haben uns aber entschlossen, diesen Vortrag allen auch als Audio zur Verfügung zu stellen. Diese Naturheilkunde Vorträge findest du als Podcast hier und abonnierbar hier. Hinweis: Die Infos und Tipps zu Gesundheit und Heilung sind nicht gedacht zur Selbstdiagnose und Selbsttherapie. Sie sind vielmehr allgemeine Informationen. Wenn du selbst erkrankt bist, solltest du einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Eventuell können dir die Anregungen in diesem Beitrag beim Gespräch mit Arzt oder Heilpraktiker hilfreich sein.
"Haste mal ne Ibu?" Egal, ob es sich um Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Sportverletzungen oder Menstruationsbeschwerden handelt, die Schmerzen müssen weg, also greifen wir gerne zu Ibuprofen. Denn es eilt ihm der Ruf voraus, schnell zu helfen. Es ist das beliebteste Schmerzmittel der Deutschen und auch im Nachbarland Österreich regelmäßig an der Spitze der Verkaufszahlen zu finden Noch dazu ist es günstig und rezeptfrei. Aber das sind andere Schmerzmittel auch. Paracetamol, Aspirin und co sind inzwischen so selbstverständlich wie Zahnpasta. Gepuscht haben das Mediziner Anfang der 2000er Jahre, die das „schmerzfreie Krankenhaus" forderten. Keiner muss mehr Schmerzen ertragen müssen, so die Botschaft, die den Verkauf und die Verschreibung von Schmerzmitteln sprunghaft ansteigen lassen haben. Nicht selten hören wir beim Arzt unseres Vertrauens den Rat, bei Schmerzen doch erst einmal eine kleine Tablette dagegen zu nehmen. Aber sind sie auch so harmlos wie die freie Verfügbarkeit uns glauben lässt? Jan-Peter Jansen, Leiter des Schmerzzentrums Berlin weiß, dass das Werben um die frei verkäuflichen Analgetika so angelegt ist, dass sie, vom Kleinkind über den Partyteenager bis hin zur Oma, die ganze Familie anspreche. Ob diese uns so vertrauten Schmerzmittel uns auch gut tun und was wir auf jeden Fall über Analgetika wissen sollten, das ist unser Thema im heutigen Podcast. Mehr Infos zu Ibuprofen finden Sie natürlich auch auf Praxis Vita Haben Sie Themen, Fragen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne unter podcast@praxisvita.de
Definitionen und Gedankengänge zu Analgetika. Erfahre einiges rund um Analgetika in diesem kleinen Improvisations-Vortrags-Podcast. Eine Ausgabe des Naturheilkunde Podcasts von und mit Sukadev Bretz, Yogalehrer bei Yoga Vidya. Anmerkung: Gesundheitliche Informationen in diesem Podcast sind nicht gedacht für Selbstdiagnose und Selbstbehandlung, sondern Gedankenanstöße aus dem Gebiet der Naturheilkunde. Bei eigener Erkrankung brauchst du Arzt oder … „Analgetika“ weiterlesen
Zur Wirkung des Seeanemonen Toxins II (ATX-II) auf spannungsgesteuerte Natriumionenkanäle neuronaler Zellen und zu den dadurch erreichten Änderungen im Schmerzempfinden
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
ATX-II wurde ursprünglich aus dem Gift der Seeanemone Anemonia sulcata isoliert und ist als potenter Aktivator spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle (Navs) bekannt, da es einen persistierenden Na+-Strom induziert. Vor Kurzem wurden bestimmte Nav Subtypen mit menschlichem Schmerz in Verbindung gebracht. Somit liegt es nahe, dass detaillierte Kenntnisse über die Regulierung von Navs für die Entwicklung neuer Pharmaka im Bereich der Schmerztherapie von Vorteil sind. Auch der durch einen alternativen Inaktivierungsmechanismus entstehende resurgent current spielt nach Erkenntnissen der jüngsten Zeit eine Rolle im Schmerzgeschehen. Er kann einen Angriffspunkt für neue Analgetika darstellen, so man seine Entstehung und mögliche Modifikationen entschlüsseln kann. Das Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, ob ATX-II resurgent currents von Navs in großen und kleinen murinen DRGs verändern bzw. induzieren kann. Zudem sollte beleuchtet werden, ob und wenn ja, welche Wirkung das Toxin auf periphere A- und C Schmerzfasern hat. Die Auswirkungen von ATX-II auf Navs wurden in großen und kleinen DRGs der Maus sowie in Zelllinien mit whole-cell voltage-clamp Messungen untersucht. Gesunde humane Probanden bewerteten Empfindungsänderungen (Schmerz und Juckreiz) nach intrakutaner Injektion von ATX-II. Mit Hilfe des "Laser Doppler Imagers" wurde das mögliche Auftreten eines Axon Reflex Erythems untersucht. Die mittels des FACS Zellsortierers nach Zellgröße sortierten DRGs wurden mit RT-qPCR auf ihren Gehalt an Nav1.6, Nav1.7 und 4 mRNA untersucht. ATX-II verstärkte resurgent currents in großen DRGs, zeigte in kleinen jedoch keinen Effekt. Im heterologen Expressionssystem trat ein resurgent current erst auf, wenn 4 Peptid über die Intrazellulärflüssigkeit zur Verfügung stand. Korrelierend zu den Befunden auf Zellebene rief ATX-II bei intrakutaner Injektion im Menschen nur solange stechenden Schmerz und veränderte mechanische Empfindung hervor, wie die A-Fasern für die Schmerzleitung verfügbar waren. Nachdem ein Nervenkompressionsblock angelegt und die Leitung via A-Fasern blockiert war, waren die ATX-II vermittelten Effekte verschwunden. Zudem konnte kein Axon Reflex Erythem gefunden werden, das ein Zeichen für eine C-Schmerzfaser-Aktivierung wäre. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass geringe Konzentrationen von ATX-II eine selektive Wirkung auf große DRGs haben. Erst durch Hinzufügen von 4-Peptid ist es möglich mit dem Toxin resurgent current in kleinen DRGs sowie Zelllinien mit heterolog exprimierten Nav1.6 und Nav1.7 zu induzieren. Dies lässt darauf schließen, dass es kleinen DRGs an 4 in ausreichender Menge mangelt und deshalb kein resurgent current sichtbar ist. Ebenso übt ATX-II einen Effekt auf A Fasern aus, die mit großen DRGs verbunden sind, wohingegen C-Fasern weitgehend unbeeinflusst bleiben. Die intrakutane Injektion von ATX-II führt zu stechendem Schmerz und einer Juckreiz ähnlichen Empfindung, die sich durch A-Faser-Block verhindern lässt. Daraus kann man schließen, dass ATX-II in niedrigen Konzentrationen als spezifischer A-Faser Aktivator fungiert.
Evaluation of Metamizole and Carprofen as postoperative analgesics in canine total hip replacement
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/07
Evaluierung von Metamizol und Carprofen als postoperative Analgetika nach Hüftgelenksersatz bei Hunden. Das Ziel dieser Studie war es, die analgetische Wirkung der von den jeweiligen Arzneimittelfirmen für den Hund empfohlenen Dosierungen von Metamizol im Vergleich zu Carprofen nach Hüftgelenkersatz zu bewerten. Es ist bekannt, dass Metamizol ein potentes Analgetikum beim Menschen ist. Bis heute gibt es keine Studien zur postoperativen Wirksamkeit von Metamizol beim Hund. Subjektive (Melbourne Schmerzskala (mMPS) und visuelle Analogskala (VAS)) und objektive (Ganganalyse, in welcher die vertikale Spitzenkraft (PVF) und der vertikale Impuls gemessen wurden) Bewertungsverfahren wurden in dieser Studie für die Evaluierung der Schmerzen herangezogen. 39 klinisch gesunde Hunde mit einem Körpergewicht zwischen 5,5 und 60,5 kg (keine Rassespezifität) wurden in diese Studie eingeschlossen. Die Hunde wurden nach Randomisierung in zwei Gruppen verteilt: Tiere der Gruppe M (n = 19) erhielten 50 mg•kg-1 IV Metamizol TID. Tiere der Gruppe C (n = 20) erhielten 4 mg•kg-1 Carprofen IV SID. Die Patienten wurden 3, 6, 9, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 44, 48 and 56 Stunden nach Operationsende subjektiv beurteilt. Wurden bei der Evaluierung mittels mMPS bzw. VAS Punktwerte von 12 bzw. 50 Punkten überschritten, so wurde dies als Anzeichen von Schmerzen betrachtet, welche mit einer intravenösen Gabe von Buprenorphin, 10 μg•kg-1, behandelt wurden (rescue analgesia). Eine Ganganalyse wurde einmal präoperativ (preOP) und dann am ersten (OP1) und zweiten (OP2) postoperativen Tag durchgeführt. Drei Patienten in der Gruppe C benötigten in den ersten 3 bis 6 postoperativen Stunden rescue analgesia. Keines der Tiere in Gruppe M benötigte die Gabe zusätzlicher Schmerzmittel. Sowohl bei der mMPS als auch bei der VAS zeigten Tiere der Gruppe M im Vergleich zu Gruppe C über den gesamten Zeitraum niedrigere Schmerz-Werte. Je nach verwendeter Schmerzskala waren diese Unterschiede nach 6 h (mMPS) bzw. nach 24 h (VAS) als signifikant zu betrachten (p < 0.05). Die postoperativen Ganganalysen zeigten bei Hunden der Gruppe M eine bessere Belastung der operierten Gliedmaße (p < 0.05). Diese Ergebnisse zeigen, dass die alleinige Verwendung von Metamizol als Analgetikum eine potente und zufriedenstellende Analgesie nach orthopädischen Eingriffen bei Hunden gewährleistet. Des Weiteren wurde gezeigt, dass die alleinige Verwendung von Carprofen in der vom Hersteller empfohlenen Dosierung nach Hüftgelenksersatz bei Hunden nicht immer eine zufriedenstellende Analgesie hervorruft.
Wirksamkeit intraoperativ applizierter, lokaler Analgetika bei Tonsillektomie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Mon, 20 Jul 2009 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10380/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10380/1/Hiller_Joachim.pdf Hiller, Joachim ddc:610, ddc:600, Medizinische
Untersuchung des tatsächlichen Einflusses häufig angewandter nichtsteroidaler Antiphlogistika auf die Thrombozytenfunktion
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
1. Fragestellung: Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit war zum einen die Untersuchung des tatsächlichen Einflusses verschiedener nicht steroidaler Antiphlogistika auf die Thrombozytenfunktion und zum anderen der Vergleich der hier angewandten Methoden hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit und Praktikabilität im klinischen Alltag. Während die Thrombozytenaggregationshemmung für Acetylsalicylsäure schon lange bekannt ist, sind Daten oder Aussagen zu einer Reihe von anderen Analgetika nach wie vor unklar. Diese Fragestellung interessierte uns insbesondere vor dem Hintergrund der onkologischen und hämatologischen Patienten, bei denen häufig eine krankheits- oder medikamentenbedingte Thrombozytopenie besteht, und die andererseits häufig auf schmerzstillende oder fiebersenkende Medikamente angewiesen sind. Ausserdem sollte die Dauer einer Thrombozytenfunktionsstörung nach Einnahme von NSAIDs untersucht werden. 2. Methoden Wir untersuchten 5 nichtsteroidale Antiphlogistika an gesunden Probanden. Die Medikamente waren ASS, Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenac und der selektive COX-2 Hemmer Rofecoxib. Zunächst wurde an Tag 0 die Thrombozytenfunktion der Probanden ohne Einfluss eines Medikamentes gemessen. An Tag 1, 2 und 3 nahmen die Probanden eines der genannten Medikamente ein. An Tag 4, 5 und 6 wurde die Thrombozytenfunktion im Verlauf gemessen. Die angewandten Methoden waren die Durchflusszytometrie, die Aggregometrie, die Thrombelastographie und der Platelet function Analyser -100. Die Durchflusszytometrie ermöglicht Aussagen über die Plättchengröße, die Plättchengranularität und Glykoproteinexpression an der Oberfläche der Thrombozyten. Die Aggregometrie erlaubt Aussagen über das Aggregationsverhalten der Thrombozyten nach Stimulation durch ADP oder Kollagen. Die Thrombelastographie ist in der Lage, die Geschwindigkeit der plasmatischen Gerinnung, der Koagelbildung und die Festigkeit des Blutgerinnsels zu messen. Der PFA-100 ist ein Analysesystem, das den Prozess der Thrombozytenadhäsion und Thrombozytenaggregation nach einer Gefäßverletzung simuliert. Sozusagen eine Messung der Blutungszeit in vitro, die das Erkennen von ererbten, erworbenen oder durch Thrombozytenaggregationshemmer induzierte Thromozytenfunktionsstörungen ermöglicht. 3. Ergebnisse In der Durchflusszytometrie zeigte sich nach der Einnahme von ASS, Ibuprofen und Diclofenac eine vermehrte Expression von P-Selektin an der Oberfläche der Thrombozyten. Die Expression des Glykoproteins GPIIb/IIIa war überraschenderweise nach Einnahme von Rofecoxib statistisch signifikant vermindert. Bei der Untersuchung der Blutungszeit in vitro mit dem PFA-100 fanden sich statistisch signifikante Verlängerungen der Blutungszeit nach Einnahme von ASS, Ibuprofen und Diclofenac. Paracetamol und Rofecoxib nahmen keinen Einfluss auf die Blutungszeit. In der Aggregometrie ließ sich nur nach Einnahme von ASS ein signifikanter Einfluss auf die Menge der benötigten, die Aggregation auslösenden, Stimulantia nachweisen. Die weiteren Medikamente hatten keinen Einfluss. In der Thrombelastographie zeigte sich eine Verlängerung der plasmatischen Gerinnung nach Einnahme von ASS, Diclofenac und Rofecoxib. 4. Zusammenfassung Im Vergleich der hier angewandten Methoden stellte sich heraus, dass im klinischen Alltag der PFA-100 und die Aggregometrie als wegweisende Methoden für die Entdeckung eventueller Gerinnungsstörungen nach Einnahme von NSAIDs als Methoden der Wahl anzusehen sind. Die Thrombelastographie ist aufgrund der Dauer bis zu einem Ergebnis zu langsam und aus den Veränderungen in der Durchflusszytometrie lassen sich nicht zwangsläufig Thrombozytenfunktionsstörungen ableiten, die zu veränderten Blutungsneigungen führen können. Außerdem ist die Durchflusszytometrie auch die aufwendigste und teuerste der hier durchgeführten Methoden. In der Zusammenschau ist also dem PFA-100, und in zweiter Linie der Aggregometrie, der Vorzug in der Untersuchung der Throm-bozytenfunktion - nach Einnahme von NSAIDs - hinsichtlich einer Aussage über die Blutungsgefahr zu geben. Von den untersuchten Medikamenten hatte der selektive COX-2 Inhibitor Rofecoxib und das nicht steroidale Antiphlogistikum Paracetamol den geringsten Einfluss auf die Thrombozytenfunktion. Eine Empfehlung zur Schmerztherapie bzw. fiebersenkenden Therapie bei blutungsgefährdeten Patienten geht also zum Einsatz von Paracetamol oder einem Medikament aus der Gruppe der COX-2 Inhibitoren.
Funktionelle Magnetresonanztomographie zur Darstellung zerebraler Aktivierungen bei thermischen Schmerzreizen ohne Medikation sowie nach Gabe von Remifentanil und Metamizol
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Ziel. Thema der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der zerebralen Schmerzverarbeitung. Mit der Methode der funktionellen Magnetresonanztomographie sollten Kortexareale lokalisiert werden, die bei thermischer Schmerzreizung am linken Vorfuß eine Aktivitätszunahme zeigen. Ziel war es, diese unter standardisierten Bedingungen reproduzierbar nachzuweisen und damit die Voraussetzung zu schaffen, Veränderungen dieser Aktivierungen bei Sauerstoff- und Analgetikagabe zu erfassen. Methodik. Zunächst wurden die physikalischen Grundlagen der Bilderzeugung mittels Magnetresonanztomographie vorgestellt. Dabei wurde insbesondere auf die funktionelle Bildgebung und die zugrunde liegende Physiologie eingegangen. Im speziellen Methodikteil wurden das untersuchte Kollektiv (6 gesunde Probanden) und der Versuchsablauf beschrieben. An einem 1,5 Tesla Magnetresonanztomographen wurden mit Hilfe von T2*-gewichteten Sequenzen funktionelle Bilddaten der Probandengehirne bei schmerzhafter und neutraler thermischer Stimulation am linken Fußrücken aufgezeichnet. An vier der Probanden wurden diese Messungen jeweils viermal wiederholt, um schmerzspezifische zerebrale Aktivierungen zu erfassen und deren intra- und interindividuelle Variabilität zu überprüfen. Im Anschluss wurden diese funktionellen Messungen an allen Probanden ohne und mit Gabe von Sauerstoff durchgeführt, um einen denkbaren negativen Effekt der bei Analgetikagabe erforderlichen Sauerstoffapplikation auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen auszuschließen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die Auswirkungen von Schmerzmedikamenten auf die zerebrale Aktivität bei Schmerzreizen zu untersuchen. In einem Pilotversuch wurde die beschriebene Messmethodik bei drei Probanden unter Gabe von Remifentanil, Metamizol und Kochsalzlösung in randomisierter Abfolge eingesetzt. Die Auswertung der funktionellen Bilddaten erfolgte anhand des General Linear Model (Softwarepaket FSL). Hiermit konnten sowohl individuelle zerebrale Aktivierungen erfasst, als auch Gruppenanalysen durchgeführt werden. Ergebnisse. Bei den Experimenten zur Lokalisation der zerebralen Aktivierungen konnten bei schmerzhafter Stimulation aktivierte Areale am häufigsten im frontalen Operculum und benachbarten Inselkortex, im dorsolateralen präfrontalen Kortex, im Gyrus frontalis medius, im anterioren Cingulum und im parietalen Operculum/SII Kortex nachgewiesen werden. Weniger häufig konnten Aktivierungen im primären somatosensorischen Kortex, im Thalamus, im Temporallappen, in den Basalganglien und im Hirnstamm nachgewiesen werden. Diese waren meist beidseits vorhanden, zeigten jedoch eine Betonung der kontralateral zur stimulierten Körperhälfte gelegenen Hirnhemisphäre. Im Vergleich mit der Neutralmessung stellten sich die aktivierten Areale im frontalen Operculum und der vorderen Inselregion, im anterioren Cingulum und in den Basalganglien als schmerzspezifisch dar. Die Aktivierungen im parietalen Operculum/SII Kortex konnten erst bei niedrigerem Signifikanzniveau nachgewiesen werden. Der interindividuelle Vergleich zeigte bei zwei der Probanden eine gute Übereinstimmung mit den zerebralen Aktivierungen der Gesamtgruppe. Zwei weitere Probanden wiesen jedoch ein deutlich unterschiedliches Aktivierungsmuster auf. Bei der intraindividuellen Analyse zeigte sich eine gute Reproduzierbarkeit der aktivierten Areale. Bei den Experimenten mit Sauerstoffgabe konnte ein negativer Effekt auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen ausgeschlossen werden. Bei Gabe von Remifentanil konnte der aus der klinischen Erfahrung bekannte ausgeprägte analgetische Effekt der Substanz beobachtet werden. In der funktionellen MRT ließen sich nach Gabe von Remifentanil keine zerebralen schmerzspezifischen Aktivierungen darstellen. Allerdings ergaben Kontrollmessungen bei visueller Stimulation ebenfalls eine Abnahme der zerebralen Aktivierungen. Bei Gabe von Metamizol konnte unter den gewählten Versuchsbedingungen kein analgetischer Effekt registriert werden. Als Erklärung kommt einerseits die niedrig gewählte Dosierung, andererseits die Pharmakokinetik der Substanz in Betracht. Eine Änderung des zerebralen Aktivierungsmusters konnte bei den drei untersuchten Probanden nicht objektiviert werden. Schlussfolgerung. Mit der funktionellen Magnetresonanztomographie war es möglich, durch Schmerzreize ausgelöste zerebrale Aktivierungen darzustellen. Diese Daten können als Grundlage für weitere Experimente mit schmerzmodulierenden Medikamenten dienen. Die gewählten Rahmenbedingungen der fMRT-Messungen gewährleisten die notwendige Sicherheit der Probanden während der Applikation von Schmerzmedikamenten, ohne die Darstellbarkeit der zerebralen Aktivierungen zu beeinträchtigen. Aussagen über die Wirkung von opioidartigen und nichtopioidartigen Analgetika müssen jedoch noch an einer größeren Gruppe von Probanden evaluiert werden.
Orale Provokationstestung bei anaphylaktoiden Unverträglichkeitsreaktionen gegen Nicht-Opioidanalgetika
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Ziel unserer Untersuchung war es, die diagnostische Aussagekraft der oralen Provokationstestung bei anaphylaktoiden Unverträglichkeitsreaktionen zu untersuchen. Des Weiteren wollten wir erfahren, welchen Einfluß die durchgeführten Testungen auf den späteren Umgang der Patienten mit Schmerzmitteln ausübten. Es handelt sich um eine retrospektive Studie mit 102 Patienten, an die nach Abschluß der Testungen ein Fragebogen verschickt worden war. Es ließ sich zeigen, das die orale Provokationstestung eine valide Methode zur Diagnostik bei Analgetikaunverträglichkeit darstellt, bei der sich anamnestisch angegebene Unverträglichkeitsreaktionen oft reproduzieren lassen. Nach den Testungen wurden von den meisten Patienten wieder Analgetika angewendet, meist empfohlene Ausweichpräparate, welche überwiegend gut vertragen wurden.
Verhaltenspharmakologische und molekularbiologische Untersuchungen zum Opiatentzug bei der Ratte
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit verschiedenartigen Aspekten zum Thema Opiatentzug. Dabei wurde die Funktionalität µ-Opioidrezeptor-gekoppelter G-Proteine in der intrazellulären Signaltransduktionskaskade im Entzug und unter chronischer Opiatverabreichung untersucht. Als Ergebnis dieser Studie, die mittels einer in situ [S35]-GTPγSAutoradiographie durchgeführt wurde, konnte die Erkenntnis bestätigt werden, nach der eine Adaption auf extern zugeführte Opioide nicht auf einer Veränderung von Rezeptoren oder deren Interaktion mit G-Proteinen beruht (Kapitel 2). Vielmehr scheinen intrazelluläre, durch Genexpression gesteuerte Mechanismen für eine erfolgreiche Adaption an veränderte Umweltbedingungen ausschlaggebend zu sein. Hierbei spielt eine veränderte Transkription von CREB und somit in Folge eine erhöhte Transkription der Adenylatcyclase eine tragende Rolle. Eine weitere Studie beschäftigte sich mit einem neuartigen Konzept zur Verstärkung von opioidagonistischen Wirkungen durch die Zugabe von Opioidantagonisten in geringer Dosierung (low dose Naloxon-Konzept, Kapitel 3). Hier konnte in verhaltensbiologischen Untersuchungen kein Effekt nachgewiesen werden. Insbesondere konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Koverabreichung von low dose Naloxon während der Abhängigkeitsentwicklung Entzugserscheinungen moduliert. Beide Studien beschäftigen sich direkt und indirekt mit der in der Wissenschaft intensiv diskutierten Frage der Existenz von Gs-Proteingekoppelten Opioidrezeptoren, die neben den bereits bekannten Gi/o-Protein-gekoppelten Opioidrezeptoren in der Zellmembran lokalisiert sind. Ein autoradiographischer Nachweis hierzu steht bislang aus. Abhilfe könnte eine weiterentwickelte [S35]-GTPγSAutoradiographie schaffen, in der durch selektive Blockade der Gi/o-Protein-gekoppelten Opioidrezeptoren durch Pertussistoxin ein Nachweis Gs-Protein-gekoppelter Opioidrezeptoren in situ möglich sein müsste. Ein direkter Nachweis dieser Kopplung eröffnet völlig neuartige Perspektiven in der modernen Opioidpharmakologie, da durch selektive Liganden dieser Gs-Protein-gekoppelten Rezeptoren die Opiatwirkung in der klinischen Anwendung verstärkt werden könnte. Möglicherweise findet dieses Wirkprinzip bereits unbeabsichtigt seit Jahren Anwendung: der Opiatagonist Tilidin (Valoron N) kommt bei der Behandlung mittelschwerer bis schwerer Schmerzen zum Einsatz. Als Besonderheit ist diesem Präparat der Opiatantagonist Naloxon im Verhältnis 1:12,5 (Einzeldosis: 4 mg Naloxon/50 mg Tilidin) beigemischt, um eine missbräuchliche Anwendung zu unterbinden. Bei normaler therapeutischer Dosierung unterliegt der Naloxonanteil einem intensivenhepatischen Abbau, so dass Tilidin voll wirksam ist. Bei missbräuchlicher Einnahme hoher Dosen durch Opiatabhängige wird der Naloxonanteil nicht vollständig metabolisiert; Entzugssymptome werden provoziert oder bereits bestehende werden verstärkt. Tilidin selbst wird in der Leber zu Nortilidin und Binortilidin metabolisiert, wobei Nortilidin als der eigentliche Opiatagonist am Rezeptor angesehen wird (Schulz et al. 1978). Möglicherweise passieren aber geringste Spuren von Naloxon bei normalem therapeutischen Einsatz die Leber und könnten folglich im low dose -Bereich wirksam werden. Über die Wirkungsweise low dose Naloxon-vermittelter Verstärkung der analgetischen Wirkung von Opiaten können nur rein hypothetische Ansätze formuliert werden. Neben den bereits diskutierten Gs-Protein gekoppelten Opioidrezeptoren könnte auch ein Einfluss auf die Internalisierung von Opioidrezeptoren möglich sein. Hier steht, neben dem dringend nötigen Nachweis Gs-Protein gekoppelter Opioidrezeptoren, ein völlig neuartiges Forschungsgebiet der Opioidpharmakologie offen. Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit konnte erstmals das Phänomen konditionierter Opiatentzug näher charakterisiert werden (Kapitel 4). Auch wenn es nicht gelang, aus der Vielzahl an Entzugserscheinungen die wichtigsten Kardinalsymptome zu konditionieren, so besteht dennoch kein Zweifel, dass Entzugssymptome ausreichend konditioniert werden können und dass diese konditionierten Symptome mit einer Aktivierung von Stressmechanismen verbunden sind. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass mit der Präsentation des konditionierten Stimulus eine massive neuronale Aktivität im Locus coeruleus ausgelöst wird. Dieses Kerngebiet ist seit Jahren ohne Zweifel für die Ausbildung der meisten körperlichen Entzugssymptome während eines Opiatentzugs verantwortlich (Aghajanian, 1978; Maldonado et al., 1992b). Gerade in den letzten Jahren kommt dem konditionierten Entzug die Aufmerksamkeit zu, die ihm möglicherweise in seiner Bedeutung im Rückfallverhalten zusteht. Neueste Studien (Schulteis et al., 2000) zeigen deutlich, dass konditionierte Entzugserscheinungen mit dem Kerngebiet assoziiert werden, die für die hedonistische Beurteilung eines Ereignisses ausschlaggebend sind. Obwohl in frühen Studien durch Befragung von Abhängigen kein Einfluss konditionierter Entzugserscheinungen auf Rückfallverhalten nachgewiesen werden konnte (McAuliffe, 1982), stellt sich berechtigterweise die Frage, ob von Drogensüchtigen bzw. entzogenen Patienten der Reflexbogen, der zum Rückfall führte, überhaupt als solcher erkannt und benannt werden kann. Gerade das stereotype Ablaufen suchtrelevanter Konditionierungs- und Sensibilisierungsmechanismen entzieht sich oftmals dem Bewusstsein des Suchtkranken (Zieglgänsberger und Spanagel, 1999). In frühen tierexperimentellen Studien waren Versuchstiere nicht in der Lage, die im konditionierten Entzug auftretenden Entzugserscheinungen durch Trinken von opioidagonistischer Lösung zu lindern (Stewart et al., 1984). Dabei stellt gerade die orale Verabreichung von z.B. Morphin auf Grund der schlechten Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt eine schlechte Art der Verabreichung von Opiaten dar (Gellert und Holtzman, 1978). In einem konditionierten Entzugsgeschehen kommt daher der schnellen intravenösen Verabreichung von Opiaten tragende Bedeutung zu. Opiatsucht stellt sich als komplexes Krankheitsbild dar, zumal die Patienten nicht nur von einem Opiat abhängig sind, sondern meist Polytoxikomanen sind. Dennoch erscheint gerade der konditionierte Entzug als ein wichtiges Element im Rückfallverhalten, möglicherweise eben nur im Zusammenspiel anderer suchtrelevanter Parameter. Aufschluss inwieweit hier konditionierte Entzugs-erscheinungen eine tragende Rolle spielen, könnte ein Tierexperiment darstellen, in dem auf Entzug konditionierte Versuchstiere gelernt haben, sich über eine intracerebroventriculare Injektion Morphin zuzuführen. Nur ein schneller, unmittelbarer Wirkungseintritt von Morphin greift in den Reflexbogen ein, der von den meisten Patienten im Rückfall nicht kognitiv wahrgenommen wird. Kein anderer Stoff begleitet die Menschheit so lange wie der Saft der Kapseln des Schlafmohns und bei keinem anderen Stoff liegen Wohl und Wehe so eng beisammen. Opium und seine in der modernen Medizin angewandten Derivate stellen nach wie vor die potentesten Schmerzmittel dar. Bis heute gibt es keine vergleichbaren Analgetika. Die erstaunliche Kongruenz zwischen speziellen Rezeptoren im Gehirn und einem sekundären Pflanzenalkaloid bringt die moderne Opioidpharmakologie immer wieder in den Konflikt zwischen maximaler Schmerzlinderung und den fatalen Folgen dieser Therapie, die in Toleranz, Abhängigkeit und Entzug münden kann. Dennoch bemühten sich seit Menschengedenken Ärzte und Wissenschaftler um die Vorteile dieses Prinzips und so sollte es eines Tages gelingen, die schmerzlindernde Komponente der Opiate von den negativen Auswirkungen abzukoppeln.