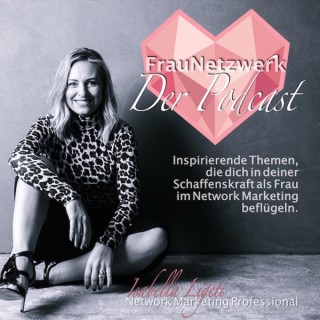Podcasts about verhaltensebene
- 21PODCASTS
- 22EPISODES
- 30mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 24, 2024LATEST
POPULARITY
Best podcasts about verhaltensebene
Latest podcast episodes about verhaltensebene
#173 - Bringt es was? MBTI vs. Enneagramm [mit Markus Püttmann]
Artikel "MBTI vs. Enneagramm": https://www.enneagramgermany.de/MBTI Enneagramm im Business: https://www.enneagramgermany.de/Business Was ist Tritelligence: https://www.enneagramgermany.de/Tritelligence Über Markus Püttmann: https://www.impulsraum.eu/ ____ ⟩⟩
Ein Podcast von und mit Kedo Rittershofer. Wenn das innere Kind übernimmt, reagieren wir nicht mehr mit den Ressourcen und Fähigkeiten eines Erwachsenen, sondern verhalten uns, als wären wir wieder 5 oder 10 Jahre alt. Dies kann sich sowohl auf emotionaler als auch auf Verhaltensebene zeigen. Aber warum passiert das? Was löst es aus? Und vor allem: Wie können wir diese Muster durchbrechen, um souveräner und erwachsener zu reagieren? Genau das erfährst Du in dieser Folge.
Was macht Social Media mit unserem Körperbild? – Mit Dr. Julia Tanck
"Was wir über unseren Körper denken, hat immer eine Konsequenz auf unsere Gefühls- und unsere Verhaltensebene.”, sagt die Psychotherpeuting und Wissenschaftlerin Dr. Julia Tanck. In ihrem Buch “Unfiltered. Social Media und unser Körperbild“ geht sie der Frage nach, wie die Wahrnehmung und Beurteilung des eigenen Körpers von Social Media beeinflusst wird. Im Gespräch mit Kristina erläutert sie, wie stark unsere Gesellschaft körpersensibel geprägt ist, welchen Einfluss die Medien auf unsere Körperzufriedenheit haben, was sich dringend ändern muss und wie wir einen wohlwollenden Umgang mit uns selbst lernen. Viel Spaß beim Anhören! Wir freuen uns über Fragen und Anregungen zum Podcast. Schreibt uns dazu gerne an podcast@penguinrandomhouse.de +++ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
In diesem Podcast spreche ich darüber, wie wir beginnen können, unsere psychischen Muster zu verändern. Leider gibt es hier keine Abkürzung und nur die Verhaltensebene zu verändern, wird langfristig nicht zum Ziel führen. Viel Spaß beim Zuhören
003 - Die wichtigste Sache, die du brauchst für Veränderung
Eine wahre Veränderung findet auf Identitätsebene statt, nicht, wie Viele denken, auf Verhaltensebene. In dieser Folge verrate ich dir, worauf es wirklich bei einer Veränderung ankommt. Direkter Kontakt zu mir: hello@steph-reinhardt.de Instagram: [https://www.instagram.com/queen.of.routine/](https://www.instagram.com/queen.of.routine/) Website: [https://steph-reinhardt.de](https://steph-reinhardt.de) YouTube: [https://www.youtube.com/@stephreinhardt/podcasts](https://www.youtube.com/@stephreinhardt/podcasts)
Wie lauten meine inneren Überzeugungen? Wozu handle ich so, wie ich handle? Diese Fragen, die auf unsere Persönlichkeit abzielen, begleiten uns derzeit in diesem Podcast. Denn auch wenn ich z.B. im Beruf sehr erfolgreich bin, sollte ich mir die Frage erlauben, ob ich mich gerade auf einem gesunden Weg befinde, der mich glücklich macht. Zu einer gesunden Selbstfürsorge gehört es, Körper, Geist und Seele im Einklang zu halten. Es geht darum, seinen Selbstwert ganzheitlich zu verstehen und nicht nur im Berufskontext. Peter Becker und Aleko Vangelis führen in diesem Espresso neben prominenten Beispielen auch solche aus ihrem Arbeitsalltag an. Dabei erläutern sie den entscheidenden Unterschied zwischen der Verhaltensebene und der Ebene innerer Überzeugungen. Das Thema Persönlichkeit wird uns in diesem Jahr verstärkt bei „führen mit Herz“ begleiten, denn eine Führungspersönlichkeit mit Herz zu sein bedeutet, an der Persönlichkeit zu arbeiten. Ihr seid neugierig, was „führen mit Herz“ betrifft? Ihr möchtet mehr Infos, oder einfach einen Austausch? Kontaktiert uns unter mail@shipleader.de oder über LinkedIn. Wir stehen gerne für ein persönliches Gespräch bereit.
Arbeitest Du gegen Dich selbst oder veränderst Du Dich so, dass Du am Ende auch wirklich eine Veränderung bemerkst? Wenn Du nur auf der Verhaltensebene arbeitest, dann könnte es anstrengend bleiben. Aber wenn Du Dich nach und nach veränderst, dann verhältst Du Dich automatisch anders. In dieser Folge geht es darum, wie Du an Deiner Identität arbeitest. Podcast auf Youtube: https://youtu.be/-aS9yFmDuZA Folge mir: https://www.tobikrick.com https://www.instagram.com/tobikrick
Fehleranalyse: Was tun, wenn andere Fehler machen? (2/4) im Gespräch mit Olaf Kapinski | RAUS AUS DEM HAMSTERRAD #51
INTERVIEW: Warum es ein Unterschied ist, ob man selbst einen Fehler macht oder andere – und Sie dafür gerade stehen müssen. Im Teil 2 unserer Interview-Reihe geht es um Fehlerkultur und den Umgang mit Fehlern. Wir schauen uns gemeinsam mit Olaf Kapinski aus dem “Leben-Führen” Podcast und als Experte für IT-Ler sowie für Mitarbeiter und Führungskräfte an, wie der Umgang mit Fehlern in der konkreten Praxis läuft und wie wertvoll dann die Fehleranalyse ist. Was hat es mit Feigheit – Faulheit und Eitelkeit auf sich? Wie können Sie damit umgehen, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat? Fehleranalyse: Der Unterschied zwischen der emotionalen und der Verhaltensebene. Aus dieser Folge werden Sie Tipps und Tricks mitnehmen, was Sie konkret tun können, wenn ein Mitarbeiter, Kunde oder Chef einen Fehler macht. Wenn Sie wissen wollen wie es weitergeht und was Sie von den Chefärzten einer Klinik im Umgang mit Fehler lernen können, dann hören Sie unbedingt in Folge 54 rein! Sie haben den ersten Teil der Interview-Reihe verpasst? Dann hören Sie unbedingt in die Folge 49 hinein. HABEN SIE GEWUSST: Die Beispiele aus meinem Podcast sind reale Fälle aus meiner 30-jährigen Erfahrung als Mentorin, Coach und Sparringspartnerin. Die Personen sind aber so verfremdet, dass sie sich vielleicht nicht mal selbst erkennen würden. LINKS ZU DIESER FOLGE: “LEBEN-FÜHREN” Podcast von Olaf Kapinski:
Hier werden die Schritte vorgestellt, die wir in dem inneren Berichtigungsprozess durchschreiten. Nicht mehr, nicht weniger. Auf der Verhaltensebene kann ich nichts bewirken, aber die Berichtigung im Geist, lässt mich "buchstäblich Berge" versetzen T2.VI.9.8.
Zu blöd zum Leben- Interview mit Frédéric Letzner
GLÜCKLICH SEIN MAL ANDERS - ES GIBT IMMER EINEN (R) - AUSWEG
Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk habe ich heute ein Interview mit Frédéric Letzner. Frédéric ist nicht nur Ernährungswissenschaftler, Buchautor und Speaker sondern betrachtet die Dinge ganzheitlich und auf der Verhaltensebene. Wir haben uns ganz gemütlich unterhalten. Infos zu Frédéric Letzner:https://www.letz-go.de/Sein Buch "Zu blöd zum Leben" kannst du auch auf der HP bestellen. https://www.instagram.com/frederic.letzner.official/
Über die Angst nicht gut genug zu sein (Podcast-Special)
In der heutigen Episode geht es um die Angst nicht genug zu sein. Ich kenne diese Angst nur zu gut und auch ich komme immer wieder mit ihr in Kontakt. Darum habe ich mich entschieden dir heute eine wundervolle Überraschung mitzugeben, die mir sehr gut hilft, wenn ich mal wieder denke, ich bin nicht gut genug. Letztendlich vereint dieser Glaubenssatz alle Ängste in sich. Doch es ist ein Unterschied zu vielen anderen Ängsten, denn diese Angst ist keine Angst auf der Verhaltensebene, sondern auf der Identitätsebene. In einer der letzten Episoden bin ich auf dieses Thema schon einmal eingegangen und habe dir erklärt, dass Leistung oder Verhalten nie mit Identität gleichgesetzt werden kann. Man kann also zB jemanden für dein Verhalten kritisieren, jedoch niemals für seine Identität. “Du machst deine Hausaufgaben nicht? Du bist dumm!”, ist ein schönes Beispiel. “Die Würde des Menschen ist unantastbar”, hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Mir ist es wichtig, dass die Menschen für dieses Thema ein Bewusstsein bekommen, um achtsamer miteinander umzugehen. Heute möchte ich aber vor allem darüber sprechen, wie du selbst mit dir umgehst! Sätze wie: “Ich habe keine Größe 36, ich bin nicht schön!”, oder “Ich habe nicht studiert, ich bin dumm!” ... sind nur ein paar Beispiele! Wie oft sagt ein Mann seiner Frau: “Du bist so schön!”, doch die Frau kann es nicht annehmen und unterstellt dem Mann dann schlimmstenfalls noch zu lügen? Nicht der Mann ist die Herausforderung in dieser Sache! Es ist die Frau, die sich selbst nicht wertschätzt. Und der Mann kann es noch 100 Mal zu ihr sagen ... wenn sie es nicht selbst glaubt, kann sie es ihm auch nicht glauben. Was denkst du über dich? Was sagst du jeden Tag zu dir selbst? Wie behandelst du dich? Nun habe ich eine kleine Aufgabe für dich und nach dieser Aufgabe kommt die versprochene Überraschung für dich: Nimm dir ein Blatt Papier. Ich möchte jetzt, dass du einmal einen Zeitstrahl aufmalst. Dieser stellt dein Alter dar. Du unterteilst ihn in von 0 an in 10 er-Schritten, bis zu deinem heutigen Alter. Jetzt nimmst du dir die Zeit und schreibst die Ereignisse zu den passenden Bereichen, in denen du wirklich was gerockt hast. Schreib die Ereignisse auf! Jetzt fühlt du dich in jeder dieser Ereignisse rein und schreibst dahinter dein Gefühl: Ich bin ... mutig, großzügig, offenherzig, Jetzt machst du dein Dankbarkeitsritual! Viel zu oft machen wir uns Gedanken Über das, was wir nicht haben, statt über das, für was wir dankbar sein dürfen! Dankbarkeit erhöht deine Schwingung und Dankbarkeit hilft dir sofort im Herzen zu sein. Wenn du den Podcast hörst, kommt nun die Meditation! Diese 3 Punkte helfen dir in Bezug auf deine Ängste immer: Glasklare Klarheit für eine starke BotschaftEine leuchtende Vision und eine passionierte Mission, für die du brennstCo-Kreation, Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit, um Großes zu erschaffen Solltest du bei der neuen Community dabei sein wollen und mit mir gemeinsam deinen Erfolgsweg gehen wollen, sende mir eine email an meine private Adresse: Isabella.ligeti@gmx.de Ich freu mich drauf! Danke, dass du dabei warst! Wähle, was dich stärkt! Deine Isabella
014: Besser Kommunizieren mit Insights Discovery – Florian Volkelt
Kommunikation ist eines der schwersten Dinge auf unserer Erde. Wenn etwas abgesprochenes klappt, ohne Probleme, ist es ein wahres Wunder. Es gibt Möglichkeiten, um ein besseres Miteinander zu fördern. Insights Discovery ist sehr einfache und praktische Art. Es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsprofil auf Verhaltensebene. Es macht transparent, wie du "tickst". **Interessiert es dich?** **Ruf mich an:** +49-173-6921266 **Schreib mir eine Mail:** florian@florian-volkelt.de oder besuche mich bei LinkedIn: www.linkedin.com/in/florian-volkelt oder auf meiner Webseite: www.florian-volkelt.de **Mehr Infos zu Insights Discovery:** https://elopage.com/s/florianvolkelt/insights-discovery-profile Dort kannst du auch direkt ein Profil inkl. Auswertungsgespräch kaufen, was wir dann gemeinsam durchführen werden. WICHTIG: Nach dem Kauf bitte ich dich, mich anzurufen oder mir eine Mail zu schreiben. Herzliche Grüße, dein Florian
#171: Wie du Scham in Mut verwandelst! – Soul Session mit Maik Baum
Ich freue mich mega, dir heute meinen Coach Maik Baum vorzustellen. Maik leitet die Baum-Akademie, die sich darauf spezialisiert hat, Emotionen und Verhalten zu sehen anhand von non-verbalen Signalen. Dadurch die Prozesse hinter den Verhaltensweisen zu verstehen und daraufhin auch das Verhalten eines Menschen verändern zu können. Er gibt auch viele Mimik-Resonanz-Seminare und coacht Jungunternehmer*innen wie mich darin, emotionale Blockaden zu lösen. :) IM INTERVIEW MIT MAIK HÖRST DU: was deine Mimik über dich verrät was sagen dir der Ärger oder die Scham? Scham hängt oft mit Suizid zusammen und setzt direkt am Selbstwert an hinter jeder Emotion, die wir empfinden, steckt eine Kompetenz Scham hat eine dunkle Seite: "Ich bin falsch", "Ich bin nicht gut genug", "Ich bin nicht richtig" = Identitätsebene Schuld hingegen setzt auf Verhaltensebene an mit: "ich habe etwas falsch gemacht" die Kompetenz von Scham sind Demut & Bescheidenheit Demut bedeutet, zufrieden mit sich selbst zu sein und Ansprüche zurückschrauben mit Demut erlaubst du dir auch mutig zu sein und Fehler zu machen Demut sorgt dafür, dass du in deinem eigenen Tempo gehen kannst Selbstwahrnehmung, vom Kopf ins Gefühl zu gehen, ist der erste Schritt Was möglich wird, wenn wir "putting feelings into words" dank Achtsamkeit leben "Wo darfst du Ansprüche an dich selbst zurückschrauben?" "Wie kannst du es schaffen, wieder authentisch zu sein?" die helle Seite von Schuld ist Authentizität: wenn sich Schuld bei dir löst, kannst du wieder du selbst sein wenn du dich ent-schuldigst, lässt du die Last auf deinen Schultern los, selbst wenn dein Gegenüber es nicht akzeptiert es geht nicht um das Wort der Entschuldigung, es geht viel mehr um das Verhalten danach; das du dich danach an deine eigenen Werte hältst und wieder im Einklang mit diesen handelst du kannst durch Angst einen gesunden Respekt entwickeln, um aus deiner Komfortzone zu gehen durch Emotion + Stress bewegen wir uns auf die Schattenseite wie wir mit WingWave unseren emotionalen Stress verarbeiten und verändern können Ärger und Stolz zeigen Menschen mit Depressionen am Wenigsten was du tun kannst, um mit dem Stolz in dir wieder ganz authentisch in Kontakt zu kommen SHOWNOTES: Melde dich zum SoulFood Letter an Homepage: https://www.soulfoodjourney.de Instagram: instagram.com/soulfoodjourney.de Community auf Facebook: SoulFood Journey Community Baum-Akademie: https://baum-akademie.de Maik's IG-Profil: https://www.instagram.com/maikbaum_/
Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir als Menschheit mehr Verständnis dafür entwickeln, wie Trauma auf Bindungsebenen und in Paardynamiken hineinwirkt. Sowohl in Beziehungen auf der partnerschaftlichen Ebene als auch zwischen Eltern und Kindern und in anderen Beziehungen. In meiner Praxis berate ich als systemische Paartherapeutin auch Paare. Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr darüber gelernt, wie Trauma in die Beziehungsebenen hineinwirkt. Wenn man nichts von Trauma-Dynamiken weiß, wenn man die Psychodynamik von Traumafolgen nicht kennt oder grundlegendes darüber nicht verstanden hat, dann interpretiert man viele Dinge einfach anders. Leider bedeutet das dann häufig, dass man an der Verhaltensebene hängen bleibt. Dass man versucht über Verhaltensveränderungen Dinge zu lösen und Partnerschaften zu verändern. Doch das gelingt leider nie, wenn Trauma im Hintergrund schwingt. Denn um das zu verändern, was durch Trauma-Dynamiken in Partnerschaften passiert, braucht es ein wirkliches, tiefes Verstehen für die verletzte Seele, die verletzte Psyche, die ungelösten Emotionen und die Schutz- und Verarbeitungsstrategien, die sich daraus ergeben. Das klingt jetzt erst einmal kompliziert und es ist tatsächlich komplex, aber ich werde in dieser Folge versuchen die einfachsten Prinzipien herauszuarbeiten, die wichtig sind, um diese Dynamiken zu verstehen. In dieser Folge erfährst Du: wie wichtig das Verstehen von Trauma-Dynamiken ist wie Unterbewusstsein Kompensationsstrategien Beziehungen steuern wie wichtig es ist, Trigger und automatischen Schutzreaktionen zu entschlüsseln warum sich traumatisierte Personen eine/n traumatisierte/n Partner/in suchen dass Beziehung auch Heilung bedeuten kann
Viele Therapien konzentrieren sich auf die Verhaltensebene. TEACCH ist ein ganzheitlicher Ansatz, der als Anregung dargestellt wird. Für ausführliche Informationen ist eine Fortbildung sinnvoll. Weitere lohnenswerte Ansätze, aus meiner Sicht, sind: Soziales Kompetenztraining (SOKO) und Unterstützte Kommunikation (UK). Mehr zu heilpädagogischen Themen, sowie Kontakt zu Nachfragen, Anregungen und Co: www.innovation-bba.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/alicia-sailer/message
doch die meisten sind keine Tipps auf der Verhaltensebene, sondern sie betreffen eher Dein Mindset, Deine Glaubenssätze und Deine Identität – denn, ganz ehrlich: Du wirst sehr viel mehr erreichen und verändern, wenn Du das veränderst... Nichtsdestotrotz präsentiere ich Dir in dieser Folge meinen besten Tipp fürs Flirten und wie Du erfolgreich im flirten wirst. Sozusagen der „magische Schlüssel“ für die besten Flirts der Welt – viele Flirts, tolle Flirts... Glaubst Du nicht? Hör doch selber rein. Du wirst erstaunt sein. Mal wieder. Hol Dir dazu auch meinen kostenlosen „Dein-Weg-zur-Liebe-Newsletter“ auf https://www.kontaktvoll.de/newsletter und mach jetzt den Test zu den Liebesblockaden auf https://www.kontaktvoll.de.
doch die meisten sind keine Tipps auf der Verhaltensebene, sondern sie betreffen eher Dein Mindset, Deine Glaubenssätze und Deine Identität – denn, ganz ehrlich: Du wirst sehr viel mehr erreichen und verändern, wenn Du das veränderst... Nichtsdestotrotz präsentiere ich Dir in dieser Folge meinen besten Tipp fürs Flirten und wie Du erfolgreich im flirten wirst. Sozusagen der „magische Schlüssel“ für die besten Flirts der Welt – viele Flirts, tolle Flirts... Glaubst Du nicht? Hör doch selber rein. Du wirst erstaunt sein. Mal wieder. Hol Dir dazu auch meinen kostenlosen „Dein-Weg-zur-Liebe-Newsletter“ auf https://www.kontaktvoll.de/newsletter und mach jetzt den Test zu den Liebesblockaden auf https://www.kontaktvoll.de.
In der letzten haben wir kurz das Thema angerissen, dass die Menschen – DU und ich - im Büro das Umfeld gestalten und genau aus diesem Grund macht es natürlich auch Sinn, die Beschäftigten in einen Veränderungsprozess mit einbezogen werden. Mit den beiden Beispielen die ich erlebt habe, sehen wir, dass es ohnehin nötig ist, also warum nicht in der Planung schon damit beginnen? In meiner Pyramide Büro-Effizienz erkennst du sehr deutlich, dass das persönliche Verhalten auf eine Wissensebene, eine Verhaltensebene und eine Sozial-Ebene aufgeteilt wurde. Hierzu habe ich nun übrigens mein Buch fertig geschrieben, wenn du Lust hast, kannst du es über meine Website www.lauble.net im Shop kaufen. Aber lasst uns zurück kommen, zum Thema: Die Beschäftigten sind das Umfeld und haben gleichzeitig Einfluß darauf. Logischerweise, wir sprechen und bewegen uns und werden somit von anderen im Raum wahrgenommen. Wenn die Beschäftigten sich nun in einer komplett neuen Arbeitswelt befinden, als dies jahrelang der Fall war, wird dies ebenfalls Einfluß auf uns haben. Vielleicht hast du schonmal ein neues Auto gekauft, dann kennst du das. Angenommen du hast früher eine spartanisch ausgestattete und gebrauchte Kiste gefahren und bist auf einen Neuwagen mit vielleicht sogar deutlich besserer Ausstattung gewechselt, dann hast du dich in den ersten Wochen anders verhalten. Hierbei ist egal ob besser oder schlechter, es war einfach anders. Genauso ist das in Büros, in denen Leute arbeiten. Sie werden sich anders verhalten, denn im Gegenzug zum Auto wurde ihnen in der Regel noch nicht einmal erklärt, welche Funktionen alles in dem neuen Umfeld enthalten sind. Vor kurzem hatte ich genau einen solchen schönen Auftrag, von dem ich dir erzählen möchte. Es ging um einen Neubau, bzw. die Büros wurden bereits vor einem halben Jahr bezogen. Die Beschäftigten kamen aus Zellenbüros und wurden jetzt mit jeweils ca. 20 Personen in einen Raum gesetzt. Die Räume waren wirklich groß, so dass nahezu jeder einen Arbeitsplatz direkt am Fenster genießen konnte. Es gab für die Beschäftigten ausreichend große Tische, einen seitlichen Ausziehschrank mit Akustikfronten und auch einige Schränke im Rücken – ebenfalls mit Akustikfronten. Nun haben sich die Beschäftigten aber über diverse Störungen beklagt und nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich schon den Tip gegeben, den Beschäftigten zu sagen, dass diese die seitlichen Schränke sehr einfach – nämlich mittels Öffnen – als Schutz vor vorbeilaufenden Leuten nutzen könnten. Natürlich gab es auch andere Themen und hier erlebte ich wie so oft, dass wir die Beschäftigten mit ins Boot holen müssen. Ich durfte also dort zwei Tage verbringen und in diesen zwei Tagen war das Ziel, die Beschäftigten über deren aktuelle Themen zu interviewen und mit deren Hilfe die Gesamtsituation für alle Beteiligten zu optimieren. Zunächst hatte das Unternehmen selbst die bereits von mir bekannten Fragebögen an die Beschäftigten übermittelt und damit dann auch meinen Termin angekündigt. Aus meiner Erfahrung und bei 58 Beschäftigten sowieso - macht es Sinn, zunächst zwei Gruppen für jeweils eine halbe Stunde zusammen zu führen. Dies spart Zeit und hat den charmanten Vorteil einer guten Gruppendnyamik. Zu Beginn ist natürlich eine Ungewissheit „was kommt da für einer und was will der von uns“ In der Praxis ist das relativ schnell in eine Positive Energie zu verwandeln, indem den Beschäftigten klar gemacht wird, dass es überhaupt nicht wichtig ist, was ich denke oder meine, sondern dass es ausschließlich um sie – also die Beschäftigten geht. Wer auch immer an meiner Stelle stehen würde, diese Person ist schon lange weg, während die Beschäftigten sich immer noch haben. In solchen Momenten mache ich auch klar, dass ich mich gut in die Beschäftigten hinein Versetzen kann, dass ich die Probleme deshalb auch verstehe, über die aktuell geklagt werden. Damit habe ich in der Regel sehr hohe Unterstützung wenn ich darum bitte, auch die Sicht der Unternehmer kurz einzunehmen. Es geht um Effizienz-Steigerung, es geht um gute Kooperation der Beschäftigten ohne störende Wände – und natürlich geht es um Wirtschaftlichkeit, damit die Arbeitsplätze lange gesichert sind. Da in diesem Fall die Ausstattung – also das Mobiliar gut war, bin ich darauf eingegangen, dass es sinnvoll wäre, diese Möbel auch entsprechend der persönlichen Gegebenheiten einzustellen und natürlich auch Optimierungsvorschläge für andere Situationen zu unterbreiten. Dafür komme ich zu jedem Einzelnen hin und habe auch jeweils 15 Minuten Zeit – für Jeden ! Was jedoch ganz wichtig ist und das muß jedem bewußt sein: Ich bin nur ein ganz kleines Rädchen in diesem Unternehmen und spiele auch nur für 2 Tage eine Rolle. Dabei kann ich sicherlich einige Einstellungen ändern, indem ich Wissen und ein Gefühl für persönliche Verbesserungen vermittle. Für das Beibehalten der Verhaltensweisen ist jeder selbst verantwortlich und insofern ist hier die Gruppe wieder interessant, die sich gegenseitig unterstützen kann. Das könnte beispielsweise sein, „hey du wolltest doch nicht mehr durchs Ganze Büro schreien“ – freundlich und ohne Vorwurf, dann kann die Methode Täglicher Optimierungs-Prozess ohne Druck umgesetzt werden und mit der Zeit können sich damit alle besser fühlen. Dieses Üben und Wiederholen aktiviert das semantische Gedächtnis. Um die Effizienz zu steigern – übrigens auch die Motivation - mache ich in der Gruppe noch so meine 2 – 3 Übungen, mit denen das episodische Gedächtnis aktiviert wird und gleichzeitig das AHA-Erlebnis bringt. Dann geht es in der Regel um Rückfragen und wir starten in die 1 zu 1 – Situation am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz muß ich leider noch viel zu häufig feststellen, dass neue Möbel zwar ausgeliefert, aber in keinster Weise erklärt werden. Sorry, das empfinde ich als hundsmiserabel. Was hilft es denn den Beschäftigten wenn der Verkäufer der Stühle dem Einkäufer erklärt was der alles kann? Ich kauf mir doch auch kein Auto – und sorry selbst ich als Vielfahrer sitz nur sehr selten 8 Stunden im Auto – ich kauf mir doch auch kein Auto und schick jemanden vom Einkauf, dass dieser die Funktionen erklärt bekommt. Folglich werden die ausgefüllten Zettel sehr häufig die Themen Schmerzen im Nacken und auch Schmerzen im Rücken beinhalten, was natürlich auch hier der Fall war. Im Einzelgespräch gebe ich nun Tips, wie die Möbel korrekt eingestellt werden, meistens wird dies auch gleich umgesetzt, bei höhenverstellbaren Sitz- Stehtischen ist es logischerweise am Einfachsten und hat deshalb auch gut funktioniert. Nun ist die wichtigste Frage natürlich, ob die Beschäftigten eine Verbesserung spüren. Damit meine ich nicht, dass die Rücken oder Nackenschmerzen weg sind, sondern ob es sich gut und entspannt anfühlt so am Tisch zu arbeiten. Dann gehe ich persönlich nochmal in das Negative Erlebnis und erläutere warum die Anspannung kam und dass wir – also alle Menschen – bei schon vorhandenen Problemen viel empfindlicher für zusätzliche Störungen sind. Auf diese gehen wir natürlich auch ein, nicht alles ist an diesem Tag umzusetzen, teils darf der Arbeitgeber hier mit gewissen Materialien noch nachrüsten. Diese Hoffnung dürfen sich die Beschäftigten aber machen, wenn sie selbst auch dazu beitragen, etwas an der Änderung des Umfeldes und dem Umgang mit sich selbst und anderen zu optimieren. So etwas kläre ich immer zuvor mit dem Auftraggeber ab und es motiviert die Beschäftigten zusätzlich, denn wir wollen doch alle unsere Arbeiten gut erledigen und zufrieden damit sein können. Und tatsächlich war es so, dass die Beschäftigten mit einer enormen Motivation die beiden Tage voll da waren, sich selbst anders verhalten haben und somit das Umfeld schon einmal extrem verbessert wurde. Stell dir das vor, wir haben bei 58 Personen durch das Verhalten jedes einzelnen, eine Verbesserung von 0,1 % hinbekommen, dass sind 5,8 % Steigerung an einem Tag ! Ich würde sagen, diese Investition in mich hat sich ausgezahlt für den Arbeitgeber. Jetzt wurde telefonisch oder durch Gänge zum Kollegen gesprochen, anstatt durch den Raum gerufen, die Achtung auf die eigene Körperhaltung wurde erhöht und somit auch langfristige Gesundheitsschäden vermieden, die ansonsten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingetreten wären. Es war sogar so, dass die Beschäftigten gemeinsam zum Kaffee holen gingen, damit eine weitere Beschäftigte in der Nähe der Kaffee-Maschine nicht mehrmals gestört wird. Eine andere Kaffeezone wurde eigenhändig umgestellt, wodurch ebenfalls weniger Störungen für andere stattfinden. Alleine die Gruppendynamik die hier gewonnen wurde – übrigens bei allen Personen mit Freude – war schon eine WIN – WIN – Situation für Arbeitgeber und Beschäftigte. Es war nicht mehr die Rede von kleineren Büros, die aktuelle Situation wurde besser genutzt und gestaltet ! Und wie gesagt – die Beschäftigten gestalten IMMMER !!! Auch wenn wir glauben, wir gestalten die Arbeitswelten, weil wir planen und mit Möbeln ausstatten, sollte dabei nie vergessen werden, dass die Beschäftigten mit jeder Sekunde, die sie im Büro verbringen einen deutlich größeren Anteil an der Gestaltung der Büros haben. Das ist eine der Grundessenzen in meinem Leitspruch „Humanisierung ist die intelligenteste Art der Rationalisierung!“ Ich versichere euch, es war ein tolles Gefühl mit so vielen freundlichen und motivierten Personen arbeiten zu dürfen und auch zu sehen, wie viel zusammen erreicht werden kann, indem jeder ein kleines bißchen was dazu tut. Eine tolle Erfahrung, für die ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanke ! Damit will ich für heute erst einmal beenden, ich danke dir fürs Anhören dieser Folge, wenn du Lust hast, kauf mein Buch und gib mir gern Feedback dazu, du findest es auf meiner Website www.lauble.net. Hast du spezielle Themen oder Anregungen und Wünsche, dann schreibe mir diese gern an martin@lauble.net oder ruf mich an. Meine Nummer findest du ebenfalls auf der Website. Egal was du tust, ich wünsche dir maximale Erfolge und denke bitte immer daran, Humanisierung ist die intelligenteste Art der Rationalisierung !
Proxies of extra-pair behaviour
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/06
Viele Vogelarten sind monogam, aber es kommt zugleich häufig zu Paarungen außerhalb des Paarbundes (Griffith et al. 2002). In einer großen Zahl von Studien wurde bereits der adaptive Wert der aus diesem Verhalten hervorgehenden „Fremdvaterschaften“, insbesondere für Weibchen, anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse auf genetischer Ebene untersucht. Die Ergebnisse dieser Studien haben jedoch bisher nicht zu generalisierbaren Resultaten geführt (Akçay & Roughgarden 2007). Im Gegensatz dazu gibt es relativ wenig Informationen über verhaltensbegründete Kosten und Vorteile von Fremdvaterschaften, obwohl diese ein Verständnis der Mechanismen von Fremdverpaarungen erleichtern können. Die hier vorliegende Studie untersucht, wie zeitliche, räumliche, und soziale Faktoren beeinflussen wann, wo, und warum bestimmte Individuen Nachkommen mit einem anderen als ihrem sozialen Partner zeugen. Ich untersuche dies an der Blaumeise (Cyanistes caeruleus), einer Art, für die genetische Konsequenzen von Fremdvaterschaften bereits detailliert untersucht wurden, bei der die Kenntnisse im Bereich des außerpaarlichen Verhaltens selbst aber noch unvollständig sind. In den ersten beiden Studien stelle ich einen neuartigen Ansatz zur Untersuchung von Fremdvaterschaften vor und validiere diesen. Fremdverpaarungen erfordern als Beteiligte sowohl ein Weibchen als auch ein Männchen und beide können beeinflussen, ob eine Paarung stattfindet. In dem von mir vorgeschlagenen Ansatz werden nicht nur Informationen über das Individuum, sondern auch über potentielle und realisierte außerpaarliche Partner mit eingebunden. Bei Arten wie der Blaumeise, deren Territorien nicht nur in einzelnen, sondern in allen Aspekten des Brutverhaltens (Nahrungssuche, Balz, etc.) genutzt werden, sind Interaktionen räumlich oft auf Individuen aus nahegelegenen Territorien beschränkt. Auch außerpaarliches Verhalten zeigt eine solche Beschränkung. Im vorliegenden Ansatz werden daher räumliche Verhaltensstrukturen explizit in das Modell mit einbezogen. Um solche räumliche Verhaltensinformationen für einen Langzeitdatensatz über Brutverhalten (die hier eingesetzen Daten von Blaumeisen umfassen 12 Jahre und 2 Populationen) zu erhalten, ist es notwendig, im Nachhinein die Position der Territorien der Brutpaare abzuschätzen. In der Ökologie werden zu diesem Zweck immer häufiger Thiessen-Polygone eingesetzt (z.B. Wilkin et al. 2006, Valcu & Kempenaers 2008). Im 1. Kapitel (Chapter 1) belege ich daher zunächst die Gültigkeit einer solchen Abschätzung von Territorien mit Hilfe von Thiessen-Polygonen, basierend of 14 publizierten Studien, für die detaillierten Informationen über Territorien vorliegen. Im 2. Kapitel (Chapter 2) stelle ich dann den neuartigen Ansatz im Detail vor. Anschließend wende ich diesen auf den genannten Langzeitdatensatz an, nutze dabei Thiessen-Polygone als Approximation für die räumliche Beschränkung von außerpaarlichem Verhalten und untersuche gleichzeitig die Korrelation relevanter Parameter mit außerpaarlichem Fortpflanzungserfolg. Meine Resultate bestätigen die Ergebnisse früherer Studien und zeigen, dass dieser Ansatz genutzt werden kann, um Hypothesen zu testen, die mit bisherigen Methoden nicht statistisch robust überprüft werden konnten. Fremdverpaarungen können früh morgens stattfinden und aus einer Studie über die nahe verwandte Kohlmeise (Parus major) geht hervor, dass Weibchen, die ihren Schlafplatz morgens früher verließen, mit größerer Wahrscheinlichkeit außerpaarliche Nachkommen hatten. Im 3. Kapitel (Chapter 3) untersuche ich mit Hilfe von korrelativen Daten über vier Jahre diesen Zusammenhang für Blaumeisen. Darüber hinaus wurden die Aufstehzeiten von Weibchen über zwei Jahre hinweg experimentell manipuliert, um einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Aufstehzeiten und außerpaarlichem Fortpflanzungserfolg zu ergründen. Ich konnte keinen solchen Zusammenhang feststellen, jedoch führte das Experiment interessanterweise in den zwei Jahren zu entgegengesetzten Ergebnissen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Verhalten von Weibchen am frühen Morgen durchaus Relevanz für Fremdverpaarungen hat, dass jedoch eine Interaktion mit Umwelteinflüssen diese Zusammenhänge beeinflussen kann. Im 4. Kapitel (Chapter 4) beschreibe ich, dass Blaumeisen vor oder während der Legephase der Weibchen immer wieder die Nester fremder Paare besuchen. Für Männchen korrelierte dieses Verhalten auch mit ihrem außerpaarlichen Fortpflanzungserfolg. Es erwies sich nämlich, dass ein Männchen, welches das Nest eines Weibchens besucht, mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit außerpaarliche Nachkommen mit diesem Weibchen zeugt. Im Gegensatz zu einer früheren Studie an Blaumeisen (Kempenaers et al. 1992) zeigt dieses Ergebnis, dass nicht nur das Verhalten des Weibchens, sondern auch das des Männchens einen wichtigen Einfluss auf die außerpaarliche Fortpflanzung haben kann. Im 5. Kapitel (Chapter 5) betrachte ich abschließend das Balzverhalten der Blaumeisen. Dies erfolgt mittels Audioaufnahmen von Rufen, die speziell im Balzkontext eingesetzt werden (Bijnens & Dhondt 1984). Zunächst beschreibe ich das zeitliche Vorkommen dieser Rufe im Laufe der Brutsaison und im Tagesverlauf. Im nächsten Schritt vergleiche ich diese Daten mit früheren Studien, um zu verifizieren, dass Balzrufe tatsächlich als Maß für das Balzverhalten verwendet werden können. Anschließend untersuche ich dann speziell Balzrufe von Männchen, die in einem Kontext auftreten, der nahelegt, dass die Rufe nicht an das soziale Weibchen gerichtet sind. Es ist wahrscheinlich, dass diese (zu großen Teilen) außerpaarliche Balz anzeigen. Es gab keine Korrelation der „außerpaarlichen Balzversuche“ von Männchen mit ihrem außerpaarlichen Fortpflanzungserfolg, jedoch verloren Männchen mit vielen außerpaarlichen Balzversuchen weniger Vaterschaft in ihrem eigenen Nest. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Qualität von Blaumeisenmännchen auf Verhaltensebene relevant für den außerpaarlichen Fortpflanzungserfolg ist. In der allgemeinen Einleitung (General Introduction) beschreibe ich detailliert den biologischen Hintergrund dieser fünf Studien. Weiterhin diskutiere ich die Relevanz von Studien im Bereich der Forschung über Fremdvaterschaften, die anstelle der rein genetischen Betrachtung darüber hinaus auch das Verhalten untersuchen. In der allgemeinen Diskussion (General Discussion) erörtere ich die Implikationen dieser fünf Studien für außerpaarliches Verhalten: Das zeitliche Vorkommen von Balz und Paarungen im Tagesverlauf und über die Saison hinweg, das räumliche Vorkommen, die relative Wichtigkeit des Verhaltens von Männchen und Weibchen und welche Faktoren beeinflussen, dass es zu Fremdverpaarungen zwischen einem ganz bestimmten Männchen und Weibchen kommt.
Interaktion von Emotion und Kognition als Grundlage für die Verhaltensregulation bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Zu den Kernsymptomen der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zählen die Störung der Impulskontrolle und die emotionale Dysregulation, die für die sozialen und zwischenmenschlichen Konflikte sowie für das bei Patienten mit einer Borderline- Persönlichkeitsstörung (BPS-Patienten) fast immer vorhandene selbstverletzende Verhalten ursächlich verantwortlich gemacht werden. Ziel des Promotionsvorhabens war es, die Inhibitions- und Regulationsfähigkeit für Reize unterschiedlicher Valenzen und unterschiedlicher Arousalausprägungen als Grundlage der Verhaltensregulation bei BPS-Patienten mittels experimenteller Paradigmen (mit Papier und Bleistift-Methode oder am Computer) und funktioneller Kernspintomographie (f-MRT) zu untersuchen. Aufgrund der heterogenen Befundlage sollte zudem ein Beitrag zur Erstellung des neuropsychologischen Leistungsprofils bei der BPS geleistet werden. Somit stellt die vorliegende Arbeit eine umfangreiche Untersuchung von klinischen, kognitiven und neurofunktionellen Leistungen bei einer einzigen klinischen Stichprobe und einer vergleichbaren Stichprobe von gesunden Probanden dar. Nachdem das Untersuchungsmaterial (Bildersammlung) für die experimentelle Kernspinuntersuchung nach eigens für die Studie festgelegten Kriterien entwickelt und zusammengestellt und anhand einer gesunden Stichprobe bewertet wurde, konnte die klinische, neuropsychologische, experimentelle und neurofunktionelle Untersuchung der BPS-Patienten und einer gesunden Vergleichsgruppe durchgeführt werden. Die Inhibitions- und Regulationsfähigkeit für neutrale und emotionale Reize wurden mittels unterschiedlicher Inhibitionsarten (willentliche kognitive Inhibition, automatische kognitive Inhibition und affektive Interferenzkontrolle) und verschiedener emotionaler Regulationsmechanismen („Top-down-“ und „Bottom-up-Regulation“) geprüft. Im Theorieteil wird ein Überblick über das Störungsbild der BPS sowie über neuropsychologische und neurofunktionelle Befunde bei der BPS gegeben. Des Weiteren werden die für diese Arbeit relevanten Aspekte der Impulsivität und Inhibition sowie der Emotion und Emotionsregulation behandelt. Im Methodenteil Teil A wird die methodische Vorgehensweise bei der Erstellung der neuen Bilderbatterie ausführlich erläutert. Im Methodenteil Teil B werden alle eingesetzten standardisierten bzw. etablierten Instrumente sowie die experimentellen Paradigmen und das fMRT-Paradigma beschrieben. Erhoben wurden klinische Daten aus den Selbstauskunftsfragebögen, kognitive Leistungsparameter, Verhaltensdaten aus den experimentellen Paradigmen sowie aus dem fMRT-Paradigma und neurofunktionelle Daten mittels funktioneller Kernspintomographie. Die Ergebnisse werden zunächst pro Bereich und abschließend integrativ diskutiert. Die neuropsychologischen Ergebnisse suggerieren, dass die Leistungsunterschiede zwischen BPS-Patienten und gesunden Probanden sowohl im verbalen als auch im non-verbalen Gedächtnis auf Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses und der Planungsfähigkeit für komplexe Informationen zurückzuführen sind. Insgesamt lassen sich die bei den BPS-Patienten beobachteten Einbußen einem rechtshemisphärischen fronto-temporalen Netzwerk zuordnen. Die bereits von mehreren Autoren postulierte rechtshemisphärische fronto-temporale Beeinträchtigung wurde ebenfalls im Rahmen der Emotionsregulationaufgabe beobachtet, da die BPS-Patienten bevorzugt eine linkshemiphärische Beteiligung im Vergleich zu den gesunden Probanden zeigen. Zur kognitiven Inhibitionsfähigkeit ergaben sich lediglich für die intentionale kognitive Inhibition (geprüft anhand des Emotionalen Directed Forgettings) eindeutige Ergebnisse, die die Vermutung einer erhöhten Interferenzanfälligkeit für negativ geladene Reize bei der BPS bestätigen. Sowohl aus der Prüfung der intentionalen kognitiven Inhibition als auch aus den klinischen Daten geht hervor, dass bei den BPS-Patienten die bevorzugte Vearbeitung aversiver Reize mit einer defizitären Verarbeitung appetitiver Reize bzw. das Zurückgreifen auf stressinduzierende Strategien mit einem Defizit an stressreduzierenden Strategien einhergeht. Obwohl die Hypothese, dass BPS-Patienten negativ geladene Reize im Arousal stärker bewerten als Gesunde, nicht bestätigt werden konnte, fanden wir eine stärkere Beteiligung der Amygdala sowohl für stark erregende aversive als auch bereits bei leicht erregend aversiven Reizen. Die ausgebliebene höhere Arousalbewertung trotz vorliegender limbischer Hyperreagibilität geht mit ähnlichen Befunden aus der Literatur einher (Herpertz et al., 1999; 2001) und bekräftigt die Vermutung einer Dissoziation der Reaktionsebenen als Charakteristikum der BPS (Renneberg, 2003). Im Vergleich zu den gesunden Kontrollprobanden fiel die Arousalreduktion bei den BPS-Patienten lediglich in der willentlichen Emotionsregulation durch Distanzierung signifikant geringer aus. Für die automatische Regulation durch Ablenkung zeigten sich weder bei den BPS-Patienten noch bei den Gesunden Veränderungen in der subjektiven Wahrnehmung des Arousals. Das neuronale Aktivierungsprofil unterschied sich zwischen den Gruppen sowohl in der Distanzierungs- als auch in der Ablenkungsbedingung. Mögliche Ursachen hierfür werden diskutiert. Auch in der Gedächtnisleistung zeigten sich unterschiedliche Leistungsprofile zwischen der Distanzierung- und Ablenkungsbedingung, die mit den Ergebnissen aus der Arousalbewertung und der neuronalen Aktivierung gut vereinbar sind. Die BPS-Patienten zeigten im Vergleich zu den Gesunden in der Ablenkungsbedingung mehr Fehler für aversive Bilder. In der Distanzierungsbedingung, und teilweise in der Ablenkungsbedingung, zeigten die BPS-Patienten eine Beeinträchtigung im Erinnern positiver Wörter. In der Distanzierungsbedingung ging diese Beeinträchtigung mit einer besseren Erinnerungsleistung von stark erregenden aversiven Bildern einher. All diese Ergebnisse können mit der Psychopathologie der BPS in Zusammenhang gebracht werden: Die erhöhte Interferenz für aversive Reize führt zusammen mit einer geringeren Verarbeitungsfähigkeit von appetitiven Reizen zu einem physiologischen Hyperarousal, das auf Verhaltensebene aufgrund mangelnder subjektiver Wahrnehmung und fehlenden adäquaten Strategien nicht unterdrückt werden kann und durch das Zurückgreifen von inadäquaten Strategien weiter verstärkt wird. Das Hyperarousal kommt vor allem in interpersonellen bzw. sozialen Interaktionen zum Tragen, da sie komplexe Anforderungen an das Individuum stellen und eine ständige Analyse und Interpretation der verbalen und non-verbalen Informationen sowie eine nahezu ständige on-line Regulation der parallel ablaufenden emotionalen Prozesse erfordern. Da die BPS-Patienten eine Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses und der Fähigkeit komplexe Informationen zu strukturieren aufweisen, ist es ihnen jedoch kaum möglich diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der aversive Spannungszustand wirkt nach dem Modell von Herpertz und Saß (1997) als modulierender Faktor auf den impulsiven Antrieb und/oder auf die Impulskontrolle und führt somit zu einer erhöhten Impulsivität, die dazu beiträgt, dass die fehlerhafte kognitive Analyse verstärkt wird. Dadurch kommt es zu einem Hochschaukeln von aversiver Spannung und fehlerhafter kognitiver Informationsverarbeitung und endet schließlich in inadäquaten, selbstschädigenden Reaktionen sowie interpersonnellen Konflikten. Zum Abschluss wird die Arbeit kritisch gewürdigt und ein Blick auf die aus den diskutierten Ergebnissen sich ergebenden weiterführenden Untersuchungen geworfen.
Bindung, soziale Kognition und die Balance von Autonomie und Verbundenheit in den Liebesbeziehungen junger Paare
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage, wie die generalisierten inneren Arbeitsmodelle von Bindung, die zwei Partner bereits beim Kennenlernen in eine Beziehung mitbringen, die Gestaltung von Liebesbeziehungen beeinflusst. Unter Rückgriff auf Bowlbys Konzept der zielkorrigierten Part-nerschaft, Fonagys Mentalisierungstheorie sowie Selmans Annahmen über die Bedeutung von sozialkognitiven Prozessen wurde angenommen, dass ein wichtiger Vorteil einer sicheren Bin-dungsrepräsentation darin zu sehen ist, dass die Erfüllung von psychologischen Grundbedürfnis-sen nach Autonomie und Verbundenheit auch in neuen Beziehungen besser gelingt, was eine we-sentliche Voraussetzung für das langfristige Gelingen einer Partnerschaft darstellt. Überprüft wurden diese Annahmen an einer Stichprobe von 60 Paaren im Jugend- und frühen Er-wachsenenalter, für die Daten zu ihrer Bindungsrepräsentation sowie zu Autonomie und Verbun-denheit in der Partnerschaft vorliegen. Autonomie und Verbundenheit wurden dabei zum einen auf Verhaltensebene, zum anderen auf Ebene der diesem Verhalten zu Grunde liegenden sozialkogni-tiven Prozesse erfasst. Die Befunde dieser Arbeit belegen, dass eine sichere generalisierte Bindungsrepräsentation die Entwicklung von Liebesbeziehungen und Partnerschaften begünstigt, die durch ein Klima von au-tonomer Verbundenheit gekennzeichnet sind, was es beiden Partnern ermöglicht, einerseits die eigenen alltäglichen Erfahrungen, Ängste und Nöte mit dem Partner zu teilen, andererseits gleich-zeitig aber auch die eigene Meinung sowie individuelle Wünsche und Bedürfnisse offen zum Aus-druck zu bringen, ohne dass die Beziehung hierdurch gefährdet wird. Dabei konnte gezeigt wer-den, dass das individuelle Verhalten im Kontext einer spezifischen Partnerschaft zwar immer eine Reaktion auf das Verhalten des Partners darstellt, dass die sich zwischen zwei Partnern etablie-renden Interaktionsmuster gleichzeitig aber auch wesentlich durch sozialkognitive Prozesse der Bedeutungszuschreibung beeinflusst werden, durch die beide Partner ihre früheren Erfahrungen in die Beziehung einbringen. Die Klassifikation von Partnerschaften als Bindungs- oder Datingbezie-hungen erbrachte darüber hinaus, dass einige Effekte auf Bindungsbeziehungen beschränkt wa-ren, wobei insbesondere negative, autonomieverhindernde Verhaltensmuster in Bindungsbezie-hungen besser vorhergesagt werden konnten. Dies entspricht bindungstheoretischen Annahmen, denen zufolge die vorrangige Funktion von Bindungsbeziehungen in ihrer Bedeutung für die Regu-lation von (negativen) Emotionen zu sehen ist. Insgesamt lässt sich die Aushandlung von Autonomie und Verbundenheit in einer Partnerschaft vor dem Hintergrund dieser Arbeit als ein ko-konstruktiver Prozess verstehen, der nicht nur durch die gegenseitige Beeinflussung zwischen den Partnern im alltäglichen Austausch geprägt wird, son-dern in den beide Partner auch ihre bewussten und unbewussten Erwartungen, Befürchtungen und Wünsche einbringen. Das Verhalten des Partners wird vor diesem Hintergrund wahrgenommen und interpretiert, wodurch die bereits zu Beginn der Partnerschaft bestehenden inneren Arbeitsmo-delle von Bindung auf die Partnerschaft übertragen werden.
Untersuchungen zur Rolle des endogenen Cannabinoidsystems bei der Anpassung an aversive Situationen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06
Ziel der vorliegenden Arbeit war es zu untersuchen, auf welche Art und Weise das endogene Cannabinoidsystem die Extinktion konditionierter Furcht vermittelt. Dabei gliedert sich diese Arbeit in vier Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Modulation intrazellulärer Signalkaskaden durch den CB1 Cannabinoidrezeptor während der Extinktion konditionierter Furcht. Dafür wurden CB1 Cannabinoidrezeptor-knockout Mäuse einer Furchtkonditionierung und deren Extinktion unterzogen und danach der Phosphorylierungsstatus der Kinasen p42, p44 sowie der Proteinkinase B und das Expressionslevel der Phosphatase Calcineurin im basolateralen und zentralen Nucleus der Amygdala, im ventromedialen präfrontalen Cortex sowie im dorsalen und ventralen Hippocampus dieser Tiere gemessen. Die untersuchten Enzyme zeigten sich in diesen Hirnregionen, die in die Extinktion konditionierter Furcht involviert sind, im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen unterschiedlich reguliert. Diese Studie legt den Schluss nahe, dass Endocannabinoide die Extinktion konditionierter Furcht über die Modulation intrazellulärer Signalkaskaden vermitteln, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Hirnstruktur unterschiedlich einbezogen sind. Da bisherige Arbeiten zur allgemeinen Rolle von CB1 in verschiedenen Lernaufgaben kontroverse Ergebnisse lieferten und allein die Einbeziehung des Endocannabinoidsystems in die Extinktion konditionierter Furcht übereinstimmend gezeigt wurde, wird im zweiten Teil dieser Arbeit untersucht, inwieweit sich die Furchtkonditionierung von anderen Lernparadigmen unterscheidet. In diesem Zusammenhang wurde in der vorliegenden Arbeit erstmalig nachgewiesen, dass die bei der Furchtkonditionierung auftretende unabdingbare, stark aversive Situation neben der klassischen Konditionierung auch eine Stress-Sensitivierung hervorrufen kann. Hierfür wurde gezeigt, dass bereits die Applikation eines milden elektrischen Fußschocks per se ausreicht, um eine unspezifische Erhöhung der Reaktivität des Tieres zu erzielen. Auf der Verhaltensebene zeigten schocksensitivierte Tiere beispielsweise eine Furchtreaktion auf Töne, wie sie ebenfalls für die Furchtkonditionierung verwendet wurden, aber auch ein verstärktes angstähnliches Verhalten im Hell-Dunkel-Meidetest. In einer Reihe von Experimenten wurde demonstriert, dass sich diese Erhöhung der Furchtantworten nach Applikation eines Fußschocks nicht auf eine Kontextgeneralisierung, d.h. auf kontextuelles assoziatives Lernen, zurückführen lässt. So zeigten auch Mäuse, die eine Furchtkonditionierung erfahren hatten, neben der Furchtreaktion auf den konditionierten Tonreiz ein verstärktes angstähnliches Verhalten im Hell-Dunkel-Meidetest, was unterstreicht, dass während einer Furchtkonditionierung nicht nur assoziative, sondern auch nicht-assoziative Lernvorgänge, wie die Sensitivierung, induziert werden. Ähnliches gilt für die Extinktion der Furchtkonditionierung, die in derzeitigen Modellen als neue inhibitorische Assoziation zwischen konditioniertem Stimulus und dem Ausbleiben des vorhergesagten ‚Bestrafungsreizes’ beschrieben wird. In der vorliegenden Arbeit wurde dargelegt, dass nicht-assoziative Habituationsprozesse, die bei wiederholter Präsentation des konditionierten Stimulus auftreten, ebenfalls zur Extinktion konditionierter Furcht beitragen. Dieses erstmalig gezeigte Zusammenspiel assoziativer und nicht-assoziativer Prozesse bei der Akquisition und Extinktion konditionierter Furcht wurde in der ‚Zwei-Komponenten-Theorie’ zum Gedächtnis konditionierter Furcht zusammengefasst. Da vorhergehende Studien die Involvierung des Endocannabinoidsystems in die Extinktion konditionierter Furcht belegten, wurde im dritten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht, ob Endocannabinoide assoziatives Extinktionslernen oder Habituationsprozesse modulieren. In einer Reihe von Experimenten wurde gezeigt, dass der CB1 Cannabinoidrezeptor assoziatives Sicherheitslernen nicht beeinflusst – für Habituationsprozesse jedoch erforderlich ist. In einigen Experimenten konnte kein Einfluss des CB1 Cannabinoidrezeptors auf die Kurzzeitanpassung festgestellt werden, dennoch vermittelte der CB1 Cannabinoidrezeptor generell, d.h. auch in diesen Fällen, Langzeithabituation an aversive Situationen. Dies deutete darauf hin, dass das Endocannabinoidsystem Kurzzeitanpassung und Langzeithabituation über verschiedene Mechanismen vermittelt. Zusammenfassend wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit das endogene Cannabinoidsystem als erstes molekulares Korrelat der Habituationskomponente der Furchtextinktion identifiziert. Um die unterschiedliche Einbeziehung des Endocannabinoidsystems in die Kurzzeitanpassung an aversive Situationen besser zu verstehen, wurde im letzten Teil der Arbeit die Aversivität der Testsituation, d.h. die Intensität der Fußschocks während der Sensitivierung, systematisch verändert und danach die akute Furchtreaktion auf einen Ton gemessen. Nach geringen und starken Fußschocks waren Endocannabinoide nicht an der Kurzzeitanpassung beteiligt, lediglich die Applikation eines Fußschocks mittlerer Intensität führte dazu, dass Endocannabinoide ihre Furcht reduzierende Wirkung während der darauf folgenden Tonpräsentation entfalten konnten. Um zu erforschen, ob in stark aversiven Situationen der CB1 Cannabinoidrezeptor durch effiziente Endocannabinoid-Wiederaufnahme- und Abbauprozesse nicht genügend stimuliert wird, um Furchtreaktionen zu reduzieren, wurden Endocannabinoid-Wiederaufnahme- und Abbauhemmer appliziert. Dies führte zu einer verbesserten Anpassung an stark aversive Situationen, die sich in einer verringerten Furchtreaktion zeigte und somit eine therapeutische Ansatzmöglichkeit für Angsterkrankungen bilden könnte. Die hier neu gewonnen Erkenntnisse, namentlich dass eine bestimmte Aversivität erreicht werden muss, um das Endocannabinoidsystem zu aktivieren und dass bei sehr starker Aversivität die Furcht reduzierende Wirkung der Endocannabinoide durch effiziente Wiederaufnahme- und Abbauprozesse limitiert wird, wurde in der ‚Hypothese vom kritischen Bereich der Endocannabinoidwirkung’ zusammengefasst. Auf diese Weise gewährleistet das Endocannabinoidsystem eine adäquate Anpassung an aversive Situationen, indem Furchtreaktionen in Situationen mittlerer Aversivität gedämpft werden, starke Aversivität jedoch eine starke Reaktion auslöst, um bei relevanten Stimuli und Ereignissen die Bildung eines Furchtgedächtnisses zu ermöglichen. Zusammenfassend wurde in der vorliegenden Arbeit erstmalig nachgewiesen, dass sowohl bei der Akquisition als auch bei der Extinktion konditionierter Furcht Sensitivierung bzw. Habituation als nicht-assoziative Prozesse mitwirken. Dabei zeigte sich, dass das Endocannabinoidsystem die Extinktion konditionierter Furcht vermittelt, indem es Langzeithabituation ermöglicht und in einigen Fällen auch in die Kurzzeitanpassung involviert ist. Eine solche Einbeziehung des Endocannabinoidsystems in die akute Anpassung an aversive Situationen erwies sich als von der Aversivität der Situation abhängiger Prozess. Der CB1 Cannabinoidrezeptor wurde somit als erstes molekulares Korrelat der Habituationskomponente der Extinktion konditionierter Furcht identifiziert.