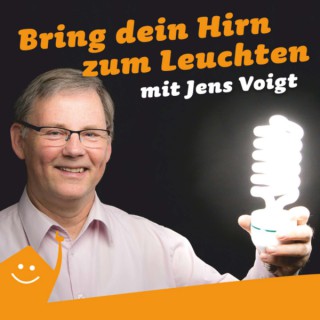Podcasts about arbeitsged
- 47PODCASTS
- 64EPISODES
- 29mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Feb 19, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about arbeitsged
Latest podcast episodes about arbeitsged
Manchmal fühlt sich Alltag mit FASD an wie ein Leben im Bermuda-Dreieck – Dinge und Informationen verschwinden spurlos.Warum Erinnern bei FASD so schwer istIch erkläre dir, was im Gehirn passiert, wenn Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis und ihre Verknüpfung nicht zuverlässig funktionieren. Dein Kind hört zu – und kann sich trotzdem nicht erinnern. Es geht nicht um Trotz.Es ist eine hirnorganische Beeinträchtigung. Wenn du das verstehst, verändert sich dein Blick – und das entlastet. Was im Alltag wirklich hilftDu bekommst konkrete Strategien: feste Ablageorte visuelle Hilfen klare Einzelschritte gleichbleibende RoutinenWeniger Druck. Mehr Struktur. Mehr Geduld.Wenn du lieber Video schaust: YouTube Version der FolgeMein kostenloses E-Book "Kompaktes Wissen über FASD" bietet dir in 7 Schritten Anregungen zum Verstehen der Diagnose, Finden von Unterstützung und Erkennen typischer Verhaltensmuster. Meine persönlichen Erfahrungen als Pflegevater von Zwillingen mit FASD fließen mit ein.Melde dich jetzt für meinen Newsletter "Chaos im Kopf - FASD Insights" an und erhalte sofortigen Zugriff auf das E-Book. Profitiere von regelmäßigen Updates und hilfreichen Tipps für den Alltag mit FASD.[Hier klicken zur E-Book-Seite]
7 Eigenschaften emotional intelligenter Kinder, die zu besseren Noten führen
⬇️ Warum Emotionale Intelligenz der geheime Turbo für bessere Noten ist ❤️ Wusstest du, dass Schulerfolg bei deinem Kind sehr viel mit der emotionalen Intelligenz zu tun hat?
Zoomer Meets Boomer Folge #59 - Lesen & Schreiben: Brauchen wir das noch?
Nach vier Tagen Frankfurter Buchmesse ist Michael eines klar geworden: Lesen lebt! Bei Leuchtturm1917, wo am 23. Januar 2026 Michaels gemeinsames New Work Journal erscheint, hat er viele intensive Gespräche rund um das Thema Lesen und Schreiben geführt. In dieser Folge vertiefen wir mit aktuellen Studien, was im Kopf passiert, wenn wir lesen und schreiben, und was wir verlieren, wenn wir es lassen. Papier schlägt Screen beim Verstehen Eine Meta-Analyse aus 2024 mit 49 Studien zeigt deutlich besseres Textverständnis auf Papier, besonders bei komplexen Texten. Die Haptik und räumliche Orientierung schaffen eine mentale Landkarte, die die Erinnerung stärkt. Physische Bücher binden uns emotional stärker ein und fördern tiefere Immersion. Abends bedeutet analog lesen auch besseren Schlaf ohne Blaulicht. Lesen formt unser Gehirn, Scrollen schwächt es Mehr Lesezeit korreliert mit besserer Kognition, während TV und Endless Scroll sie schwächen. Lesen vergrößert nachweislich die kortikale Oberfläche in Sprach- und Aufmerksamkeitsarealen. Es aktiviert unser reflektiertes Denken (System 2) statt impulsiver Reaktionen. Besonders Fiktion trainiert unsere Empathie und Perspektivübernahme messbar. Handschrift ist kognitives Training EEG-Studien zeigen breitere Hirnaktivierung beim Handschreiben als beim Tippen. Handnotizen erzwingen Auswahl und Struktur, was das Behalten steigert. Bei Kindern und Erwachsenen fördert Handschrift Rechtschreibung, Lesefluss und Kreativität. Das langsamere Tempo unterstützt Reflexion und echtes Begreifen. Journaling wirkt, besonders analog Expressives Schreiben senkt die Amygdala-Reaktivität und stärkt den Präfrontalkortex. Gedanken aufs Papier zu bringen entlastet das Arbeitsgedächtnis und schafft Klarheit. Morgens beim Cortisol-Peak Ziele setzen, abends Dankbarkeit notieren verbessert nachweislich den Schlaf. Analog ist dabei achtsamer und nachhaltiger als digital. Unsere Alltags-Empfehlungen die uns jeden Tag helfen: / 20 Minuten täglich lesen, abends besonders wertvoll / Handnotizen bei Deep Work und wichtigen Meetings / Mini-Journal mit morgendlichen Top-3 und abendlichen Highlights / Bildschirm-Hygiene ab 21 Uhr, Buch statt Blaulicht / Monatlich einen Roman als Empathie-Booster Was ist eure Lese- oder Schreib-Routine und was wollt ihr wieder etablieren? Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gern 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und teilt sie mit Menschen, die moderne Führung voranbringen wollen. #Leadership #GenZ #Führung #Stärkenorientierung #Feedbackkultur #ReverseMentoring #NewWork #KI #ZoomerMeetsBoomer
In der aktuellen Folge von „Die Wahrheit irgendwo hier drinnen“ spricht Deborah mit Ruth, Assistenzärztin an der Karl-Jaspers-Klinik. Ruth erzählt, wie sie zu ihrer ADHS-Diagnose gekommen ist und welche Erfahrungen sie seitdem gemacht hat. Sie erklärt, warum sie ADHS nicht als Aufmerksamkeitsdefizit, sondern vielmehr als Störung der Aufmerksamkeitssteuerung versteht. Außerdem berichtet sie, welche Strategien ihr helfen, wenn das Arbeitsgedächtnis überfordert ist – und was Klemmbretter damit zu tun haben. Zum Schluss gibt Ruth zwei wertvolle Tipps: • Wer bei sich ADHS vermutet, sollte sich nicht über Social Media, sondern professionell diagnostizieren lassen. • Und: Definiert euch nicht über die Diagnose.
#282 Fussballspiele werden im Kopf entschieden - mit Prof. Dr. Daniel Memmert
Spielintelligenz & Kognition im Fußball – mit Prof. Dr. Daniel Memmert In dieser Episode ist Prof. Dr. Daniel Memmert zu Gast – Leiter des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Sporthochschule Köln und einer der führenden Experten für kognitives Training im Fußball. Wir sprechen über zentrale kognitive Fähigkeiten, die im modernen Fußball eine immer größere Rolle spielen: Wahrnehmung, Kreativität, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Spielintelligenz – und wie sie gezielt trainierbar sind. Wie kann ich als Trainer:in kognitives Training in den Alltag integrieren? Welche Methoden sind praxisnah und wirkungsvoll? Und warum sollten kognitive Reize nicht als „Extra“, sondern als zentraler Bestandteil der Ausbildung verstanden werden? Außerdem werfen wir einen Blick auf die Matchplan Konferenz, die am 15. November 2025 in Köln stattfindet – mit vielen spannenden Impulsen rund um Taktik, Training und Innovation im Fußball.
Es ist wieder soweit und der erste Folge meiner Sommer-Special Ausgabe 2025 ist da. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum To-Do-Listen oft nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich erkläre dir, warum diese Listen in der Praxis häufig scheitern und wie du mit den richtigen Tools und Methoden dein Aufgabenmanagement verbessern kannst. Du erfährst, welche Rolle Disziplin und Routine spielen und warum unser Arbeitsgedächtnis oft ein Hindernis darstellt. Freue dich auf spannende Einblicke und praktische Tipps, die dir helfen werden, deine Produktivität zu steigern und den Überblick über deine Aufgaben zu behalten. Viel Spaß beim Zuhören! Dieser Podcast wird unterstützt von: Netpoint International GmbH Madrider Straße 18 41069 Mönchengladbach
#132 Sportler haben besseres Arbeitsgedächtnis | Freunde haben ähnliche Darmbakterien | Zwergwale können ultra-hohe Töne hören | Kakadus entscheiden energiesparend
Wenig Zeit - trotzdem neugierig? Hier ist Euer Podcast Update für alles, was Ihr zu aktueller Forschung wissen müsst. Kurz, relevant und überraschend. Die Themen in dieser Podcast-Folge: (00:00:35) Zwergwale können ultra-hohe Töne hören https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado7580 | (00:03:15) Sportlich = besseres Arbeitsgedächtnis https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2024.2423812#abstract | (00:05:15) Freunde = gleiche Darmbakterien https://www.nature.com/articles/s41586-024-08222-1#Sec9 | (00:08:02) Kakadus entscheiden schlau und energiesparend https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado7580 | Habt Ihr Feedback? Anregungen? Wir freuen uns, von Euch zu hören: WhatsApp (https://wa.me/491746744240) oder iq@br.de.
257: Schockierende Enthüllung: So Sehr Beeinflusst ADHS Dein Gedächtnis!
In dieser Folge spreche ich über die Herausforderungen, die ADHS mit sich bringt, insbesondere im Zusammenhang mit unserem Arbeitsgedächtnis und der daraus resultierenden Vergesslichkeit. Ich teile meine persönlichen Erfahrungen, Strategien zur Bewältigung und wie ich gelernt habe, mein Arbeitsgedächtnis effektiv zu unterstützen. Erfahre mehr über ADHS und wie du besser damit umgehen kannst: www.eliasmünzel.de
Im Matheunterricht an der Tafel oder im Meeting mit Vorgesetzte: In dieser Episode erklärt Bent Freiwald, warum Angst und Druck unser Arbeitsgedächtnis blockieren.Hier geht's zum gleichnamigen Newsletter: Das Leben des BrainLinks zu Quellen und verwendeten Studien:1. Working memory, math performance, and math anxiety2. Think you're bad at math? You may suffer from ‘math trauma Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
240: Brutale Wahrheit über Burnout bei ADHS!
ühlst du dich ständig erschöpft und ausgebrannt? In dieser packenden Folge enthüllt Elias Münzel die wahren Ursachen von Burnout bei ADHS. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch auf eliasmünzel.de und werde zum ADHS-Athleten! Erfahre, wie dein Arbeitsgedächtnis, Stress und Selbstregulationsprobleme dich in den Teufelskreis der Erschöpfung treiben. Entdecke die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest, um deine Energie zurückzugewinnen. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch auf eliasmünzel.de und werde zum ADHS-Athleten!
Drei Tipps, wie Du Deinen Redefluss unterbrichst und wirksam wirst. Folge 374
In dieser Episode unseres Podcasts lernst du, welche Macht Sprechpausen und deren Einfluss auf unsere alltägliche Kommunikation – sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext haben können.Arno erklärt den psychologischen Mechanismus hinter der Verarbeitung gesprochener Sprache und betont die Bedeutung des richtigen Timings beim Einlegen von Pausen.Durch eine Pause nach dem Aussprechen eines Satzes oder einer Phrase wird dem Gehirn Zeit gegeben, das Gesagte vom Kurzzeit- ins Arbeitsgedächtnis zu überführen – ein Prozess entscheidend für das Verständnis und das Merken von Informationen.Die Lehrerin Elfriede konnte durch Anwendung der besprochenen Techniken einen Schüler motivieren sich aktiv am Unterricht zu beteiligen - ein Erfolgserlebnis sowohl für sie als auch den Schüler.Darüber hinaus spricht Arno über Herausforderungen beim Halten des roten Fadens während eines Vortrags und gibt praktische Tipps zur Selbstwahrnehmung sowie zum Umgang mit Abschweifungen.Kernthemen:* Bedeutung von Sprechpausen für das Verständnis* Die drei Schritte des Zuhörprozesses: Wortverstehen, Sprachverstehen und Sinnbildung* Rückmeldungen der Zuhörer als wichtige Signale nutzen* Techniken zur Selbstwahrnehmung beim Abdriften vom ThemaPraktische Tipps:* Bewusstmachen eigener Triggerpunkte für zu weites Abschweifen* Einsatz von Fragen zur Strukturierung und zum Halten am roten Faden* Pattern Interrupts (Musterunterbrechungen) wie Innehalten oder Positionswechsel nutzen* Arnos Klientin erlebt einen Durchbruch mit einem ihrer Schüler durch den gezielten Einsatz von Fragen und Pausen, was dessen Engagement im Unterricht steigert.Du erhältst wertvolle Anregungen für mehr Wirkungskraft in Gesprächen durch bewussten Umgang mit Pausen sowie Tools zur Reflexion des eigenen Kommunikationsstils. . . . . . . . . . . . . . .Gesprächspartner von Arno Fischbacher ist auch in dieser Episode Andreas K. Giermaier von https://lernenderzukunft.com/Dein Voicecoach Arno Fischbacher begleitet Dich auf Deinem persönlichen Weg von Stimm-Besitzer zum Stimm-Benutzer!✅ Hast Du Fragen? Schreib an podcast@arno-fischbacher.com✅ Du willst mit mir persönlich sprechen? Gern: https://arno-fischbacher.com/espresso
Stimme wirkt! Der Stimmtraining-Podcast mit Arno Fischbacher: Drei Tipps, wie Du Deinen Redefluss unterbrichst und wirksam wirst. Folge 374
In dieser Episode unseres Podcasts lernst du, welche Macht Sprechpausen und deren Einfluss auf unsere alltägliche Kommunikation – sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext haben können.Arno erklärt den psychologischen Mechanismus hinter der Verarbeitung gesprochener Sprache und betont die Bedeutung des richtigen Timings beim Einlegen von Pausen.Durch eine Pause nach dem Aussprechen eines Satzes oder einer Phrase wird dem Gehirn Zeit gegeben, das Gesagte vom Kurzzeit- ins Arbeitsgedächtnis zu überführen – ein Prozess entscheidend für das Verständnis und das Merken von Informationen.Die Lehrerin Elfriede konnte durch Anwendung der besprochenen Techniken einen Schüler motivieren sich aktiv am Unterricht zu beteiligen - ein Erfolgserlebnis sowohl für sie als auch den Schüler.Darüber hinaus spricht Arno über Herausforderungen beim Halten des roten Fadens während eines Vortrags und gibt praktische Tipps zur Selbstwahrnehmung sowie zum Umgang mit Abschweifungen.Kernthemen:* Bedeutung von Sprechpausen für das Verständnis* Die drei Schritte des Zuhörprozesses: Wortverstehen, Sprachverstehen und Sinnbildung* Rückmeldungen der Zuhörer als wichtige Signale nutzen* Techniken zur Selbstwahrnehmung beim Abdriften vom ThemaPraktische Tipps:* Bewusstmachen eigener Triggerpunkte für zu weites Abschweifen* Einsatz von Fragen zur Strukturierung und zum Halten am roten Faden* Pattern Interrupts (Musterunterbrechungen) wie Innehalten oder Positionswechsel nutzen* Arnos Klientin erlebt einen Durchbruch mit einem ihrer Schüler durch den gezielten Einsatz von Fragen und Pausen, was dessen Engagement im Unterricht steigert.Du erhältst wertvolle Anregungen für mehr Wirkungskraft in Gesprächen durch bewussten Umgang mit Pausen sowie Tools zur Reflexion des eigenen Kommunikationsstils. . . . . . . . . . . . . . .Gesprächspartner von Arno Fischbacher ist auch in dieser Episode Andreas K. Giermaier von https://lernenderzukunft.com/Dein Voicecoach Arno Fischbacher begleitet Dich auf Deinem persönlichen Weg von Stimm-Besitzer zum Stimm-Benutzer!✅ Hast Du Fragen? Schreib an podcast@arno-fischbacher.com✅ Du willst mit mir persönlich sprechen? Gern: https://arno-fischbacher.com/espresso
Arbeitsgedächtnis, Dart, Stechmücken
Die Themen der Wissensnachrichten: +++ Weite der Pupillen verrät, wie leistungsstark das Arbeitsgedächtnis ist +++ wie schlechte und mittelgute DartsspielerInnen maximal punkten +++ Stechmücken juckt Kältewelle kaum +++**********Weiterführende Quellen zu dieser Folge:Pupillary correlates of individual differences in n-back task performance. 07 February 2024Maximum Expected Reward Line If Non Specialist - Law (for darts) April 1, 2024MückenatlasComparison of Hospital Mortality and Readmission Rates by Physician and Patient Sex. 23 April 2024Memorability shapes perceived time (and vice versa) 22.4.2024Alle Quellen findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
Impulshemmung, Flexibilität, Arbeitsgedächtnis - das sind die drei wichtigsten Säulen der exekutiven Funktionen. Wie wir den Kindern ideale Trainingsbedingungen bereiten um diese entwickeln zu können, und warum sie für das Erlernen von fachlichen Kompetenzen wichtig sind, darüber reden wir auch in der zweiten Folge über exekutive Funktionen. Mehr Raised! ... with love. im Netz: https://raisedwithlove.ch/ https://www.instagram.com/raised_withlove/ https://twitter.com/Raised_withlove Mehr Stephan Kälin: https://stephan-kaelin.ch/ Mehr Hanbekks: https://hanbekks.ch/ Literaturverzeichnis/Link: TS 53:30 https://stephan-kaelin.ch/wp-content/uploads/2023/07/CAMPUS_32_2023_ueberfachliche_Kompetenzen_exekutive_Funktionen.pdf Mehr exekutive Funktionen: https://stephan-kaelin.ch/wp-content/uploads/2021/06/Campus-29.pdf https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf
Impulshemmung, Flexibilität, Arbeitsgedächtnis - das sind die drei wichtigsten Säulen der exekutiven Funktionen. Wie wir den Kindern ideale Trainingsbedingungen bereiten um diese entwickeln zu können, und warum sie für das Erlernen von fachlichen Kompetenzen wichtig sind, darüber reden wir in dieser ersten Folge über exekutive Funktionen. Mehr Raised! ... with love. im Netz: https://raisedwithlove.ch/ https://www.instagram.com/raised_withlove/ https://twitter.com/Raised_withlove Mehr Stephan Kälin: https://stephan-kaelin.ch/ Mehr Hanbekks: https://hanbekks.ch/ Literaturverzeichnis/Link: TS 25:25 https://time-timer.ch/ TS 48:45 Daniel Fassbender, Die weltbeste Geschichte vom Fallen. https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf
Education Minds - Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung: #075 - Yvo Wüest - Cognitive Overload und warum weniger oft mehr ist
Was meinen wir mit "Cognitive Overload". In der Regel verstehen wir darunter eine kognitive Überlastung im Lernprozess. In dieser Solofolge spanne ich den Bogen zu Methoden der "didaktischen Reduktion" und zeige auch, wie man "Überlastung" minimieren kann. Den Begriff kannte ich aus der Studienzeit am IAP - Institut für Angewandte Psychologie in Zürich. Dort hatten wir das Thema im MAS "Educational Management" behandelt. Wer in dieser Podcastreihe regelmässig mithört, erinnert sich: Kürzlich war hier Eliane Cziumplik, eine junge Erziehungswissenschaftlerin aus Freiburg im Breisgau, auf Besuch. Sie war es, die in unserem Gespräch über die “Konzeption von professionellem E-Learning und die Perspektive der neuen Generationen" den Begriff erneut ins Spiel brachte. Dank ihrer Inspiration entschied ich mich, meine alten Notizen hervorzukramen und eine eigene Folge zum Thema aufzunehmen. Ich beginne das Selbstgespräch mit der Grundannahme, dass Lernen immer mit kognitiver Anstrengung verbunden ist. Dann definiere ich “Cognitive Load” genauer und erkläre, wie es zu “Cognitive Overload” oder auf Deutsch zu “Kognitiver Überlastung” kommen kann. Ein Zustand, der eintritt, wenn das Arbeitsgedächtnis mehr Informationen erhält, als es verarbeiten kann. Schliesslich greife ich diese Themen auf: -Die verflixte Begrenztheit unseres Arbeitsgedächtnisses -Warum weniger oft mehr ist -Verstehen statt Auswendiglernen -Intrinsische und extrinsische kognitive Belastung reduzieren … so gelingt's!
Education Minds - Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung: #075 - Yvo Wüest - Cognitive Overload und warum weniger oft mehr ist
Was meinen wir mit "Cognitive Overload". In der Regel verstehen wir darunter eine kognitive Überlastung im Lernprozess. In dieser Solofolge spanne ich den Bogen zu Methoden der "didaktischen Reduktion" und zeige auch, wie man "Überlastung" minimieren kann. Den Begriff kannte ich aus der Studienzeit am IAP - Institut für Angewandte Psychologie in Zürich. Dort hatten wir das Thema im MAS "Educational Management" behandelt. Wer in dieser Podcastreihe regelmässig mithört, erinnert sich: Kürzlich war hier Eliane Cziumplik, eine junge Erziehungswissenschaftlerin aus Freiburg im Breisgau, auf Besuch. Sie war es, die in unserem Gespräch über die “Konzeption von professionellem E-Learning und die Perspektive der neuen Generationen" den Begriff erneut ins Spiel brachte. Dank ihrer Inspiration entschied ich mich, meine alten Notizen hervorzukramen und eine eigene Folge zum Thema aufzunehmen. Ich beginne das Selbstgespräch mit der Grundannahme, dass Lernen immer mit kognitiver Anstrengung verbunden ist. Dann definiere ich “Cognitive Load” genauer und erkläre, wie es zu “Cognitive Overload” oder auf Deutsch zu “Kognitiver Überlastung” kommen kann. Ein Zustand, der eintritt, wenn das Arbeitsgedächtnis mehr Informationen erhält, als es verarbeiten kann. Schliesslich greife ich diese Themen auf: -Die verflixte Begrenztheit unseres Arbeitsgedächtnisses -Warum weniger oft mehr ist -Verstehen statt Auswendiglernen -Intrinsische und extrinsische kognitive Belastung reduzieren … so gelingt's!
#075 - Yvo Wüest - Cognitive Overload und warum weniger oft mehr ist
Education Minds - Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung
Was meinen wir mit "Cognitive Overload". In der Regel verstehen wir darunter eine kognitive Überlastung im Lernprozess. In dieser Solofolge spanne ich den Bogen zu Methoden der "didaktischen Reduktion" und zeige auch, wie man "Überlastung" minimieren kann. Den Begriff kannte ich aus der Studienzeit am IAP - Institut für Angewandte Psychologie in Zürich. Dort hatten wir das Thema im MAS "Educational Management" behandelt. Wer in dieser Podcastreihe regelmässig mithört, erinnert sich: Kürzlich war hier Eliane Cziumplik, eine junge Erziehungswissenschaftlerin aus Freiburg im Breisgau, auf Besuch. Sie war es, die in unserem Gespräch über die “Konzeption von professionellem E-Learning und die Perspektive der neuen Generationen" den Begriff erneut ins Spiel brachte. Dank ihrer Inspiration entschied ich mich, meine alten Notizen hervorzukramen und eine eigene Folge zum Thema aufzunehmen. Ich beginne das Selbstgespräch mit der Grundannahme, dass Lernen immer mit kognitiver Anstrengung verbunden ist. Dann definiere ich “Cognitive Load” genauer und erkläre, wie es zu “Cognitive Overload” oder auf Deutsch zu “Kognitiver Überlastung” kommen kann. Ein Zustand, der eintritt, wenn das Arbeitsgedächtnis mehr Informationen erhält, als es verarbeiten kann. Schliesslich greife ich diese Themen auf: -Die verflixte Begrenztheit unseres Arbeitsgedächtnisses -Warum weniger oft mehr ist -Verstehen statt Auswendiglernen -Intrinsische und extrinsische kognitive Belastung reduzieren … so gelingt's!
Episode 104: Fipsi liest A. Miyake et al. „The Unity and Diversity of Executive Functions“
Die 104. Folge des Podcasts Fipsi, der als erster seiner Art den Dialog zwischen Philosophie und Psychologie anstrebt. In dieser Episode geht das Format "Fipsi liest" in die vierte Runde. Hannes Wendler und Alexander Wendt diskutieren einen erfolgreichen Aufsatz von Miyake et al. über exektuvie Funktionen. In diesem Zusammenhang erschließen sie auch angelagerte Diskurse, wie die des Arbeitsgedächntisses oder der Psychologie des Willens.Auf YouTube finden Sie alle Episoden von Fipsi unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLpIT6jK3mKTiQcXbinapKRbf39mLEpKWmAuf Spotify finden Sie Fipsi unter https://open.spotify.com/show/0il832RRDoPZPaNlC7vams?si=5KbdEcF1TImSHexKYGccfw&dl_branch=1Die Website der Arbeitsgemeinschaft: https://www.phi-psy.deMelden Sie sich mit Rückmeldungen und Anmerkungen gerne unter fipsi@phi-psy.deDiskutieren Sie mit uns auf Telegram: https://t.me/FipsiPPP oder https://t.me/PhiundPsyFür das Intro bedanken wir uns bei Estella und Peter: https://www.instagram.com/elpetera
#112 - Boxen und Boxtraining – Warum Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität damit verbessert werden können
Kennst du die exekutiven Funktionen unseres Gehirns? Das sind laut Prof. Manfred Spitzer unser Arbeitsgedächtnis, unsere geistige Flexibilität und die Inhibition (die Fähigkeit zur Unterdrückung von Gedanken und Handlungen, die uns ablenken könnten) Und um Ablenkungen geht es heute: Ich spreche über unsere Bedürfnisse und die jetzige Situation und was bestimmte Vorgehensweisen der "Umstände" uns von unserer eigenen Potentialentwicklung oder die unserer Kinder ablenken. Wie sagte schon Bertold Brecht: "Erst kommt das Essen und dann die Moral" Wenn unser Grundbedürfnis Wohnen in einer warmen Wohnung, das Einkaufen zu einem bezahlbaren Preis, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, eine stabile Währung usw. gefährdet sind, werden die Wachstumsbedürfnisse die eigene Weiterentwicklung, Potentialentwicklung, Förderung der Talente der Kinder usw. schnell hinten angestellt. Das beobachten wir mit Schrecken seit ein paar Monaten. Verhindert, dass uns andere runterziehen! Das macht depressiv. Wir wollen aktive Menschen, Veränderer. Macher.
#140: Interview mit Katherine Hentzschel zur Bedeutung der Neuropsychologie bei MS
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Katherine Hentzschel beantwortet meine Fragen zur Neuropsychologie und welche Relevanz sie bei der Diagnose und Behandlung von MS hat. Heute ist Katherine Hentzschel, leitende Neuropsychologin am Carolinum Dr. Ebel Fachkliniken in Bad Karlshafen, zu Gast bei mir im Interview. Sie gibt einen Einblick in den Fachbereich der Neuropsychologie und welche Bewandtnis er für die Diagnose und Behandlung von MS-Symptomen hat. Du erfährst, welche Möglichkeiten und Grenzen die Neuropsychologie hat, welche Untersuchungen dazu gehören und wann es Sinn macht für eine Check zum Neuropsychologen zu gehen. Erfahre mehr über diesen spannenden Bereich. Schließlich führen kognitive Probleme bei MS häufig zu Einschränkungen im Leben. Information und rechtzeitiges Entgegenwirken können Dir helfen, die Auswirkungen zu minimieren. Inhaltsverzeichnis Vorstellung Allgemeines zur Neuropsychologie Neuropsychologie spezifisch für MS-Patienten Blitzlicht-Runde Verabschiedung Vorstellung Ich bin ledig, gerne draußen im Garten oder Mountain Bike fahren, lese gerne alles von Klassikern bis Psychothrillern und ich liebe Hunde. Leider habe ich aufgrund der Arbeit keinen, aber zu Studienzeiten hatte ich einen Dackel
#130 - Interview mit Dr. Anja Dillenseger über relevante digitale Biomarker für MS-Patienten
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
In Folge #130 vom MS-Perspektive-Podcast spreche ich mit Dr. Anja Dillenseger vom MS-Zentrum in Dresden über relevante digitale Biomarker für MS-Patienten. Es geht darum, was Biomarker sind? Wie sie eine bessere Beurteilung des Ist-Zustandes ermöglichen, was wiederum eine bessere Behandlung ermöglicht. Welche Rolle dabei Smart Phones, Apps und Fitness Tracker spielen? Außerdem sprechen wir ganz konkret darüber, wie Sehstörungen erfasst werden und die Aussagekraft der Ergebnisse. Und es geht darum, wie Technik objektiv vergleichende Verlaufsdaten zeigen kann, selbst wenn andere Symptome wie Fatigue beim Messen von beispielsweise Sprechstörungen reinspielen. Hier geht es zum Blogartikel: https://ms-perspektive.de/dr-anja-dillenseger-digitale-biomarker/ Inhaltsverzeichnis Vorstellung Digitale Biomarker Überblick Detailfragen digitale Biomarker Zusammenfassung Biomarker Blitzlicht-Runde Verabschiedung Vorstellung Anja Dillenseger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit akademischem Abschluss beim Multiple Sklerose Zentrum Dresden. Sie arbeitete zunächst im Groß- und Außenhandel und war Chefsekretärin bei RENO-Schuhimport. Es folgte ein BWL-Studium. Dann ging sie für 10 Monate in eine Tierarztpraxis und studierte anschließend Veterinärmedizin. Bis 2014 arbeitete sie in einer Praxis in Chemnitz, wechselte dann nach Dresden wo sie in den Jahren 2015/2016 in einer Tierarztpraxis tätig war. Und seit 2016 gehört sie zum Team des MS-Zentrum in Dresden. Digitale Biomarker Überblick Was sind Biomarker und wofür werden sie genutzt? Biomarker sind objektiv messbare Indikatoren physiologischer oder pathologischer Prozesse oder pharmakologischer Antworten auf therapeutische Interventionen. Im Rahmen der MS kann man diese Biomarker unterteilen in: diagnostische (d.h., sie helfen bei der Unterscheidung zwischen verschiedenen Erkrankungen, z.B. oligoklonale Banden), prognostische (diese unterstützen Ärzte dabei abzuschätzen, wie sich eine diagnostizierte Erkrankung entwickelt; z.B. Neurofilament) prädiktive/“vorhersagende“ (geben eine „Vorhersage“, wie die Antwort auf eine Therapie sein wird; welcher Patient profitiert von welcher Therapie? Hier ist zum Beispiel die Genotypisierung vor Siponimod-Therapie zu nennen.) Krankheitsaktivität (messen die Entzündung oder Neurodegeneration, z.B. MRT, Klinik) und Biomarker bezüglich der Therapie-Antwort (hilft zu unterscheiden, ob ein Patient auf eine Therapie anspricht). Was ist das Besondere an digitalen Biomarkern und warum sind sie so wichtig? Klassisch mussten und müssen diese Biomarker durch Ärzte oder medizinisches Personal erhoben und dokumentiert werden. Dafür fehlt leider häufig die Zeit oder das Personal oder beides (von Räumlichkeiten, um zum Beispiel Funktionstests durchzuführen, mal ganz zu schweigen). Daher ist der Gedanke, dass durch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen zum einen diese Informationen gleich digital aufgenommen, dokumentiert und zur Verfügung gestellt werden können. Aber die Digitalisierung bietet auch die Chance, dass Patienten selbst diese Daten generieren und mit ihrem Behandlungsteam teilen. Wir hatten 2019 einmal eine Umfrage bei knapp über 200 Patienten gemacht, welche digitale Technologie sie am häufigsten verwenden. Das Smartphone war da ganz vorne mit dabei mit einer Nutzung mehrmals täglich. Smartphones bieten im Grunde alles, was man braucht: Kamera (z.B. zur Stimmungserhebung anhand des Gesichtsausdruckes), Mikrofon (zur Dokumentation der Sprache und eventuellen Auffälligkeiten), GPS und Gyroskop (zur Messung von Mobilität und Rotationsbewegungen des Körpers) etc. Also: warum dies sich nicht zunutze machen? Oder Fitness-Tracker? Wie können digitale Biomarker das Leben von Menschen mit MS verbessern in Bezug auf Behandlung und Prognose? Bei MS heißt es, frühzeitig auf Progressionen zu reagieren. Aber natürlich auch die Kontrolle der Therapie-Aktivität oder das Hinzukommen von neuen Symptomen. Normalerweise sehen wir Patienten alle 3 Monate, manchmal auch nur alle 6 Monate. Mal ehrlich, ich könnte mich nicht erinnern, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie oft ich in den letzten 3 Monaten z.B. unter Kopfschmerzen gelitten habe. Das Gedächtnis eines jeden erinnert vielleicht die letzten 5 Tage ganz konkret, je nachdem natürlich, wie gravierend das Ereignis war. Aber im Grunde geht wohl viel Information verloren. Oder wird nicht ernst genug genommen. Wenn jetzt aber der Patient sich zum Beispiel hinsichtlich bestimmter Symptome selbst in seiner Häuslichkeit messen kann oder regelmäßig digitale Fragebögen zu den wichtigsten Symptomen zugeschickt bekommt, die Veränderung bestehender Symptome von ihm/ihr selbst über ein digitales Programm dokumentiert werden kann oder auch Schübe im Rahmen eines Tagebuches, dann unterstützt dies auch bei Visiten das Arztgespräch. Noch besser natürlich, wenn der Arzt ebenfalls (nach Zustimmung des/der Patient*in natürlich) direkt Zugriff zu diesen Informationen in Echtzeit hätte. Und da geht die Reise hin. Welche krankheitsbedingten Veränderungen bei MS-Patienten können bereits gut und effizient mit Hilfe von digitalen Biomarker erfasst werden? Die Bekanntesten hier sind wohl das MRT sowie die Untersuchung des Augenhintergrundes mittels der optischen Kohärenztomographie. Da ist dann aber noch lange nicht Schluss. Patienten an unserem Zentrum kennen hier zusätzlich die Ganganalyse, die bei uns mithilfe digitaler Technologie (z.B. ein mit Drucksensoren ausgestatteter Teppich), Opal-Sensoren, die am Körper befestigt werden und die Rotation des Körpers während verschiedener Aufgaben dokumentieren, digitale Fragebögen (Selbsteinschätzung der Mobilität) und vieles mehr. Zusätzlich gibt es bereits die Möglichkeit, Funktionstest tablet-basiert durchzuführen, ohne dass Patienten hier durch medizinisches Personal unterstützt werden müssen. Diese Funktionstests fokussieren sich hierbei auf die am häufigsten betroffenen Beeinträchtigungen im Rahmen der MS: das Gehen, das Kontrastsehen, die Kognition (also Konzentration und Verarbeitungsgeschwindigkeit) sowie die Funktion der oberen Extremitäten. Studien haben hier belegt, dass diese den papierbasierten Funktionstests in nichts nachstehen. Bisher waren solche digitalen Funktionstestungen häufig nur im Rahmen von Studien einsetzbar, aber die Überprüfung des Nutzens in der klinischen Routine nimmt gerade sehr an Fahrt auf. Apps, die Funktionstests von zuhause aus ermöglichen gibt es bereits. Im Bereich der Alzheimer-Erkrankung werden Sprach- bzw. Sprech-Aufgaben mit Erfolg eingesetzt, um Hinweise auf depressive Verstimmungen, kognitive Beeinträchtigungen und Fatigue zu erhalten. Bei MS muss dies noch überprüft werden. Da startet im April bei uns ein Projekt dazu. Wie man erkennen kann, ist die Erfassung dieser digitalen Biomarker nicht überall verfügbar. Das wird sich in Zukunft hoffentlich ändern. Welche Rolle spielen Apps, Smartphones und Fitnesstracker beim Erfassen der Daten und wie viel wird beim Arzt gemessen? Diese Tools bieten die Möglichkeit der Erfassung digitaler Biomarker! Ein Smartphone hat doch jeder. Tablets sind mittlerweile auch so erschwinglich, dass man die sich in die Praxis oder Klinik legen kann, um Testungen oder digitale Fragebögen darauf durchzuführen. Fitness-Tracker sind eher nicht so ganz verbreitet, könnten aber bei bestimmten Patienten zur Verfügung gestellt werden, was derzeit nur im Rahmen von Studien der Fall ist. Aber in diesen digitalen Werkzeugen liegt die Zukunft. Was derzeit mit Hilfe von Apps, Smartphones und Tablets gemacht werden kann bewegt sich zum Großteil auch im Bereich der Forschung. Beispiel der Einsatz von digitalen Funktionstests (Kontrastsehen, Stäbchen-Steck-Test, 7,61-Meter-Gehtest, Verarbeitungsgeschwindigkeit), wobei hier gerade auch ein Zulassungsverfahren für eine DiGA (digitale Gesundheitsanwendung auf Rezept) läuft, die Funktionstest beinhaltet, Tagebuchfunktion und noch mehr. Auch werden immer mehr Apps, sogenannte DiGAs zur Unterstützung bei bestimmten Symptomen, wie Fatigue (basierend auf etablierten psychotherapeutischen Ansätzen und Verfahren insbesondere der kognitiven Verhaltenstherapie) und demnächst auch zur Unterstützung bei depressiven Verstimmungen. Da ist viel in der Entwicklung. Auch bei uns im Zentrum ist da einiges im Gange, wie die Testung einer App für das Selbstmonitoring (auch über digitale Funktionstests), Sprachanalyse, unsere multimodale Ganganalyse und vieles mehr, an dem geforscht und entwickelt wird. Wie kompliziert ist die Auswertung der erfassten Daten? Das ist ein wichtiges Thema. Durch die digitale Erfassung und des immer umfangreicher werden Spektrums, was alles erfasst werden kann, nimmt natürlich die Datenmenge extrem zu. Die Verwendung digitaler Biomarker stellt andere Anforderungen an die Datenanalyse als die herkömmliche Verarbeitung von Daten im klinischen Alltag und sogar als die aufwändigere Verarbeitung in klinischen Studien. Um den prädiktiven Zweck eines Biomarkers zu erfüllen, ist die Datenübertragung und Datenanalyse in Echtzeit das Ziel. Dies erfordert eine Unabhängigkeit von Ort und Situation der Datenerhebung, d. h. eine Datenverarbeitung, die in der klinischen Praxis stattfinden kann, aber nicht auf die Räumlichkeiten des Neurologen beschränkt ist, und die Besuche, die in größeren Abständen stattfinden. Dazu müssen Daten aus unterschiedlichsten Quellen über standardisierte, sichere Schnittstellen digital aggregiert werden – eine Aufgabe, die weit über die Möglichkeiten einzelner Apps hinausgeht. Die allgemeine Anforderung an (automatisierte) Informationsverarbeitungssysteme besteht auch darin, dass sie zuverlässig nützliche Informationen (echte medizinische Bedürfnisse) von Rauschen unterscheiden können, z. B. durch Anwendung festgelegter Grenzwerte. Auch ist es wichtig zu überlegen, welche Daten denn Sinn machen und überhaupt wichtig sind für die Therapie und Verlaufskontrolle. Wo liegen aktuell die größten Hürden, um digitale Biomarker breitflächig einzusetzen? Grundsätzlich einmal in der Validierung der digitalen Biomarker, das heißt, messen diese auch, was man messen möchte und sind diese Messwerte auch repräsentativ und aussagekräftig? Die Privatsphäre (vor allem z.B. bei passiver Dokumentation über GPS des Smartphones) und Datenschutz sind hier besonders wichtig. Wo werden die Daten gespeichert und wer ist dafür (auch hinsichtlich des Datenschutzes) verantwortlich? Über die Datenauswertung hatten wir ja bereits gesprochen. Und hinsichtlich der Adhärenz, das heißt, der Nutzung dieser Technologie, Tests und Apps, muss der Patient ebenfalls mitarbeiten. Detailfragen digitale Biomarker Wie gut können Sehstörungen mit digitalen Biomarkern gemessen werden und welche Arten gibt es? Das Sehvermögen ist eines der am stärksten betroffenen Funktionssysteme bei Patient*innen mit MS und äußert sich häufig in Form einer Sehnervenentzündung. Die klinischen Anzeichen können von Veränderungen des Farbsehens, verminderter Sehschärfe bis hin zum vollständigen Verlust des Sehvermögens reichen. Das am häufigsten eingesetzte digitale Untersuchungsverfahren ist das OCT, die optische Kohärenz-Tomographie. Mit OCT können die Dicke der peripapillären Netzhautnervenschicht (pRNFL) und das Makulavolumen (Makula = Bereich des scharfen Sehens) gemessen werden, um nach Netzhautatrophie zu suchen. Es wurden im Bereich der Forschung Modelle entwickelt, um die Assoziation von OCT-basierten Metriken mit dem Grad der Behinderung zu bestimmen. Diese umfassten kontinuierliche Variablen wie die pRNFL-Dicke und das Makulavolumen, um die Wirkung (Zunahme oder Abnahme) auf das Risiko einer Verschlechterung der Behinderung zu quantifizieren. Die Ergebnisse legen nahe, dass die regelmäßige Überwachung der peripapillären retinalen Nervenfaserschicht ein nützlicher digitaler Biomarker zur Überwachung der Verschlechterung der Behinderung bei MS sein könnte, zumal er mit klinischen und paraklinischen Parametern des Sehvermögens, der Behinderung und der MRT korreliert. Ein weiterer digitaler Biomarker, der zur Überwachung von Sehbehinderungen verwendet werden kann, ist das Kontrastsehen. Die Prüfung der Sehschärfe bei niedrigen Kontrastverhältnissen ist von Bedeutung, da bei Menschen mit Behinderung die Schwelle, bei der ein Buchstabe noch vom Hintergrund unterschieden werden kann, deutlich höher ist als bei gesunden Personen. Digital wird diese Untersuchung derzeit allerdings nur im Rahmen der Forschung durchgeführt. Ein Bereich der noch erforscht wird, sind die okulomotorischen Störungen, die ebenfalls auftreten können, also Störungen der Augenbewegung. Die am häufigsten beobachteten Augenbewegungsstörungen sind zum Beispiel überschießende oder zu kurz erfolgende schnelle, ruckartige Augenbewegungen beim Wechsel eines Fixpunktes), gestörte horizontale Augenbeweglichkeit, und Nystagmus (unwillkürliche Augenbewegung).] Welche Sprachstörungen können MS-Patienten bekommen und wie können digitale Biomarker diese testen? Sprach- und Sprechprobleme kommen bei 40-50 % aller MS-Patienten vor. Dazu zählt vor allem die Dysarthrie, das heißt eine neurologisch bedingte Sprechstörung, die durch eine Schädigung des zentralen oder des peripheren Nervensystems verursacht wird. Dabei kann die Lautbildung bzw. Artikulation gestört sein, aber auch die Atemkapazität, die Sprechmelodie (also eher ein monotones Sprechen), dass vermehrt Pausen gemacht werden oder die Stimme sehr angespannt ist. Und das kann man sich für die Untersuchung mittels digitalen Biomarkern auch zunutze machen. Da diese Beeinträchtigungen auch nur ganz leicht auftreten können, ist es für das menschliche Ohr (also den Untersucher) manchmal schwierig zu erkennen. Nutzt man Applikationen (Apps), anhand derer Patienten Sprach-Aufgaben durchführen und diese gespeichert und analysiert wird, hat man zum einen eine objektive Erkennung von Veränderungen, die aber auch standardisiert ist. Das heißt, bei Verlaufskontrollen wird sich immer auf das gleiche „Normal“ bezogen. Menschliche Unterschiede bei Beurteilungen und der Wahrnehmung (2 Untersucher können zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen) fallen also weg. Das Gleiche gilt für alle digitalen Biomarker. Sie sind standardisiert. Ein Problem könnten allerdings verschiedene Akzente oder Dialekte darstellen. Auch das Alter, die Komplexität der durchzuführenden Sprachaufgaben und die individuellen kognitiven Fähigkeiten müssen berücksichtigt werden. Der Vorteil von digitalen Sprachanalysen ist, dass diese auch zum Beispiel während der Visite, bei Telefonaten oder Videosprechstunden mit durchgeführt werden können, also passiv. Warum sind Untersuchungen von Sprache/des Sprechens wichtig? Neben der frühzeitigen Erfassung von Beeinträchtigungen darf man nicht vergessen, dass Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigungen durchaus negative Effekte hinsichtlich Berufstätigkeit und sozialer Einbindung haben, mit daraus resultierenden Einflüssen auf die Lebensqualität! Welche Auswirkungen haben Depression und Fatigue auf die Sprache und andere Symptome der MS und ist es möglich, trotz verschiedener Einflussfaktoren ein klares Bild über den Ist-Zustand eines Patienten zu gewinnen? Die Fatigue kann die Konzentrationsfähigkeit sowie die Sprech-Geschwindigkeit beeinflussen. Depressive Verstimmungen zum Beispiel zu monotoner Stimme, einer leisen Stimme oder zu negativen Einflüssen bei der Sprachanalyse führen, wenn zum Beispiel ein positives Erlebnis der vergangenen zwei Wochen berichtet werden soll, der/die Patient*in aber ein negatives Erlebnis erzählt. Anzeichen von Müdigkeit und Depression sind bereits bei gesunden Personen oder Patienten ohne neurologische Erkrankung nachweisbar. Da Müdigkeit, Depressionen und kognitive Beeinträchtigungen bei MS häufig vorkommen, könnten sie durch Sprachanalysen erfasst werden. Testbatterien können so konzipiert werden, dass sie exekutive Funktionen und Verarbeitungsgeschwindigkeit (z. B. phonematische und semantische Wortflüssigkeit), Gedächtnis (z. B. Wechsler Memory Scale und California Verbal Learning Test), Affekt und Müdigkeit (z. B. Storytelling), Sprache (Bildbeschreibung) und motorische Funktionen (Pa-ta-ka-Aufgabe) erfassen. Bislang ist die Durchführung solcher Sprach- und Sprachtests auf Studien beschränkt (bei uns am MS Zentrum Dresden wie gesagt ab April), doch kann man sich vorstellen, dass sie in Zukunft bei klinischen Besuchen von Menschen mit Behinderung oder sogar zu Hause durch den Einsatz spezieller Apps oder Aufzeichnungen bei telemedizinischen Besuchen eingesetzt werden können. Wie vielfältig sind die Ursachen für einen schlechten Gang und wie viele Tests werden benötigt, um sich ein umfassendes Bild zu machen? Beeinträchtigungen des Gehens sind mit ca. 85 % die häufigsten Symptome bei MS. Mehrere Faktoren tragen dabei zur Gangstörung bei Patient*innen mit MS bei. Sensorische Veränderungen und das daraus resultierende Ungleichgewicht, die Schwäche der unteren Extremitäten oder das Vorliegen einer Spastik sowie Kleinhirn-Ataxien haben hier wohl die größten Auswirkungen. Der in der Routine am häufigsten durchgeführte Test ist der 7,61-Meter-Gehtest. Wie der Name schon verrät, geht der/die Patient*in hier lediglich 7,61 Meter so schnell und sicher wie möglich, ohne zu rennen. Eine Schwester/Pfleger misst die dafür notwendige Zeit. Das Problem mit diesem Test ist aber, dass hier Auffälligkeiten bei Patient*innen beobachtet werden, bei denen augenscheinlich Beeinträchtigungen vorliegen. Was man nicht damit erfasst, sind Gehbeeinträchtigungen, die erst nach mehreren Minuten oder einigen zurückgelegten Metern auftreten. Auch Faktoren wie die Schrittlänge, Spurbreiten, wie fußt der Patient*in, muss mit dem Körper ausbalanciert werden, wie verändert sich das Gehen, wenn noch eine zweite Aufgabe hinzukommt, werden nicht erfasst. Diese Informationen sind aber essentiell und müssen dokumentiert und im Zeitverlauf verfolgt werden. Es ist also komplexer. Wir haben daher bei uns im Zentrum die multimodale Ganganalyse, die meine geschätzte Kollegin Frau Katrin Trentzsch etabliert hat. Hier werden neben dem 7,61-Meter-Gehtest auch ein 2-Minuten-Gehtest, die Erfassung des Ganges über das GaitRITE (ein Teppich, der über Sensoren Auskunft über die Schrittlänge, Spurbreite, Geschwindigkeit des Ganges gibt) mit und ohne Dual-Task (also eine zweite Aufgabe, die während des Gehens absolviert werden muss, um so mögliche Veränderung im Gangbild hervorzurufen) sowie den Romberg Stehtest und beobachten zusätzlich bei all diesen Tests die Rotationsbewegung des Körpers mittels am Körper befestigter Opalsensoren. Hinzu kommen Fragebögen, um subjektive Angaben über die Mobilität zu erhalten. Die Kraftmessplatte kam neu dazu, die bereits frühe Veränderungen detektieren kann. Aber das ist nur ein Teil, was das Mobilitätszentrum von Frau Trentzsch macht und machen kann. Aber es ist das, was wir jedem/r Patient*in bei uns im MS-Zentrum mindestens 1x pro Jahr anbieten. Was man nicht vergessen darf: Grundsätzlich ist es wichtig, Beeinträchtigungen des Gehens im Speziellen und der Mobilität im Allgemeinen in der täglichen Routine der Patienten zu betrachten. Das ist leider derzeit nicht vollumfänglich möglich. Die Technologie gibt es schon, aber eben allenfalls im Rahmen von Studien, noch nicht für die Routine. Fitness-Tracker oder Smartphones bieten hier gute Einsatzmöglichkeiten. Das Problem ist aber noch für die Routine-Nutzung: wo die Daten speichern, so dass Arzt und Patient diese nutzen können. Datenschutz? Wie werden aktuell die Einschränkungen durch MS auf Arme und Hände gemessen und was ist hier zukünftig realistisch? Derzeit ist der hauptsächlich verwendete Test der sogenannte 9-Hole-Peg-Test oder Stäbchen-steck-Test. Hierbei sollen jeweils mit einer Hand 9 Stäbchen in vorgebohrte Löcher auf eine Platte nacheinander eingesetzt und wieder entfernt werden. Dabei wird von einer Schwester oder Pfleger die Zeit erfasst, die dazu benötigt wird. Diese Zeit wird in Bezug gesetzt zu einer Kontroll-Kohorte (Menschen ohne Einschränkung). Wenn dieser Test regelmäßig gemacht wird, können Veränderungen sehr gut erkannt werden. Natürlich gibt es Schwankungen. Aber wenn beispielsweise eine Verschlechterung um 20 % über mindestens 3 Monate bestehen bleibt, ist dies klinisch signifikant. Diesen Test gibt es auch in etwas abgewandelter Form digital. Dazu müssen Tomaten oder Ballons zerquetscht werden, die auf dem Smartphone-Display an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlicher Größe erscheinen. Studien belegten bereits eine Korrelation dieses digitalen Tests mit der „herkömmlichen“ Version. Was hier aber noch weitere Vorteile bringt, ist, dass neben der Standardisierung und der Vermeidung, dass das Personal mal zu früh oder zu spät die Stopp-Uhr betätigt, zum Beispiel auch die Möglichkeit der Erfassung des Druckes, den die Finger auf dem Display ausüben. Oder die Zielgenauigkeit. Das sind alles Daten, die kann man mit dem herkömmlichen Test nicht erfassen. Diese sind aber wichtig! Und, nicht zu vergessen, diese Tests können zuhause durchgeführt werden, auch und vor allem dann, wenn Patienten Verschlechterungen bemerken und messen wollen. Auf welche Art können kognitive Probleme festgestellt werden? Kognitive Probleme beeinträchtigen häufig das Arbeitsgedächtnis, die Wortflüssigkeit, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, das verbale und visuelle Gedächtnis sowie die exekutiven Funktionen und – nach neuen Erkenntnissen – der Bereich der „Theory of Mind“ (die Fähigkeit, auf der Grundlage nonverbaler und verbalen Hinweisen auf die Emotionen anderer Menschen zu schließen). Das wären dann auch die Ansatzpunkte für mögliche Testungen. Der bisher eingesetzte Test ist der SDMT, bei dem Zahlen zu Symbolen innerhalb von 90 Sekunden zugeordnet werden müssen. Dieser Test adressiert das Arbeitsgedächtnis. Das Problem bei diesem Test ist, dass eigentlich auch die schulische Ausbildung mit zur Beurteilung des Ergebnisses herangezogen werden müsste, da das gleiche Ergebnis bei einem eine Auffälligkeit ist, während sie bei dem anderen völlig normal ist. Hinzu kommt natürlich, dass dieser Test auch beeinflusst werden kann durch andere Beeinträchtigungen, wie das Sehen oder der oberen Extremitäten. Trotzdem bleibt dieser Test auch bei der Digitalisierung der Test der Wahl und ist bereits auch als solcher verfügbar. Er ist schnell durchführbar und wenn regelmäßig absolviert, ermöglicht er im Monitoring doch das Erkennen von Veränderungen. Für den klinischen Einsatz wurde eine Reihe von vereinfachten Tests für die Kognition bei MS entwickelt, darunter Testbatterien wie der BICAMS (Brief Repeatable International Cognitive Assessment for MS), die Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests und der Minimal Bewertung der kognitiven Funktion bei MS. Deren Einsatz scheitert aber an zeitlichen und personellen Engpässen (abgesehen von der Umsetzung in eine digitale Form). Aber sollte in dem Symbol-Zahlen-Test eine klinisch relevante Verschlechterung auftreten, kann eine eingehendere neuropsychologische Testung dann angeordnet werden. Zusammenfassung Biomarker Welche Entwicklungen im Bereich der digitalen Biomarker wünschst Du Dir in den kommenden 5 Jahren? Im Bereich der MS würde ich mir die Weiterentwicklung digitale Biomarker wünschen, die bereits frühe Progressionen erkennen können. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, dass alle Patienten die Möglichkeit erhalten, von digitalen Biomarkern zu profitieren und nicht nur in ausgewählten Zentren oder im Rahmen von Studien. Wie können Patienten dabei helfen, dass digitale Biomarker schneller Verbreitung finden, um möglichst bald von den gewonnenen Ergebnissen zu profitieren? Es werden derzeit sehr viele Apps oder digitale Testmöglichkeiten sowie DiGAs (digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept) entwickelt. Aber häufig ist es ja so, dass der Entwickler seine Vorstellung hat, der Arzt ebenfalls, aber der „End-Nutzer“, also der Patient, diese aus den unterschiedlichsten Gründen nicht nutzt. Um dies zu vermeiden geht man dazu über, diese Innovationen durch Patienten testen zu lassen, zumindest ist es unsere Empfehlung dies zu tun. Das bieten wir auch Unternehmen mit guten Ideen im Bereich der MS an, diese durch Patienten unseres Zentrums beurteilen zu lassen. Patienten sind da sehr ehrlich und auch wahnsinnig kreativ, was Verbesserungen angeht! Da bin ich immer wieder erstaunt. Wenn aber dann solche digitalen Möglichkeiten, die auch eine qualitativ gute Datenerfassung und Bereitstellung an den Arzt ermöglichen, existieren und funktionieren, müssen sie von Patienten konsequent genutzt werden und nicht nur zu Beginn, wenn die Begeisterung groß ist. Adhärenz ist da ein großes Problem. Wir schauen auch im Rahmen eines anderen Projektes an unserem Zentrum derzeit, wie die Adhärenz bei einer App ist, die Funktionstests zuhause ermöglicht und was die Ursachen mangelnder Adhärenz sind. Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Blitzlicht-Runde Vervollständige den Satz: „Für mich ist die Multiple Sklerose... “ … der Antrieb, möglichst hochwertige und patientenorientierte Versorgung anzubieten und weiterzuentwickeln. Wie lautet Dein aktuelles Lebensmotto? Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Sowie: Bitte mehr Life in der Work-Life-Balance. Das Leben kann sich so schnell ändern, man hat es eben nicht in der Hand… Mit welcher Person würdest Du gern ein Kamingespräch führen und zu welchem Thema? Wenn es um Prominente geht: Martin Luther King jr.; wobei es mir schwer fällt, mich auf eine Person festzulegen. Es gab und gibt viele interessante Menschen, mit denen ein Kamingespräch bestimmt nicht langweilig werden würde. Ansonsten: meine Oma, die gestorben ist, als ich noch zu unreif war, ihr zuzuhören. Welches Buch oder Hörbuch, das Du kürzlich gelesen hast, kannst Du empfehlen und worum geht es darin? Als Hörbuch kann ich „Die Purpurnen Flüsse“ (Jean-Christophe Grange) empfehlen! Sehr gut! Höre ich immer wieder.
Studie: Wenn Uhren schneller laufen, arbeiten wir aufmerksamer
Ein Forschungsteam aus Dortmund zeigt in einer Studie: Zeitdruck verbessert offenbar unser Arbeitsgedächtnis und wir sind motivierter. Während Proband*innen Aufgaben lösten, ließ das Team die Uhren mal schneller und mal langsamer laufen.
Auf geht's - der Reha-Blog! 096 Verlangsamung nach SHT bremst aus
Manchmal kommen nicht so positive Ergebnisse aus neuropsychologischen Testungen heraus. Gerade dann, wenn viele neuropsychologische „Funktionen“ gutgehen, treten andere notwendige Ressourcen in den Hintergrund. Aktuell kann ein Klient zwar auf viele Exekutivfunktionen, wie zum Beispiel Handlungsplanung, Entscheiden, einkalkulieren, Arbeitsgedächtnis, zielgerichtetes Beginnen, Planungsfähigkeit, Koordinieren, um nur einige zu nennen, zurückgreifen. Allerdings ist sie so dermaßen verlangsamt, dass die Informationsverarbeitung verzögert ist. Dies bedeutet für das Unfallopfer, dass eine Mobilität im Sinne einer Fahrtüchtigkeit nicht vorhanden ist. Sowohl für das Führen eines PKW als auch zum Beispiel für einen Elektrorollstuhl oder Handbike. Hier muss mit Intensivtherapie geholfen werden, um eine Teilhabe am Arbeitsleben und Leben in der Gemeinschaft sicherzustellen. Problematisch wird es dann, wenn zwar das direkte Umfeld, nicht aber der Betroffene selbst diese Einschränkung wahrhaben will. Zeit also, das Reha-Management zum Ruhen zu bringen. Warum? Wenn Teilhabeziele nicht erreichbar sind (hier Mobilität gleich Erreichen des Arbeitsplatzes), kann nicht einfach so weiter gemacht werden, als wäre nichts passiert.
Intelligenztraining: Das N-Back-Arbeitsgedächtnistraining
WENN KINDER NICHT HÖREN - Der Podcast zum Buch für Eltern und Lehrer
Während es in früheren Zeiten tatsächlich die Muskeln waren, die Ruhe benötigten, ist es heute das Arbeitsgedächtnis, das braucht, was in Gebot steht: Du sollst den Sonntag so achten, dass er dich heil macht.
Podcast Medizin & Gesundheit: Wenn unser Gehirn nicht richtig funktioniert
Manchmal hat unser Arbeitsgedächtnis Aussetzer - also der Teil des Gehirns, in dem die alltäglichen Dinge ablaufen. Aber es lässt sich reaktivieren, zumindest zeitweise.
#01 Hirnstimulation - Kann man das Arbeitsgedächtnis reaktivieren?
Im Alter lässt das Gedächtnis nach - das ist normal. Wissenschaftler haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, das Arbeitsgedächtnis wieder auf Trab zu bringen: Per Magnetwellen stimulieren sie das Gehirn! Immerhin 50 Minuten hält der Effekt an.
Hirnstimulation, Hecken in der Landwirtschaft, Flugzeug im Röntgenscanner, Stonehenge
Hirnstimulation - Kann man das Arbeitsgedächtnis reaktivieren? / Hecken in der Landwirtschaft - Nutzen für Artenvielfalt und Ertrag / Flugzeug im Röntgenscanner - Historischer Raketenjäger wird durchleuchtet / Kultstätte Stonehenge - Pilger nahmen lange Wege auf sich.
Wer gut schläft kann auch gut denken!
„Konzentriert geht’s wie geschmiert“ - Der Podcast für Mutter, Vater und Kind mit Gerda Arldt
Mehrere Studien mit Kindern beweisen, dass ausreichend Schlaf sich auch in den Leistungen der Kinder bemerkbar macht. Kinder die ausgeschlafen sind, schneiden beim Hörverständnis und beim Mathematikverständnis besser ab als Kinder die nicht optimal schlafen. Schlafmangel beeinträchtigt auf jeden Fall die Konzentration, das Arbeitsgedächtnis, das logische Denken die Stimmungslage sowie auch die motorischen Fähigkeiten. Wenn wir schlafen verarbeitet das Gehirn, das was wir erlebt haben und die Nervenzellen verknüpfen sich und finden synaptische Verbindungen. Dadurch können wir uns an Gelerntes wieder erinnern. Ist der Schlaf zu kurz, unterbrochen oder auch nicht tief genug, können sich die Nervenzellen nicht verknüpfen und das Gelernte ist nur teilweise oder lückenhaft im Gedächtnis. Gerne unterstütze ich dich auch in diesem Fall. Ich gebe dir gerne Hilfestellung. Komm auch in meine kostenlose Facebookgruppe „Konzentriert geht’s wie geschmiert!“ Dort sehen wir uns dann auch mal live! Weitere Informationen über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website: www.gerda-arldt.de Weitere Fragen dazu kannst du in einem kostenlosen Beratungsgespräch in meiner Praxis Klären, oder du kannst mir eine E-Mail mit deiner Frage schicken. arldt@insel-welt.de Zum Thema gibt es auch laufend Seminare oder Infoabende in meiner Praxis in 76275 Ettlingen, Seminarstr. 14. www.gerda-arldt.de Wenn du meinen Podcast sinnvoll und gut findest, dann freue ich mich über deine Bewertung. Gehe dazu auf die Lupe der Podcast-App, klicke auf Bewertung und auf Rezension. Damit hilfst du, dass dieser Podcast auch von anderen Menschen gefunden wird. Vielen Dank für deine Unterstützung Gerda Arldt
13. November 2017, die 317. Folge. Gedanken zum "Machen" - ein weiterer Begriff für das Experimentelle, intervenierende, Gegenwart schaffende und beobachtende Denken, das mich die letzten Tage und Wochen beschäftigt. Nachträge zu einem Kommentar von Günter zum Arbeitsgedächtnis, Fragen zu Rainald Goetz (und an Hanna Engelmeier) und vor allem Überlegungen im Anschluss an den Text von Elias Kreuzmair "Machen". Quelle: Kreuzmair, Elias. “Machen.” In Bologna-Bestiarium, edited by Unbedingte Universitäten, 1. Aufl., 235–42. Unbedingte Universitäten. Zürich: Diaphanes, 2013. Tweet von Hanna: https://twitter.com/HannaEngelmeier/status/928942407294636032
GF-0004 | Vom Nobelpreis fürs Schlafen und Erinnern trotz Lücke
I. BEGRÜSSUNG | ZU DIESER EPISODE: Schlafen & Erinnern Hallo da Draussen an den digitalen Weltempfängern! Wir begrüßen Euch zu unserer vierten GEHIRNfutter Podcast Folge. Wir, dass sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitgründer des NEURONprocessing Institutes für Gehirn- und Zukunftsforschung. In unserer vierten Folge geht es um den Nobelpreis fürs Schlafen und Erinnern trotz Lücke. Das klingt jetzt trivial - ist es aber nicht - im Gegenteil ... es wird spannend ... inklusive Einführung in die Morphische Feldtheorie. Wir verstehen uns mit unserem GEHIRNfutter Podcast als ein Reisebegleiter an die Grenzen unseres Bewusstseins und unserer Wahrnehmung – basierend auf moderner Gehirnforschung. Worum es in dieser Erkenntnisreise geht, lässt sich in unserem GEHIRNfutter Podcast Trailer nachlesen und nachhören. Dort befindet sich auch unser aktueller Sendeplan. II. NEWS Und wir beginnen natürlich wieder mit den News der Woche. Sprich, was unsere persönlichen Highlights waren. 1. Uwe´s Highlight der Woche: Der Nobelpreis für Medizin geht an die Erforscher der biologischen Uhr. "Warum schlafen wir und wann sind wir wach? Für ihre Forschung zum inneren Rhythmus von Lebewesen werden drei US-amerikanische Wissenschaftler geehrt." Weitere Informationen unter: http://www.zeit.de/wissen/2017-10/nobelpreis-fuer-medizin-geht-an-erforscher-der-biologischen-uhr Des weiteren Einführung in die (Morphische) Feldtheorie und mögliche Feldfunktion für Zeitempfinden. Im Podcast zu hören » 2. Thomas Highlight der Woche: Erinnerung: Mut zur Lücke ... Neue Forschung stellt die Idee in Frage, dass das Arbeitsgedächtnis uns durch anhaltende Hirnaktivität hilft, sich an Dinge zu erinnern. Stattdessen haben Forscher der Universität von Wisconsin-Madison herausgefunden, dass unsere Gehirne unwichtigere Informationen außer Reichweite der Verfahren "vorhalten", die normalerweise für die Messungen unserer Gehirnaktivität genutzt werden. Die Forscher konnten diese Informationen dann mit Magneten (TMS: Transkranielle Magnetstimulation) wieder in die aktive Aufmerksamkeit bringen. Diese Forschung kann zukünftig ev. Menschen helfen, die an Schizophrenie oder Depressionen leiden, sagt Dr. Brad Postle, Professor für Psychologie an der Universität von Wisconsin-Madison: "Viele psychische Erkrankungen sind mit der Unfähigkeit verbunden, zu entscheiden, worüber nachzudenken ist. Was wir tun, sind die ersten Schritte in Richtung auf die Mechanismen, die uns die Kontrolle darüber geben, woran wir denken." Laut Postle haben die meisten Menschen das Gefühl, sich auf viel mehr konzentrieren zu können, als ihr Arbeitsgedächtnis tatsächlich halten kann. Es ist ein bisschen wie beim Sehen, bei dem es sich so anfühlt, als würden wir alles in unserem Blickfeld sehen, wobei die Details verschwinden, es sei denn, man konzentriert sich regelmäßig auf diese: "Die Vorstellung, dass man sich immer allem bewusst ist, ist eine Art Illusion, die unser Bewusstsein erschafft. Das gilt auch für das Denken. Man hat den Eindruck, dass man an viele Dinge gleichzeitig denkt und diese gleichzeitig in seinem Geist hält." Aber viele Forschungen zeigen uns, dass man - in jedem aktuellen Moment - wirklich nur auf eine sehr kleine Anzahl von Dingen gleichzeitig achten kann." ... Weitere Informationen unter: https://psychcentral.com/news/2016/12/03/magnetic-brain-stimulation-can-activate-stowed-memories/113363.html Im Podcast zu hören » III. TALK Unser Talk in dieser Sendung zu ist zu unseren Highlight der Woche: Wo tickt die Uhr im Gehirn? Was sind Erinnerungen im Gehirn - und deren Lücken bzw. auch Tücken? Im Podcast zu hören » IV. INTERVIEW Wir haben Interviews bis auf weiteres zurückgestellt. Somit geben wir potentiellen Interviewpartnern die Möglichkeit, sich ein umfassenderes Bild von unserem Podcast zu machen. Wir halten dies für einen fairen und sinnvollen Weg. Mehr hier zu in der nächsten Sendung. V.
18. April 2017, die 108. Folge. Heute nur ein paar winzige Notizen zur Erinnerung, an das Thema und die Fragen für das Arbeitsgedächtnis des Podlog. Es geht um "reale Utopien" (von Erik Olin Wright), mit einem kleinen Querverweis auf Geert Lovinks Artikel in der Le Monde diplomatique. Ich notiere nur Fragen. Quellen: Wright, Erik Olin. Reale Utopien: Wege aus dem Kapitalismus. Translated by Max Henninger. Deutsche Erstausgabe. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017. Lovink, Geert. “Techno-Reue in der Hyperrealität.” Le Monde Diplomatique (Deutsch), June 4, 2017. https://monde-diplomatique.de/artikel/!5390843.
#36 Boris Konrad – Der Gedächtnis-Weltmeister über verschiedene Methoden beim Gedächtnistraining, was Gedächtnissport eigentlich ist, wie er mit verlorenen Wetten bei „Wetten, dass…?“ umgeht und den Irrglauben über unser Gehirn
Link zu den Shownotes: http://www.i-unlimited.de/podcast/ep36 Falls du diese Show noch nicht auf iTunes abonniert hast, dann mache das unbedingt - so verpasst du keine Folge: https://itunes.apple.com/de/podcast/die-dominieren-statt-kampfen/id1122015542?mt=2# Es gibt auch einen speziellen Newsletter mit Zusatztipps und -tricks zur Show. Registriere dich kostenlos dafür hier: http://julianhosp.com/dominieren/ Wenn du mir einen Gefallen tun würdest, dann hinterlasse mir bitte ein Review zur Show auf iTunes. Ich brauche diese Reviews damit mehr Leute von der Show hören und das ist schlussendlich ein WIN-WIN-WIN für alle. Das ganze dauert lediglich 1 Minute indem du einfach auf diesen Link hier klickst: http://getpodcast.reviews/id/1122015542 Wenn du Interesse hast voll durchzustarten und eine gute Gruppe dazu suchst, dann sei bei uns in der Mastermind Erfolgsgruppe dabei. Stelle eine Anfrage hier: http://www.JulianHospMastermind.com Brauchst du tägliche Motivation und Inspiration? Dann hol dir meinen motivierenden und inspirierenden täglichen Audio Blog: http://tab.julianhosp.com ------------------------------------------ SHOWNOTES 06:01 Min – Wer ist Boris? 08:18 Min – Auftritte bei „Wetten, dass…?“ und das erste Treffen mit Günther Jauch 18:45 Min – Methoden beim Gedächtnistraining 23:57 Min – Tipps zu Sudoku 27:17 Min – Zauberwürfel-Wette bei „Wetten, dass…?“, Verteidigung der Doktorarbeit und Umzug zugleich 32:03 Min – Resumée aus erfolglosen Auftritten 37:24 Min – Lernen sich Sprachen für Boris leichter? 39:22 Min – Hängt der IQ mit dem Gedächtnis-Vermögen zusammen? 45:40 Min – „Wir vergessen keine Vokabeln, die wir jemals gelernt haben.“ 48:48 Min – Was Gedächtnissport eigentlich ist und welche Methoden es gibt 01:11:11 h – Wie du dein Arbeitsgedächtnis trainierst 01:15:18 h – Gedächtnispaläste löschen – geht das?! 01:17:07 h – Sichere Passwörter erstellen – und merken! 01:23:42 h – Der Beweis, dass Gedächtnissportler ein ganz normales Gehirn haben 01:26:05 h – Die Trends der Zukunft 01:29:56 h – Kurze Fragen mit kurzen oder langen Antworten 01:42:13 h – Wie Boris „grenzenlos erfolgreich sein“ definiert 01:45:20 h – Sein Tipp für sein jüngeres Ich 01:48:04 h – Der Irrglaube über unsere Gehirnhälften MEHR ZUR PERSON: Homepage: http://www.boriskonrad.de/ MEHR ZUM THEMA: Buch "Superhin" (Boris Konrad): http://amzn.to/2jqqZpX Buch "Alles nur in meinem Kopf" (Boris Konrad): http://amzn.to/2jqehY8 Produkte auf seiner Homepage: http://www.boriskonrad.de/produkte/ Seminar-Angebot: http://www.boriskonrad.de/seminare-gedaechtnistraining/ Gedächtnistechniken: http://www.boriskonrad.de/mnemotechnik/ Major-System: http://www.lernen-heute.de/major-system.html Gedächtnis-Palst / Loci-Methode: https://de.wikipedia.org/wiki/Loci-Methode Chinesische Gedächtnis-Show "The Brain": https://en.wikipedia.org/wiki/The_Brain_(game_show) App Memrise: www.memrise.com Memrise-Gründer Ed Cooke: https://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Cooke_(author) TedX Talk: https://www.youtube.com/watch?v=t76N00urDlU Manfred Spitzer: https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Spitzer Antelope Canyon: https://de.wikipedia.org/wiki/Antelope_Canyon
Das ist unser "geistiger Notizblock". Wir können durchschnittlich fünf bis neun Informationen speichern; wenn wir eine fünfstellige Zahl genannt bekommen, können wir uns die für …
Brain Computer Interfaces und belastungsadaptive Informationsumwelten
Prof. Dr. Peter Gerjets über Messungen der Arbeitsgedächtnis-Belastungen und wie diese im Schulkontext eingesetzt werden könnten.
Einfluss genetischer Polymorphismen im GRIA1 Gen auf antizipatorische Sakkaden in der Schizophrenie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Eine Beeinträchtigung kognitiver Parameter lässt sich u.a. durch die Durchführung von Sakkadenaufgaben nachweisen, wo beispielsweise Schizophreniepatienten hier spezifische Defizite zeigen. Die Ausführung von Aufgaben des Antigap Paradigmas erfordert die zeitlich und räumlich korrekte Ausführung von Antisakkaden. Dazu müssen sowohl die reflexgesteuerten Reaktionen inhibiert als auch gleichzeitig eine willentliche Handlung ermöglicht werden. Hier wurden bei Schizophrenie verlängerte Latenzen sowie erhöhte Fehlerraten beschrieben. Mit dem memory- Paradigmus wurden die Fähigkeiten zur Unterdrückung von reflexiven Sakkaden unter overlap- Bedingungen ermittelt, sowie gedächtnisgetriggerte und –gesteuerte memory- Sakkaden aufgezeichnet. Beim Memory Test wurden einerseits die Fähigkeit untersucht, auf einen Punkt zu schauen und sich gleichzeitig die Position eines weiteren zu merken (Ultrakurzzeitgedächtnis). Die Fähigkeit der Perzeption und sensomotorischen Integration (Abgleichen visueller Information mit vorgespeicherten Bildern im Gehirn), die Repräsentation des Gedächtnisstimulus im Arbeitsgedächtnis sowie die Fähigkeit der Regression (rückführende Augenbewegung auf bereits bekannte visuelle Objekte), ermöglichen die Positionserinnerung und Ausführung des Memory Test. Es wird davon ausgegangen, dass das glutamaterge System in die Pathophysiologie der Schizophrenie ursächlich involviert ist. So weisen u.a. post mortem Studien auf eine Beteiligung der AMPA- Rezeptoren als Teil des glutamatergen Systems hin. Das GRIA1 Gen, welches den AMPA1- Rezeptor kodiert, ist zusätzlich in einer mit Schizophrenie gekoppelten Region lokalisiert. Dazu wurden bei 60 Patienten und 108 Kontrollprobanden die Augenbewegungen während der Durchführung des Antigap- und Memory- Tests mit Hilfe einer VOG- Brille aufgezeichnet und ausgewertet und eine Assoziation zur Genotyp- und Allelfrequenz der SNPs rs578772 und rs548294 im GRIA1-Gen überprüft. Die Ergebnisse zeigen für den Polymorphismus rs578772 im Antigap Test eine Reduktion der zeitlichen Flexibilität assoziiert mit den A-Allelträgern bzw. AA-Genotyp sowohl in Form einer verzögerten Reaktion als auch einer erhöhten Fehlerrate durch verfrüht ausgeführte Antisakkaden. Das Gleiche läßt sich auch im Memoryparadigma nachweisen. Für den Polymorphismus rs548294 wurden im Antigap Test sowohl zeitliche als auch räumliche Abweichungen registriert. Eine erhöhte Latenz durch verzögerte Reaktionszeit bei gleichzeitig räumlich nicht korrekt ausgeführter Antisakkade assoziiert mit A-Allelträgern und AA-Genotyp. G-Allelträger fallen weniger durch zeitliche, dafür aber durch räumliche Abweichungen im Antigap Test auf. Beim Memoryparadigma war eine zeitlich inkorrekte Ausführung der Sakkaden mit AG-Allelträgern und Genotyp AG assoziiert. Räumlich und zeitlich inkorrekte Antisakkaden assoziieren mit AA-Allelträgern und AA-Genotyp. Die Studie konnte den Nachweis eines Zusammenhangs des GRIA1 Gens mit den Sakkadenleistungen erbringen. Eine Erweiterung dieser Studie in Hinblick auf eine erhöhte Stichprobenzahl sowie den Einschluss weiterer genetischer Variationen ist im Anschluss an diese Pilotstudie möglich, um die Validität der Ergebnisse zu festigen.
Auswirkungen der Aufgabenschwierigkeit auf altersabhängige Aktivierungsmuster in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Der Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter spielt eine zentrale Rolle für die Gesellschaft der Zukunft und bildet das Hauptaugenmerk dieser Studie. Obwohl einige kognitive Funktionen konstant bleiben (z.B. Wortflüssigkeit) bzw. bis ins hohe Alter kontinuierlich ansteigen (z.B. verbales Wissen), nimmt die Mehrzahl der kognitiven Funktionen im Laufe des Erwachsenenalters ab. Von dieser Tendenz am stärksten betroffen sind die Verarbeitungsgeschwindigkeit und das Arbeitsgedächtnis. Diese Veränderungen werden begleitet von strukturellen Alterungsprozesses der grauen und weißen Hirnsubstanz. Sowohl eine Volumenminderung der grauen Substanz als auch eine verminderte Integrität der Faserverbindungen wird mit verringerten kognitiven Leistungen assoziiert. Studien der funktionellen Bildgebung deuten auf unterschiedliche Aktivierungsmuster bei jüngeren und älteren Probanden hin. Überaktivierung, verminderter Inhibierung und Dedifferenzierung führen bei älteren Probanden zu schlechterer Performanz. Auch eine geringere Effizienz und/ oder Kapazität der neuronalen Netzwerke wird berichtet. Allerdings treten auch kompensatorische zusätzliche (De-)Aktivierungen auf, die zum Erhalt oder zur Steigerung der Leistung beitragen. Der Alterungsprozess zeichnet sich aber auch durch große interindividuelle Unterschiede aus. Zur Beschreibung der Ursachen und Wirkmechanismen werden bio- psycho-soziale Modelle herangezogen, zu denen auch die Theorie der Kognitiven Reserve gezählt wird. Die Theorien der Reserve sind aus der Beobachtung entstanden, dass strukturelle Veränderungen des Gehirns, die durch Krankheiten, Verletzungen aber auch durch normale Alterungsprozesse bedingt sind, nicht bei allen Personen zwangsläufig zu Einbußen in der Kognition führen müssen. Die Modelle der Kognitiven Reserve führen aus, dass diese über das Leben hinweg erworben wird und bei Bedarf aktiviert werden kann. Als Operationalisierungen der Kognitiven Reserve wurden meist die Stellvertretervariablen hohe Bildung, hohe prämorbide Intelligenz, Herausforderungen im Beruf und bei Freizeitaktivitäten und gute Einbindung in soziale Netzwerke herangezogen. Einen Teilbereich der Kognitiven Reserve stellt die Neuronale Reserve dar, welche in der effizienteren oder flexibleren Nutzung neuronaler Netzwerke besteht. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Leistung in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe und ihrer funktionellen Aktivierungsmuster und dem Konstrukt der Kognitiven Reserve bei Berücksichtigung des Alters. Hierzu wurden 104 ältere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 60 und 75 Jahren (M = 68,24 Jahre) und 40 jüngere gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren (M = 21,15 Jahre) untersucht. Die Studie beinhaltete eine umfassende neuropsychologische Testung am ersten Tag, in der Teilbereiche der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der exekutiven Funktionen erfasst wurden. Zudem wurde die Kognitive Reserve durch eine wiederholte Durchführung des Zahlen-Symbol-Tests und die Ermittlung der Zugewinne (Testing-the-limits-Verfahren) erhoben. Diese dynamische Testungsmethode weicht von den vielfach verwendeten Methoden der Stellvertretervariablen bewusst ab, da das so erhobene Maß der Definition der Kognitiven Reserve als Leistungspotential besser gerecht wird. Am zweiten Tag folgte die Durchführung einer Arbeitsgedächtnisaufgabe (n-back-Aufgabe) mit drei (bei den jüngeren Probanden vier) unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen während mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztherapie die Aktivierungsmuster des Gehirns aufgezeichnet wurden. Ergänzend wurden strukturelle MRT-Aufnahmen erhoben, welche zur Eruierung der Integrität der weißen Hirnsubstanz herangezogen wurden. Wie erwartet nahmen mit höherer Aufgabenschwierigkeit die Genauigkeit in der Arbeitsgedächtnisaufgabe ab und die Reaktionszeiten zu. Im Vergleich zu jüngeren Probanden reagierten ältere Probanden signifikant langsamer, wiesen mehr Fehler auf und wurden stärker von der Aufgabenschwierigkeit beeinflusst. Überraschend war die Tatsache, dass die Bearbeitung der Aufgabe bei Älteren und Jüngeren mit sehr unterschiedlichen kognitiven Funktionen zusammen hing: Alleine die Verarbeitungsgeschwindigkeit nahm in beide Gruppen eine zentrale Rolle ein. Mit steigender Aufgabenschwierigkeit zeigte sich bei beiden Gruppen eine steigende (De-) Aktivierung in den relevanten Bereichen, jedoch wurde bei älteren Probanden vor allem eine schwächere Deaktivierung des Ruhenetzwerks um den Precuneus beobachtet. Zusätzlich wurden Regionen identifiziert, in denen ein Zusammenhang zwischen der (De-)Aktivierung und dem Leistungsabfall zur Bedingung mit der höchsten Aufgabenschwierigkeit bestand. Während bei den Älteren eine geringere frontale Deaktivierung und höhere Deaktivierung im Precuneus mit einem Leistungserhalt einherging, bewirkte bei den Jüngeren eine höhere frontale Deaktivierung den Leistungserhalt. Die Kognitive Reserve wies in beiden Gruppen jeweils nur einen Zusammenhang mit der Leistung der schwierigsten Aufgabenbedingung auf, was einen Nachweis der externen Validität der verwendeten Operationalisierung, als Leistungspotential, welches bei Bedarf herangezogen werden kann, darstellt. Eine höhere Aktivierung im mittleren und inferioren frontalen Cortex korrelierte positiv mit der Kognitiven Reserve und war leistungsförderlich. Es zeigte sich eine Mediation des Zusammenhangs zwischen der Aktivierung und der Leistung durch die Kognitive Reserve. Dies deutet auf die Vermittlerrolle hin, welche durch die Reserve eingenommen wird. Einen Moderationseffekt der Kognitiven Reserve auf den Zusammenhang der strukturellen Integrität der weißen Substanz des gesamten Gehirns und der Leistung in der Arbeitsgedächtnisaufgabe konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse legen zusammengenommen nahe, dass den älteren Probanden hauptsächlich durch gescheiterte Deaktivierung Leistungseinbußen entstanden, dass sie aber in der Lage waren, kompensatorisch weitere Regionen zur Bearbeitung der Aufgabe hinzuzuziehen. Die Kognitive Reserve bildet das Bindeglied zwischen Aktivierung und Leistung und sollte somit in mögliche Modelle mit aufgenommen werden. Insgesamt liefern die Ergebnisse dieser Arbeit einen Beitrag zur Grundlagenforschung im Bereich des kognitiven Alterns und der Kognitiven Reserve. Besonders der Zusammenhang der Kognitiven Reserve mit den fordernden Bedingungen und die Mediation des Zusammenhang zwischen Aktivierung und Leistung zeigen, dass die hier gewählte Operationalisierung ein valides Testinstrument für zukünftige Studien darstellt.
Kognitive Basisfunktionen
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Die Relevanz der kognitiven Basisfunktionen Arbeitsgedächtnis und der Fähigkeit zum Shifting sowie der fluiden Intelligenz für viele kognitive Leistungen wurde wiederholt gezeigt. Insbesondere das Arbeitsgedächtnis ist wichtig für das Lernen und sollte bei Entscheidungen hinsichtlich instruktionaler Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden. In der ersten Studie der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob der Effekt einer Lernumgebung mit hohem Grad an instruktionaler Unterstützung durch Lösungsbeispiele verglichen mit einer Lernumgebung mit niedrigem Grad an instruktionaler Unterstützung (Problemlösen) auf den Wissenserwerb von der Arbeitsgedächtniskapazität, der Shifting-Fähigkeit sowie der fluiden Intelligenz moderiert wird. In den beiden Lernumgebungen lernten 76 Studierende aus den Fachrichtungen Pädagogik, Psychologie und Schulpsychologie mit Problemen aus der Domäne Statistik. Die Ergebnisse zeigten, dass die Fähigkeit zum Shifting und die fluide Intelligenz, nicht aber die Arbeitsgedächtniskapazität einen moderierenden Einfluss auf den Erwerb anwendungsorientierten Wissens haben. Die kognitive Belastung war nicht mit der Arbeitsgedächtniskapazität, aber der fluiden Intelligenz, konzeptuellem und anwendungsorientiertem Vorwissen sowie Skalen eines Fragebogens zur Erfassung aktueller Motivation korreliert. Den Ergebnissen der ersten Studie zu Folge könnten die Fähigkeit zum Shifting und die fluide Intelligenz für die Bestimmung des optimalen Grads an instruktionaler Unterstützung wichtig sein. Vor dem Hintergrund der Bedeutung kognitiver Basisfunktionen und einer Vielzahl neuerer Studien zu Arbeitsgedächtnistrainings wurde in der zweiten Studie dieser Arbeit eine Metaanalyse zu Arbeitsgedächtnistrainings durchgeführt. In dieser Metaanalyse wurden mehrere, bisher nicht beachtete Trainingsbedingungen als potentielle Moderatoren berücksichtigt. Es wurden 47 Studien mit 65 Gruppenvergleichen analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass Arbeitsgedächtnistrainings nahe Transfereffekte auf Kurzzeit- und Arbeitsgedächtniskomponenten erzielen, die zum Follow-up erhalten bleiben. Weite Transfereffekte auf andere kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (nonverbale und verbale Fähigkeit, Fertigkeit zur Wortdekodierung, mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten) waren klein, auf die nonverbale und verbale Fähigkeit beschränkt und blieben nicht zum Follow-up erhalten. Unter den Moderatoren hatten der Interventionstyp, die Trainingsdosis, die Sessiondauer, die Supervision während des Trainings und der Trainingsort einen Einfluss auf nahe und weite Transfereffekte. Den Ergebnissen der zweiten Studie zufolge können Arbeitsgedächtnistrainings robuste, nahe Transfereffekte auf andere Aufgaben erzielen, die Kurzzeit- und Arbeitsgedächtniskomponenten erfassen. Die Bedingungen für Transfereffekte, insbesondere weite Transfereffekte, sind noch schlecht verstanden. Arbeitsgedächtnistrainings mit optimierten Trainingsbedingungen könnten jedoch zu praktisch relevanten Transfereffekten führen.
In Utrecht wurde eine drahtlose Neuroprothese entwickelt, die demnächst an Menschen mit Locked-In-Syndrom ausprobiert werden soll. Martin war an Bau und Studiendesign beteiligt und erzählt ein wenig von diesem Gerät und von Roboterarmen (Video), die mittels Stecker im Kopf (Video) angesteuert werden. Wir reden über Schmetterling und Taucherglocke, Epilepsie, Ouija-Boards, den Motorcortex, das Arbeitsgedächtnis, das Jennifer-Anniston-Neuron, das EEG, […]
In Utrecht wurde eine drahtlose Neuroprothese entwickelt, die demnächst an Menschen mit Locked-In-Syndrom ausprobiert werden soll. Martin war an Bau und Studiendesign beteiligt und erzählt ein wenig von diesem Gerät und von Roboterarmen (Video), die mittels Stecker im Kopf (Video) angesteuert werden. Wir reden über Schmetterling und Taucherglocke, Epilepsie, Ouija-Boards, den Motorcortex, das Arbeitsgedächtnis, das Jennifer-Anniston-Neuron, das EEG, […]
In Utrecht wurde eine drahtlose Neuroprothese entwickelt, die demnächst an Menschen mit Locked-In-Syndrom ausprobiert werden soll. Martin war an Bau und Studiendesign beteiligt und erzählt ein wenig von diesem Gerät und von Roboterarmen (Video), die mittels Stecker im Kopf (Video) angesteuert werden. Wir reden über Schmetterling und Taucherglocke, Epilepsie, Ouija-Boards, den Motorcortex, das Arbeitsgedächtnis, das Jennifer-Anniston-Neuron, das EEG, […]
Phänotypische Charakterisierung eines transgenen Mausmodells der Alzheimer-Krankheit unter Bezug auf Alter und Geschlecht
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz mit einer stetig steigenden Zahl Betroffener. Trotz intensiver Forschung sind die genauen Ursachen noch immer weitgehend ungeklärt, mit der Folge, dass bislang keine kausale Therapie zur Verfügung steht. Als einer der vermuteten Risikofaktoren gilt das Geschlecht – Frauen erkranken häufiger und mit insgesamt schwererem Verlauf an Alzheimer als Männer. Ziel der vorliegenden Studie ist es, das transgene Mausmodell Tg2576, das ein humanes Amyloid-Vorläuferprotein mit der schwedischen Doppelmutation überexprimiert, phänotypisch umfassend zu charakterisieren und auf geschlechtsspezifische Differenzen hin zu untersuchen. Dabei werden jeweils sechs männliche und sechs weibliche Träger des Transgens (Carrier) im Alter von 6, 8, 10, 12, 14 und 16 Monaten mit ihren gesunden Wurfgeschwistern (Wildtypen) verglichen. Die Tiere werden im modifizierten Hole-Board-Test über acht Tage auf kognitive, verhaltensbedingte und motorische Parameter untersucht. Ab einem Alter von 8 bis 10 Monaten weisen die Carrier im Gegensatz zu den Wildtypen progressive, signifikante Beeinträchtigungen des deklarativen Gedächtnisses und des Arbeitsgedächtnisses auf. Damit einhergehend können eine verstärkte Anwendung nicht-räumlicher Suchstrategien sowie disinhibitorische Verhaltenstendenzen beobachtet werden. Im Geschlechtervergleich sind die kognitiven Defizite der weiblichen Carrier signifikant stärker ausgeprägt. Weiterhin zeigen sich ab einem Alter von 10 Monaten geschlechtsunabhängige, progressiv fortschreitende feinmotorische Störungen beim Fressen der Belohnungsmandeln. Die Mortalität der männlichen Carrier (48,4 %) ist signifikant höher im Vergleich zu den weiblichen Carriern (25,4 %) (p = 0,005). Die weibliche Tiere weisen ein signifikant niedrigeres Gewicht als die männliche Tiere auf (p < 0,001), wobei die Carrier signifikant weniger wiegen als die Wildtypen (p < 0,001). Laboranalysen zeigen im Geschlechtervergleich einen höheren Testosterongehalt im Blutserum der männlichen Tiere und einen höheren Östradiolgehalt bei den weiblichen Tieren. Bei der Untersuchung auf mögliche zugrundeliegende Störungen der Neurotransmission können keine mit zunehmendem Alter progressiven Veränderungen der Expression spezifischer Rezeptoren (NMDAR-NR2B, mGluR5 und PBR) im Western-Blot gezeigt werden. Insgesamt erweist sich das Tg2576-Modell als ein vielversprechendes Modell der Alzheimer-Krankheit für die weitere Grundlagenforschung und präklinische Testung therapeutischer Strategien. Dabei ist es insbesondere auch für weiterführende geschlechtsspezifische Forschungsansätze geeignet.
Mehr als 85% aller Granularzellen im menschlichen Kleinhirn entstehen postnatal - ohne Unterschied zwischen plötzlichem Kindstod und Kontrollfällen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Ziel der Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit war die Überprüfung der Hypothese, dass sich beim plötzlichen Kindstod („sudden infant death syndrome“; SIDS) im Vergleich zu alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen (d.h. bei Kindern, die innerhalb des ersten Lebensjahres nicht an SIDS verstorben waren), im Kleinhirn veränderte Gesamtzahlen von Purkinjezellen und Granularzellen finden. Hintergrund dieser Hypothese waren (i) Spekulationen in der Literatur über eine mögliche Rolle des Kleinhirns in der Pathogenese von SIDS sowie (ii) wiederholte Berichte in der neuropathologischen Literatur über mögliche Veränderungen der oben genannten Parameter bei SIDS. Diese neuropathologischen Berichte widersprechen sich jedoch gegenseitig teilweise erheblich, d.h. manche dieser Studien berichteten Veränderungen der oben genannten Parameter bei SIDS, andere Studien hingegen nicht. Wichtig ist dabei, dass keine dieser Untersuchungen in der Literatur mit „design-based“ stereologischen Methoden (d.h. dem „state of the art“ der quantitativen Histologie) durchgeführt wurde. Dementsprechend muss unklar bleiben, ob (und wenn ja, in welchem Ausmaß) die beschriebenen Widersprüche in der neuropathologischen Literatur zur Beteiligung des Kleinhirns an der Pathogenese von SIDS auf die verwendeten Methoden zurückzuführen sind. Dies machte eine Neuauswertung der genannten Parameter im Kleinhirn bei SIDS mit design-based stereologischen Methoden notwendig. Darüber hinaus wurde in einer Nebenuntersuchung der Frage nachgegangen, ob im menschlichen Kleinhirn von den Purkinjezellen im ersten Lebensjahr Sonic hedgehog exprimiert wird, dem bei Labortieren (Maus, Ratte, Huhn) bei der Entstehung der inneren Granularzellschicht im Kleinhirn eine zentrale Steuerfunktion zukommt. Die Beantwortung dieser Frage bezog sich auf einen Bericht in der jüngeren Literatur, nach dem dies bei der Entwicklung des menschlichen Kleinhirns anders sein sollte. Für die Hauptuntersuchung wurden insgesamt n=23 Kleinhirnhälften (je eine Kleinhirnhälfte pro Fall) von Kindern untersucht, die im ersten Lebensjahr verstorben waren. Von diesen n=23 Kleinhirnhälften stammten n=9 von SIDS-Fällen (im Alter zwischen zwei und zehn Monaten verstorben), n=9 von alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen, sowie n=5 weitere von Kontrollen, die entweder in einem früheren oder einem späteren Alter als die SIDS-Fälle gestorben waren (sowie ein Kind, das im Alter von 8 Monaten gestorben war). Die Nebenuntersuchung erfolgte an insgesamt n=6 Kleinhirnhälften (davon n=4 SIDS-Fälle und n=2 Kontrollen, die im Alter zwischen einem und zehn Monaten gestorben waren). Alle Kleinhirnhälften stammten aus einer Sammlung des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München und wurden dort in den Jahren 1999 bis 2001 durch Herrn Univ.Prof. Dr.med. Andreas Büttner (heute: Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Rostock) im Rahmen von Autopsien gesammelt. Die Verwendung dieser Kleinhirnhälften für die vorliegende Arbeit wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock unter der Nummer A2012-0053 genehmigt. Bei der Hauptuntersuchung wurden für jede Kleinhirnhälfte an mit Nissl gefärbten 100 µm dicken parasagittalen Serienschnitten die folgenden Parameter mittels „high-precision design-based stereology“ bestimmt: (i) Volumen der Molekularschicht; (ii) Volumen der inneren Granularzellschicht (einschliesslich der Purkinjezellschicht); (iii) Volumen der weißen Substanz; (iv) Gesamtzahl von Purkinjezellen; (v) Gesamtzahl von Granularzellen (in der inneren Granularzellschicht); und (vi) Anzahl von Granularzellen pro Purkinjezelle. Die Bestimmung der Volumina erfolgte mit dem sogenannten Cavalieri-Prinzip, und die Bestimmung der Gesamtzahlen von Purkinjezellen und Granularzellen mit dem sogenannten „optical fractionator“. Bei der Nebenuntersuchung erfolgte ein immunhistochemischer Nachweis von Sonic hedgehog und Calbindin in den Purkinjezellen. Keiner der beschriebenen Parameter zeigte in der Hauptuntersuchung einen statistisch signifikanten (p
(43) Intelligenztraining: Das N-Back-Arbeitsgedächtnistraining
Entwicklung und Diagnostik von Arbeitsgedächtnis und Inhibition
Fakultät für Psychologie und Pädagogik - Digitale Hochschulschriften der LMU
Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten stellt sowohl historisch als auch aktuell eines der breitesten und lebendigsten psychologischen Forschungsfelder dar. Besonders bezüglich der (Alters-) Differenzierungshypothese, welche die Ausdifferenzierung kognitiver Fähigkeiten mit fortschreitendem Alter postuliert, weisen die durchgeführten Studien jedoch eine beachtliche Heterogenität in ihren Befunden auf. Die Diagnostik kognitiver Fähigkeiten hängt untrennbar mit den vorausgesetzten Modellen und eingesetzten diagnostischen Verfahren zusammen, welche den Befunden hinsichtlich ihrer Heterogenität in nichts nachstehen. Die gegenwärtige Arbeit zeigt, dass im Grundschulalter bei der Entwicklung von Inhibitionsfähigkeit, Arbeitsgedächtniskapazität und Reasoningfähigkeit keine Ausdifferenzierung im Sinne sinkender Korrelationen zu beobachten ist (Studie I). Eine Analyse möglicher Prädiktoren der Mathematiknote zeigt zudem, dass in der zweiten Klasse Arbeitsgedächtniskapazität die beste Vorhersage liefert, während Reasoningfähigkeit in der dritten und vierten Klasse den einzig relevanten Prädiktor darstellt. Diese Ergebnisse sind konform mit den Schwerpunkten des Mathematikunterrichts in den jeweiligen Klassenstufen. In einer anschließenden Studie (Studie II) zur Diagnostik der Arbeitsgedächtniskapazität mittels der Zahlenspanne Rückwärts wird gezeigt, dass sowohl visuelle als auch verbale kognitive Strategien zur Bearbeitung der Aufgabe eingesetzt werden können, welche sich nicht durch die Präsentationsmodalität der Aufgabe beeinflussen lassen müssen. Dieser Befund liefert wichtige Implikationen zur Einordnung verschiedener widersprüchlicher Ergebnisse in der Arbeitsgedächtnisdiagnostik und der klinischen Diagnostik. In einer Studie (Studie III) zur Diagnostik der Inhibitionsfähigkeit werden die beim klassischen Stroop Test involvierten kognitiven Subprozesse untersucht und durch Einsatz eines räumlichen Stroop Paradigmas die verbale Komponente des Stroop Phänomens isoliert. Zudem wird gezeigt, dass Interferenz zwar durch positionsinkongruente Richtungswörter konstruiert werden kann, die Position-Wort-Interferenz jedoch schwächer als die klassische Farbe-Wort-Interferenz ausfällt. Zusammengenommen zeigt die Serie der drei Studien, dass wissenschaftliche Ergebnisse zur Diagnostik kognitiver Fähigkeiten einen Großteil ihrer Aussagekraft einbüßen, wenn die involvierten kognitiven Teilprozesse nicht berücksichtigt werden.
(39) Intelligenztraining - Arbeitsgedächtnistraining für Kinder mit ADS
Braincast 241 – Kognitive Filter
Unser kognitiver Radius ist begrenzt und gefiltert. Das schlägt sich nieder in Wahrnehmung und Arbeitsgedächtnis und auch wenn sie Ehen gefährdet, ist diese gefilterte Realität doch mehr feature als bug. Alles andere wäre ein buffer overflow.
Kortikale Veränderungen des Arbeitsgedächtnisses bei Patienten mit leichter kognitiver Störung im Vergleich zu gesunden Probanden in der funktionellen Magnetresonanztomographie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Thu, 3 Mar 2011 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/12804/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/12804/2/Eser_Simone.pdf Eser, Simone
Interaktion von Emotion und Kognition als Grundlage für die Verhaltensregulation bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Zu den Kernsymptomen der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zählen die Störung der Impulskontrolle und die emotionale Dysregulation, die für die sozialen und zwischenmenschlichen Konflikte sowie für das bei Patienten mit einer Borderline- Persönlichkeitsstörung (BPS-Patienten) fast immer vorhandene selbstverletzende Verhalten ursächlich verantwortlich gemacht werden. Ziel des Promotionsvorhabens war es, die Inhibitions- und Regulationsfähigkeit für Reize unterschiedlicher Valenzen und unterschiedlicher Arousalausprägungen als Grundlage der Verhaltensregulation bei BPS-Patienten mittels experimenteller Paradigmen (mit Papier und Bleistift-Methode oder am Computer) und funktioneller Kernspintomographie (f-MRT) zu untersuchen. Aufgrund der heterogenen Befundlage sollte zudem ein Beitrag zur Erstellung des neuropsychologischen Leistungsprofils bei der BPS geleistet werden. Somit stellt die vorliegende Arbeit eine umfangreiche Untersuchung von klinischen, kognitiven und neurofunktionellen Leistungen bei einer einzigen klinischen Stichprobe und einer vergleichbaren Stichprobe von gesunden Probanden dar. Nachdem das Untersuchungsmaterial (Bildersammlung) für die experimentelle Kernspinuntersuchung nach eigens für die Studie festgelegten Kriterien entwickelt und zusammengestellt und anhand einer gesunden Stichprobe bewertet wurde, konnte die klinische, neuropsychologische, experimentelle und neurofunktionelle Untersuchung der BPS-Patienten und einer gesunden Vergleichsgruppe durchgeführt werden. Die Inhibitions- und Regulationsfähigkeit für neutrale und emotionale Reize wurden mittels unterschiedlicher Inhibitionsarten (willentliche kognitive Inhibition, automatische kognitive Inhibition und affektive Interferenzkontrolle) und verschiedener emotionaler Regulationsmechanismen („Top-down-“ und „Bottom-up-Regulation“) geprüft. Im Theorieteil wird ein Überblick über das Störungsbild der BPS sowie über neuropsychologische und neurofunktionelle Befunde bei der BPS gegeben. Des Weiteren werden die für diese Arbeit relevanten Aspekte der Impulsivität und Inhibition sowie der Emotion und Emotionsregulation behandelt. Im Methodenteil Teil A wird die methodische Vorgehensweise bei der Erstellung der neuen Bilderbatterie ausführlich erläutert. Im Methodenteil Teil B werden alle eingesetzten standardisierten bzw. etablierten Instrumente sowie die experimentellen Paradigmen und das fMRT-Paradigma beschrieben. Erhoben wurden klinische Daten aus den Selbstauskunftsfragebögen, kognitive Leistungsparameter, Verhaltensdaten aus den experimentellen Paradigmen sowie aus dem fMRT-Paradigma und neurofunktionelle Daten mittels funktioneller Kernspintomographie. Die Ergebnisse werden zunächst pro Bereich und abschließend integrativ diskutiert. Die neuropsychologischen Ergebnisse suggerieren, dass die Leistungsunterschiede zwischen BPS-Patienten und gesunden Probanden sowohl im verbalen als auch im non-verbalen Gedächtnis auf Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses und der Planungsfähigkeit für komplexe Informationen zurückzuführen sind. Insgesamt lassen sich die bei den BPS-Patienten beobachteten Einbußen einem rechtshemisphärischen fronto-temporalen Netzwerk zuordnen. Die bereits von mehreren Autoren postulierte rechtshemisphärische fronto-temporale Beeinträchtigung wurde ebenfalls im Rahmen der Emotionsregulationaufgabe beobachtet, da die BPS-Patienten bevorzugt eine linkshemiphärische Beteiligung im Vergleich zu den gesunden Probanden zeigen. Zur kognitiven Inhibitionsfähigkeit ergaben sich lediglich für die intentionale kognitive Inhibition (geprüft anhand des Emotionalen Directed Forgettings) eindeutige Ergebnisse, die die Vermutung einer erhöhten Interferenzanfälligkeit für negativ geladene Reize bei der BPS bestätigen. Sowohl aus der Prüfung der intentionalen kognitiven Inhibition als auch aus den klinischen Daten geht hervor, dass bei den BPS-Patienten die bevorzugte Vearbeitung aversiver Reize mit einer defizitären Verarbeitung appetitiver Reize bzw. das Zurückgreifen auf stressinduzierende Strategien mit einem Defizit an stressreduzierenden Strategien einhergeht. Obwohl die Hypothese, dass BPS-Patienten negativ geladene Reize im Arousal stärker bewerten als Gesunde, nicht bestätigt werden konnte, fanden wir eine stärkere Beteiligung der Amygdala sowohl für stark erregende aversive als auch bereits bei leicht erregend aversiven Reizen. Die ausgebliebene höhere Arousalbewertung trotz vorliegender limbischer Hyperreagibilität geht mit ähnlichen Befunden aus der Literatur einher (Herpertz et al., 1999; 2001) und bekräftigt die Vermutung einer Dissoziation der Reaktionsebenen als Charakteristikum der BPS (Renneberg, 2003). Im Vergleich zu den gesunden Kontrollprobanden fiel die Arousalreduktion bei den BPS-Patienten lediglich in der willentlichen Emotionsregulation durch Distanzierung signifikant geringer aus. Für die automatische Regulation durch Ablenkung zeigten sich weder bei den BPS-Patienten noch bei den Gesunden Veränderungen in der subjektiven Wahrnehmung des Arousals. Das neuronale Aktivierungsprofil unterschied sich zwischen den Gruppen sowohl in der Distanzierungs- als auch in der Ablenkungsbedingung. Mögliche Ursachen hierfür werden diskutiert. Auch in der Gedächtnisleistung zeigten sich unterschiedliche Leistungsprofile zwischen der Distanzierung- und Ablenkungsbedingung, die mit den Ergebnissen aus der Arousalbewertung und der neuronalen Aktivierung gut vereinbar sind. Die BPS-Patienten zeigten im Vergleich zu den Gesunden in der Ablenkungsbedingung mehr Fehler für aversive Bilder. In der Distanzierungsbedingung, und teilweise in der Ablenkungsbedingung, zeigten die BPS-Patienten eine Beeinträchtigung im Erinnern positiver Wörter. In der Distanzierungsbedingung ging diese Beeinträchtigung mit einer besseren Erinnerungsleistung von stark erregenden aversiven Bildern einher. All diese Ergebnisse können mit der Psychopathologie der BPS in Zusammenhang gebracht werden: Die erhöhte Interferenz für aversive Reize führt zusammen mit einer geringeren Verarbeitungsfähigkeit von appetitiven Reizen zu einem physiologischen Hyperarousal, das auf Verhaltensebene aufgrund mangelnder subjektiver Wahrnehmung und fehlenden adäquaten Strategien nicht unterdrückt werden kann und durch das Zurückgreifen von inadäquaten Strategien weiter verstärkt wird. Das Hyperarousal kommt vor allem in interpersonellen bzw. sozialen Interaktionen zum Tragen, da sie komplexe Anforderungen an das Individuum stellen und eine ständige Analyse und Interpretation der verbalen und non-verbalen Informationen sowie eine nahezu ständige on-line Regulation der parallel ablaufenden emotionalen Prozesse erfordern. Da die BPS-Patienten eine Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses und der Fähigkeit komplexe Informationen zu strukturieren aufweisen, ist es ihnen jedoch kaum möglich diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der aversive Spannungszustand wirkt nach dem Modell von Herpertz und Saß (1997) als modulierender Faktor auf den impulsiven Antrieb und/oder auf die Impulskontrolle und führt somit zu einer erhöhten Impulsivität, die dazu beiträgt, dass die fehlerhafte kognitive Analyse verstärkt wird. Dadurch kommt es zu einem Hochschaukeln von aversiver Spannung und fehlerhafter kognitiver Informationsverarbeitung und endet schließlich in inadäquaten, selbstschädigenden Reaktionen sowie interpersonnellen Konflikten. Zum Abschluss wird die Arbeit kritisch gewürdigt und ein Blick auf die aus den diskutierten Ergebnissen sich ergebenden weiterführenden Untersuchungen geworfen.
Der "Turm von Hanoi" und "Turm von London" auf dem Tablet PC
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Der Turm von Hanoi (TvH) und der Turm von London (TvL) sind Transformationsaufgaben zur Untersuchung des Problemlöse- und Planungsverhaltens, die in der neuropsychologischen Diagnostik und in den Neurowissenschaften eingesetzt werden. Die Durchsicht der Literatur zeigt allerdings, dass es bis jetzt für beide Turmaufgaben weder eine einheitliche Struktur, noch ein standardisiertes Auswertungssystem in Klinik und Forschung gibt. Daher existiert eine große Bandbreite bezüglich Aufgabenauswahl, unterschiedlichen Variablen und Testdurchführung (Instruktion, Holz- oder Computerversion). Dies könnte an der fehlenden Information über die Strukturen des TvL und TvH und an den zu messenden kognitiven Funktionen liegen. Diese Uneinheitlichkeit macht es schwer bis unmöglich, einzelne Studien und Ergebnisse miteinander zu vergleichen und Schlussfolgerungen zu ziehen. In dieser Arbeit sollen die kognitiven Anforderungen an den TvL und den TvH untersucht werden. Wir haben in der Arbeitsgruppe Kognitive Neurologie der Neurologischen Universitätsklinik München zusammen mit dem Mathematischen Institut der LMU München eine Computerversion beider Aufgaben auf dem Tablet-PC entwickelt, mit denen es möglich ist, jeden einzelnen Schritt mit dem „Hanoi“-Graphen und dem „London“-Graphen zu dokumentieren. Zusätzlich werden die benötigte Zeit, die gemachten Züge, die Anzahl der Fehler, die genauen Positionen der Fehler und die gegangenen Pfade aufgezeichnet. Ziel dieser Arbeit war es, mögliche Alterseffekte in Bezug auf das Problemlöseverhalten sowie Parameter zu bestimmen, die die Aufgabenschwierigkeit ausmachen. Mit Hilfe der Graphen wurde der Einsatz von Strategien untersucht. Ferner sollten Zusammenhänge mit anderen Tests zur Untersuchung der Exekutivfunktionen sowie zwischen dem TvH und dem TvL untersucht werden. Zur genaueren Bestimmung beteiligter neuroanatomischer Strukturen wurde das Problemlöseverhalten von Patienten mit umschriebenen Hirnläsionen analysiert. Dazu wurden 70 gesunde Probanden im Alter von 20-70 Jahren und 22 Patienten mit umschriebenen Hirnläsionen untersucht. Die Probanden und Patienten führten jeweils 20 TvH- und TvL-Aufgaben durch. Die ersten 12 TvL-Aufgaben waren die Originalaufgaben aus der Studie von Shallice (1982) mit 2 bis 5 Zügen und wurden um je 4 Aufgaben mit 6 und 7 Zügen erweitert. Die TvH-Aufgaben waren in den Start- und Zielpositionen sowie in der Anzahl der Züge ähnlich. Als Kontrollvariablen wurden das verbale und visuelle Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis (Zahlen- und Blockspannen), die Wort- und Zeichenflüssigkeit, die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und Flexibilität (Trail Making Test A und B) sowie das Intelligenzniveau (MWT-B, Matrizentest aus dem WIE) untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass es Alterseffekte in Bezug auf das Problemlöseverhalten gibt. Ältere gesunde Probanden waren insgesamt langsamer und hatten weniger optimal gelöste Aufgaben. Die Analyse der Graphen ergab, dass die meisten Probanden beim Lösen von TvH- und TvL-Aufgaben bestimmte Strategien einsetzen. Beim TvH wurde die verfeinerte perzeptuelle Strategie (VPS) und beim TvL vermutlich die „obstacle-removal subgoal“ Strategie eingesetzt. Parameter, die die Aufgabenschwierigkeit ausmachen, sind neben der Zugzahl hauptsächlich die Anfangs- und Endkonfigurationen sowie die Anzahl der kürzesten Lösungswege. Dabei sind Aufgaben mit einer flachen Zielkonfiguration schwieriger zu lösen als Aufgaben mit einer partiellen Turm-Zielkonfiguration sowie Turm-Zielkonfiguration. Letztere erscheinen am leichtesten. Der Vergleich des TvH mit dem TvL ergab, dass gesunde Probanden zur Lösung des TvL zwar mehr Zeit benötigten, aber der Unterschied zwischen jüngeren und älteren gesunden Probanden sowie zwischen Gesunden und Patienten beim TvH größer war als beim TvL. Ältere und Patienten brauchten für den TvH mehr Zeit und Züge. Korrelationsanalysen ergaben, dass beim Lösen des TvH und TvL abstraktes Denkvermögen (Matrizentest) sowie kognitive Flexibilität (Zeichenflüssigkeit, TMT B) beteiligt sind. Die Läsionsanalysen weisen darauf hin, dass linkshemisphärische Läsionen zur Verlangsamung und rechtshemisphärische eher zu Schwierigkeiten beim Einhalten von Regeln führen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Turm von Hanoi und London auf dem Tablet PC eine bessere Alternative zu bisherigen Versionen ist sowie eine gezieltere Auswahl der Aufgaben, aber auch eine differenziertere Analyse des Problemlöseverhaltens von gesunden Kontrollpersonen und Patienten mit umschriebenen Läsionen ermöglicht.
Arbeitsgedächtnisprozesse schizophrener Patienten vor und nach psychopharmakologischer Therapie mit Quetiapin
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Thu, 23 Jul 2009 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10447/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10447/1/Zipse_Maria.pdf Zipse, Maria
Einfluss repetetiver transkranieller Magnetstimulation (rTMS) und Theta Burst Stimulation (TBS)auf ereigniskorrelierte Potenziale (EKP) in GoNogo-Aufgaben am präfrontalen Kortex
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Die präfrontale repetitive transkranielle Magnestimulation (rTMS) wird seit den 90er Jahren angewendet, um einerseits die Bedeutung des präfrontalen Kortex für verschiedene kognitive und affektive Prozesse zu erforschen und andererseits die Pathophysiologie psychiatrischer Erkrankungen zu untersuchen und therapeutisch zu modulieren. Von neuen Stimulationsprotokollen, wie der Theta Burst Stimulation (TBS), die analog zum Tiermodell zur Induktion von Langzeitpotenzierung beim Menschen entwickelt wurde, werden stärkere und länger anhaltende therapeutische Effekte erhofft. Im Gegensatz zur Stimulation des Motorkortex wurde die präfrontale rTMS bislang kaum neurophysiologisch untersucht. In dieser Arbeit werden daher zwei Experimente beschrieben, in denen eine niederfrequente 1 Hz-rTMS und TBS bezüglich ihrer Effekte auf ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) in GoNogo-Aufgaben charakterisiert wurden. Sie verfolgten die Fragestellungen, ob EKP analog zu motorisch evozierten Potenzialen (MEP) geeignet sind die Wirkungsweise einer präfrontalen rTMS einzuschätzen und ob sich die TBS qualitativ oder quantitativ von herkömmlichen rTMS-Protokollen unterscheidet (Experiment 1 und 3). In einem Vorexperiment zu Experiment 3 (Experiment 2) wurde erstmals die Sicherheit verschiedener präfrontaler TBS-Formen mittels EEG und kognitiver Tests untersucht. In Experiment 1 wurden 18 gesunde Probanden mit einer als inhibitorisch geltenden 1 Hz rTMS über dem linken dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC), dem medialen präfrontalen Kortex (mPFC) und einer Kontrollregion stimuliert. Bei der nachfolgenden Bearbeitung einer GoNogo-Aufgabe, zeigte sich eine Vergrößerung der P3-Amplitude nach Stimulation des mPFC bei zeitgleich größerer parietaler Aktivität. Hypothesenkonform konnte eine Reduktion der N2-Amplitude bei Stimulation des linken DLPFC gefunden werden. Während der rTMS-Effekt auf die P3-Amplitude am besten durch die Initiierung von Aufmerksamkeitsprozessen erklärt werden kann, spricht der Einfluss der 1 Hz-rTMS über dem linken DLPFC für einen inhibitorischen Effekt auf kortikaler Ebene (Experiment 1). Im Hinblick auf die vorbeschriebenen nachhaltigeren Effekte von TBS-Protokollen am Motorkortex wurde in Experiment 2 die TBS am präfrontalen Kortex bei 24 gesunden Probanden plazebo-kontrolliert bezüglich ihrer Sicherheit untersucht, um diese als innovative Stimulationsform für weitere Experimente einsetzbar zu machen. Die Ergebnisse dieses Experimentes zeigten, dass eine präfrontale, als inhibitorisch geltende TBS (continuous TBS - cTBS) und eine als exzitatorisch geltende TBS (intermittent TBS - iTBS) keine epilepsietypischen Potenziale im EEG oder epileptische Anfälle triggerten. Es kamen jedoch bei drei von 25 Probanden vagale Reaktionen vor, deren Auftreten beachtet und deren Ursache in weiteren Studien erforscht werden sollte. In den neuropsychologischen Untersuchungen wurde eine verminderte Leistung im Arbeitsgedächtnis und in einer frontalen Testbatterie (Trend) nach iTBS des linken DLPFC und in der Anzahl der ‚false alarms’ einer GoNogo-Aufgabe nach cTBS des mPFC festgestellt. Diese Veränderungen spiegelten sich auch in neurophysiologischen Parametern wider. Eine Analyse der EEG-Daten mittels standardized low resolution brain electromagnetic tomography (sLORETA) ergab eine Zunahme der Aktivität im Alpha 2-Band links präfrontal nach iTBS des linken DLPFC, die bis zu einer Stunde nachweisbar blieb und einen Zusammenhang mit den Leistungen im Arbeitsgedächtnis und der frontalen Testbatterie zeigte. In Experiment 3 wurden dann 1 Hz rTMS, cTBS und eine Plazebostimulation bei 9 gesunden Probanden miteinander verglichen. Alle Stimulationen erfolgten neuronavigiert bezogen auf eine Aktivierung im individuellen funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) Bild, die während der Entscheidungskomponente (Volition) einer modifizierten GoNogo-Aufgabe gefunden wurde. Hierbei konnte die in Experiment 1 beobachtete inhibitorische Wirkung der 1 Hz rTMS auf eine relevante EKP-Komponente (N2P2-peak-to-peak-Amplitude) analog repliziert werden (Trend). Bei einer zeitlichen Betrachtung der Stromdichten mittels sLORETA ließ sich deskriptiv eine Verminderung nach 1 Hz rTMS beobachten, während sich der Verlauf der Stromdichten in der cTBS-Bedingung abhängig vom Aktivierungszustand des Kortex zu ändern schien. In einer für ‚conflict monitoring’ relevanten region of interest (ROI) konnte in dem für die N2P2-Amplitude relevanten Zeitfenster eine Verminderung (Trend) der Stromdichte in der 1 Hz-Bedingung gefunden werden, die mit der N2P2-Amplitude korrelierte. Desweiteren waren in Experiment 1 und 3 keine Effekte auf Verhaltensdaten und EKP-Latenzen nachweisbar. Die Ergebnisse dieser Arbeit sprechen dafür, dass die gemeinsame Betrachtung von Verhaltensdaten, EKP- und Stromdichteanalysen eine neurophysiologische Interpretation der rTMS erlaubt. Die alleinige Verwendung von EKP zur Beurteilung der Wirkungsweise einer präfrontalen rTMS hingegen ist methodisch und inhaltlich begrenzt. Am präfrontalen Kortex zeigten cTBS und iTBS andere Effekte als für den Motorkortex vorbeschrieben. Insgesamt betrachtet sprechen die Ergebnisse dafür, dass sich die TBS nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ von einer 1 Hz rTMS unterscheidet. Nach diesen Pilotexperimenten stellt die Untersuchung rTMS-vermittelter Effekte auf präfrontal generierte EKP einen vielversprechenden Untersuchungsansatz dar, um die Bedeutung präfrontaler Regionen als Generatoren spezifischer EKP-Komponenten zu erforschen, die Wirkung verschiedener rTMS Protokolle neurophysiologisch zu untersuchen und diese Protokolle für experimentelle oder therapeutische Anwendungen weiter zu entwickeln. So könnte die Wirkung spezifischer TBS-Protokolle durch eine pathologisch veränderte Grundaktivität bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen im Gegensatz zu gesunden Probanden verändert sein. Dies könnte in einem nächsten Schritt mit dem oben beschriebenen Untersuchungsansatz näher erforscht werden.
Braincast 155 - Bewusstsein gleich Arbeitsgedächtnis?
Das Bewusstsein ist eines der großen Fragezeichen im Hirn. Das Arbeitsgedächtnis nicht – hier wissen wir relativ viel. Nun vermuten einige Forscher, die beiden seien weitgehend identisch. Entstehende Antworten und Fragen beleuchtet Braincast 155.
Braincast 113 - Testosteron
Testosteron - das bedeutet schnelle Autos, schnelle Musik, schnelle Frauen und immer mal wieder eins auf die Nase. Es definiert männliches Verhalten, auch bei Frauen. Und es bedeutet ein besseres Arbeitsgedächtnis und womöglich einen Schutz vor Alzheimer.
Die Imitatation von bedeutungslosen Armgesten nach unilateraler Hirnschädigung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Die fehlerhafte Imitation von Gesten ist ein wichtiges Merkmal von Apraxie. In der Studie wurde die Imitation bedeutungsloser Armgesten untersucht. Dabei wurden räumliche und zeitliche Bewegungsaspekte betrachtet und ihre Zusammenhänge zu Apraxie-Kriterien. Es wurden 11 Patienten mit Schädigungen der sprach-dominanten linken Hemisphäre und mit unterschiedlich schwerer Apraxie untersucht; des weiteren 10 Patienten mit rechtshemisphärischen Schädigungen und insgesamt 20 gesunde Kontrollpersonen. Die Probanden sollten Armgesten imitieren. Zur Standardisierung der Präsentation wurden den Probanden Videoclips der Gestendemonstration gezeigt, bei dem der Untersucher in Originalgröße wiederholt Figuren vor seinem Körper "in die Luft zeichnete". Die Bewegungen sollten jeweils nach Beendigung der Vorführung einer Figur mit der nicht-paretischen Hand imitiert werden. Die Bewegungen wurden mit einem Bewegungsmesssystem registriert und analysiert. Da die Demonstration ebenso registriert wurde, konnten die resultierenden Bewegungsparameter direkt mit der Vorgabe verglichen werden. Es zeigte sich, dass es fast allen Probanden gelang, die Figuren in ihrer Grundstruktur erkennbar zu imitieren. Jedoch wiesen linkshemisphärisch geschädigte Patienten nicht nur hypothesengemäß die größten Veränderungen der räumlichen, sondern auch der zeitlichen Bewegungsparameter auf. Die Veränderungen korrelierten nicht mit Apraxie-Kriterien. Auch rechtsseitig geschädigte Patienten agierten in moderater Form fehlerhaft. Es wird eine maßgebliche Beteiligung der linken Hemisphäre für räumliche und auch für zeitliche Bewegungsaspekte, sowie die Koordination beider Bewegungsfaktoren, vermutet. Möglicherweise kam es zu einer Kaschierung apraktischer Bewegungsstörungen, indem eine Darstellung der Figuren über das semantische Gedächtnis erfolgte. Eine mangelnde Kenntnis über die Relation der Körperglieder zueinander, die möglicherweise bei Handgesten die Bewegungsausführung beeinträchtigt, scheint bei Armgesten nicht vorrangig zu sein. Möglicherweise erleichtert die wiederholte Vorführung der Armbewegungen die Bewegungsausführung durch einen vereinfachten Aufbau im Arbeitsgedächtnis.
Differences in brain activation between mild cognitive impairment patients and healthy controls during a verbal working memory task: a functional magnetic resonance imaging (fMRI) study
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Hintergrund: Diese Studie wurde durchgeführt, um Unterschiede in der zerebralen Aktivierung zwischen zwei Gruppen von einerseits Patienten mit leichten kognitiven Störungen (LKS) und andererseits gesunden Kontrollpersonen (GK) während eines verbalen Arbeitsgedächtnistests zu untersuchen. LKS wird als Vorstufe der Alzheimer Demenz angesehen. Um eine frühe Diagnose der Demenz zu ermöglichen, ist es wichtig, diagnostische Marker für LSK und AD zu etablieren. Methoden: Acht Personen mit LKS und acht GK haben sich einer funktionellen Magnetresonanztomographie unterzogen, während sie einen verbalen Arbeitsgedächtnistest durchführten. Sie bekamen fünf Buchstaben gezeigt, die sie sich nach der Einprägungsphase sechs Sekunden lang merken mussten, währenddessen sie ein Fixierungskreuz sahen. Nach dieser Verzögerung wurde den Probanden ein einzelner Buchstabe gezeigt, und sie mussten entscheiden, ob dieser Buchstabe in der vorher gezeigten Gruppe von Buchstaben enthalten war. Die Antwort erfolgte über Tasten in der rechten und linken Hand. Statistische parametrische Karten des Gehirns, die die Gehirnaktivität für die jeweiligen Gruppen zeigen, und Karten, die die Unterschiede zwischen beiden Gruppen zeigen, wurden für beide Gruppen erstellt. Ziele: Ziele der Studie waren, die Gehirnaktivierung von Patienten mit LKS und einer Gruppe von GK während eines verbalen Arbeitsgedächtnistests zu untersuchen, und Unterschiede in der Aktivierung zwischen den beiden Gruppen zu finden. Ergebnisse: Gehirnaktivierung in der GK-Gruppe wurde in dorsolateral-präfrontalen, parietalen und temporalen Gegenden beobachtet. Diese Aktivierungen wießen linksseitige Lateralisierung auf, was für verbale Aufgaben typisch ist. Trotzdem gab es auch aktive Regionen in der rechten Hemisphäre, was einen gewissen Grad von Delateralisierung bedeutet. Dies wiederum ist ein typischer Prozess der normalen Alterung. Die LKS-Gruppe wies Aktivierung in den gleichen Regionen auf, allerdings mit einem geringeren Grad an Delateralisierung. Es gab sowohl interhemisphärische wie auch interregionale Unterschiede in der Aktivierung zwischen den Gruppen. Die GK-Gruppe zeigte höhere Aktivierung in Regionen des Frontallappens, während die LKS-Gruppe höhere Aktivierung in Regionen des Termporallappens aufwies. In beiden Gruppen fanden sich Regionen, die höhere Aktivierung während der Ruhe-Phase des Tests im Vergleich zu der tatsächlichen Aufgabe zeigten. Diese Regionen werden ‚Default’-Netzwerk genannt. Die LKS-Gruppe hatte eine ausgeprägtere ‚Deaktivierung’ als die GK-Gruppe während der Wiederholungs-Phase des Tests, und eine niedrigere ‚Deaktivierung’ als die GK-Gruppe während der Entscheidungs-Phase. Ausblick: In beiden Gruppen war die Gehirnaktivierung während der verschiedenen Teile der Aufgabe in Gegenden, die während eines verbalen Arbeitsgedächtnistests typischerweise aktiviert werden. Es fanden sich Unterschiede in den Aktivierungsmustern zwischen den beiden Gruppen. Der auffallendste Unterschied war, dass die LKS-Gruppe höhere Aktivierung als die GK-Gruppe hatte, was auf Kompensierung für neurale Degeneration und kognitiven Leistungsabfall zurückgeführt werden kann. Dieser Kompensationsprozess trat während allen Teilen des Arbeitsgedächtnistests auf.
Beeinflusst die komplette extrakorporale Zirkulation (EKZ) bei Ratten deren neurokognitive Leistung, neurologischen Status und Verhalten?
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/07
Zur Ursachenfindung neurokognitiver und neurologischer Schädigungen nach EKZ und zur Entwicklung neuroprotektiver Strategien beim Menschen soll ein Tiermodell entworfen werden. Mit Hilfe des modifizierten Hole-Board-Tests nach OHL (mHBT) (OHL und FUCHS 1998) und einer Reihe neurologisch-motorischer Tests werden die Auswirkungen einer nicht pulsatilen, normothermen und vollständigen EKZ von 90minütiger Dauer an der Ratte untersucht, wobei entweder ein modifizierter Neugeborenenoxygenator oder ein speziell an die Größe der Ratte adaptierter Oxygenator Einsatz finden. Insbesondere neurokognitive und neurologisch-motorische Beeinträchtigungen als Folge des operativen Eingriffs sind zu erfassen. Es werden vier Versuchsgruppen gebildet, auf welche männliche Sprague Dawley Ratten randomisiert verteilt werden. Durch das Auftreten eines postoperativen Infekts der oberen Atemwege in zwei Tiergruppen (n = 8), erfolgt die Bildung einer zusätzlichen Versuchsgruppe. Die fünf Versuchsgruppen (n = 45) setzen sich wie folgt zusammen: Kontrollgruppe (n = 7): 2-stündiges Verbringen in den Operationsbereich, ohne Narkose und Operation; Sham-Gruppe (n = 10): identische Kanülierung und identisches zeitliches und anästhesiologisches Protokoll wie EKZ-Gruppen, kein Anschluss an die EKZ; Gruppe EKZ/NGO (n = 10): Durchführung einer nicht pulsatilen, normothermen (37,5°C) und vollständigen EKZ über 90 Minuten, Einsatz eines Neugeborenenoxygenators (Füllungsvolumen = 34 ml); Gruppe EKZ/RO (n = 10): Durchführung einer nicht pulsatilen, normothermen (37,5°C) und vollständigen EKZ über 90 Minuten, Einsatz eines Rattenoxygenators (Füllungsvolumen = 4 ml); Infektgruppe (n = 8): 6 Sham-Tiere und 2 EKZ-Tiere, bei denen es im Zeitraum der Operation zu einer Infektion der oberen Atemwege kam. Alle Tiere erlernen in einer 14-tägigen präoperativen Lernphase den mHBT. Nach der Operation wird der Test täglich über 21 Tage fortgesetzt. Beim mHBT sind 3 der 15 Löcher auf dem Hole-Board markiert und mit Futterbelohnungen versehen. Die Tiere lernen, dass nur in den markierten Löchern, Belohnungen zu finden sind. Jedes Tier absolviert pro Tag drei/zwei Durchläufe, wobei die Lochkombinationen jeden Tag wechseln. Mit dem Test können die kognitiven Leistungen des deklarativen Gedächtnisses und des Arbeitsgedächtnisses, sowie verschiedene Verhaltensparameter beurteilt werden. Das Allgemeinbefinden und der neurologische Status der Tiere werden anhand neurologisch-motorischer Tests überprüft. Zusätzlich wird täglich das Körpergewicht sowie der Futter- und Wasserverbrauch protokolliert. In der Infektgruppe kommt es in den Tagen nach der OP zu einer vorübergehenden signifikanten Verschlechterungen aller Gedächtnisparameter. Ebenso treten Verhaltensänderungen wie eine verringerte Motivation und eine Zunahme des Putzverhaltens im Verlauf der Infektion auf. Auch der Anstieg des prozentualen Körpergewichts ist postoperativ gegenüber den Kontrolltieren signifikant verzögert. In beiden EKZ-Gruppen sowie in der Kontroll- und Sham-Gruppe finden sich postoperativ keine neurokognitiven und keine signifikanten neurologischen Defizite. Es findet sich kein Hinweis auf zerebrale Schädigungen. Das vorliegende EKZ-Modell führt bei der jungen und gesunden Ratte zu keinen neurokognitiven und signifikanten neurologischen Schäden, was dafür spricht, dass die EKZ bei einem Patientengut mit niedrigem Risiko für Komplikationen keine negativen Auswirkungen hat.
Dissoziationen exekutiver Funktionen bei hirngeschädigten Patienten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Das Konzept exekutiver Funktionen hat eine lange Geschichte.(vgl. Benton, 1991, Tranel et al, 1994), welche im Laufe der Zeit zu den bekannten kognitiven Modellen geführt hat (Baddeley & Hitch, 1974, Norman & Shallice, 1980, Grafman, 1989, 1995, Damasio et al., 1991). Aufgrund der methodischen Probleme, eine zentral exekutive Instanz zu bestätigen, gehen einige Autoren von einem „multikomponenten“ exekutiven System aus (McCarthy & Warrington, 1990, Milner & Petrides, 1984), welches eigene Zuständigkeitsbereiche für bestimmte Anforderungen beinhaltet. Baddeley (1996) hingegen geht in seinen Überlegungen von einem einzelnen koordinierten System aus, welches verschiedene Funktionen bereitstellt. Es kann mit Sicherheit behauptet werden, dass die zentrale Exekutive keine monolithische Einheit darstellt (vgl. Baddeley et al., 1997, Burgess et al., 1997). Es hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll ist, die kognitiven Anforderungen von Aufgaben systematisch zu untersuchen und diese anschließend für die Konstruktion eines kohärenten Modells der zentralen Exekutive zu verwenden (Baddeley, 1996, 1997). Eine Doppelaufgabe ist ein geeignetes kognitives Modell, um die zentrale Exekutive zu untersuchen, weil im Sozialverhalten und in der Selbstkontrolle eine Dual-Task Anforderung beinhaltet ist. Aus diesem Grund wurde die Anforderung einer Dual-Task Aufgabe als Brückenmaß zwischen einer kognitiven Dysfunktion und einem gemessenen beeinträchtigten Verhalten herangezogen. Beeinträchtigtes Sozialverhalten ist deshalb von Bedeutung, weil es mit einem Leben in sozialer und finanzieller Unabhängigkeit interferiert und weil es die Rehabilitation anderer kognitiver Defizite reduzieren kann. Der Zusammenhang dieser zwei Verfahren untermauert demnach Baddeley`s Theorie einer zentralen Exekutive, die für kognitive Leistungen als auch für Verhaltensaspekte zuständig ist. Die Ergebnisse der hier vorliegenden Arbeit unterstützen die Theorie einer zentralen Exekutive (vgl. Baddeley, 1997, 1996, Baddeley et al, 1997) und sprechen somit gegen ein Multikomponentensystem (McCarthy & Warrington, 1990, Milner & Petrides, 1984), welches autonome Kontrollprozesse ausführt, da die erfasste verbale Arbeitsgedächtnisleistung als neuropsychologisches Verfahren mit einer Verhaltensproblematik einhergeht. Die gefundenen Ergebnisse im visuo-spatialen Arbeitsgedächtnisverfahren können in der hier vorliegenden Studie weder für eine Bestätigung noch Widerlegung der angenommenen Hypothese herangezogen werden, da aufgrund des festgestellten Bodeneffektes keine tendenziellen Aussagen getroffen werden können. Jedoch konnte gezeigt werden, dass neben dem statistischen Zusammenhang des DEX mit einem verbalen Dual-Task Verfahren, die Leistungen in einer verbalen Flüssigkeitsprüfung wiederum eng mit der verbalen Dual-Task Leistung verknüpft sind (vgl. Baddeley, 1996, Daneman & Carpenter, 1980), und dass die Anforderungen im ToL Parallelen zu den Anforderungen beim Generieren von Wörtern zeigen.
Ortsgedächtnis für Blütenpositionen bei der Blütenfledermaus Glossophaga soricina
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Die Nahrungssuche ist für Tiere kein triviales Verhaltensproblem. Nahrung ist im Habitat eines Tieres selten homogen verteilt, wobei räumliche Heterogenität unter anderem durch das zeitliche Muster der Ressourcenerneuerung und durch die Nahrungssuche der Tiere selbst verursacht wird. Besonders bei sich rasch erneuernden Nahrungsquellen wie z.B. Blütennektar ist es für viele Tiere von Vorteil, sich einerseits den Ort dieser Quellen zu merken, um wieder dorthin zurückzukehren, andererseits jedoch eine Rückkehr vor einer rentablen Ressourcenerneuerung zu vermeiden. Blüten sind ortskonstant und produzieren Nektar über einige Zeit hinweg. Ein gutes Ortsgedächtnis sowie die Fähigkeit, vorzeitige Wiederbesuche einer Blüte zu meiden, können somit die Effizienz der Nahrungssuche beträchtlich steigern. Viele der neotropischen Blütenfledermausarten (Phyllostomidae, Glossophaginae) ernähren sich hauptsächlich von Nektar. Sie ermöglichen daher die Untersuchung eines spezialisierten Ortsgedächtnisses bei einem Säugetier. Die vorliegende Doktorarbeit hatte zwei Ziele: 1. Die Entwicklung eines neuartigen, computergesteuerten Versuchssystems zur automatisierten Durchführung sequenzieller Verhaltensexperimente mit mehreren Individuen (Kapitel 1). 2. Die Untersuchung des Ortsgedächtnisses von Blütenfledermäusen für kleinräumige Blütenansammlungen unter Verwendung dieses Systems (Kapitel 2 bis 5). Das Versuchssystem (Kapitel 1) umfasst ein computergesteuertes künstliches Blütenfeld mit 64 Kunstblüten sowie 6 ebenfalls computergesteuerte Käfige. Das Blütenfeld stellt eine Nahrungsareal dar, dessen einzelne Futterquellen eine rechnergesteuerte Ergiebigkeit haben und deren wahrnehmbare Erscheinung für drei Sinnesmodalitäten (Geruch, visuell, echoakustisch) variiert werden kann. Die Käfige sind mit je zwei Kunstblüten zur Einzeldressur, einem computerüberwachten Hangplatz, einem Kameraüberwachungssystem und computergesteuerten Türen ausgestattet. Blütenbesuche und andere versuchsrelevante Parameter werden vom Computer mit Zeitangabe gespeichert. Dieses System ermöglicht sowohl die Datenaufnahme als auch den Austausch von Versuchstieren computergesteuert und ohne Störung der Tiere. Eine Anpassung des Systems an andere Tierarten lässt sich problemlos vornehmen. Für die Experimente wurden Blütenfledermäuse der Art Glossophaga soricina darauf trainiert, am beschriebenen Blütenfeld Nektar zu suchen. Kapitel 2 befasst sich mit folgenden Fragen: 1. Ist das Ortsgedächtnis von Blüten-fledermäusen so hoch auflösend, dass sie sich auch in einer kleinräumigen Ansammlung von Blüten wie einer Baumkrone Ort und Qualität einzelner Blüten merken können? 2. Wenn ja, vermindern sie nach Möglichkeit die Anforderungen an das Ortsgedächtnis durch kognitive Gruppierung räumlich nahe benachbarter belohnender Blüten? 3. Wie hoch sind Kapazität und Flexibilität des Ortsgedächtnisses innerhalb eines solchen Areals? Die Fledermäuse hatten in diesem Experiment die Aufgabe, am Blütenfeld die Nektar gebenden Blüten zu finden und deren Positionen zu lernen. 32 der 64 Blüten gaben pro Versuchsdurchlauf einmal Nektar, wobei belohnende Blüten entweder geklumpt oder zufällig angeordnet waren. Das Ortsgedächtnis der Fledermäuse erwies sich als so hoch auflösend, dass sich die Tiere auch in dieser kleinräumigen Blütenansammlung einzelne Blütenpositionen merken konnten. Zwar erreichten die Tiere bei der geklumpten Verteilung ein höheres Korrektwahlenniveaus als in der zufälligen, doch eine Simulation ergab, dass dieser unterschiedliche Korrektwahlenanteil nicht nur auf kognitiver Gruppierung räumlich benachbarter Blüten beruhen könnte, sondern auch auf örtlichen Positionsfehlern. Es bleibt somit ungeklärt, ob die Tiere in der gegebenen Situation Blüten kognitiv gruppierten, oder bisweilen versehentlich eine Nachbarblüte der eigentlich anvisierten Blüte besuchten. Das Ortsgedächtnis der Fledermäuse erwies sich als äußerst flexibel. Die Tiere stellten sich schnell und ohne Anzeichen von proaktiver Interferenz (ohne Beeinträchtigung der Lernleistung durch zuvor gelernte Information) auf Verände-rungen der Nahrungsverfügbarkeit ein. Sie lernten in beiden Blütenverteilungen die Positionen von mindestens 27 Blüten. In Kapitel 3 wurde der Frage nachgegangen, ob die Fledermäuse im oben beschriebenen Versuch unmittelbare (und damit unprofitable) Wiederbesuche vermieden und - falls ja - ob sie dazu ihr räumliches Arbeitsgedächtnis (entspricht dem Kurzzeitgedächtnis), Bewegungs-regeln oder andere Strategien anwenden würden. Die Tiere vermieden Wiederbesuche. Da sich kein systematisches Ausbeuteverhalten nachweisen ließ, das rein auf Bewegungsregeln beruhte und ohne Arbeitsgedächtnis realisierbar gewesen wäre, ist zu vermuten, dass die Tiere Wiederbesuche hauptsächlich mit Hilfe ihres Arbeitsgedächtnisses vermieden. Ist dies der Fall, so konnten sie sich einzelne Blütenbesuche über mindestens 62 Besuchsereignisse merken (dies zeigte eine Analyse des "Recency"-Effekts). Jedem Lernen der Ortsposition einer Blüte muss ein Erkennen der Blüte als Futterquelle vorangehen. Da Blütenfledermäuse in der Regel viele Blüten derselben Pflanzenart an verschiedenen Standorten besuchen, ist anzunehmen, dass sie die Fähigkeit besitzen, Blüten als "Typ" zu erkennen. In dem in Kapitel 4 beschriebenen Experiment wurde die Fähigkeit untersucht, in einer Zweifachwahl-Diskriminationsaufgabe echoakustisch spezifisch markierte Kunstblüten an neuen Standorten wiederzuerkennen. Dies führte zu dem überraschenden Befund, dass die Tiere die an einem Ort erlernte Unterscheidung an einem anderen Ort neu lernten und damit keine Generalisierung zeigten. Möglicherweise ist das Lösen von Zweifachwahl-Aufgaben für Blütenfledermäuse schwierig, weil solche Aufgaben der starken Ortspräferenz der Tiere zuwiderlaufen. Eine Blüte ist für eine Fledermaus ein multimodaler Stimulus, der echoakustisch, olfaktorisch und gegebenenfalls auch optisch wahrgenommen werden kann. Mit dem in Kapitel 5 beschriebenen Experiment wurde untersucht, ob Sinnesinformation verschiedener Modalitäten in unterschiedlicher Weise zum Aufbau des Ortsgedächtnisses einer Blüten-position beiträgt. Wie im ersten Versuch hatten die Tiere die Aufgabe, am Blütenfeld die Nektar gebenden Blüten zu finden und deren Positionen zu lernen. 32 der 64 Blüten gaben pro Versuchsdurchlauf einmal Nektar, wobei belohnende Blüten zufällig verteilt waren. Belohnende und unbelohnende Blüten waren durch verschiedene echoakustische oder visuelle Stimuli oder gar nicht (Kontrolle) gekennzeichnet. Im Verlauf des Experiments wurden die Stimuli zweimal vorübergehend entfernt. Die Fledermäuse erreichten mit Stimuli beider Modalitäten einen höheren Korrektwahlenanteil als ohne. Die Entfernung der Stimuli hatte zur Folge, dass sich der Korrektwahlenanteil zwischen den Versuchsbedingungen nicht mehr signifikant unterschied. Die Tiere nutzten also neben ihrem Ortsgedächtnis sowohl echoakustische als auch visuelle Information zur Lokalisation Nektar gebender Blüten am Feld. Während echoakustische Stimuli nur als Orientierungshilfe dienten, verbesserten visuelle Stimuli anscheinend zusätzlich das Ortslernen, denn nach Entfernung der echo-akustischen Stimuli fiel der Korrektwahlenanteil drastisch, nach Entfernung der visuellen Stimuli nicht. Das im Rahmen dieser Doktorarbeit entwickelte Versuchssystem erwies sich als ein zuverlässiges Mittel zur Durchführung voll automatisierter Versuche mit mehreren Tieren. Die durchgeführten Lernexperimente zeigten, dass Blütenfledermäuse ein hoch auflösendes, flexibles Langzeit-Ortsgedächtnis besitzen. Sie können unprofitable Wiederbesuche bereits geleerter Blüten wahrscheinlich mit Hilfe des Arbeitsgedächtnisses über mehr als 62 Blütenanflüge meiden. Es war keine Generalisierung echoakustischer Stimuli in Zweifachwahl-Diskriminationsaufgaben zwischen einem Dressurort und einem Testort nachzuweisen. Dieses überraschende Phänomen könnte aufgrund des Versuchsparadigmas durch eine Interferenz zwischen Ortslernen und Objektlernen verursacht worden sein. Die Tiere nutzten echoakustische und visuelle Stimuli als Orientierungshilfe, wobei die Präsenz visueller Stimuli zusätzlich das Ortslernen verbesserte.