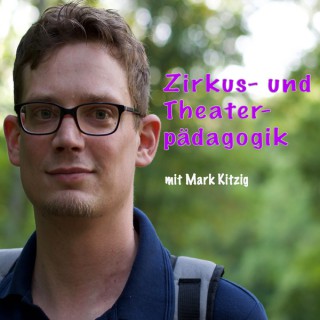Podcasts about die bearbeitung
- 23PODCASTS
- 24EPISODES
- 28mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 10, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about die bearbeitung
Latest news about die bearbeitung
- Katalog der Militaria aus Vindonissa – GPV XIV AWOL - The Ancient World Online - Apr 19, 2025
Latest podcast episodes about die bearbeitung
Warum will eine Hamburger Initiative Social Media erst ab 16 erlauben?
Moin, ich kann mir vorstellen, dass ihr über das Thema auch schon mal diskutiert habt, in der Familie oder mit Freunden: Sollte Social Media erst ab 16 erlaubt sein? In Australien ist das seit diesem Jahr gesetzlich so geregelt und auch bei uns nimmt die Diskussion Fahrt auf, dank eine Hamburger Initiative, die ihre Petition heute im Bundestag vorgestellt hat. Außerdem geht es um die Frage, warum zehn Jahre nach seinem Tod Helmut Schmidt so sehr vermisst wird. Wenn er noch Kanzler wäre: Wäre dann einiges anders gelaufen? Viel Spaß beim Hören wünscht Ole >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Was war heute in Hamburg los? Maiken Nielsen und Ole Wackermann werfen im wöchentlichen Wechsel zum Tagesende einen Blick auf die News und das aktuelle Stadtgeschehen. Das sind die Nachrichten und Themen mit Ole Wackermann am Montag, 10. November 2025: +++Hamburger Initiative fordert Social-Media-Verbot für Jugendliche+++ Eine Hamburger Elterninitiative fordert: Kein Zugang zu sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute wird die Petition im Bundestag vorgestellt. Mehr dazu: Mehr dazu: https://www.ndr.de/socialmedia-116.html +++ Lange Bearbeitungszeiten bei BAföG-Anträgen in Hamburg+++ Mehr als 4.000 Studierende in Hamburg warten momentan auf die Entscheidung, ob sie BAföG-Zahlungen bekommen werden. Die Bearbeitung der Anträge dauert zurzeit länger als sonst, sagt das BAföG-Amt. Mehr dazu: https://www.ndr.de/bafoeg-154.html +++Hamburg damals: Ex-Kanzler Helmut Schmidt stirbt+++ Die Zigarette und seine "Schmidt-Schnauze" sind seine Markenzeichen. Aus dem Hamburger Jung wird 1974 der fünfte Bundeskanzler der BRD. Link für die Wohnhaus-Führungen: https://www.helmut-schmidt.de/das-wohnhaus Du hast Feedback zur Folge oder Wünsche für Recherchen? Unsere Podcast-Hosts erreichst du über den Messenger in der NDR Hamburg App, in den Social-Media-Kanälen von NDR Hamburg und via E-Mail an hamburgheute@ndr.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr unter www.ndr.de/hamburgheute
#464 - KI-Bordmittel & Agenten: Wie du mit Claude, 11 Labs & Perplexity produktiver wirst – mit Tanja Förster
KI-Bordmittel & Agenten: Wie du mit Claude, 11 Labs & Perplexity produktiver wirst In dieser Episode dreht sich alles um die „Bordmittel" – also die Basistechnologien, mit denen du sofort starten kannst, ohne dich durch neue Tools zu kämpfen. Statt Tool-Zoo setzen wir auf das Wesentliche. Du erfährst, wie Claude, 11 Labs, Perplexity und Co. deine tägliche Arbeit bereits heute massiv vereinfachen können – ganz ohne Umwege, ganz ohne Hürden. Tanja Förster auf LinkedIn: LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/foerster-tanja/ Claude als Power-User: Office-Dokumente auf Zuruf Claude Sonnet 4.5 bringt frischen Wind in deine Arbeit mit Texten und Daten. Mit einem einzigen Prompt kannst du PowerPoint-Präsentationen, Excel-Tabellen oder Word-Dokumente erzeugen – direkt aus Rohdaten. Die neue Artefakt-Funktion geht sogar noch weiter: Erste Mini-Anwendungen lassen sich direkt im Chatfenster bauen. Besonders stark ist die neue Möglichkeit, Ergebnisse zu validieren und Denkprozesse transparent nachzuvollziehen. Das hebt Claude auf ein neues Level im Alltagseinsatz. Video- und Audio-KI im Sprintmodus Auch in Sachen Medienproduktion geht's steil bergauf: Heygen erstellt komplette Videos mit Avataren auf Basis deiner Prompts – inklusive Sprecher. 11 Labs bringt mit Studio 3.0 sogar Podcasts direkt aus deinen Dokumenten aufs Ohr. Lade ein PDF hoch, wähle eine Stimme (oder deine eigene), und heraus kommt eine professionelle Podcast-Episode. Die Bearbeitung ist im Nachgang flexibel möglich – ideal für Content Recycling auf Autopilot. KI-Agenten: Deine digitalen Assistenten im Hintergrund Mit Tools wie Manus, Fellow, Strawberry oder Komet von Perplexity bekommst du echte Unterstützung bei komplexen Aufgaben. Manus reagiert sogar auf E-Mails wie ein echter Kollege und erstellt daraus komplette Präsentationen. Fellow navigiert für dich durchs Netz, füllt Formulare aus und liefert strukturierte Recherche. Und Komet – der neue Agenten-Browser von Perplexity – steht jetzt allen offen und bindet Gmail, Kalender und Co. direkt ein. So entsteht eine KI, die nicht nur reagiert, sondern mitdenkt. Fazit: Basistechnologie schlägt Tool-Wirrwarr Ob Office-Automatisierung mit Claude, Medienproduktion mit 11 Labs oder smarte Agenten wie Manus – du brauchst keine 100 Tools. Mit den richtigen Bordmitteln holst du jetzt schon das Maximum aus KI heraus. Halte es simpel, mach's effektiv – und beobachte, wie du mit überschaubarem Setup richtig PS auf die Straße bringst. Noch mehr von den Koertings ... Das KI-Café ... jede Woche Mittwoch (>350 Teilnehmer) von 08:30 bis 10:00 Uhr ... online via Zoom .. kostenlos und nicht umsonstJede Woche Mittwoch um 08:30 Uhr öffnet das KI-Café seine Online-Pforten ... wir lösen KI-Anwendungsfälle live auf der Bühne ... moderieren Expertenpanel zu speziellen Themen (bspw. KI im Recruiting ... KI in der Qualitätssicherung ... KI im Projektmanagement ... und vieles mehr) ... ordnen die neuen Entwicklungen in der KI-Welt ein und geben einen Ausblick ... und laden Experten ein für spezielle Themen ... und gehen auch mal in die Tiefe und durchdringen bestimmte Bereiche ganz konkret ... alles für dein Weiterkommen. Melde dich kostenfrei an ... www.koerting-institute.com/ki-cafe/ Mit jedem Prompt ein WOW! ... für Selbstständige und Unternehmer Ein klarer Leitfaden für Unternehmer, Selbstständige und Entscheider, die Künstliche Intelligenz nicht nur verstehen, sondern wirksam einsetzen wollen. Dieses Buch zeigt dir, wie du relevante KI-Anwendungsfälle erkennst und die KI als echten Sparringspartner nutzt, um diese Realität werden zu lassen. Praxisnah, mit echten Beispielen und vollständig umsetzungsorientiert. Das Buch ist ein Geschenk, nur Versandkosten von 9,95 € fallen an. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene, die mit KI ihr Potenzial ausschöpfen möchten. Das Buch in deinen Briefkasten ... https://koerting-institute.com/shop/buch-mit-jedem-prompt-ein-wow/ Die KI-Lounge ... unsere Community für den Einstieg in die KI (>2800 Mitglieder) Die KI-Lounge ist eine Community für alle, die mehr über generative KI erfahren und anwenden möchten. Mitglieder erhalten exklusive monatliche KI-Updates, Experten-Interviews, Vorträge des KI-Speaker-Slams, KI-Café-Aufzeichnungen und einen 3-stündigen ChatGPT-Kurs. Tausche dich mit über 2800 KI-Enthusiasten aus, stelle Fragen und starte durch. Initiiert von Torsten & Birgit Koerting, bietet die KI-Lounge Orientierung und Inspiration für den Einstieg in die KI-Revolution. Hier findet der Austausch statt ... www.koerting-institute.com/ki-lounge/ Starte mit uns in die 1:1 Zusammenarbeit Wenn du direkt mit uns arbeiten und KI in deinem Business integrieren möchtest, buche dir einen Termin für ein persönliches Gespräch. Gemeinsam finden wir Antworten auf deine Fragen und finden heraus, wie wir dich unterstützen können. Klicke hier, um einen Termin zu buchen und deine Fragen zu klären. Buche dir jetzt deinen Termin mit uns ... www.koerting-institute.com/termin/ Weitere Impulse im Netflix Stil ... Wenn du auf der Suche nach weiteren spannenden Impulsen für deine Selbstständigkeit bist, dann gehe jetzt auf unsere Impulseseite und lass die zahlreichen spannenden Impulse auf dich wirken. Inspiration pur ... www.koerting-institute.com/impulse/ Die Koertings auf die Ohren ... Wenn dir diese Podcastfolge gefallen hat, dann höre dir jetzt noch weitere informative und spannende Folgen an ... über 440 Folgen findest du hier ... www.koerting-institute.com/podcast/ Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg zu begleiten!
Grosser Aufstand gegen Micarna Poulet-Fabrik in Saint-Aubin
Im 2000 Seelendorf im Kanton Freiburg soll ein neuer Micarna-Schlachthof entstehen. Dagegen sind nun 1800 Einsprachen eingegangen. Die Bearbeitung der Einsprachen bringt die kleine Gemeinde an ihre Grenzen. Weiter in der Sendung: * Der Kanton Bern will die Steuern senken, besonders für Menschen, welche wenig verdienen. Er schickt die Massnahmen in die Vernehmlassung. * Wegen eines Ölunfalls in Péry sollten Fische aus der Schüss momentan nicht gegessen werden. * Im Sommer 2022 ging das provisorische Asylzentrum auf dem Viererfeld in der Stadt Bern auf. Wie läuft das Zusammenleben zwei Jahre später? Ein Gespräch mit der Leiterin Francesca Chukwunyere.
[Podcast] Operette: Eine Operette mit viel Humor Mitislaw geht in die Moderne
In dieser Operettenkritik wird eine moderne Interpretation einer humorvollen Operette mit viel Liebe präsentiert. Die Hauptfigur führt einen Dialog über die Relevanz von Franz Lehars Werken in der heutigen Zeit mit einer Freundin, die betont, wie wichtig es sei, gesellschaftskritisch zu sein. Trotz anfänglicher Bedenken wegen des fehlenden satirischen Ansatzes in heutigen Aufführungen begibt sich der Hauptredner allein ins Theater. Schon vor Beginn der Aufführung herrscht eine ausgelassene Stimmung im Publikum, was auf ein vielversprechendes Erlebnis hindeutet. Die Einführung durch Frau Mecke schafft einen historischen Kontext für die Aufführung von 1907 und weist auf die aktuelle Zensurproblematik hin, die humorvoll thematisiert wird. Die Inszenierung beginnt im Erdgeschoss des Theaters mit Tommy Wendt als Moderator, der das Stück charmant ankündigt und das Publikum auf eine unterhaltsame Reise mitnimmt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugen mit feinem Humor und präsentieren das Stück mit Leidenschaft und Hingabe. Die Hauptaufführung im Keller des Theaters begeistert das Publikum mit modernen Elementen und interaktiven Einlagen, die das Geschehen auf der Bühne lebendig gestalten. Die Darstellerinnen und Darsteller überzeugen mit ihren stimmlichen und schauspielerischen Leistungen, wobei besonders Izabella Radić und Clark Ruth hervorstechen. Kritisch betrachtet wird die Dominanz einiger Stimmen im Ensemble, was die Balance und Harmonie in manchen Szenen beeinflusst. Die Inszenierung zeichnet sich durch eine gelungene Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Elementen aus, die das Publikum zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Die sorgfältige Auswahl der Musik sowie die Detailverliebtheit in der Ausstattung tragen zum Gesamterlebnis bei und lassen die Operette aus dem Jahr 1907 in einem neuen Licht erstrahlen. Die Bearbeitung des Stücks durch Hauke Berheide und Amy Stebbins wird als kreativ und gelungen empfunden, was die Hoffnung auf weitere moderne Interpretationen von Klassikern weckt. Mit einem Mix aus Unterhaltung und Gesellschaftskritik schafft die Inszenierung eine einzigartige Atmosphäre, die das Publikum begeistert und zum Nachdenken anregt.
277 - I. Schwarz - "+" - Editors' Choice
Zwischen Blende und Zeit - Der Fotografie-Talk der fotocommunity
Das Foto von I. Schwarz schafft es, einen Rückzugsort in einem anderen Licht zu zeigen. Die Bearbeitung unterstreicht dabei dessen Funktion, Abstand zum Alltag zu finden. Setz Dich gern zu uns, wir freuen uns auf Dich!
Gute Opfer - schlechte Opfer: die Nakba-Ausstellung in München. Ein Kommentar von Jonny Rieder
In Millisekunden erfassen wir dargestellte Angst, Unrecht, Grausamkeit und Unfrieden. Oder Schönheit, Liebe, Geborgenheit. Heute dürfen wir unseren Augen nicht mehr trauen. Die Bearbeitung der Bilder durch Retusche und künstliche Intelligenz manipulieren unsere Sinne, auch der bewusste, tendenziöse Einsatz von Bildern, beispielsweise in den Medien, täuscht unsere Wahr – Nehmung, also die Bildung unserer eigenen Wahrheit. Zumindest im Jahr 1948 kann man davon ausgehen, dass Retouche und Manipulation des Bildes an sich noch nicht ausgeprägt waren. Aus dieser Zeit stammen die Aufnahmen, die in der Ausstellung „Die Nakba. Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ zu sehen sind. Sie werden in der Seidlvilla vom Arbeitskreis Palästina-Israel e.V., Salam Shalom, noch bis zum 7. Juni 2024 gezeigt. Die Seidlvilla ist als öffentliche Einrichtung der Landeshauptstadt München (LHM) rechtlich dazu verpflichtet, ihre Räumlichkeiten für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Gerne, so eine öffentliche Distanzierung der Landeshauptstadt München auf deren Webseite, tun sie das nicht. Nakba heißt Katastrophe oder Unglück und erinnert an die Vertreibung und Flucht der arabischen Plästinenser während des Palästinakrieges zwischen 1947 und 1949 im Mandatsgebiet Palästina und dem enstehenden Staat Israel. Rund 700.000 Menschen waren von den Enteignungen von Land und Besitz und Kultur betroffen. Im Geschichtsbild der Palästinenser wird die Nakba als geplante ethnische Säuberung durch das israelische Militär bezeichnet. In Israel wird üblicherweise von der freiwilligen Flucht von Teilen der arabischer Bevölkerung infolge von Aufrufen arabischer Führungspersönlichkeiten gesprochen. So zeichnet Wikipedia die Nakba nach. Der Autor Jonny Rieder hat die Ausstellung in der Seidl-Villa besucht und einen Kommentar verfasst, den Sabrina Khalil für uns eingelesen hat. Foto: MiddleEastMonitor
Die Judenbuche - Klassiker im Dialog mit der Gegenwart
•Experiment• Annette von Droste-Hülshoffs Klassiker "Die Judenbuche" ist vielen aus der Schule bekannt, wenn auch selten präsent. Die Bearbeitung des Kunstkollektivs Rimini Protokoll rückt ihn in die Gegenwart und gibt der jüdischen Perspektive Raum. // Von Rimini Protokoll / WDR 2023 // www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter Von Rimini Protokoll.
"Wie schaffe ich es, einen durchgängigen und stimmigen Bearbeitungsstil zu entwickeln?" Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und sie ist wirklich wichtig, denn dein fotografischer Stil sagt eine Menge über dich aus. Er hebt dich von anderen ab und hilft dir dabei, deinen eigenen Look zu finden. Aber ich verrate dir mal was: Die Bearbeitung selbst ist nur ein kleiner Teil des Ganzen, wenn es darum geht, deinen Stil zu definieren und konstant zu bleiben. Tatsächlich gibt es eine Menge, die passieren muss, lange bevor du dich vor deinen Computer setzt, um die Bearbeitung zu starten. In dieser Podcast-Episode teile ich meine besten Tipps und Tricks, die dir mit Sicherheit helfen werden, auf dem Weg zur Bildkonsistenz zu bleiben.
Interview mit Elina Albach über die Bearbeitung von Bachs h-Moll-Messe
Bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg gibt es am Samstag Bachs berühmte h-Moll-Messe in einer kammermusikalischen Fassung zu erleben - unter anderem mit historischen Instrumenten und modernem Schlagwerk. Bearbeitet hat das Werk die Cembalistin Elina Albach. Wie sie darauf kam und was sie an Bachs Musik so berührt, hat sie BR-KLASSIK im Interview verraten.
Ihre Farbe: Grün: Ihr Ziel: Klimarettung. Britta Haßelmann sitzt für Bielefeld und die Grünen im Bundestag und ist deren Erste Parlamentarische Geschäftsführerin. Bei WDR 2 Jörg Thadeusz zur Wahl 2021 spricht sie über Klimaschutz als das politische Ziel der Stunde, wieso es starke Kommunalpolitik braucht und welche Lehren sie aus den Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition von 2017 gezogen hat. Hinweis der Redaktion: Wir haben den Podcast in Minute 5 um wenige Sekunden gekürzt. Jörg Thadeusz hatte in der Live-Sendung seine persönliche Meinung zu Claus Weselsky, dem Vorsitzenden der GdL, geäußert, die in der Form nicht dem Standard entsprach, den WDR 2 bei einer kritischen journalistischen Kommentierung für angemessen hält. Die Bearbeitung verändert den Inhalt des Gesprächs mit Britta Haßelmann aber nicht.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Bearbeitung der Folgen abzugeben?
Früher oder später stellen sich alle Podcaster die Frage, ob sie die Bearbeitung der Folgen abgeben sollten. Doch ab wann solltest du jemand anderes zum Bearbeiten deiner Folgen ins Board holen? Erwähnungen und Ressourcen:Hinweis: Einige der folgenden Links sind Affiliate Links. Wenn du dich für einen Kauf entscheidest, verdiene ich eine kleine Provision – ohne zusätzliche Kosten oder Nachteile für dich. Wertvolle Impulse und Ressourcen für Changemaker: https://www.changemakerdigest.de/ (www.changemakerdigest.de) https://simonmcschubert.de/auphonic (Auphonic) Support this podcast
Wie du die Bearbeitung deiner E-Mails an eine/n MitarbeiterIn abgibst
168: Wäre es nicht mega cool, wenn du deine E-Mails nicht mehr selbst bearbeiten müsstest – weil du jemanden in deinem Team hast, der das für dich erledigt? *träum* Wenn du jetzt denkst “Brauch ich nicht!”, dann bekommst du offensichtlich noch nicht genug E-Mails. Aber wenn du denkst “YES, PLEASE!”, dann ist meine neue Podcast-Episode für dich. In der Episode verrate ich warum und ab wann es sinnvoll ist deine E-Mails abzugeben (Früher als du denkst!), was die besondere Herausforderung ist wenn jemand anders deine E-Mails beantwortet und die 5 Phasen, wie du eine/n neue/n MitarbeiterIn in die Bearbeitung deiner E-Mails einarbeitest. Alle Shownotes zu dieser Episode findest du hier: www.katharina-lewald.de/168 Schau dir meine kostenlose Live-Masterclass “Wie du aus deinen ersten Online-Einnahmen ein profitables Online-Business machst” an: www.katharina-lewald.de/wachstum Schau dir meine kostenlose Masterclass "In 4 Schritten zu deinem profitablen Onlinekurs" an: www.katharina-lewald.de/masterclass Folge mir auf Instagram: www.instagram.com/katharina.lewald Hol dir meinen kostenlosen Erfolgsplan für dein profitables Onlinekurs-Business: www.katharina-lewald.de/erfolgsplan Lade dir gratis meine 90-Tage-Launch-Checkliste herunter: www.katharina-lewald.de/checkliste Schnapp dir kostenlos meine “10 Onlinekurs-Ideen in 10 Minuten!”: www.katharina-lewald.de/ideen Hier findest du alle Tools, die ich in meinem Online-Business nutze (inkl. Mikro, Webcam etc.): www.katharina-lewald.de/tools Komm in meine gratis Facebook-Gruppe für erfolgreiche Onlinekurs-AnbieterInnen mit bereits über 4.000 Mitgliedern: www.katharina-lewald.de/community
#086 – Ästhetisches Forschen: Damit gelingt dir die Bearbeitung von jedem Thema
In dem Interview mit Harald habe ich mich über die Möglichkeiten des ästhetischen Forschens unterhalten. Nachdem wir angerissen haben, was ästhetisches Forschen ist, haben wir uns über den Begriff Ästhetik unterhalten und wie dieser Begriff mit Forschen verbunden werden kann. Zum Abschluss hat Harald dann noch eine praktische Anleitung erklärt, die du eins zu eins nachmachen kannst.
Videos bearbeiten: brauche ich dafür ein teures Programm?
Du willst, dass deine Social Videos professionell aussehen und da gehört die Videobearbeitung und der Schnitt natürlich mit dazu. Aber keine Sorge, das lässt sich auch alles leicht lösen. Vor allem: du kannst kostenfrei starten, um deine Videos zu bearbeiten. Denn die gute Sache ist, dass unsere Handys (wenn sie nicht gerade einige Jahre auf dem Buckel haben) in sehr guter Qualität Videos produzieren. Die Bearbeitung ist dann – je nachdem was du umsetzen möchtest – ein letzter Schritt.
#218 – Bearbeite deine Videos schneller mit diesen Tipps – DaVinci & Premiere
Die Bearbeitung von Videos ist anspruchsvoll. Sowohl für dich als auch für deinen Computer. Ich habe jetzt ein paar Tipps für dich wie du das maximum aus deinem Gerät holen kannst und deine Videos deutlich schneller Schneiden, Graden und Exportieren kannst.
Thüringer Aufbaubank: Pro Antrag 15 Minuten zur Bewilligung
Kleinunternehmer und Soloselbständige können ab sofort die Corona-Soforthilfe beantragen. Die Bearbeitung soll unbürokratisch und schnell laufen. Dazu Maret Montavon von der Thüringer Aufbaubank:
Podyssey, der Podcast für Science-Fiction- & Fantasy-Kurzgeschichten
Podyseey, der Podcast für Science-Fiction-und Fantasy-Kurzgeschichten Podyssey bringt alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Sciencefiction und Fantasy. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über Weiterempfehlungen und Bewertungen. Podyseey hat eine bewegte Geschichte. Der Podcast wurde am 27. Mai 2007 von Jens Hartmann ins Leben gerufen. Im Dezember 2008 übernahm der Verein zur Förderung phantastischer Literatur in Österreich (Earth Rocks) den Podcast und hat ihn bis zur Folge 33 am 27. November 2011 weitergeführt. Nach November 2016 wurde die URL zu einer Werbe-Seite weitergeleitet und am 02. Juli 2019 gelöscht. Am 03. August 2019 haben wir die URL wieder angemeldet. Nach langer Suche, konnten wir Jens Hartmann kontaktieren und mit seiner Zustimmung am 22. Dezember 2019 die alten Folgen wieder veröffentlichen. Leider besaß auch Jens nur noch 25 der 33 Folgen. Nach mehreren Posts in verschieden Foren, fand sich jemand, der uns ein Backup zur Verfügung stellen konnte. Mitmachen als Autorinnen/Autor Die Produktion neuer Episoden beginnt jetzt, damit wir den zweiwöchigen Rhythmus aufrechterhalten können. Dazu benötigen wir dringend gute Geschichten, gute Sprecherinnen und Sprecher. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir suchen Kurzgeschichten aus dem Bereich Sciencefiction und Fantasy, die in etwa 15 bis 35 Minuten vorgelesen werden können. Also etwa 3.000 bis 10.000 Wörter. Mitmachen als Sprecherin/Sprecher Die Geschichten werden den Sprecherinnen und Sprechern vorgeschlagen. Diese können sich die Kurzgeschichten aussuchen, die sie aufnehmen wollen. Zur Aufnahme braucht ihr ein Mikrofon und eine Aufnahmesoftware, z.B. Audacity. Am besten eignen sich für uns FLAC Dateien. Die Bearbeitung der Aufnahme machen wir. Die Aufnahme sollte beginnen mit: „Titel“ von „Autor/Autorin”, dann die Geschichte und als Schluss: “Sie hörten „Titel“ von „Autor/Autorin” gesprochen von „Sprecher/Sprecherin“, eine Produktion von podyssey.de”. Bitte schickt uns auch eine Kurzvita von euch und links zu euren Homepage oder Sozialen Medien damit wir sie in der Episode schreiben könnten. Wir freuen uns auf eure Einreichungen (geschichten@podyssey.de). Liebe Grüße euer Podyssey-Team
Willkommen zur 2. Episode des ScreencastHero Podcasts. Camtasia 2018 ist seit einigen Monaten verfügbar und bietet einige tolle neue Funktionen. Dazu gehört ... ... die neue Medienbibliothek für Windows und Mac Designvorlagen und Schemas für Elemente Die Bearbeitung und Produktion mit 60 fps (Bildern pro Sekunde) Eine bessere Performance mit bis zu 50 % mehr Leistung bei der Bearbeitung und Produktion Und neue Techsmith Medienelemente (kostenfrei und kostenpflichtig) Lohnt sich der Umstieg? Dazu ein paar Gedanken in dieser Episode. / Meine Einschätzung dazu bekommst du in dieser Episode. Die neue einheitliche Medienbibliothek für Camtasia 2018 ist jetzt in der Windows und in der Mac Version enthalten. Über eine übersichtliche Ordnerstruktur innerhalb der Medienbibliothek ist die perfekte Organisation von Medienelementen möglich. Diese stehen anschließend in jedem Projekt zur Verfügung. Neue Elemente können ganz einfach importiert oder direkt von der Timeline des aktuellen Projekts hinzugefügt werden. Für unterschiedliche Projekte lassen sich sogar extra Medienbibliotheken anlegen. Mit den Designvorlagen bzw. Schemas in Camtasia 2018 ist die Umsetzung eines einheitlichen Videodesigns und die Einhaltung der Corporate Idendity noch einfacher. Nach der Definition eines Schemas mit Farben und Schriftarten kann dieses mit einem Klick auf Medienelemente angewendet werden. Die Bearbeitung von mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommene Videos ist nun auch mit 60 fps möglich. Die höhere Performance in Camtasia 2018 macht sich sowohl während der Bearbeitung als auch bei der Produktion bemerkbar. Mit Camtasia 2018 bringt Techsmith eine Premium Bibliothek mit unzähligen Medienelementen. Das waren die wichtigsten Neuerungen in Camtasia 2018. Lohnt sich der Umstieg? Nutzt Du Camtasia 9 regelmäßig? Dann lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall. Durch die höhere Performance kannst du schneller arbeiten. Die neuen Features machen die Bearbeitung einfacher. Hast Du Camtasia 9 gekauft aber noch nicht viel damit gearbeitet? Dann starte mit der Erstellung der ersten Videos in Camtasia 9. Die Benutzeroberfläche und Bedienung ist fast identisch mit Camtasia 2018. Das Update kannst du kaufen, wenn Du Camtasia intensiver nutzt. Du verwendest Camtasia 8 oder eine vorherige Version und erstellst mehr als 1 Video pro Jahr? Dann wird es höchste Zeit für den Umstieg. Schon Camtasia 9 bietet tolle neue Funktionen und eine bessere Performance als die Vorgänger. Mit Camtasia 2018 ist die Perfomance noch einmal gestiegen und die Bearbeitung noch einfacher geworden. Link zur Episode: https://www.techsmith.de/store/camtasia/upgrade https://www.facebook.com/groups/ScreencastHero/ https://screencasthero.de/
An Pädagogischen Hochschulen werden Lehrerinnen und Lehrer für fast alle Schulformen ausgebildet, es gibt sie inzwischen in Deutschland nur noch in Baden-Württemberg. Beispielsweise seien die Pädagogische Hochschule Heidelberg und die Pädagogische Hochschule Karlsruhe genannt- hier in Karlsruhe gibt es zusätzlich auch eine Abteilung für Didaktik an der Fakultät für Mathematik am KIT. An den pädagogischen Hochschulen werden aber nicht nur Pädagogik und Didaktik unterrichtet, sondern auch die entsprechenden Fachrichtungen und jeweilige didaktische Konzepte in diesen Fachrichtungen. Christian Spannagel unterrichtet so als Professor für Mathematik und Informatik in den Fächern, und erzählt im Gespräch mit Sebastian Ritterbusch, wie er didaktische Konzepte für den Mathematikunterricht erforscht und aktiv erprobt. Die Frage nach Verbesserung des Mathematik-Unterrichts ist sehr aktuell: Die OECD-Studie zu Geschlechtsunterschieden in der Schule hat gerade in Mathematik Verbesserungspotential aufgezeigt, denn viele geben Mathe auf, weil sie nachweislich fälschlich glauben, sie könnten es nicht. Der zentrale Begriff ist hier die Selbstwirksamkeitserwartung, die insbesondere in Naturwissenschaften und Mathematik durch gesellschaftliche Einflüsse stark geprägt ist. Die Erforschung neuer Lehrmethoden kann aber nicht den Ersatz der bisherigen und erprobten Konzepte zum Ziel haben: So sind selbst vermeintlich alte Übungen zum Kopfrechnen und zur schriftlichen Division auch heute noch überaus wichtige Hilfen zur Vermittlung von Algorithmen, Stellenwertsystemen und auch zur Vorbereitung auf ein Studium. Das Ziel muss sein, den Fundus möglicher Vermittlungsformen zu bereichern, und für verschiedene Konzepte bessere Kombinationen der Verfahren zu finden. Ein nützliches neues Werkzeug ist die Tabellenkalkulation, mit der beispielsweise Würfelexperimente und Simulationen im Unterricht interaktiv erfahrbar gemacht werden können. Ebenso können Dynamische Geometriesysteme den Zugang zur Konstruktion und Analytischer Geometrie, wie beispielsweise den Satz des Thales, deutlich vereinfachen. Die Software GeoGebra ist ein solches System, das insbesondere auch unterschiedliche Darstellungen und Analyse der Konstruktionen ermöglicht. Leider ist es zu Zeit noch nicht möglich, dass in Klassen jederzeit an jedem Platz ein Rechner zum Einsatz interaktiver Experimente vorhanden ist. Aber auch an einem interaktiven Whiteboard können die Methoden durchgeführt werden. Die technische Ausstattung ist aber nur ein kleiner Schritt zur Einführung neuer Werkzeuge in den Unterricht, auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen die Kompetenzen zum Einsatz der neuen Medien erlernen. Hier müssen die pädagogischen Hochschulen den Lehramtsstudierenden den Weg bereiten, damit das Lehrpersonal zu Beginn und auch in ihrer langen Lehrzeit für den Stand und die Entwicklung der Technik vorbereitet ist. Auch Wissensmanagement in der Form von Wikis haben in Schulen Einzug gehalten, so setzen Maria Eirich und Andrea Schellmann auf ein Schulwiki am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt und Lernpfade zum interaktiven Mathematik-Unterricht. Auch Schülerinnen und Schüler können hier selbst Quiz-Aufgaben erstellen. Michael Gieding und Andreas Schnirch haben für Geometrie-Vorlesungen an der PH Heidelberg ein Geometrie-Wiki auf dieser Technologie erstellt, das auch weiterhin für Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende genutzt wird. Eine Einführung in die frühen interaktiven Elemente am CMS der Fakultät für Mathematik sind auf der Fragebogen-Seite mit einer Vielzahl von Beispielen zu finden. Gerade in Mathematik stellt die Einbindung digitaler Medien eine gewisse Hürde dar, da Formeln, Beweise, Algorithmen und Konstruktionszeichnung nicht leicht digitalisierbar sind- auch wenn das Textsatz-System LaTeX oder LyX im mathematischen Bereich mit perfektem Druckbild für fast alles verwendet werden kann, so muss man es erst erlernen- beispielsweise mit der l2kurz-Anleitung. Das Austauschen von abfotografierten Seiten ist da häufig deutlich effektiver. Dabei ein solcher Austausch zwischen den Lernenden sehr zu begrüßen, da es zum einen die gemeinsame Konstruktion von Lösungswegen begünstigt, aber auch die angehenden Lehrenden auf die Nutzung der Medien trainiert. Wichtig sind niederschwellige Zugänge und die Möglichkeit zu anonymen Beiträgen, da nur so das Lernen aus Fehlern ermöglicht wird. Im Flipped Classroom wird der Prozess der interaktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, der traditionell zu Hause erst bei den Hausaufgaben auftritt, in den Unterricht gebracht, und der herkömmliche Frontal-Unterricht aus dem Klassenzimmer verbannt. Dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden zur Vorbereitung ein Video, in dem das grundsätzliche Verfahren erklärt wird. Die Unterrichtsstunde kann dann mit einer Fragerunde zum Videomaterial starten, gefolgt von einigen Aufgaben, die vom Plenum in Gruppenarbeit bearbeitet werden sollen. Hier werden Probleme und Fragen offensichtlich, die vom Lehrenden oder gemeinsam in einer Diskussion erörtert werden können. Anschließend könnte sich ein Hörsaal- oder Klassenzimmerspiel anschließen, das sowohl auflockert, als auch das Thema verfestigt. Dass besondere Ereignisse den Lernerfolg verbessern können, wurde auch beim Thema >Gestern hab ich noch Zeit genug< im Methodisch-Inkorrekt Podcast Folge 43 besprochen. Auch wenn es nicht immer außerordentliche Ereignisse geben kann, so ist eine sinnvolle Abwechslung der Lehrmethoden sicher zuträglich zur Verbesserung des Unterrichts. Neben der Frage zur zeitlichen Planung des Unterrichts sind auch Fragen innerhalb der Mathematik eine Untersuchung auf mögliche Vermittlungsmethoden interessant: Die Gaußsche Summenformel ist nicht nur wichtig zur Berechnung der Anzahl der Spiele in einer Fußball-Liga, sondern auch ein schönes Beispiel zur verschiedene mathematische Beweisverfahren. Die Formel kann durch vollständige Induktion bewiesen werden, ein anderer Ansatz ist die Verwendung von Dreieckszahlen zu einem ebenso korrekten ikonischen Beweis der Summenformel. Einen wichtigen Stellenwert hat auch die Haltung der Lehrperson: Anstatt zu demoralisieren, müssen die Lernenden in ihrem Lernprozess unterstützt und bei Bedarf geleitet werden. Dazu gehört auch die Anpassung der Komplexität an die unterschiedlichen Kenntnisse der Lernenden- eine fast unmögliche Aufgabe angesichts großer Unterschiede in den Vorkenntnissen. Eine Möglichkeit sind Angebote für optionale Übungsgruppen, oder Zusatzangebote für weitergehende Fragen. Ideal sind jedoch natürlich differenzierende Aufgaben, die von allen Lernenden je nach ihrem Kenntnisstand hinreichend und unterschiedlich umfangreich beantwortet werden können. Ein Beispiel ist hier die Aufgabe zu den Pythagoreischen Zahlentripeln, die sehr knapp, aber auch sehr weitreichend beantwortet werden kann. Eine andere interessante Frage steckt im Münzproblem, die man bis zur Frage der kleinsten Anzahl von Münzen zur Rückgabe aller Geldbeträge von 1-99 Cent beantworten kann (Optimal sind acht Münzen in vier möglichen Variationen: zB 1+1+2+5+10+10+20+50 oder 1+2+2+5+10+20+20+50). Die Frage der Evaluation von Unterrichtsmethoden wie dem Flipped Classroom ist leider nicht einfach zu beantworten: Es ist kaum möglich zwei Gruppen parallel und voneinander unbeeinflusst unterschiedlich zu unterrichten. Bei einer Evaluation zwischen verschiedenen Jahrgängen konnte ein besseres Abschneiden bei Prüfungen nicht sicher nachgewiesen werden, jedoch ist war das subjektive Empfinden der Studierenden gegenüber den neuen Methoden ausgesprochen positiv. Malte Persike hat entsprechende Ergebnisse erhalten, u.a. beim MOOC zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, stellt aber auch zur Diskussion, dass bei mit herkömmlichen Methoden weniger erfolgreichen Dozenten die neue Methoden deutlich bessere Ergebnisse erzielen könnten. Bei der Umstellung auf Flipped Classroom-Konzepte ist die Videoerstellung oft nicht sehr aufwendig, da hier abgefilmte frühere Veranstaltungen in Frage kommen können. Dafür ist die Umstellung und die Planung des neuen Unterrichts oftmals deutlich aufwendiger, wenn man eine Stunde zum ersten Mal durchführt. Anders sieht es bei einem Massive Open Online Course, kurz MOOC, aus, für den Videos deutlich aufwendiger und in kürzerer Form produziert werden. MOOCs sind besonders durch Sebastian Thrun bekannt geworden, als er eine Vorlesung zur künstlichen Intelligenz online zur Verfügung stellte, an der etwa 160'000 Studierende teilnahmen. In der Regel werden Videos mit vorlesungsartigen Inhalten wöchentlich online gestellt, zu denen die Teilnehmer regelmäßig Aufgaben gestellt bekommen. Durch Verfügbarkeit im Internet können sehr viele an diesen Kurs teilnehmen, und durch die Verwendung offener Technologien und Zugänge ist die Teilnahme sehr niederschwellig und spricht viele Interessenten an. An der PH Heidelberg wurde der Mathe-MOOC Mathematisch Denken von Christian Spannnagel, Michael Gieding, Lutz Berger und Martin Lindner ins Leben gerufen, der das MOOC-Konzept nicht ganz klassisch umgesetzt hat. Viel mehr wurde ein Schwerpunkt auf Mathematikdidaktik gelegt: Statt einem festen Wechsel von Vorlesung und Übung wurden einführende experimentelle Einheiten eingesetzt, bei denen die Teilnehmenden schon im Vorfeld Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema machen konnten. Die Bearbeitung der Aufgaben und der Vergleich der Lösungen erfolgte dann in öffentlichen Foren- eine abschließende Prüfung war in diesem MOOC nicht vorgesehen, sondern möglichst vielen einen Einstieg in die mathematische Denkweise ermöglichen. Die Teilnehmenden können sich selbst als Kiebitze, Anpacker und Formalisierer bezeichnen, auch von Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich- die Kiebitze sind hauptsächlich passive Zuschauer, wogegen die Anpacker die Lösungen aktiv, beispielsweise ikonisch, erarbeiten wollen. Die Formalisierer suchen schließlich die exakte mathematische Beschreibung und symbolische Lösung der Aufgaben. Diese Differenzierung ermöglicht eine Klarstellung der eigenen Teilnahmeabsicht und vereinfacht durch die Vorgabe verschiedener Ansätze den Zugang in den jeweiligen Nutzungsszenarien. MOOCs können und sollten herkömmliche Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sondern die Nutzung wie beim Flipped Classroom-Konzept die Qualität der Präsenzveranstaltungen verbessern. Ausgesprochen sinnvolle Beispiele zum Einsatz von MOOCs sind Brückenkurse vor Studienbeginn, wo noch nicht alle Studierende am Studienort sind, oder in der Weiterbildung für Berufstätige. Der Mathe-MOOC Mathematisch Denken findet aktuell jedes Semester statt, und wer mitmachen möchte, kann jeweils Anfang April oder Anfang Oktober einsteigen. Die Kurse werden auch kontinuierlich weiter entwickelt. So werden nun mit Christian Freisleben-Teutscher Improvisationsmethoden eingebunden, um die gegenseitige Interaktion zwischen den Teilnehmenden zu fördern. Schon seit Beginn des Mathe-MOOCs sind auch szenische Darstellungen sehr erfolgreicher Teil der Darstellung, und dienen der Motivation und Auflockerung der manchmal trockenden Mathematik. So tritt Christian Spannagel oft als Dunkler Lord auf, der auf seine besondere Weise die Mathematik erklärt. Wie es schon Jean-Pol Martin formulierte, haben Professoren die Verantwortung neue Wege zu gehen, um für die Gesellschaft auch riskantere Wege einzuschlagen. Auch am KIT werden erfolgreich MOOCs angeboten, und der MOOC gegen Chronisches Aufschieben wurde vor kurzem mit dem Bildungsmedienpreis digita ausgezeichnet. Ein weiterer neuer Zugang ist die Gamification, bei der spielerische Elemente in spielfremde Bereiche eingeführt werden. Dies kann durch die Zuteilung von Punkten, Leveln oder Abzeichen bzw. Badges erfolgen, und dies kann auch in der Hochschullehre eingesetzt werden. Die Wahl eines Kontexts hat sich aber als kritisch herausgestellt: Wenn die Lernenden sich nicht mit dem Spiel identifizieren können, ist kaum ein Erfolg zu erwarten. Nando Stöcklin und Nico Steinbach entwickelten das erfolgreiche System QuesTanja, mit den Schülerinnen und Schüler mit Tablets selbstständig Mathematik erlernen können. Die Forschung richtet sich hier auf die Konzepte des Design-based Research, sie konzentriert sich also darauf die Methode zu entwickeln und iterativ und zyklisch zu verbessern. Auch zum Erlernen des Programmierens haben sich spielerische Konzepte bewährt, ein Beispiel dafür ist die Plattform Scratch und ScratchJr, oder auch Lightbot. Diese Lernprinzipien gehen auf Seymour Papert zurück, der schon mit der Programmiersprache Logo den Grundstein zu erziehungsorientierten Programmiersprachen gelegt hat. Die Logo-Programmiersprache gab es als Schildkrötengrafik auch schon im NDR-Klein-Computer. Eine interessante Frage im Umgang mit neuen Medien in Lehre und Wissenschaft ist die Zitierbarkeit der Angebote. Auf der einen Seite geben sich neue Nutzungsmöglichkeiten durch direkte Links an bestimmte Zeitpunkte, jedoch sind Zitate auf Videos, Audiodateien und Internetseiten noch nicht in der wissenschaftlichen Literatur etabliert. Neue Ansätze zur Vortragsaufzeichnung beim KonScience Podcast werden diskutiert. Ein wichtiger Ansatz ist auch die Vergabe von DOI-Nummern für digitale Medien, wie es auch im Open Science Radio Podcast angesprochen wurde. Letztendlich kann man bei der Erstellung von Videos für den Unterricht nicht zu viel Perfektionismus an den Tag legen, wie es auch schon Aaron Sams formulierte: "Do you need it perfect, or do you need it by Tuesday?" Literatur und Zusatzinformationen C. Spannagel: Digitale Medien in der Schule: in medio virtus, LOG IN, 180, 22-27, 2015. M. Fischer, C. Spannagel: Lernen mit Vorlesungsvideos in der umgedrehten Mathematikvorlesung, In J. Desel, J. M. Haake & C. Spannagel (Hrsg.), DeLFI 2012 – Die 10. e-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. (S. 225-236). Bonn: Köllen Druck+Verlag, 2012. C. Spannagel, J. Spannagel: Designing In-Class Activities in the Inverted Classroom Model, In J. Handke, N. Kiesler & L. Wiemeyer, L. (Hrsg.) (2013). The Inverted Classroom Model. The 2nd German ICM-Conference (S. 113-120). München: Oldenbourg Verlag, 2013. Flipped Classroom: Die umgedrehte Mathematikvorlesung Video: 10 Irrtümer zum Einsatz digitaler Medien in der Schule Podcast Lob und Tadel 019: Schulmathematik
Imaging of physiological retinal structures in various raptor species using Optical Coherence Tomography (OCT)
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Die Optische Kohärenztomografie (OCT) ist eine neue Technik, die vor kurzem in der Humanophthalmologie etabliert wurde und sich durch ihr Potential auszeichnet, Retinastrukturen in vivo und nicht-invasiv (ohne Augenkontakt) in einer Qualität vergleichbar mit der von Histologieschnitten darzustellen. Diese Technik ermöglicht es, minimale pathologische Veränderungen bei fast histologischer Auflösung darzustellen, sowie longitudinale Untersuchungen im Verlauf der Erkrankung oder Therapie durchzuführen. In der Tiermedizin, vor allem in der Vogel-Ophthalmologie, wurde bis jetzt OCT nur sehr selten angewendet. Das Hauptziel dieser Studie war es daher, die Eignung der OCT-Technik als eine Darstellungsmethode in der Vogel-Ophthalmologie zu evaluieren. Um dieses Ziel zu erreichen, fokussierte diese Studie auf die Darstellung der physiologischen Retinastrukturen von Greifvögeln. Des Weiteren wurde die Anwendung von OCT bei vielen verschiedenen Greifvogelarten evaluiert, um erste Hinweise auf Unterschiede zwischen unterschiedlichen Arten und auf innerartliche Unterschiede der Retinastruktur zu gewinnen. Die Ergebnisse der OCT-Augenuntersuchungen wurden mittels histologischer Untersuchungen validiert. Um die Möglichkeiten der Darstellung der physiologischen Retinastrukturen von Greifvögeln mittels OCT zu überprüfen, wurden 56 wilde Tag- und Nachtgreifvögel drei verschiedener Familien und 12 verschiedener Arten untersucht. Alle einbezogenen Vögel waren Patienten der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Zierfische der Ludwig-Maximilians-Universität München und wurden meist mit Verdacht auf Trauma vorgestellt. Die OCT-Untersuchungen wurden an Augen und Retinaregionen durchgeführt, welche nach einer vorherigen ophthalmologischen Untersuchung als gesund erachtet wurden. Bei Vögeln, die aufgrund ethischer und Tierschutzgründen euthanasiert werden mussten, wurden die Augen zur Validierung der OCT-Technik histologisch untersucht. Zur Darstellung der Retina wurde in der vorliegenden Untersuchung das Modell Spectralis® HRA+OCT Plus (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) verwendet. Die Bearbeitung der Fotos wurde mit der Spectralis Software Heidelberg Eye Explorer® (HEYEX) version 5.4 (October 2011, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) durchgeführt. Abhängig von der zu erwartenden Stresstoleranz des Patienten erfolgte die OCT Untersuchung im wachen Zustand oder es wurde vor Beginn der Untersuchung eine Sedation mit Midazolam (2 mg/kg KM) oder eine Inhalationsnarkose durchgeführt. Bei der Untersuchung des Fundus wurden fünf unterschiedliche Areale einbezogen, und zwar eine Region unmittelbar superior des Pecten oculi einschließlich eines Teils des Ansatzes des Sehnervenkopfes, die sagitalste Region des retinalen Äquators und des Fundus superior sowie die am weitesten temporal und nasal gelegenen Bereiche des Äquators. Dickemessungen der Retinaschichten in unterschiedlichen Retinaabschnitten wurden durchgeführt, um potentielle Dickeunterschiede darzustellen. Die Messungen beinhalteten erstens die gesamte Retina-Dicke (TRT) von dem retinalen Pigmentepithel bis zur Membrana limitans interna, zweitens die Nervenfaserschicht und Ganglienzellschicht (RNFL+GCL), drittens die äußere Retina (OR), mit den Schichten zwischen dem retinalen Pigmentepithel und der innersten Grenze der äußeren Körnerschicht, und viertens die Schichten zwischen dem retinalen Pigmentepithel und der äußeren Grenzmembran (RPE-ELM). Die histologischen Schnitte der Augen wurden nach einem Standardprotokoll mittels Davison’s Lösung als Fixation und Haematoxylin & Eosin Färbung angefertigt. Mittels OCT-Technik konnte die physiologische Struktur der Greifvogelretina mit einer Auflösung, die nicht von anderen tomographischen Techniken erreicht wird, reproduzierbar dargestellt werden. Die TRT und die RNFL+GCL war bei allen Spezies in der Region superior des Pectens maximal und verminderte sich zu den peripheren Regionen hin. Im Gegensatz dazu blieben die OR und die RPE-ELM von gleicher Dicke. Zwischen den einzelnen Spezies variierten die gemessenen Werte. Die gesamte Retinadicke (TRT) war bei Taggreifvögeln höher als bei Nachtgreifvögeln. Die Werte für OR und RPE-ELM hingegen waren bei Nachtgreifvögeln höer als bei Taggreifvögeln. Bei Pernis apivorus, Asio otus und Aegolius funereus konnte die äußere Körnerschicht nicht differenziert werden. Die OCT-Untersuchung der Greifvogel-Retina kann zusammenfassend als eine wertvolle Methode in der Vogelophthalmologie beurteilt werden. Diese Studie bietet die Grundlage für die Interpretation von OCT-Ergebnissen hinsichtlich pathologischer Veränderungen der Retina von Greifvögeln, sowie die Basis für eine in vivo Kontrolle von Krankheitsverläufen der Retina und die Beurteilung von Behandlungserfolgen über die Zeit.
Erstellung und Bearbeitung von dreidimensionalen Ultraschall-Datensätzen von gesunden und kranken felinen Herzen sowie Entwicklung von Katzenmodellen für den Einsatz in einem Echokardiographie-Simulator
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
In der Tiermedizin gehört die echokardiographische Untersuchung vor allem im Kleintierbereich zu den Standarduntersuchungen auf dem Gebiet der Kardiologie. Das Erlernen der Echokardiographie setzt jedoch voraus, dass Studierende der Tiermedizin und/ oder Tierärztinnen und Tierärzte die Möglichkeit haben die Echokardiographie praktisch selbst zu üben, um das korrekte Einstellen der gebräuchlichen Standardschnittebenen in der zweidimensionalen Echokardiographie zu erlernen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eigens für die Tiermedizin ein Echokardiographiesimulator für die Katze entwickelt. Da die elektronisch-technischen Grundlagen mit geringfügigen Modifikationen von einem humanmedizinischen Ultraschall- und Echokardiographiesimulator, dem SonoSim III der Firma Sonofit GmbH, Darmstadt, übernommen werden konnten, lag der Fokus dieser Arbeit auf der Bestückung des Simulators mit geeigneten Echokardiographiedatensätzen von herzgesunden und herzkranken Katzen, sowie dem Entwurf und der Konstruktion von realitätsnahen Katzenattrappen einerseits und Untersuchungstischen andererseits. Die Datensätze, die in den Simulator integriert wurden stammen von dreidimensionalen Echokardiographiedatensätzen verschiedener feliner Patienten. Es wurde in Abhängigkeit ihrer zugrundeliegenden Erkrankung und ihrer Relevanz sowie der Qualität des Datenmaterials die Datensätze einer gesunden und zwei herzkranker Katzen ausgewählt. Eine Jungkatze wies einen deutlichen perimembranösen Ventrikelseptumdefekt (VSD) auf, der auch ohne Doppler im B-Bild zu erkennen war. Die zweite herzkranke Katze zeigte eine asymmetrische Hypertrophie des Kammerseptums und der Papillarmuskeln (HCM), sowie eine mittelgradige Aortenklappeninsuffizienz. Der VSD und die HCM sind laut Literatur die häufigste angeborene bzw. erworbene Herzerkrankung der Katze. Die 3D-Datensätze wurden in ihre kleinsten Einheiten, die Einzelbilder, zerlegt, manuell bearbeitet, wieder zusammengefügt und der daraus entstandene Datensatz anschließend in den Simulator geladen. Die Bearbeitung diente einerseits der Verbesserung der Qualität durch Minimierung von Artefakten und andererseits der Verdeutlichung der kardialen Morphologie durch unterschiedliches Einfärben der rechten und linken Herzhälfte. Dadurch wird garantiert, dass die simulierten 2D-Echokardiogramme annähernd dem Standard heutiger realer 2D-Ultraschallbilder des Herzens entsprechen. Durch die farblich unterschiedliche Markierung der Herzhälften wird die Orientierung auch für ungeübte Untersucher erleichtert. Im Rahmen der anschließenden Umfrage, wurde die Realitätsnähe der Schnitteben von über 90% der befragten echokardiographisch vorgebildeten Studierenden als sehr gut und gut beurteilt. Auch der Wert der Kolorierung erhielt von 86 % der Studierenden sehr gute und gute Noten. Ein Untersuchungstisch wurde auf eine Art und Weise entworfen und konstruiert, dass eine praxisnahe Handhabung möglich war und gleichzeitig auf jegliches Metall als Werkstoff verzichtet werden konnte, um die Technik des Simulators nicht zu stören. Dieser Tisch wurde mit zwei austauschbaren Tischplatten, auf denen jeweils eine Katzenattrappe in linker und rechter Seitenlage fixiert war, bestückt. Das Innere der Katzenattrappen besteht aus einem Schaumstoffkern, in den Merkmale einer echten Katze, zum Beispiel Rippen zur Orientierung eingearbeitet wurden. Bezogen wurde der Schaumstoffkern mit einem maßgefertigten Kunstfell, das ebenfalls über spezifische Orientierungsmarken wie zum Beispiel die Ellbogenhautfalte verfügt. Die befragten Studierenden äußerten sich zu Design der Katzen sowie zu Funktionalität und Design des Tisches mehrheitlich überaus positiv (88 % gut oder sehr gut). Anhand der bearbeiteten Datensätze wurden drei Patientenfälle im Simulator erstellt und dazu passende Tutorials entwickelt, um auch autodidaktisches Lernen zu ermöglichen. Bei der anschließenden Evaluierung gaben 100 % der Befragten an, dass der Simulator eine sehr gute (89%) und gute (11%)Ergänzung zur echokardiographischen Untersuchung am lebenden Tier ist. Sogar 52 % der Studierenden betrachten den Simulator als sehr gute (6%) oder gute (46%) vollständige Alternative zum lebenden Tier in der Echokardiographieausbildung.
Live in Coburg, in der alten Schmiede, hab ich im September eine Gruselgeschichte erzählt. Die Bearbeitung diese Aufzeichnung könnt ihr heute hier, als Halloweengeschichte hören. Etwaige Versprecher, Knackser, Lautstärkenunterschiede oder unpassende Geräusche, sind dem Live-Event geschuldet. Da wir in der alten Schmiede Lichteffekte und Nebel hatten, bin ich natürlich bei einer rein hörbaren Folge ohne Bild gezwungen, das Ganze irgendwie anders für die Ohren darzustellen. Jetzt freut euch auf: Die alte Schmiede, Eleonora, ein Grab hinterm Haus, ein geheimes Geheimfach, das dunkle Moor, die strenge Mutter, geschmiedete Liebe und einen Spuk den das alles umgibt... Es werden Jingles, Hintergrundmusik oder Sounds selbst gebastelt mit dem Programm Garageband, sowie mit mobilen digitalen Recordern aufgenommen und gesammelt. Ebenso finden Verwendung, Sounds und Jingles von Apple Garageband, als auch aus Apple JamPacks, enthalten in der Software MainStage, welche nach den dort angegebenen Lizenzen gemafrei sind und genutzt werden dürfen. Weitere gemafrei Musik, Intro, Outro, Jingles, Hintergrund-, Zwischen- und Hörspielmusik sind von einem offiziellen Musikstudio, für diesen Podcast, auf meinen Namen, zur Hobbynutzung lizenziert. (ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, das jede andere Nutzung dieser Musik, nicht zulässig ist) www.meikys-podcast.de
In Wuppertal vermehren sich Elefanten besonders gut, warum? Hört´s euch an. Ausserdem habe ich mein erstes geschnittenes Videofilmchen nach 7Load hochgeladen, und welch ein Zufall, es ist vom Podcastertreffen in Köln. Die Bearbeitung hat mich echt Nerven gekostet. Dann noch ein Promo von "M" vom Neulich Podcast, den findet man auf meiner Link - Seite www.wuppercast.de
Möglichkeiten eines DMO-Prozesses in der CMP-Refraktionsseismik
Fakultät für Geowissenschaften - Digitale Hochschulschriften der LMU
Die herk¨ommlichen Wellenfeldbearbeitungen der CMP-Refraktionsseismik basieren auf N¨aherungsl¨osungen f¨ur kleine Schichtneigungen. Dieser Ansatz hat sich f¨ur Schichtneigungswinkel bis zu ca. 100 bew¨ahrt. Mit gr¨oßer werdendem Neigungswinkel verschlechtern sich die Ergebnisse der CMP-Refraktionsseismik aber zunehmend. Große Neigungswinkel machen sich in zu hoch bestimmten Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten und einer schlechteren Fokussierung auf gemeinsame Untergrundabschnitte durch die CMPSortierung bemerkbar. Die Probleme falsch bestimmterWellenausbreitungsgeschwindigkeiten und die schlechtere Fokussierung auf gemeinsame Untergrundspunkte, sind auch aus den Anf¨angen der CMP-Reflexionsseismik bekannt. Es gelang zuerst Judson, Shultz und Sherwood (1978) mit der Einf¨uhrung eines zus¨atzlichen Korrekturschritts das CMP-Konzept so zu erweitern, daß auch das reflektierte Wellenfeld von geneigten Schichtgrenzen korrekt bearbeitet werden konnte. Ihr Verfahren, das sie DEVILISH nannten, wurde durch eine Vielzahl von Autoren weiter verbessert und ist heute unter dem Namen DMO weitl¨aufig in der Seismik bekannt. Die DMO hat sich zum Standardschritt in der modernen seismischen Datenverarbeitung etabliert. Die vorliegende Arbeit besch¨aftigt sich erstmals mit der M¨oglichkeit einer DMOKorrektur f¨ur die CMP-Refraktionsseismik. Zu diesem Zweck mußte zun¨achst das DMOKonzept aus der Reflexionsseismik in die Refraktionsseismik ¨ubertragen und in mathematischen Grundgleichungen quantifiziert werden. F¨ur eine Erprobung der Refraktions-DMO an seismischen Daten mußte man aus den Grundgleichungen einen geeigneten Algorithmus konstruieren. Die ¨Ubertragung des DMO-Konzepts aus der Reflexionsseismik in die Refraktionsseismik erfolgte in Kapitel 3. In Kapitel 4 wurden die zugeh¨origen Grundgleichungen mit Hilfe des Hales-Kreises nach Hales (1958) hergeleitet. Es zeigt sich, daß die gewonnenen Grundgleichungen nicht mehr von der Zeit- bzw. der Ortskoordinate abh¨angen. Weil auch die LMO-Korrektur unabh¨angig von der Zeit ist, sind LMO und Refraktions-DMO,im Gegensatz zu NMO und Reflexions-DMO, im Processing kommutativ. Die Kommutativit ¨at vereinfacht das urspr¨unglich in Analogie zur Reflexionsseismik entwickelte Processing. Die Stapelung kann nach DMO (ohne vorherige LMO) mit den neigungsfreien Stapelgeschwindigkeiten entlang schr¨ager Geraden erfolgen. F¨ur die iterative Geschwindigkeitsbestimmung ben¨otigt man statt LMO-, DMO- und inverser LMO-Korrektur nur eine einfache DMO-Korrektur. Diese Erkenntnis f¨uhrt zu dem in Kapitel 3 beschriebenen Processingvorschlag. Aus den Grundgleichungen konnte in Kapitel 4 ein DMO-Algorithmus entwickelt werden. Dieser Algorithmus wirkt auf die fouriertransformierten COF-Wellenfelder. Der Weg ¨uber den Frequenz-Wellenzahl-Bereich hat sich auch schon bei der Reflexions-DMO bew¨ahrt (s. z.B. Hale, 1984; Jakubowicz, 1990). Ein o®ensichtlicher Vorteil beim Wechsel des Koordinatensystems ist, daß die recht komplizierte und numerisch aufwendige Operation der Faltung zu einer einfachen Multiplikation des Spektrums mit einem Operator wird. Im DMO-Verfahren von Hale (1984) macht sich der Autor einen heuristischen Ansatz zunutze. Es zeigt sich in dieser Arbeit, daß dieser heuristische Ansatz von Hale (1984) auch f¨ur die Refraktions-DMO funktioniert. Der gewonnene DMO-Operator (Gl. 4.64) f¨ur die Spektren der COF-Familien wurde auf dem Rechner implementiert. Bei der Implementierung der Refraktions-DMO f¨ur diskrete Wellenfelder m¨ussen die Eigenarten der Diskreten Fouriertransformation beachtet werden. Zur Vermeidung des wrap-around- E®ekts wurde deshalb eine Option zum Anf¨ugen von Nullspuren vorgeschlagen. Die bei Migrationsalgorithmen immer auftretenden, st¨orenden Ausschmierungen an den Enden der Laufzeitkurven, konnten durch eine Option zur Beschr¨ankung der ¨O®nungsweite teils unterdr¨uckt werden. Die Grundgleichungen lassen sich auch f¨ur eine theoretische Vorhersage ¨uber die Wirkungsweise des Prozesses bei der iterativen Geschwindigkeitsbestimmung nutzen. Durch die verschiedenen numerischen Versuche prognostiziert man ein schnelles Konvergieren bei den neigungsfreien CRP-Scheingeschwindigkeiten. Diese theoretische Prognose wurde mit Versuchen an synthetischen Datens¨atzen unter Verwendung des DMO-Algorithmus f¨ur den Frequenz-Wellenzahl-Bereich in Kapitel 5 best¨atigt. Die Grundgleichungen der Refraktions-DMO wurden, wie ¨ubrigens auch die Gleichungen f¨ur die Reflexions-DMO, auf der Basis des sehr einfachen 2-Schichtenmodells mit konstanten Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten hergeleitet. Im Fall mehrerer Schichten im Hangenden einer Schichtgrenze f¨uhrt der Einsatz Reflexions-DMO i.d.R. trotzdem zu einer Verbesserung. Das Processing der CMP-Reflexionsseismik ist dann allerdings nicht mehr exakt richtig. F¨ur die Refraktions-DMO konnte mit Hilfe der Grundgleichungen gezeigt werden, daß das Verfahren bei geeignet gew¨ahlten Korrekturparametern vhan und vref sehr gut funktioniert. Mit den neigungsfreien CRP-Scheingeschwindigkeiten des direkt angrenzenden Hangenden f¨ur vhan kann man wie im 2-Schichtenfall, die neigungsfreien CRP-Scheingeschwindigkeiten des Refraktors exakt bestimmen. Die theoretisch, auf der Basis der Grundgleichungen getro®enen Aussagen, konnten an einem synthetischen Datensatz erprobt werden. Die simulierten Seismogramme wurden mit Hilfe eines Cerveny-Raytracing-Programms auf der Basis eines Mehrschichtenfalls mit Geschwindigkeitsgradienten berechnet. Anschließend wurde der Datensatz nach dem Konzept aus Kapitel 3 mit DMO bearbeitet. Das verwendete Modell wich dabei bewußt von dem zur Herleitung der DMO verwendeten Modell ab, um bei der Bearbeitung auch die Grenzen des DMO-Verfahrens auszuloten. Sowohl die Geschwindigkeitsgradienten, wie auch die kleinen Neigungen im Hangenden, wurden in der Theorie der Refraktions-DMO nicht ber¨ucksichtigt. Die Bearbeitung des synthetischen Datensatzes demonstrierte die stabile Funktionsweise der f-k-DMO. Auch die großen Amplituden anderer Wellentypen (Reflektierte und Direkte Welle) bzw. das aufaddierte Rauschen konnten die Funktionsweise nicht beeintr¨achtigen. Es zeigte sich, daß man die Geschwindigkeiten nicht durch eine langwierige Iteration verbessern mußte. Schon nach einer DMO-Korrektur mit den zu großen neigungsabh¨angigen CMP-Scheingeschwindigkeiten ließen sich die anschließend ermittelten CRP-Scheingeschwindigkeiten nicht weiter verbessern. Die Scheingeschwindigkeiten wurden mit einer ¢tV-Inversion in Geschwindigkeitstiefen-Funktionen gewandelt und zu einem 2-dimensionalen Geschwindigkeitsmodell kombiniert. Der Vergleich dieses Modells mit dem Ausgangsmodell und mit dem Modell einer CMP-Bearbeitung ohne DMO-Korrektur zeigte die Vorteile der Refraktions-DMO bei der Geschwindigkeitsbestimmung. Der zweite Ansatzpunkt bei der Konzeptionierung der Refraktions-DMO, die verbesserte Fokussierung auf gemeinsame Untergrundabschnitte, war weniger erfolgreich. Die DMO-Bearbeitung brachte keine Vorteile bei der Darstellung der refraktierenden Strukturen gegen¨uber der CMP-Bearbeitung ohne DMO. Theoretisch sollte allerdings zumindest die verbesserte Geschwindigkeitsbestimmung zu einer besseren Lotzeittransformation f¨uhren. Der E®ekt war allerdings gering. Die theoretisch erdachten Verbesserungen der Refraktions-DMO konnten an dem synthetischen Datensatz also gr¨oßtenteils best¨atigt werden. Allerdings basiert die Theorie der Refraktions-DMO, wie ¨ubrigens die Theorie der Reflexions-DMO auch, auf der Annahme zumindest lokal planarer Schichtgrenzen. Die Erweiterung der CMP-Refraktionsseismik auf gekr¨ummte Schichtgrenzen ist eine sehr spannende und anspruchsvolle Herausforderungen. Es ist zu erwarten, daß mit einer erweiterten CMP-Refraktionsseismik noch große Fortschritte in der Abbildung der refraktierenden Strukturen durch das Wellenfeld zu erzielen sind. Ho®entlich regen die ¨Uberlegungen und Ergebnisse dieser Arbeit m¨oglichst viele Leser zu Weiterentwicklungen der CMP-Refraktionsseismik an.