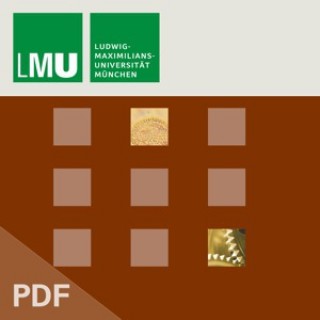Podcasts about die erforschung
- 68PODCASTS
- 84EPISODES
- 33mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Dec 4, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about die erforschung
Latest news about die erforschung
- FRÜHER TOD IM SPÄTANTIKEN VINDONISSA – GPV XXVIII. Interdisziplinäre Auswertung des spätantiken Gräberfelds Windisch-Tschanz AWOL - The Ancient World Online - Apr 8, 2025
Latest podcast episodes about die erforschung
Heino Falcke ist Astrophysiker und Laienprediger in der evangelischen Kirche. Für ihn passt das sehr gut zusammen. Ein Gespräch über Naturgesetze, die Schöpfungsgeschichte und Wissenschaftler als moderne Propheten. (00:00:55) Begrüßung (00:02:06) Vorstellung Heino Falcke (00:04:16) Der Weihnachtsstern als besondere Konjunktion? (00:06:11) Wissenschaft und Glaube – wie geht das zusammen? (00:07:40) Wer ist Gott? (00:10:05) Die Naturgesetze (00:16:21) Der Urknall (00:18:25) „Lückenfüller-Gott“ (00:20:17) Die Erforschung des Universums (00:31:21) Parallelen in der Schöpfungsgeschichte (00:40:20) Die modernen Propheten (00:43:36) Das Multiversum (00:51:48) Belebte und unbelebte Materie und der Glaube (00:56:09) Die Verantwortung der Wissenschaft (00:59:09) Was die Naturwissenschaft über Gott sagt (01:00:39) Die Gottesbeweise (01:03:23) Assoziationsspiel (01:06:18) Persönliches: Müllabfuhr, Frechen, Kirche (01:16:58) Zweitberuf Laienprediger (01:19:03) Die erste Aufnahme von einem Schwarzen Loch (01:27:32) Die Theodizee-Frage (01:30:20) „Einstein hat Gott zu klein gedacht“ (01:32:58) Die Spektrum-Zukunftsmaschine (01:36:08) Verabschiedung (01:36:42) Eindrücke und Verabschiedung LINKS: Hier geht’s zur Spektrum-Sonderseite „Wissenschaft und Glaube“. Hier lest ihr das Streitgespräch zwischen Barbara Drossel und Volker Sommer über Naturwissenschaft und Religion. Hier erfahrt ihr mehr über das erste Foto eines Schwarzen Lochs. Hier geht’s zum Artikel über mysteriöse Strahlungsquellen. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/die-grossen-fragen-der-wissenschaft-heino-falcke
Die großen Fragen der Wissenschaft | Gibt es Gott, Heino Falcke?
Heino Falcke ist Astrophysiker und Laienprediger in der evangelischen Kirche. Für ihn passt das sehr gut zusammen. Ein Gespräch über Naturgesetze, die Schöpfungsgeschichte und Wissenschaftler als moderne Propheten. (00:00:55) Begrüßung (00:02:06) Vorstellung Heino Falcke (00:04:16) Der Weihnachtsstern als besondere Konjunktion? (00:06:11) Wissenschaft und Glaube – wie geht das zusammen? (00:07:40) Wer ist Gott? (00:10:05) Die Naturgesetze (00:16:21) Der Urknall (00:18:25) „Lückenfüller-Gott“ (00:20:17) Die Erforschung des Universums (00:31:21) Parallelen in der Schöpfungsgeschichte (00:40:20) Die modernen Propheten (00:43:36) Das Multiversum (00:51:48) Belebte und unbelebte Materie und der Glaube (00:56:09) Die Verantwortung der Wissenschaft (00:59:09) Was die Naturwissenschaft über Gott sagt (01:00:39) Die Gottesbeweise (01:03:23) Assoziationsspiel (01:06:18) Persönliches: Müllabfuhr, Frechen, Kirche (01:16:58) Zweitberuf Laienprediger (01:19:03) Die erste Aufnahme von einem Schwarzen Loch (01:27:32) Die Theodizee-Frage (01:30:20) „Einstein hat Gott zu klein gedacht“ (01:32:58) Die Spektrum-Zukunftsmaschine (01:36:08) Verabschiedung (01:36:42) Eindrücke und Verabschiedung LINKS: Hier geht’s zur Spektrum-Sonderseite „Wissenschaft und Glaube“. Hier lest ihr das Streitgespräch zwischen Barbara Drossel und Volker Sommer über Naturwissenschaft und Religion. Hier erfahrt ihr mehr über das erste Foto eines Schwarzen Lochs. Hier geht’s zum Artikel über mysteriöse Strahlungsquellen. >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/die-grossen-fragen-der-wissenschaft-heino-falcke
Ausgezeichnet für die Erforschung, Erhaltung und Präsentation des Kulturerbes. (26.11.2025 15:30)
Die Slowakei hautnah, Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache
Nachrichten, Tagesthema, Magazin - Ausgezeichnet für die Erforschung, Erhaltung und Präsentation des Kulturerbes. Die mineralogische Vielfalt der Slowakei (nicht in der Podcast-Ausgabe enthalten.
Luhmanns Hypothese lautet, dass Politik und Recht zwei autonome, operativ geschlossene Funktionssysteme sind. In Abschnitt IV untersucht er hierfür weitere Anhaltspunkte. So geht er der Frage nach, wie Lobbyismus zu bewerten ist: Wie hoch ist der Einfluss von JuristInnen auf das politische System? Anmerkung: Das ist heute besser erforscht als zur Entstehungszeit des Buches vor rund 30 Jahren. In vielen Ländern gibt es Lobbyregister. Mit Studien belegen Nicht-Regierungsorganisationen regelmäßig, mit welchen Lobby-Etats Interessenverbände Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. In Deutschland z.B. LobbyControl, auf EU-Ebene das Corporate Europe Observatory. Nicht selten werden ganze Textpassagen von externen »ExpertInnen« in Gesetzestexte übernommen, teils im Wortlaut. Ohne Zweifel ist der »legislative Fußabdruck« heute besser dokumentiert als in den 1990er-Jahren. Hauptauftraggeber für juristische (Lobby-)Aktivitäten sind Wirtschaftskonzerne, allen voran die Finanzlobby. Die Erforschung von Kontaktnetzwerken hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Netzwerk- und Diskursanalysen nehmen zu. Luhmanns Frage ist jedoch: In welchem Funktionssystem wird der juristische Einfluss tatsächlich wirksam? Die Entscheidung, einen von JuristInnen verfassten Text in ein Gesetz zu übernehmen, ist eine politische. Das Risiko, damit womöglich gegen geltendes Recht zu verstoßen, trägt der Gesetzgeber allein. JuristInnen mögen die Texte entworfen haben. Die Frage ist jedoch, ob sie überhaupt politische Kontakte pflegen. Häufig vermitteln »Politikberater« die juristische Expertise an die Politik weiter. Ausschlaggebend sind persönliche Beziehungen, um überhaupt Kontakt in Entscheidungskreise des politischen Systems zu erlangen. Juristische Expertise wird natürlich vorausgesetzt. Entscheidend ist jedoch, wie gut ein Akteur mit der Politik vernetzt ist. Eben da setzen LobbyistInnen an. Für die Politik ist zudem die Frage wichtig: Welche Bedeutung hat ein Interessenträger, der JuristInnen beauftragt mit dem Ziel, politischen Einfluss zu nehmen? Eine derartige »Verwendung« von Anwälten ist jedenfalls eher dem politischen System zuzuordnen als dem Rechtssystem. Kurz, der bloße Status »Jurist« ist als alleiniges Kriterium nicht aussagekräftig genug. Man kann damit eine Kommunikation nicht zweifelsfrei Politik oder Recht zuordnen. Wären Politik und Recht eine Einheit, müsste es umgekehrt denkbar sein, dass rechtsdogmatische Erfindungen innerhalb der Parteipolitik zum Thema werden können. Anhand der juristischen Beispielthemen »Anscheinsvollmacht« und »culpa in contrahendo« erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber sich mit solchen juristisch zu entscheidenden Problemlagen befassen würde. Doch selbst wenn er es täte, ist anzunehmen, dass Gerichte derartige Problemstellungen systemintern weiterentwickeln würden. Nachdem der IV. Abschnitt die These von der operativen Geschlossenheit beider Systeme untermauert, will Luhmann im Folgenden überprüfen, ob diese These widerlegbar ist, sowohl von der politischen als auch von der rechtlichen Seite aus. Denn selbstverständlich sind die Kommunikationssysteme Politik und Recht füreinander offen – jedoch nur auf der kognitiven Ebene. Das bedeutet, beide Systeme sind füreinander Umwelt und nehmen jeweils Informationen aus der Umwelt auf. Verarbeitet werden solche »externen Fakten« jedoch systemintern, in operativer Geschlossenheit. Dies erfolgt anhand der inneren Codierung: Im Recht dreht sich alles um die Unterscheidungen von Recht/Unrecht sowie gleicher/ungleicher Fall. In der Politik läuft jede Entscheidung durch den Filter, ob sie mehr/weniger Macht bedeuten könnte. Dieses Verhältnis von operativer Geschlossenheit und kognitiver Offenheit bringt der Terminus »strukturelle Kopplung« zum Ausdruck. Strukturelle Kopplung wird in Kapitel 10 Thema sein. Darauf bereitet der IV. Abschnitt allmählich vor.
Die Archaik - Die Dorische Wanderung & die vier großen Stämme der Hellenen
Alenative History - Die Geschichte des Antiken Griechenlands
Waren die Dorer Invasoren aus dem Norden, die die Bevölkerung Griechenlands nach der Bronzezeit und während der Eisenzeit unterwarfen? Wer waren die vier großen Stämme der Griechen, die einen Großteil ihrer Geschichte prägten? Und wie erklärten sich die Griechen ihre Herkunft und Entstehen?Das alles erfahren wir in der neuen Folge!Quellen:Aischylos, EumenidenAntoninus Liberalis, MetamorphosenApollodor, BibliothekeApollonios Rhodios, ArgonautikaDiodor, BibliothekeDionysios von Halikarnassos, Antike römische GeschichteEphorosHerodot, Historien Homer, IliasHomer, OdysseeThukydides, Geschichte des Peloponnesischen KriegesPlaton, Nomoi , Politeia Pausanias, Beschreibung GriechenlandsOvid, MetamorphosenTyrtaios, Fragmente zur dorischen Herkunft Spartas und zur Dreiteilung der Dorer (Pamphyloi, Dymanes, Hylleis)Stephanus von Byzanz Strabon, Geographika LiteraturAllan, Introduction. The Children of Heracles, 2001Baumbach, A Doric Fifth Column?, 1980Beckman/Bryce/Cline, The Ahhiyawa Texts, Atlanta, 2011Beekes, Etymological Dictionary of Greek, 2009Blegen, The Mycenaean Age, the Trojan War, the Dorian Invasion, and Other Problems, 1962Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia, 1994Buck, Comparative Grammar of Greek and Latin, 1933Carlier, Aegeum, 1995Caskey, Studien zur minyschen KeramikChadwick, The Mycenaean World, 1976Chadwick/Ventris, Documents in Mycenaean Greek, 1973Cline, After 1177 BC: The Survival of Civilisations, 2024Cook, Greek Painted Pottery (3rd ed.), 2013 [1960]Daniel, The Dorian Invasion: The Setting, 1948Deger-Jalkotzy, Die Erforschung des Zusammenbruchs der sogenannten mykenischen Kultur und der sogenannten Dunklen Jahrhunderte, 1991Dickinson, The Irrelevance of Greek 'Tradition', 2020Drews, The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East, 1988Ebd., The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C., 1993Finkelberg, „From Ahhiyawa to Ἀχαιοί“, 1988Foley, A Companion to Ancient Epic, 2005Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, 1997Ebd., Hellenicity: Between Ethnicity and Culture, 2002Ebd., Dorians, 2006Ebd., A History of the Archaic Greek World, ca. 1000–479 BC, 2014Hooker, Die griechische Rückerinnerung im Lichte neuer Forschungen, 1985Howatson, Heracleidae, 2013Jung, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ COMPARATA. Vergleichende Chronologie von Südgriechenland und Süditalien von ca. 1700/1600 bis 1000 v. u. Z., 2006Karageorghis, The Peoples of the Sea, 2005Kaser, Balkan und Naher Osten. Einführung in eine gemeinsame Geschichte, 2011Kennell, Spartans: A New History, 2010Kline, After 1177 B.C.: The Survival of Civilizations, 2024Knapp & Manning, Crisis in Context: The End of the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean, 2016Kosmin, The Land of the Elephant Kings, 2014 Kustrin & Mangan, Lasting Legacy? Spartan Life as a Germanic Educational Ideal: Karl Ortfried Müller, 2003Luraghi, The Ancient Messenians: Constructions of Ethnicity and Memory, 2008Mackenzie, Peoples, Nations and Cultures, 2005 Malkin, The Return of Odysseus, 1998 Meyer, RE, 1893Middleton, Getting Closer to the Late Bronze Age Collapse in the Aegean and Eastern Mediterranean, c. 1200 BC, 2024Musti, Introduzione. In: Le origini dei Greci: Dori e mondo egeo, 1985Myres, Homer and His Critics, 1954Nilsson, Poseidon und die Entstehung des griechischen Götterglaubens (Review), 1953Papadopoulos, Greece in the Early Iron Age: Mobility, Commodities, Polities, and Literacy, 2014Reinhardt, Der antike Mythos. Ein systematisches Handbuch, 2011Robertson, The Dorian Invasion and Corinthian Ritual, 1980Schnapp-Gourbeillion, L'invasion dorienne a-t-elle eu lieu?, 1986 [1982]Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, 1856Thomas, Found: The Dorians: Archaeology and Greek Linguistics at the End of the Late Bronze Age, 1978Toepffer, Achaia, RE, 1893Walter, An der Polis teilhaben, 1993Waters, Ancient Persia, 2014 Wendt, Fischer Lexikon Sprachen, 1961Brockhaus u. Dtv, Achaier, 1982
Nach verlängerter Sommerpause sind wir wieder da! In der 5. Staffel gehen wir auf Zeitreise und schildern besondere Ereignisse aus 3.000 Jahren altägyptische Geschichte. Wir beginnen ganz am Anfang, um 3.000 v. Chr. mit der Reichseinigung unter dem mythischen König Menes. Oder dem realen König Narmer? Eine spannende Geschichte beginnt ... Shownotes: König Menes: https://de.wikipedia.org/wiki/Menes König Narmer / Narmer-Palette: https://de.wikipedia.org/wiki/Narmer YT-Vortrag zur Grabung in Minshat Abu Omar: https://youtu.be/Z0jw3q9Yrac MAAT-Beitrag zur Grabung in Minshat Abu Omar: https://smaek.de/wp-content/uploads/2025/01/maat11_wildung_mao.pdf Dynastic Race Theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Dynastic_race_theory Turiner Königspapyrus: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigspapyrus_Turin Königsliste in Abydos: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsliste_von_Abydos_(Sethos_I.) Palermostein: https://de.wikipedia.org/wiki/Palermostein Gewichtsstein des Narmer: https://smaek.de/wp-content/uploads/2025/01/AS_05847_gewicht_franke_02_20130430-scaled.jpg Folge "Die Erforschung Ägyptens": https://spotifycreators-web.app.link/e/zOYS4QU6xQb Folge "Chaemwaset": https://spotifycreators-web.app.link/e/miwUrMU6xQb #frühgeschichte #antike #ägypten #afrika #nordafrika #museum #kunst #münchen #forschung #geschichte #objekte #frühzeit #narmer #menes
Der Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und hat nach aktueller Zählung fast 100 Monde. Die bekanntesten davon sind die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymede und Kallisto die, ob ihrer Größe und Unterschiedlichkeit wie auch der Jupiter selbst im Mittelpunkt der Erforschung stehen.
Knappes Budget - Die NASA stoppt die Suche nach Wasser auf dem Mond
Nahe dem Mondsüdpol gibt es Krater, in die nie Sonnenlicht gelangt. Dort wird Wassereis vermutet. Die Erforschung dieser Krater hat die NASA nun gestoppt. Der Abbruch erfolgte aus Kostengründen. Es ist ein weiterer Rückschlag für das Mondprogramm. Lorenzen, Dirk www.deutschlandfunk.de, Sternzeit
Starlink-Satelliten gefährden die Erforschung des Alls
Schon länger befürchten Astronomen, dass die riesige Starlink-Satelliten-Konstellation von Space-X die Erforschung des Alls im sichtbaren Spektrum gefährden wird. Aber auch Radioteleskope werden von den Internet-Satelliten gestört, zeigt eine Studie. Stefan Troendle im Gespräch mit Dr. Benjamin Winkel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Radio-Observatorium Effelsberg
Zukunftskongress der Uni Stuttgart fragt: Wie kommunizieren wir mit Aliens?
Die Erforschung der Wal-Sprache könnte einmal helfen, mit Aliens zu kommunzieren, sagt die Meeresbiologin und Bloggerin Bettina Wurche anlässlich des Zukunftskongress „Next Frontiers: Fiction meets Science“ in Stuttgart. Der Kongress beschäftigt sich mit der Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Science Fiction und diskutiert unter anderem, wie in der Serie „Raumschiff Enterprise" mit Aliens kommuniziert wird.
14. Mai 1804: Die Erforschung Nordamerikas
Heute vor 220 Jahren starteten Merriwether Lewis und William Clark ihre Expedition zur Erforschung Nordamerikas, im Auftrag des Präsidenten der Vereinigten Staaten Thomas Jefferson.
Astro-Pionier Stock - Ein Leben für die Erforschung des Universums
In Chile, wo die Nächte dunkel sind und der Himmel klar, hat der Astronom Jürgen Stock eine Großsternwarte gegründet. Seine Arbeit war entscheidend für die wissenschaftliche Beobachtung und Kartierung des Universums. Vor 20 Jahren ist er gestorben. Lorenzen, Dirk www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
WW347: In arktischen Höhen – mit Dr. Heïdi Sevestre und Alex Honnold (Englische Folge)
Steile Felswände, umgeben von gewaltigen Gletschern und massiven Eisbergen, die auf dem Ozean weit darunter treiben – die Natur Grönlands ist durch und durch einzigartig. Auch, weil die dortigen Gletscher und Eiskappen eine entscheidende Rolle für den Klimawandel einnehmen. Die Erforschung ihres Zustands gestaltet sich jedoch äußerst schwierig, da sie aufgrund ihrer abgelegenen Lage nahezu unzugänglich sind.Unsere zwei Gäste in dieser Folge stellten sich dieser Herausforderung. Die französische Glaziologin Dr. Heïdi Sevestre erforschte die Auswirkungen des Klimawandels in den entlegenen Regionen Grönlands, unterstützt von einem Team aus WissenschaftlerInnen und drei der besten Kletterer der Welt.Einer dieser Kletterer ist Alex Honnold. Weltbekannt wurde er durch den Oscar-prämierten Dokumentarfilm „Free Solo“, der ihn dabei begleitete, wie er ohne jegliche Sicherung den El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien besteigt. Sein Ziel in Grönland: die Erstbesteigung einer der höchsten bislang unbestiegenen Felswände und gleichzeitig einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten. So brach er mit Heïdi und einem Team aus Bergsteigern und lokalen Experten zu einer unvergesslichen Expedition auf. Festgehalten wurde sie in der dreiteiligen Dokumentation „In arktischen Höhen mit Alex Honnold“ von National Geographic.Alex und Heïdi gewähren uns in dieser Folge einen Einblick in die Herausforderungen einer Erstbesteigung in der rauen Natur Grönlands, die Forschungsarbeiten vor Ort und die Auswirkungen des Klimawandels auf eine Wildnis, die für die Zukunft des Planeten von entscheidender Bedeutung ist. Viel Spaß beim Zuhören!Anschauen könnt ihr die Doku-Serie „In arktische Höhen mit Alex Honnold“ im Pay-TV auf National Geographic, und zwar am:ab 11.03.24, montags, 21:45 Uhrab 20.03.24, mittwochs: Folge 1 22:05 Uhr, Folge 2 22:00 Uhr, Folge 3 21:55 UhrWeitere Infos:Heïdis Website: https://www.heidisevestre.comAlex‘ Website: http://www.alexhonnold.comRedaktion & Postproduktion: Miriam Menz Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
BiOfunk (71): Bakterienkiller - 100 Jahre Bakteriophagen
Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien befallen - und töten. Es sind gute Viren. Sie können wichtige Verbündete sein, im Kampf gegen Bakterien. Und sie sind noch viel mehr. Die Erforschung von Bakteriophagen schaffte die Grundlage für die moderne Molekularbiologie. Und ohne Bakteriophagen wäre die Gentechnik nicht denkbar. Im BiOfunk betrachten wir heute die spannende Entdeckungsgeschichte der Bakteriophagen, die vor gut 100 Jahren begann.Weitere InformationenBuchtipp: "The Good Virus" von Tom IrelandWhy evolution is true: Happy birthday, Max Delbrück!Annual Reviews: Phage Therapy in the Twenty-First CenturyBBC Science Focus: The best way to kill a superbug? Weaponise a virusASM: Phage Therapy - Past, Present and FutureNature Reviews: A century of the phage: past, presentand future
Die Erforschung des Weltraums hat schon vielen Menschen große Opfer abverlangt und einigen gar das Leben. Die Forscherin, die wir heute kennenlernen, war der Meinung, dass ihr solche Schmerzen bei ihrer siebenjährigen Mission erspart bleiben würden. Aber – vielleicht – zu ihrem persönlichen Glück, kommt es anders als geplant.
Die Erforschung des Weltraums hat schon vielen Menschen große Opfer abverlangt und einigen gar das Leben. Die Forscherin, die wir heute kennenlernen, war der Meinung, dass ihr solche Schmerzen bei ihrer siebenjährigen Mission erspart bleiben würden. Aber – vielleicht – zu ihrem persönlichen Glück, kommt es anders als geplant.
Covid-19: Wo begann die Pandemie?
Wo hat Covid-19 seinen Ursprung? War es der Tiermarkt im chinesischen Wuhan oder doch ein Labor? Forschende suchen noch immer nach Antworten. Sie hoffen, dadurch für den Umgang mit künftigen Viren zu lernen. (00:00:29) Opener und Begrüßung Frank (00:01:32) Welche Rolle könnten Maderhunde spielen? (00:03:13) Was spricht für und gegen die sog. „Markt-Hypothese“? (00:05:35) Wie erforscht man einen Pandemie-Ursprung? (00:08:11) Welche anderen Hypothesen gibt es? (00:12:11) Die Erforschung des Ursprungs dauert oft lange (00:16:00) Warum ist die Ursachenforschung für die Zukunft? (00:18:43) Verabschiedung Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/spektrum-der-wissenschaft >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/spektrum-podcast-corona-covid-pandemie-ursprung
Wo hat Covid-19 seinen Ursprung? War es der Tiermarkt im chinesischen Wuhan oder doch ein Labor? Forschende suchen noch immer nach Antworten. Sie hoffen, dadurch für den Umgang mit künftigen Viren zu lernen. (00:00:29) Opener und Begrüßung Frank (00:01:32) Welche Rolle könnten Maderhunde spielen? (00:03:13) Was spricht für und gegen die sog. „Markt-Hypothese“? (00:05:35) Wie erforscht man einen Pandemie-Ursprung? (00:08:11) Welche anderen Hypothesen gibt es? (00:12:11) Die Erforschung des Ursprungs dauert oft lange (00:16:00) Warum ist die Ursachenforschung für die Zukunft? (00:18:43) Verabschiedung Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/spektrum-der-wissenschaft >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/spektrum-podcast-corona-covid-pandemie-ursprung
Spektrum der Wissenschaft – Der Podcast | Covid-19: Wo begann die Pandemie?
Wo hat Covid-19 seinen Ursprung? War es der Tiermarkt im chinesischen Wuhan oder doch ein Labor? Forschende suchen noch immer nach Antworten. Sie hoffen, dadurch für den Umgang mit künftigen Viren zu lernen. (00:00:29) Opener und Begrüßung Frank (00:01:32) Welche Rolle könnten Maderhunde spielen? (00:03:13) Was spricht für und gegen die sog. „Markt-Hypothese“? (00:05:35) Wie erforscht man einen Pandemie-Ursprung? (00:08:11) Welche anderen Hypothesen gibt es? (00:12:11) Die Erforschung des Ursprungs dauert oft lange (00:16:00) Warum ist die Ursachenforschung für die Zukunft? (00:18:43) Verabschiedung Hier entlang geht's zu den Links unserer Werbepartner: https://detektor.fm/werbepartner/spektrum-der-wissenschaft >> Artikel zum Nachlesen: https://detektor.fm/wissen/spektrum-podcast-corona-covid-pandemie-ursprung
Rhythmen im Gehirn - Die Erforschung der Hirnwellen
Das Gehirn erzeugt Schwingungen. Je nach Rhythmus werden sie mit unterschiedlichen Funktionen und Bewusstseinszuständen assoziiert. Kann die Beeinflussung von Hirnwellen bei der Behandlung von Krankheiten helfen? (Erstsendung am 4.3.2021)Von Marko Pauliwww.deutschlandfunkkultur.de, Zeitfragen. FeatureHören bis: 19. Januar 2038, 04:14Direkter Link zur Audiodatei
Das kleine Glück #84 Hand aufs Herz: Gefühle spüren, annehmen und loslassen
Das kleine Glück: Der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspirationen.
Das lange Warten hat ein Ende und unser Podcast „Das kleine Glück” ist endlich zurück! Im letzten Jahr ist so einiges passiert, das eine ganze Reihe verschiedener Gefühle in uns ausgelöst hat – und genau darüber geht es in dieser Folge! Wir alle tragen eine riesige große Palette an Gefühlen in uns. Diese zu benennen, erkennen und vor allem sie auch anzunehmen ist manchmal ganz schön herausfordernd – gerade wenn es um unangenehme Gefühle geht, die wir nicht so gerne haben. Dabei wären wir viel glücklicher, wenn wir statt dem Vermeiden von vermeintlich schlechten Gefühlen einfach alle annehmen, wie sie sind. Klingt paradox? Ist es keinesfalls! In dieser Podcastfolge von „Das kleine Glück” erklärt euch Gina, wie wichtig unsere Emotionen sind und wie wir lernen können, sie anzunehmen und auch wieder loszulassen. Es geht um Schmetterlinge und Angsthasen und darum, wie wir mit kreativen Denkwerkzeugen unser eigenes Gefühlsmanagement positiv beeinflussen können. Lasst euch ein auf die Erkundungstour und seid euch sicher: Die Erforschung unserer Emotionen ist ein echtes Abenteuer!
Soup & Science: Geschützte Zivilbevölkerung? Die Erforschung der Sicherheit
Die Wissenschaft hat Situationen, die uns gefährlich werden können, im Blick. Das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit in Berlin sorgt dafür, dass die Forschung nicht in der Schublade verschwindet. Im Lunchtalk "Soup & Science" spricht Leiterin Miriam Nagels mit Lena Petersen über Krisenkommunikation, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Meeres- und Polarforscher Georg Neumayer startet 1864 ein legendäres Experiment: Mit Hilfe von Flaschenpostnachrichten versucht er, mehr über die Strömungen der Weltmeere herauszufinden. Dabei ist er nicht der erste Forscher, der die gläsernen Driftkörper für die Forschung nutzt, aber seine Sammlung bei der Deutschen Seewarte in Hamburg (heute Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) ist die weltweit größte Flaschenpost-Sammlung mit über 660 zurückgesendeten Findezettel. Wir sprechen in der Folge über die (erstaunlich junge) Geschichte der Flaschenpost und warum sie letztlich in der Literatur mehr Einfluss hinterlassen hat als in der Wissenschaft. Das in der Folge erwähnte Buch heißt „Flaschenpost. Ferne Botschaften, frühe Vermessungen und ein legendäres Experiment“ von Wolfgang Struck. //Aus unserer Werbung Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/GeschichtenausderGeschichte NEU: Wer unsere Folgen lieber ohne Werbung anhören will, kann das über eine kleine Unterstützung auf Steady oder ein Abo des GeschichteFM-Plus Kanals auf Apple Podcasts tun. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts rezensiert oder bewertet. Für alle jene, die kein iTunes verwenden, gibt's die Podcastplattform Panoptikum, auch dort könnt ihr uns empfehlen, bewerten aber auch euer ganz eigenes Podcasthörer:innenprofil erstellen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder sogar Nachbarinnen und Nachbarn von uns erzählt!
Über die Erforschung von Langzeitschäden - mit Dipl.-Psychologin Eva Flemming
In der dieser Folge von "Staatsplan 14.25" haben wir Gelegenheit, Einblicke in die aktuelle Forschungsstudie an der Rostocker Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zu erhalten, welche unter der Leitung von Prof. Dr. Carsten Spitzer die Langzeitfolgen des DDR-Staatsdopings erforscht. Die Diplompsychologin Eva Flemming erklärt welche Fragestellungen erforscht werden, ob es bereits erste Erkenntnisse gibt und welche Themen noch offen sind. Die Studie sucht weiterhin Teilnehmer:innen. Interessierte Sportler:innen können sich gerne beim DOH e.V. melden!
Die Erforschung des "O" - Wenn Gefühle Wörter werden
"O schöne neue Welt, das solche Wesen trägt", sagt Prosperos Tochter am Ende von Shakespeares Sturm. Ihr "O" ist eines von unzähligen O-Ausrufen in der Literatur. Der Autor Tomar Dotan-Dreyfus hat die Geschichten hinter den "O"s der Literatur erforscht. Von Gerd Brendelwww.deutschlandfunkkultur.de, LesartDirekter Link zur Audiodatei
Minhós Martins/Carvalho:"Die Erforschung d. Welt in 11 außergewöhnlichen Reisen"
Lieske, Tanyawww.deutschlandfunk.de, BüchermarktDirekter Link zur Audiodatei
Wir alle kennen Selbstgespräche. Die Erforschung darüber bringt uns zu mehr Selbsterkenntnis. Ein Beispiel meiner inneren Welt.Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Der Restaurator Tim Bechthold - „Kunststoffe sind nicht prinzipiell die ‚Bad Boys‘"
Die Erforschung des Verfalls steht im Mittelpunkt der Arbeit von Tim Bechthold. Den gelernten Tischler führte sein beruflicher Weg über Studiengänge der Restauration und Konservierung in die größte Designsammlung der Welt: die Neue Sammlung München. Dort widmet er sich als Leiter der Restaurationsabteilung besonders gerne jenem Material, dem besondere Kurzlebigkeit nachgesagt wird: Kunststoff.Marietta Schwarzwww.deutschlandfunk.de, ZwischentöneDirekter Link zur Audiodatei
Der Restaurator Tim Bechthold - "Kunststoffe sind nicht prinzipiell die ‚Bad Boys‘"
Die Erforschung des Verfalls steht im Mittelpunkt der Arbeit von Tim Bechthold. Den gelernten Tischler führte sein beruflicher Weg über Studiengänge der Restauration und Konservierung in die größte Designsammlung der Welt: die Neue Sammlung München. Dort widmet er sich als Leiter der Restaurationsabteilung besonders gerne jenem Material, dem besondere Kurzlebigkeit nachgesagt wird: Kunststoff.Marietta Schwarzwww.deutschlandfunk.de, ZwischentöneDirekter Link zur Audiodatei
"Auf die Ohren - Der MuseumsPodcast" - Staffel 2 | Folge 10: Die Erforschung Ägyptens
Zum Finale der 2. Staffel des Podcasts widmen sich Roxane Bicker und Arnulf Schlüter der Erforschung des alten Ägypten von antiken Schriftstellern wie Herodot und Diodor bis zum Feldzug Napoleons und zeigen, wie sich das Bild Altägyptens und der Umgang mit Architektur und Kunstwerken im Laufe der Zeit gewandelt hat. Podcast "Mummies & Magic" von Nora und Roxane: https://anchor.fm/mummiesandmagic Podcast Geschichte Europas "Champollion und die Hieroglyphen": https://geschichteeuropas.podigee.io/74-74 Vortrag "Der Fluch des Pharao" / Tutanchamun: https://youtu.be/aHJ90kqx07k MAAT 23 mit dem Artikel zu Amelia Edwards ist als Print im Museum erhältlich oder über info@smaek.de #frühgeschichte #antike #ägypten #afrika #nordafrika #museum #kunst #münchen #forschung #geschichte
Wer im Homeoffice arbeitet, sieht und spricht seine Kolleginnen und Kollegen momentan am Bildschirm. Und Online-Meetings sind eine Wissenschaft für sich: Die Videokonferenzen werden von der Organisationspsychologie untersucht. Von Lena Petersen
Graben im Gestern – die Erforschung der antiken Stadt Doliche
Seit 25 Jahren erforscht Prof. Dr. Engelbert Winter mit seinem Team die antike Stadt Doliche im Südosten der Türkei nahe der syrischen Grenze. Die Ausgrabung der Forschungsstelle Asia Minor zählt zu den am längsten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekten. Die Dauer des Projekts, so der Archäologe, hänge vor allem mit dem Standort des Gebiets zusammen: „Die Lage der Stadt ist ein Glücksfall für die archäologische Forschung. Der Stadthügel wurde im 12. Jahrhundert verlassen und seitdem nicht mehr bebaut. Die meisten anderen Städte im antiken Teil Syriens kommen für Ausgrabungen nicht mehr in Frage, weil sie entweder nachträglich bebaut wurden oder durch den syrischen Bürgerkrieg zerstört wurden.“ Im Podcast berichtet Engelbert Winter von den Anfängen des Projekts und der Entwicklung bis heute. Dabei geht es beispielsweise um den Alltag während der mehrwöchigen Grabungsreisen, die im Sommer und Herbst stattfinden, um die Frage, wie moderne Technik die archäologische Forschung verändert hat und um die Zusammenarbeit mit den türkischen Ortskräften und der Regierung.
#12 Zeit für Dich - 3 Netzwerke in unserem Körper
Die Erforschung der Faszien bringt Parallelen zum chinesischen Weltbild zu Tage. Dabei ist es das Bindegewebe, dass wir lange übersehen haben.Buch:Anatomy Trains: Myofasziale Leitbahnen (für Manual- und Bewegungstherapeuten), Tom Myers, Elsevier-Verlag
Der November wird zu Movember: Geld sammeln für die Erforschung von Prostatakrebs
Jedes Jahr im November lassen sich Männer weltweit Schnurrbärte wachsen, um unter anderem für die Erforschung von Prostatakrebs Geld zu sammeln. Dieser Monat ist auch unter dem Namen Movember bekannt – kombiniert aus dem englischen Wort für Schnurrbart und November. Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 60.000 Männer an Prostatakrebs, im Podcast spricht dazu der Urologe Dr. Stefan Machtens.
bp21: Sensoren am Himmel - Was uns der Vogelzug über die Welt verrät
Der Storch mag keine Kinder bringen, wohl aber Beweise: So lieferte ein außergewöhnlich wiederstandsfähiges Exemplar im Jahr 1822 die entgültige Antwort auf die Frage, wo die Vögel eigentlich sind, wenn sie woanders sind. Doch wie kommen sie nach woanders, und warum bleiben sie nicht einfach hier? Die Erforschung des Vogelzugs entpuppt sich als Spezies- und Jahrzentumgreifendes globales Unterfangen und liefert auf die trivialsten Fragen die faszinierendsten Antworten. In dieser Folge begeben wir uns auf eine Reise in ein Jahrzent des kreativen Experimentalaufbaus und lernen, wieso Route und Reisezeitpunkt vererbbar sind, wie sich Vögel am Magnetfeld orientieren und was einen Storch in den Knast bringen kann. Heutzutage lassen Großprojekte wie die ICARUS-Initiative erahnen, was uns Tiermigrationsbewegungen über die Welt, in der wir leben, verraten können, wenn man sie von ganz weit oben betrachtet. Wir bleiben gespannt, was die Zkunft beginnt. Achja, und falls jemand den Sender von Weißstorch Ralph gesehen hat, gebt ihn bitte zurück. Quellen"Reisen in Corona-Zeiten: der Rekordflug einer Ente von Hessen nach Russland", Universität Giessen, Oktober 2021, https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm78-20rekordflugeinerente"Eyes on Stork? Egyption Fisherman tought bird was foreign spy", The Guardian, September 2013, https://www.theguardian.com/world/2013/sep/02/eyes-on-storks-egyptian-fisherman-spy-camera Liedvogel, Miriam. "Zugvogelgenetik–wie finden Vögel ihren Weg? Migration genetics–how do migratory birds find their way?." (2016) , Website der Max-Planck-Gesellschaft, https://www.mpg.de/10919943/_jb_2016 Helbig, A., et al., 1996. Genetic basis, mode of inheritance and evolutionary changes of migratory directions in palaearctic warblers (Aves: Sylviidae). The Journal of experimental biology. DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.199.1.49 Åkesson, Susanne, et al., Animal navigation . Animal movement across scales 21 (2014): 151-178. Emlen, Stephen T. et al., 1967. Migratory orientation in the indigo bunting, passerina cyanea: part i: evidence for use of celestial cues. The Auk . DOI: https://doi.org/10.2307/4083084 Emlen, Stephen T. et al., 1970. Celestial rotation: its importance in the development of migratory orientation. Science. DOI: 10.1126/science.170.3963.1198 Wiltschko, W., et al., 1987. The development of the star compass in garden warblers, Sylvia borin. Ethology 74.4 (1987): 285-292. Vortrag von Prof. Wikelski: https://www.youtube.com/watch?v=QDRBX8NsfhQWebsite der ICARUS- Initiative: https://www.icarus.mpg.de/deMoveBank: https://www.movebank.org/cms/movebank-mainAudioquellenVogelstimmenhttps://www.lingenverlag.de/downloads/vogelstimmen/ , 12. 10.2021 BildquellenCoverbild: privatRostock Pfeilstorch , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia commons Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia commons
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an David Julius und Ardem Patapoutian. Die Molekularbiologen haben die Rolle sogenannter Rezeptoren in unserem Nervensystem erforscht. Im Podcastupdate erklärt Jakob Simmank, der Leiter des ZEIT-ONLINE-Gesundheitsressorts, wo die Grundlagenforschung von Julius und Patapoutian künftig angewandt werden könnte. Außerdem im Update: Die Pandora Papers legen offen, wie Hunderte Amtsträger aus der ganzen Welt ihr Vermögen in Steueroasen versteckt haben. Die FDP zieht in den Sondierungsgesprächen eine rote Linie bei Steuererhöhungen und die SPD hat keinen Plan B neben einer Ampel-Koalition. Was noch? Tauende Permafrostböden legen Stoßzähne von Mammuts frei. Moderation und Produktion: Jannis Carmesin Mitarbeit: Alma Dewerny Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de. Weitere Links zur Folge: David Julius und Ardem Patapoutian : Medizinnobelpreis für die Entdeckung von Hautrezeptoren (https://www.zeit.de/gesundheit/2021-10/medizin-nobelpreis--david-julius-ardem-patapoutian-hautrezeptoren-entdeckung) Nobelpreise: Wer erhält 2021 die höchste Auszeichnung? (https://www.zeit.de/thema/nobelpreis) Pandora Papers: Steueroasen-Leak enthüllt heimliche Geschäfte Hunderter Politiker (https://www.zeit.de/politik/2021-10/pandora-papers-offshore-briefkastenfirmen-icij-steueroasen) Pandora Papers: Bundesregierung sieht bislang kaum Deutschlandbezug von Offshore-Leak (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-10/pandora-papers-deutschland-bezug-bundesfinanzministerium-erstvermutung) Koalitionsbildung: SPD bereit für Dreier-Sondierung einer Ampel-Koalition (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/bundestagswahl-news-spd-union-gruene-fdp-jamaika-ampel-koalitionsverhandlung-live) Was noch: Inside Russia's Woolly Mammoth Tusk Trade (https://www.youtube.com/watch?v=REgVkpWkh-o&t=93s)
Droht ein neuer Börsen-Crash? Die Erforschung der Kohlenstoffblase
Es gibt eine zunehmende sorge um eine Blase in der fossilen Industrie. Die Aktienkurse großer Energiekonzerne seien stark überbewertet und spiegelten den aktuellen Übergang ins postfossile Zeitalter nicht angemessen wider, so immer mehr Stimmen aus der Wissenschaft. Wer könnte die CO2-Blase zum Platzen bringen? Autorin: Maike Brzoska
Droht ein neuer Börsen-Crash? Die Erforschung der Kohlenstoffblase
Als 2008 die Blase am US-Immobilienmarkt platzte, gerieten Finanzhäuser weltweit ins Taumeln. Sie mussten mit zig Milliarden gerettet werden. Nun sorgen sich Wissenschaftlerinnen und Forscher, dass eine weitere Blase bald platzen könnte, dieses Mal in der fossilen Industrie. Denn viele Banken, Versicherungen und Pensionskassen haben Geld in Wertpapiere fossiler Energiekonzerne angelegt. Platzt die Kohlenstoff-Blase, droht ein Börsen-Crash und eine neue Weltwirtschaftskrise. Forschende untersuchen deshalb, wie sich das verhindern lässt - und was die Blase zum Platzen bringen könnte.
„Sterben unsere Wälder den Klimatod?“ - Die Erforschung der Ökophysiologie der Pflanzen am Campus Alpin des KIT - Campus-Report am 03.08.2021
Der sportliche Wettkampf mit Computerspielen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vom Nischenphänomen Ende der 90er, dessen Wurzeln mit Spacewar, Pong und Wettkämpfen am Arcade-Automaten sogar schon ein halbes Jahrhundert zurückliegen, hat sich eSports vor allem in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und professionalisiert. Jede fünfte Person in Deutschland hat schon mal eine eSports-Veranstaltung geschaut, jede achte kann sich vorstellen, in einem eSports-Verein tätig zu sein. Trotz teils gesellschaftlicher und politischer Vorbehalte lässt sich nicht leugnen, dass im digitalen Sport milliardenschwere, internationale Wirtschaftsmärkte schlummern. Auch wenn Deutschland noch nicht zu den etwa 50 Ländern zählt, die eSports als legitimen Sport anerkennen, schafft es jene Kultur trotzdem auch hierzulande, Massen zu begeistern und damit ganze Stadien wie die Commerzbank Arena in Frankfurt oder die Lanxess Arena in Köln zu füllen. Strategisches Denken sowie ausdauerndes Training der Kommunikations- und Reaktionsfähigkeiten treffen auf interaktives Zuschauen, Lernbegierde und sozialen Austausch. Die Erforschung von eSports und seinen Auswirkungen auf die Menschen gestaltet sich sehr divers und interdisziplinär. Um das enorme Forschungspotenzial auszuschöpfen, wurde das international agierende Esports Research Network (ERN) ins Leben gerufen, was auch an der Universität Siegen zum Thema forscht (ERL) in Zusammenarbeit mit dem hochschuleigenen eSports-Team Siegen Bisons. Mit den eSports-Forschenden Dr. Tobias M. Scholz und Lisa Völkel (B.Sc.) sprechen wir u. a. über das von ihnen im April 2021 im International Journal of Esports veröffentlichten Paper zur Sportification des eSports, verschiedene Arten von eSports-Teams, Forschungsinteressen im Bereich von Kommunikation der Spieler:innen und Management beim eSports und diskutieren natürlich auch die Fragen, ob eSports Sport ist und welche Folgen die Bindung an die Publisher der Spiele für den eSports haben. === Sprungmarken === -ab 00:00- Intro, -ab 06:43- Was ist eSports?, -ab 12:00- eSports & Sport, -ab 25:31- "Sportification" des eSports, -ab 41:50- eSports-Organisationen & Popkultur, -ab 49:42- Firmenabhängigkeit von eSports?, -ab 53:30- eSports in der Pandemie, -ab 56:52- aktuelle & zukünftige Forschung, -ab 61:02- ERN & Interdisziplinarität, -ab 74:49- ERL & Siegen Bisons, -ab 83:26- Outro === Weiterführende Links folgen === === Wie steht Ihr zu eSports, welche Themen interessieren Euch dabei besonders und gibt es ein Spiel, dass ihr gern kompetitiv spielt? Diskutiert gern mit uns und der Spielsinn-Zuhörerschaft auf unserem Discord-Server. === Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns einfach auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl oder auf Social Media (Facebook, Instagram, Twitter). Diverse Links sind auch zu finden unter: linktr.ee/spielsinn.podcast. Fragen, Anregungen & Anmerkungen könnt Ihr uns natürlich auch auf klassischem Weg per E-Mail an spielsinn.podcast@gmail.com zukommen lassen. Über jegliche Bewertungen & Feedback freuen wir uns sehr. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spielsinn-podcast/message
Wie verbessert Raumfahrtforschung das Leben? (Express)
Der Nutzen progressiver Raumfahrtpolitik.Die Erforschung des Alls ist weit mehr als die Suche nach fremdem Leben, sie hat längst praktischen Nutzen im Alltag. Und dennoch stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. Darüber spricht Matthias Wachter, verantwortlich für den Bereich Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie.Er ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Raumfahrt das Leben der Menschen auf der Erde radikal verändern wird. So erleben wir im Moment zwei große Entwicklungsstränge. Einerseits die Kommerzialisierung, die mehr als Weltraumtourismus bedeutet, und andererseits die sogenannte Miniaturisierung.Das heißt, Raketen und Satelliten werden immer kleiner und günstiger und damit für mehr Bereiche des Lebens nutzbar. So kann die Weltraumforschung das Wirtschaften für uns auf der Erde gewinnbringender, aber zugleich auch nachhaltiger und sicherer machen, so das Fazit.Immer freitags kuratiert die Unternehmerin und Publizistin Diana Kinnert diese Podcast-Reihe. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Wie verbessert Raumfahrtforschung das Leben?
Die Erforschung des Alls ist weit mehr als die Suche nach fremdem Leben, sie hat längst praktischen Nutzen im Alltag. Und dennoch stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. Darüber spricht Matthias Wachter, verantwortlich für den Bereich Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Er ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Raumfahrt das Leben der Menschen auf der Erde radikal verändern wird. So erleben wir im Moment zwei große Entwicklungsstränge. Einerseits die Kommerzialisierung, die mehr als Weltraumtourismus bedeutet, und andererseits die sogenannte Miniaturisierung. Das heißt, Raketen und Satelliten werden immer kleiner und günstiger und damit für mehr Bereiche des Lebens nutzbar. So kann die Weltraumforschung das Wirtschaften für uns auf der Erde gewinnbringender, aber zugleich auch nachhaltiger und sicherer machen, so das Fazit. Immer freitags kuratiert die Unternehmerin und Publizistin Diana Kinnert diese Podcast-Reihe.
350 000 ehemals Corona-Infizierte kämpfen in Deutschland wohl mit Spätfolgen der Krankheit. Die sollen jetzt besser erforscht werden.
Dr. Sibylle Anderl | Astrophysikerin und Philosophin | Eine Liebeserklärung an die Erforschung des Universums
Wie viel wiegt das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87? Aus wie viel Prozent dunkler Materie besteht das All? Und könnte das Universum in Wahrheit nicht ganz anders aussehen? Sibylle Anderl stellt diese Fragen. Als Astrophysikerin und Philosophin beschäftigt sie sich mit den Fragen, die bis an die Grenzen unseres Wissens stoßen. Sie studierte Physik und Philosophie und promovierte in Astrophysik. Als Gastwissenschaftlerin forscht sie am Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble zu den Themen Sternenentstehung und Astrochemie. Seit 2017 ist sie Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schreibt für das Feuilleton sowie das Wissenschaftsressort. In “Das Universum und ich“ berichtet sie mitreißend von der Arbeit der Astronomen und liefert gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Erforschung des Weltalls. Moderation: Nicole Köster
Die Erforschung des Weltalls ist immer noch männlich. 500 Astronauten gab es bisher, aber nur 60 Astronautinnen. Dadurch entgehen uns wichtige Daten, die etwa für Therapien eine Rolle spielen können, sagt die deutsche Raumfahrttechnikerin Claudia Kessler im Podcast-Gespräch. Seit Jahren setzt sie sich mit der Initiative "Die Astronautin" dafür ein, dass mehr Frauen ins Weltall fliegen. Außerdem spricht die Expertin im Edition-Zukunft-Podcast darüber, wann der Weltraumtourismus richtig Fahrt aufnehmen könnte, wie problematisch Weltraummüll ist und was die Raumfahrt zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann. Schließlich erzählt Kessler auch von ihrem Traum, es eines Tages doch noch ins Weltall zu schaffen.
Rhythmen im Gehirn - Die Erforschung der Hirnwellen
Das Gehirn erzeugt Schwingungen. Je nach Rhythmus werden sie mit unterschiedlichen Funktionen und Bewusstseinszuständen assoziiert. Doch ihre Erforschung ist schwierig. Wie kann die Beeinflussung von Hirnwellen bei der Behandlung von Krankheiten helfen? Von Marko Pauli www.deutschlandfunkkultur.de, Zeitfragen Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
BiOfunk (32): Drosophila und die Erforschung der biologischen Uhr
Die biologische Uhr ist ein Grundelement aller Tiere und vieler Pflanzen. Und sie tickt unabhängig von äußeren Einflüssen. Auch ohne den Wechsel zwischen hell und dunkel, ohne Temperaturschwankungen läuft das Uhrwerk regelmäßig weiter. Vor 50 Jahren wurde das erste Gen entdeckt, das an der Steuerung der inneren Uhr beteiligt ist. Das Gen wurde in einem Tier entdeckt, das die meisten Menschen lästig finden. Biologen sehen es dagegen mit anderen Augen. Es ist eines der wichtigsten biologischen Forschungsobjekte der letzten 120 Jahre: Die Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Weitere Infos auf www.BiOfunk.net
Kritik an Vertriebenen-Stiftung - Plädoyer für die Erforschung von Gewaltmigration
Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist auf Initiative von Erika Steinbach entstanden. Im Sommer soll nun das Dokumentationszentrum in Berlin eröffnet werden. Beiratsmitglied Jochen Oltmer kritisiert den übermächtigen Stiftungsrat. Jochen Oltmer im Gespräch mit Vladimir Balzer www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Ist grüner Tee wirklich so gesund wie immer behauptet wird? Und sollte man ihn wirklich nicht mit kochendem Wasser aufgießen? Wirkt langgezogener Tee wirklich beruhigend und was hat Einstein am Tee herausgefunden? Von Gábor Paál (SWR 2018) | Häufige Fragen rund um Tee – auch zur Ökobilanz: http://swr.li/tee-forschung
SpiritPreneur#137: Die Erforschung deiner Seelenräume - Interview mit Nina Segura Teil 2
SpiritPreneur - bringe dein Leben und bewusstes Business zum Leuchten!
Ein seelengeführtes Leben zu führen bedeutet, dich mit deiner Urweiblichkeit zu verbinden. Im zweiten Teil unseres Interviews spreche ich mit Nina Segura darüber, was das bedeutet und wie du dort hinkommst. Nina erzählt uns in dieser Folge, wie sie mit ihren Kundinnen arbeitet und wie sie ihnen hilft auf die Seelenebene zu kommen. Lerne ihre größte Hürde auf dem Wege zur erfolgreichen Selbstständigkeit kennen und wie sie damit umgegangen ist. Lerne in dieser Folge: - Wie sich Seelenräume öffnen - Welche Vision Nina Segura hat - Wie sie sich als Unternehmerin entwickelt hat und was sie dir rät Shownotes: Einladung zum SPELL ab 11.01.2021: bit.ly/SPELLworkshops_Januar_21 Einladung zum Hyperminds ab 21.01.2021: (Link folgt) Mehr Informationen über Nina Segura: www.nina-segura.com Ihre Facebook Gruppe: (Link folgt)
SpiritPreneur#136: Die Erforschung deiner Seelenräume - Interview mit Nina Segura Teil 1
SpiritPreneur - bringe dein Leben und bewusstes Business zum Leuchten!
Nina Segura ist Teilnehmerin meiner Programme und hat sich in den letzten 18 Monaten ihr Business aufgebaut. Sie hat dabei Höhen und Tiefen erlebt. In dieser Folge erzählt sie über ihren Weg und wie sie zu “the female voice” wurde. Lerne in dieser Folge: - Wie Nina Segura ihren sicheren Job aufgegeben hat um seelengeführt zu leben - Warum es Arschengel gibt und wie sie uns helfen - Wie Nina ihren neuen Traumjob gefunden hat Shownotes: Mehr Informationen über Nina Segura: www.nina-segura.com
Wissenschaft oder Imagepflege? - Der Boom der Behördenforschung
Die Erforschung von NS- oder DDR-Vergangenheit von Behörden und Ministerien ist zu einer wichtigen Einnahmequelle für Forschungsinstitute geworden. Historiker kritisieren, die Geschichtswissenschaft begebe sich in politische und finanzielle Abhängigkeit, degradiert zum bloßen "Aufarbeitungsdienstleister". Von Cornelius Wüllenkemper www.deutschlandfunk.de, Hintergrund Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Für die einen ist Tee ein ganz normales Genußmittel, andere machen einen regelrechten Kult daraus. Und längst beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen Tee und seinen tatsächlichen oder nur behaupteten Folgen für unser Wohlbefinden.
Was verraten Wasserflöhe darüber, wie gut es einem Gewässer geht? Eine Wissenschaftlerin aus Indonesien erforscht die kleinen Lebewesen im Bodensee und beobachtet, wie sie sich an ihre Umwelt anpassen - und damit auch an den Einfluss der Menschen.
Kai Kupferschmidt ist Wissenschaftsjournalist und schreibt vor allem für Science - zuletzt fast ausschließlich über Covid19. Wie ist der Forschungsstand in Sachen Masken, Impfung, Schulen? Kai erklärt es.Wir sprechen auch über den Umgang der Gesellschaft mit Unsicherheit, die gerechte Verteilung eines potentiellen Impfstoffs und über Kais HIV-Infektion.
Tanz ist ein Spiel mit den Bewegungsmöglichkeiten des Körpers. Musikalische Rhythmen erzeugen Impulse und die meisten Menschen reagieren darauf instinktiv. Sie bewegen sich mit und durch die Musik und drücken sich durch Schwung oder eigene Akzente wiederum selbst körperlich aus. Der Tanz scheint eine „sinnlose“ Fähigkeit des Menschen zu sein. Aber stimmt das? Wie notwendig ist der Tanz für den Menschen? Besitzt er vielleicht sogar eine heilende Wirkung?
Ep. 16 ⎪ Alexa Waschkau zur Frage: "Sind Verschwörungsmythen Märchen?"
Die Erforschung, Aufklärung und Bekämpfung von Verschwörungsmythen ist kein Einzel-, sondern ein Gemeinschaftsunternehmen. Deswegen öffnet sich dieser Podcast bewusst auch für „freshe Stimmen“ von Kolleginnen und Kollegen und lässt sie mit ihrer jeweiligen Expertise zu Wort kommen. Den Anfang für diese Kategorie macht Alexa Waschkau, bekannt als Autorin und Podcasterin Hoaxmistress zum Thema "Sind Verschwörungsmythen Märchen?".
Warum sterben jedes Jahr so viele Menschen trotz Impfung an der Grippe? Das Virus ist so vielseitig und wandelbar, dass der Impfstoff jedes Jahr aufs Neue angepasst werden muss. Jetzt rücken Vakzine in greifbare Nähe, die viele Jahre lang schützen. (BR 2019)
Baden-Württemberg fördert die Erforschung von Holzprodukten
Das Land Baden-Württemberg will mit dem Laubholzinstitut ein Zeichen setzen für den Umweltschutz. Auf dem Gelände der insolventen Papierfabrik Scheufelen in Lenningen sollen ab Frühjahr 2020 Produkte aus Buchenholz entwickelt werden, z.B. Verpackungen.
Die Zukunftsmobilisten: Nr. 52 Prof. Dr. Ing. Petra Schäfer ReLUT - Research Lab for Urban Transport
#Selbstfahrendes Auto #Innovation #Automobilindustrie #Auto #automatisiertesAuto #Ladeinfrastruktur #Elektromobilität #Elektroauto #AutonomesAuto #Elektromobilität #Ladesäule #AutomatedDriving #AutonomousCar von Jürgen Vagt 13.09.19 heute war Frau Prof. Dr. Petra Schäfer von der FH Frankfurt zu Gast bei den Zukunftsmobilisten. Die promovierte Bauingenieurin ist seit 12 Jahren Professorin in Frankfurt und war vorher in der Verkehrsplanung tätig. Prof. Dr. Petra Schäfer sieht gegenwärtig noch die Notwendigkeit eines massiven Mentalitätswandels, denn die technischen Parameter sind so gut, dass schon 90 % der Menschen auf ein Elektroauto umsteigen können und diese 90 % beziehen sich auf Städte. Selbst 70 % der Landbevölkerung können mit den Reichweiten der Modelljahrgänge 2017 oder 2018 auf Elektroauto umsteigen. Aber trotzdem kommt die Elektromobilität bei Privatkunden und kleineren Logistikern nur sehr langsam in Fahrt. Grundsätzlich muss anders kommuniziert. Frau Prof. Dr. Petra Schäfer sieht hier die Handwerkskammern und die Ihks in der Pflicht die Elektromobilität den kleinen Logistikern und den Handwerkern zu erklären und hier gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Die Logistik bekommt neue Fahrzeuge Zudem gibt es einen Wandlungsprozess, denn es wird neue Fahrzeuge geben und diese Entwicklung beginnt in den Großstädten. In der zukünftigen Logistik wird alles von der Sackkarre bis zu elektrisch angetriebenen 7,5 Tonner angewendet. Der Staat im Allgemeinen und die Kommunen im Besonderen wollen weniger Lieferverkehr und insbesondere Start ups bringen neue Fahrzeuge für die Last Mile Logistik. Schon in den nächsten Monaten werden elektrisch angetriebene Lastenfahrräder in der Auslieferung eingesetzt. Also sind neue Fahrzeugkonzepte kein allzu ferne Zukunftsmusik. Allerdings bedeutet eine Vielfalt an neuen Fahrzeugkonzepten nicht unbedingt weniger Verkehr. Diese Zielsetzung kann nur durch intelligente Verkehrssteuerung erreicht werden. Bei diesem Problem könnte das autonome Shuttle im öffentlichen Nahverkehr helfen und dieses Thema findet Frau Prof. Dr. Petra Schäfer als sehr spannend. Die Erforschung beginnt gerade in diesem Frühherbst und es werden auch in diesem Testprojekt auch die sozialen Perspektiven des Fahrens mit autonomen Shuttles erprobt. Gegenwärtig werden zwar Studien veröffentlicht, dass sich nur 50 % der Deutschen in ein autonomes Shuttle setzen wollen, aber es bleibt abzuwarten, wie den Passagieren der Frankfurter Modellvorhabens das autonome Fahren gefällt.
Nach fünf Jahrzehnten Erkundung sind knapp 15 Kilometer des Blauhöhlensystems vermessen. Dutzende weitere werden vermutet – im größten Höhlenlabyrinth der Schwäbischen Alb. Von Pia Fruth (Produktion 2008/2019)
Das Wissenschaftsmagazin mit Stephan Karkowsky: [00:00] Begrüßung // [01:21] 50 Jahre Mondlandung - die Profis live aus dem Zeiss-Großplanetarium. Dazu im Gespräch: der Direktor des Planetariums // [06:41] Das Scanner-Spiel // [14:08] Erfahrungen aus der Schwerelosigkeit // [19:30] Das Mini-Scanner-Spiel // [22:25] PTScientists planen unbemannte Mondlandung für 2021 // [30:00] Die Erforschung des Mondes // [38:51] Das Mini-Scanner-Spiel // [41:20] Der Benecke: Verschwörungstheorien zur Mondlandung // [47:04] Das Mini-Scanner-Spiel // [50:45] "Mission Mondfest" im Zeiss-Großplanetarium.
FMM 237 : Prof. Christian Bermes – Die Erforschung körperlicher Limits
Fitness mit M.A.R.K. — Dein Nackt Gut Aussehen Podcast übers Abnehmen, Muskelaufbau und Motivation
“Jede Glückssträhne reißt irgendwann. Aber wenn Du dranbleibst, findet das Glück Dich wieder.” – Prof. Dr. Christian Bermes Christian Bermes ist Professor für Automation und Mechatronik an der schweizer HSR Hochschule für Technik in Rapperswil, Vollblut-Sportler und ein guter Freund. Wir sind ehemalige Komilitonen und haben diverse Marathons zusammen bestritten. Das ausloten körperlicher Grenzen bewegt ihn privat und professionell: Christian ist Mitglied der "High Roleurs Society": Er bezwang 10.000 Höhenmeter mit dem Fahrrad in unter 24 Stunden und ohne Schlaf. Mit seinem Team gewinnt er 2016 überraschend die Goldmedaille im Cybathlon, einem internationalen Wettkampf, bei dem Menschen mit Behinderungen sich im Bewältigen von Hindernissen messen. In dieser Episode reden wir über Willenskraft, das eigene Limit, wie Du in schwierigen Situationen dranbleibst, Misserfolge meisterst und was wir von Menschen mit Behinderungen übers Dranbleiben lernen können. Außerdem steht der Cybathlon im Mittelpunkt – ein internationaler Wettkampf, der in den nächsten Jahren mehr und mehr Aufmerksamkeit erregen wird... SHOWNOTES: https://marfit.de/cybathlon TIPP: Christian's Mangoschneider ____________ Diese Fitness mit M.A.R.K. Folge wird präsentiert von Audible.de, wo Du über 150.000 Hörbücher findest. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible Abo – und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Audible Abo bekommst Du jedes Hörbuch für nur 9,95 Euro - auch, wenn es regulär 70 Euro kostet. Es sei denn, Du bist Fitness mit M.A.R.K. Hörer - dann bezahlst Du nur 4,95 pro Monat, und zwar für die ersten 6 Monate. Gehe auf FMMBuch.de und sichere Dir den halben Preis für ein HALBES Jahr. Das Angebot gilt nur, wenn Du diesen Link klickst. Viel Spaß beim Lesen, ... bzw. hören! :)
Die Erforschung der Kernfusion hat seit den 1960er Jahren zig Milliarden an öffentlichen Geldern verschlungen. Rausgeworfenes Geld, wie manche Kritiker meinen oder sinnvolle Investition in eine Energietechnologie der Zukunft? Bei Lora diskutierten Professor Dr. Hartmut Zoom vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und der Technikhistoriker Simon Märkl.
Riesige Vulkane, tiefe Canyons und ausgetrocknete Flussläufe prägen seine Oberfläche. Der Mars ist damit ein Hotspot für mögliches Leben im All. Geliefert hat diese Erkenntnisse auch die Raumsonde Mars-Express.
Elefanten, Zelte, Wohnwagen? Die Theaterwissenschaftlerin Elena Lydia Kreusch ist Expertin für zeitgenössischen Zirkus und räumt auf mit altbekannten Klischees. Manege frei für einen Science Call mit der Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, in dem sie erzählt, wie der „Neue Zirkus“ Artistik mit Tanz, Theater, Performance- und Installationskunst vereint – ganz ohne Tierdressur und Clowns. ---------- Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Gestaltung und Moderation: Julia Grillmayr Sound: Axel Hirn Bild: Shutterstock
Gesundheitsförderung durch Tee? Tee und besonders grüner Tee gilt als Wundergetränk. Was sagt die Forschung dazu? Hilft Tee das Leben zu verlängern? Von Gábor Paal.
Ein Hauch von Unsterblichkeit - Warum Lebewesen unterschiedlich altern
Warum altern Organismen, welche Bedingungen beschleunigen diesen Prozess und welche halten ihn auf? Die Erforschung tierischer Alterungsprozesse liefert überraschende Erkenntnisse.
Der Physiker Prof. Dr. Karl Jakobs erläutert den Beitrag der Universität Freiburg zur Grundlagenforschung in der Elementarteilchenphysik.
Der Physiker Prof. Dr. Karl Jakobs erläutert den Beitrag der Universität Freiburg zur Grundlagenforschung in der Elementarteilchenphysik.
Der Physiker Prof. Dr. Karl Jakobs erläutert den Beitrag der Universität Freiburg zur Grundlagenforschung in der Elementarteilchenphysik.
Der Physiker Prof. Dr. Karl Jakobs erläutert den Beitrag der Universität Freiburg zur Grundlagenforschung in der Elementarteilchenphysik.
An Pädagogischen Hochschulen werden Lehrerinnen und Lehrer für fast alle Schulformen ausgebildet, es gibt sie inzwischen in Deutschland nur noch in Baden-Württemberg. Beispielsweise seien die Pädagogische Hochschule Heidelberg und die Pädagogische Hochschule Karlsruhe genannt- hier in Karlsruhe gibt es zusätzlich auch eine Abteilung für Didaktik an der Fakultät für Mathematik am KIT. An den pädagogischen Hochschulen werden aber nicht nur Pädagogik und Didaktik unterrichtet, sondern auch die entsprechenden Fachrichtungen und jeweilige didaktische Konzepte in diesen Fachrichtungen. Christian Spannagel unterrichtet so als Professor für Mathematik und Informatik in den Fächern, und erzählt im Gespräch mit Sebastian Ritterbusch, wie er didaktische Konzepte für den Mathematikunterricht erforscht und aktiv erprobt. Die Frage nach Verbesserung des Mathematik-Unterrichts ist sehr aktuell: Die OECD-Studie zu Geschlechtsunterschieden in der Schule hat gerade in Mathematik Verbesserungspotential aufgezeigt, denn viele geben Mathe auf, weil sie nachweislich fälschlich glauben, sie könnten es nicht. Der zentrale Begriff ist hier die Selbstwirksamkeitserwartung, die insbesondere in Naturwissenschaften und Mathematik durch gesellschaftliche Einflüsse stark geprägt ist. Die Erforschung neuer Lehrmethoden kann aber nicht den Ersatz der bisherigen und erprobten Konzepte zum Ziel haben: So sind selbst vermeintlich alte Übungen zum Kopfrechnen und zur schriftlichen Division auch heute noch überaus wichtige Hilfen zur Vermittlung von Algorithmen, Stellenwertsystemen und auch zur Vorbereitung auf ein Studium. Das Ziel muss sein, den Fundus möglicher Vermittlungsformen zu bereichern, und für verschiedene Konzepte bessere Kombinationen der Verfahren zu finden. Ein nützliches neues Werkzeug ist die Tabellenkalkulation, mit der beispielsweise Würfelexperimente und Simulationen im Unterricht interaktiv erfahrbar gemacht werden können. Ebenso können Dynamische Geometriesysteme den Zugang zur Konstruktion und Analytischer Geometrie, wie beispielsweise den Satz des Thales, deutlich vereinfachen. Die Software GeoGebra ist ein solches System, das insbesondere auch unterschiedliche Darstellungen und Analyse der Konstruktionen ermöglicht. Leider ist es zu Zeit noch nicht möglich, dass in Klassen jederzeit an jedem Platz ein Rechner zum Einsatz interaktiver Experimente vorhanden ist. Aber auch an einem interaktiven Whiteboard können die Methoden durchgeführt werden. Die technische Ausstattung ist aber nur ein kleiner Schritt zur Einführung neuer Werkzeuge in den Unterricht, auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen die Kompetenzen zum Einsatz der neuen Medien erlernen. Hier müssen die pädagogischen Hochschulen den Lehramtsstudierenden den Weg bereiten, damit das Lehrpersonal zu Beginn und auch in ihrer langen Lehrzeit für den Stand und die Entwicklung der Technik vorbereitet ist. Auch Wissensmanagement in der Form von Wikis haben in Schulen Einzug gehalten, so setzen Maria Eirich und Andrea Schellmann auf ein Schulwiki am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt und Lernpfade zum interaktiven Mathematik-Unterricht. Auch Schülerinnen und Schüler können hier selbst Quiz-Aufgaben erstellen. Michael Gieding und Andreas Schnirch haben für Geometrie-Vorlesungen an der PH Heidelberg ein Geometrie-Wiki auf dieser Technologie erstellt, das auch weiterhin für Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende genutzt wird. Eine Einführung in die frühen interaktiven Elemente am CMS der Fakultät für Mathematik sind auf der Fragebogen-Seite mit einer Vielzahl von Beispielen zu finden. Gerade in Mathematik stellt die Einbindung digitaler Medien eine gewisse Hürde dar, da Formeln, Beweise, Algorithmen und Konstruktionszeichnung nicht leicht digitalisierbar sind- auch wenn das Textsatz-System LaTeX oder LyX im mathematischen Bereich mit perfektem Druckbild für fast alles verwendet werden kann, so muss man es erst erlernen- beispielsweise mit der l2kurz-Anleitung. Das Austauschen von abfotografierten Seiten ist da häufig deutlich effektiver. Dabei ein solcher Austausch zwischen den Lernenden sehr zu begrüßen, da es zum einen die gemeinsame Konstruktion von Lösungswegen begünstigt, aber auch die angehenden Lehrenden auf die Nutzung der Medien trainiert. Wichtig sind niederschwellige Zugänge und die Möglichkeit zu anonymen Beiträgen, da nur so das Lernen aus Fehlern ermöglicht wird. Im Flipped Classroom wird der Prozess der interaktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, der traditionell zu Hause erst bei den Hausaufgaben auftritt, in den Unterricht gebracht, und der herkömmliche Frontal-Unterricht aus dem Klassenzimmer verbannt. Dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden zur Vorbereitung ein Video, in dem das grundsätzliche Verfahren erklärt wird. Die Unterrichtsstunde kann dann mit einer Fragerunde zum Videomaterial starten, gefolgt von einigen Aufgaben, die vom Plenum in Gruppenarbeit bearbeitet werden sollen. Hier werden Probleme und Fragen offensichtlich, die vom Lehrenden oder gemeinsam in einer Diskussion erörtert werden können. Anschließend könnte sich ein Hörsaal- oder Klassenzimmerspiel anschließen, das sowohl auflockert, als auch das Thema verfestigt. Dass besondere Ereignisse den Lernerfolg verbessern können, wurde auch beim Thema >Gestern hab ich noch Zeit genug< im Methodisch-Inkorrekt Podcast Folge 43 besprochen. Auch wenn es nicht immer außerordentliche Ereignisse geben kann, so ist eine sinnvolle Abwechslung der Lehrmethoden sicher zuträglich zur Verbesserung des Unterrichts. Neben der Frage zur zeitlichen Planung des Unterrichts sind auch Fragen innerhalb der Mathematik eine Untersuchung auf mögliche Vermittlungsmethoden interessant: Die Gaußsche Summenformel ist nicht nur wichtig zur Berechnung der Anzahl der Spiele in einer Fußball-Liga, sondern auch ein schönes Beispiel zur verschiedene mathematische Beweisverfahren. Die Formel kann durch vollständige Induktion bewiesen werden, ein anderer Ansatz ist die Verwendung von Dreieckszahlen zu einem ebenso korrekten ikonischen Beweis der Summenformel. Einen wichtigen Stellenwert hat auch die Haltung der Lehrperson: Anstatt zu demoralisieren, müssen die Lernenden in ihrem Lernprozess unterstützt und bei Bedarf geleitet werden. Dazu gehört auch die Anpassung der Komplexität an die unterschiedlichen Kenntnisse der Lernenden- eine fast unmögliche Aufgabe angesichts großer Unterschiede in den Vorkenntnissen. Eine Möglichkeit sind Angebote für optionale Übungsgruppen, oder Zusatzangebote für weitergehende Fragen. Ideal sind jedoch natürlich differenzierende Aufgaben, die von allen Lernenden je nach ihrem Kenntnisstand hinreichend und unterschiedlich umfangreich beantwortet werden können. Ein Beispiel ist hier die Aufgabe zu den Pythagoreischen Zahlentripeln, die sehr knapp, aber auch sehr weitreichend beantwortet werden kann. Eine andere interessante Frage steckt im Münzproblem, die man bis zur Frage der kleinsten Anzahl von Münzen zur Rückgabe aller Geldbeträge von 1-99 Cent beantworten kann (Optimal sind acht Münzen in vier möglichen Variationen: zB 1+1+2+5+10+10+20+50 oder 1+2+2+5+10+20+20+50). Die Frage der Evaluation von Unterrichtsmethoden wie dem Flipped Classroom ist leider nicht einfach zu beantworten: Es ist kaum möglich zwei Gruppen parallel und voneinander unbeeinflusst unterschiedlich zu unterrichten. Bei einer Evaluation zwischen verschiedenen Jahrgängen konnte ein besseres Abschneiden bei Prüfungen nicht sicher nachgewiesen werden, jedoch ist war das subjektive Empfinden der Studierenden gegenüber den neuen Methoden ausgesprochen positiv. Malte Persike hat entsprechende Ergebnisse erhalten, u.a. beim MOOC zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, stellt aber auch zur Diskussion, dass bei mit herkömmlichen Methoden weniger erfolgreichen Dozenten die neue Methoden deutlich bessere Ergebnisse erzielen könnten. Bei der Umstellung auf Flipped Classroom-Konzepte ist die Videoerstellung oft nicht sehr aufwendig, da hier abgefilmte frühere Veranstaltungen in Frage kommen können. Dafür ist die Umstellung und die Planung des neuen Unterrichts oftmals deutlich aufwendiger, wenn man eine Stunde zum ersten Mal durchführt. Anders sieht es bei einem Massive Open Online Course, kurz MOOC, aus, für den Videos deutlich aufwendiger und in kürzerer Form produziert werden. MOOCs sind besonders durch Sebastian Thrun bekannt geworden, als er eine Vorlesung zur künstlichen Intelligenz online zur Verfügung stellte, an der etwa 160'000 Studierende teilnahmen. In der Regel werden Videos mit vorlesungsartigen Inhalten wöchentlich online gestellt, zu denen die Teilnehmer regelmäßig Aufgaben gestellt bekommen. Durch Verfügbarkeit im Internet können sehr viele an diesen Kurs teilnehmen, und durch die Verwendung offener Technologien und Zugänge ist die Teilnahme sehr niederschwellig und spricht viele Interessenten an. An der PH Heidelberg wurde der Mathe-MOOC Mathematisch Denken von Christian Spannnagel, Michael Gieding, Lutz Berger und Martin Lindner ins Leben gerufen, der das MOOC-Konzept nicht ganz klassisch umgesetzt hat. Viel mehr wurde ein Schwerpunkt auf Mathematikdidaktik gelegt: Statt einem festen Wechsel von Vorlesung und Übung wurden einführende experimentelle Einheiten eingesetzt, bei denen die Teilnehmenden schon im Vorfeld Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema machen konnten. Die Bearbeitung der Aufgaben und der Vergleich der Lösungen erfolgte dann in öffentlichen Foren- eine abschließende Prüfung war in diesem MOOC nicht vorgesehen, sondern möglichst vielen einen Einstieg in die mathematische Denkweise ermöglichen. Die Teilnehmenden können sich selbst als Kiebitze, Anpacker und Formalisierer bezeichnen, auch von Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich- die Kiebitze sind hauptsächlich passive Zuschauer, wogegen die Anpacker die Lösungen aktiv, beispielsweise ikonisch, erarbeiten wollen. Die Formalisierer suchen schließlich die exakte mathematische Beschreibung und symbolische Lösung der Aufgaben. Diese Differenzierung ermöglicht eine Klarstellung der eigenen Teilnahmeabsicht und vereinfacht durch die Vorgabe verschiedener Ansätze den Zugang in den jeweiligen Nutzungsszenarien. MOOCs können und sollten herkömmliche Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sondern die Nutzung wie beim Flipped Classroom-Konzept die Qualität der Präsenzveranstaltungen verbessern. Ausgesprochen sinnvolle Beispiele zum Einsatz von MOOCs sind Brückenkurse vor Studienbeginn, wo noch nicht alle Studierende am Studienort sind, oder in der Weiterbildung für Berufstätige. Der Mathe-MOOC Mathematisch Denken findet aktuell jedes Semester statt, und wer mitmachen möchte, kann jeweils Anfang April oder Anfang Oktober einsteigen. Die Kurse werden auch kontinuierlich weiter entwickelt. So werden nun mit Christian Freisleben-Teutscher Improvisationsmethoden eingebunden, um die gegenseitige Interaktion zwischen den Teilnehmenden zu fördern. Schon seit Beginn des Mathe-MOOCs sind auch szenische Darstellungen sehr erfolgreicher Teil der Darstellung, und dienen der Motivation und Auflockerung der manchmal trockenden Mathematik. So tritt Christian Spannagel oft als Dunkler Lord auf, der auf seine besondere Weise die Mathematik erklärt. Wie es schon Jean-Pol Martin formulierte, haben Professoren die Verantwortung neue Wege zu gehen, um für die Gesellschaft auch riskantere Wege einzuschlagen. Auch am KIT werden erfolgreich MOOCs angeboten, und der MOOC gegen Chronisches Aufschieben wurde vor kurzem mit dem Bildungsmedienpreis digita ausgezeichnet. Ein weiterer neuer Zugang ist die Gamification, bei der spielerische Elemente in spielfremde Bereiche eingeführt werden. Dies kann durch die Zuteilung von Punkten, Leveln oder Abzeichen bzw. Badges erfolgen, und dies kann auch in der Hochschullehre eingesetzt werden. Die Wahl eines Kontexts hat sich aber als kritisch herausgestellt: Wenn die Lernenden sich nicht mit dem Spiel identifizieren können, ist kaum ein Erfolg zu erwarten. Nando Stöcklin und Nico Steinbach entwickelten das erfolgreiche System QuesTanja, mit den Schülerinnen und Schüler mit Tablets selbstständig Mathematik erlernen können. Die Forschung richtet sich hier auf die Konzepte des Design-based Research, sie konzentriert sich also darauf die Methode zu entwickeln und iterativ und zyklisch zu verbessern. Auch zum Erlernen des Programmierens haben sich spielerische Konzepte bewährt, ein Beispiel dafür ist die Plattform Scratch und ScratchJr, oder auch Lightbot. Diese Lernprinzipien gehen auf Seymour Papert zurück, der schon mit der Programmiersprache Logo den Grundstein zu erziehungsorientierten Programmiersprachen gelegt hat. Die Logo-Programmiersprache gab es als Schildkrötengrafik auch schon im NDR-Klein-Computer. Eine interessante Frage im Umgang mit neuen Medien in Lehre und Wissenschaft ist die Zitierbarkeit der Angebote. Auf der einen Seite geben sich neue Nutzungsmöglichkeiten durch direkte Links an bestimmte Zeitpunkte, jedoch sind Zitate auf Videos, Audiodateien und Internetseiten noch nicht in der wissenschaftlichen Literatur etabliert. Neue Ansätze zur Vortragsaufzeichnung beim KonScience Podcast werden diskutiert. Ein wichtiger Ansatz ist auch die Vergabe von DOI-Nummern für digitale Medien, wie es auch im Open Science Radio Podcast angesprochen wurde. Letztendlich kann man bei der Erstellung von Videos für den Unterricht nicht zu viel Perfektionismus an den Tag legen, wie es auch schon Aaron Sams formulierte: "Do you need it perfect, or do you need it by Tuesday?" Literatur und Zusatzinformationen C. Spannagel: Digitale Medien in der Schule: in medio virtus, LOG IN, 180, 22-27, 2015. M. Fischer, C. Spannagel: Lernen mit Vorlesungsvideos in der umgedrehten Mathematikvorlesung, In J. Desel, J. M. Haake & C. Spannagel (Hrsg.), DeLFI 2012 – Die 10. e-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. (S. 225-236). Bonn: Köllen Druck+Verlag, 2012. C. Spannagel, J. Spannagel: Designing In-Class Activities in the Inverted Classroom Model, In J. Handke, N. Kiesler & L. Wiemeyer, L. (Hrsg.) (2013). The Inverted Classroom Model. The 2nd German ICM-Conference (S. 113-120). München: Oldenbourg Verlag, 2013. Flipped Classroom: Die umgedrehte Mathematikvorlesung Video: 10 Irrtümer zum Einsatz digitaler Medien in der Schule Podcast Lob und Tadel 019: Schulmathematik
Die Erforschung von Methoden von Wirtschaftskriminalität, aber auch die damit verbundenen ethischen Fragen, sind die Ziele des Projekts von Michael Schermann und Matthias Uhl, das im Rahmen des Programms "Fellowship Hochschullehre" durch den Stifterverband gefördert wird. Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Michael Schermann, wie er auf die Idee gekommen ist, diesen interessanten Bereich zu erforschen und welche Rolle dabei insbesondere der "White Collar Hacking Contest" spielt.
Synaptische Pathologie in Tau-transgenen Mausmodellen neurodegenerativer Erkrankungen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/06
In Zeiten des demografischen Wandels erfahren Krankheiten wie die Alzheimer-Demenz, als deren größter Risikofaktor das Alter gilt, einen rasanten Anstieg der Patientenzahl. Die Erforschung der zugrundeliegenden neurodegenerativen Mechanismen und das Einbringen daraus gewonnener Erkenntnisse in die Entwicklung von Therapieansätzen oder gar Präventionsmaßnahmen sind daher von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung - nicht zuletzt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, wie den gleichsam wachsenden Kosten für das Gesundheitssystem. In der vorliegenden Arbeit wurden neuropathologische Prozesse in verschiedenen transgenen Tauopathie-Mausmodellen mittels hochauflösender Mikroskopietechniken untersucht. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Analyse synaptischer Veränderungen im lebenden Tier, ermöglicht durch die Zwei-Photonen-Intravitalmikroskopie. Zunächst wurden in Tau P301S-Mäusen die Auswirkungen FTDP-17-mutierten humanen Tau-Proteins auf die strukturelle Plastizität neokortikaler dendritischer Spines analysiert. Dabei wurde eine im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen verminderte Spinedichte gemessen, welche auf eine geringere Ausbildung neuer Spines zurückzuführen war. Die verbliebenen Spines zeigten morphologische Veränderungen wie ein vergrößertes Kopfvolumen - möglicher Weise zur Kompensation des Synapsenverlusts. Ergänzend wurde eine Methode zur immunhistochemischen Synapsendichtemessung an Gehirnschnitten etabliert, welche jedoch keine Effekte der Transgenexpression auf die Dichte prä- oder postsynaptischer Spezialisierungen offenbarte. Um die Rolle inflammatorischer Prozesse in Tauopathien zu analysieren, wurde die Mauslinie Tau x CXCR erzeugt. Partielle oder vollständige genetische Fraktalkinrezeptor-Deletion in diesen Mäusen erlaubte eine gezielte Modifizierung der Kommunikation zwischen Neuronen und Mikrogliazellen. Die resultierende Aktivitätserhöhung der Mikrogliazellen hatte wider Erwarten keinen signifikanten Einfluss auf die Dichte Phospho-Tau enthaltender Zellen in den untersuchten kortikalen Gehirnregionen. Zur Modellierung der Alzheimer-Demenz wurden Tau P301S-Mäuse mit der Linie APP PS1 verpaart. Die Nachkommen wiesen Alzheimer-typische histologische Läsionen wie extrazelluläre Aβ-Plaques und intrazelluläre Tau-Ablagerungen auf. Es konnte jedoch im Vergleich zur Ursprungslinie Tau P301S keine Aβ-induzierte Verstärkung der kortikalen Tau-Pathologie gemessen werden, welche die Amyloid-Kaskaden-Hypothese suggeriert. Eine intravitalmikroskopische Analyse dendritischer Spines in Tau P301S- und Tau x APP PS1-Mäusen in unterschiedlichen Krankheitsstadien sowie in Wildtyp-Wurfgeschwistern sollte die Abgrenzung Tau-bedingter von Aβ-bedingten Effekten ermöglichen. Dabei wurden Veränderungen in der strukturellen Plastizität gefunden, beispielsweise in der Spine-Neuausbildung oder in bestimmten morphologischen Fraktionen, nicht aber in der absoluten Spinedichte. Schließlich erfolgte eine elektronenmikroskopische Untersuchung neuritischer Dystrophien in einem weiteren Alzheimer-Mausmodell, der Linie 3xTg-AD. Durch immunhistochemische Markierung konnten sowohl Aβ- als auch Tau-Ansammlungen in den pathologischen Anschwellungen nachgewiesen werden. Die präsentierten Befunde zeigen u. a. die ersten intravitalmikroskopischen Langzeitstudien dendritischer Spines in Mausmodellen mit reiner Tau-Pathologie sowie damit kombinierter Aβ-Pathologie. Sie bieten grundlegende, durch Patientenuntersuchungen nicht zu gewinnende Informationen über krankhafte synaptische Veränderungen, welche als frühe Ereignisse in der Alzheimer-Demenz betrachtet werden.
Der Einfluß des Retinoid-X-Rezeptors gamma auf die Entstehung der Schizophrenie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Die Schizophrenie, eine psychiatrische Erkrankung mit stärksten Auswirkungen auf Wahrnehmung, Gedanken und Emotionen der Patienten, tritt weltweit bei etwa einem Prozent aller Menschen auf. Ihre genaue Ursache ist bisher weitgehend ungeklärt. Neben Umweltfaktoren spielt die genetische Komponente eine herausragende Rolle, wobei nicht ein Gen alleine beteiligt ist, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Gene als Auslöser vermutet wird.Die Erforschung solcher Suszeptibilitätsgene kann zu besserem Verständnis der Ätiopathogenese der Erkrankung führen und schließlich zu neuen Ansätzen in Diagnose und Therapie. Zahlreiche funktionelle Kandidatengene der Schizophrenie, allen voran der Dopaminrezeptor D2, unterliegen der Regulierung durch Retinoidrezeptoren, welche dadurch selbst zum Gegenstand der Forschung werden. In vorliegender Arbeit wird das Gen des Retinoidrezeptor RXR gamma (RXRG-Gen) untersucht, das sich auf Chromosom 1q22-23 befindet. In einer Fall-Kontroll-Assoziationsstudie mit 287 Schizophrenie¬patienten und 421 gesunden Kontrollpersonen als Probanden werden zwei Einzelbasenaustausch-Polymorphismen – einer ist innerhalb der potentiellen Promotorregion lokalisiert, der andere befindet sich auf Exon 8 –auf einen Zusammenhang mit Schizophrenie untersucht.Bei den Allel- und Genotypfrequenzen der Polymorphismen rs1467664 und rs2134095 zeigte sich keine signifikante Assoziation mit Schizophrenie, bei rs1467664 konnte der homozygote Genotyp des selteneren Allels Guanin im Vergleich zu den zusammengefaßten beiden anderen Genotypen einen Trend in Richtung Assoziation aufweisen. Um eine Beteiligung des RXR gamma bei der Entstehung der Schizophrenie endgültig klären zu können, müßten noch andere Polymorphismen des Gens flächendeckend untersucht und ein stärkeres Augenmerk auf das Wechselspiel mit anderen Genen gelegt werden, da eine isolierte Betrachtung eines Gens innerhalb der Ätiologie einer so komplexen Erkrankung wie die der Schizophrenie zu wenig Aussagekraft hat.
Bedeutung der WNK3-Kinase für die Salz-, Wasser- und Blutdruckhomöostase in vivo
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/07
Die Reabsorptionsprozesse der Niere leisten einen essentiellen Beitrag zur Salz-, Wasser- und Blutdruckhomöostase. Die Erforschung dieser Mechanismen ist ein wichtiges Element der Hypertonietherapie. In diesem Zusammenhang sind die sogenannten WNK-Kinasen, die die Aktivität renaler Ionentransporter regulieren, von besonderem Interesse. Die WNK3-Kinase spielt in vitro eine wichtige Rolle bei der Aktivierung von NKCC2 und NCC. Das Ziel dieser Arbeit war daher, die Relevanz von WNK3 für die Nierenfunktion und die Blutdruckhomöostase in vivo zu klären. Hierzu wurden Versuche an WNK3-defizienten Mäusen durchgeführt. Es konnte kein relevanter renaler Phänotyp bei den WNK3-KO-Mäusen detektiert werden. Jedoch konnte eine signifikant gesteigerte WNK1-Expression nachgewiesen werden. Das Fehlen der WNK3-Kinase-Funktion scheint durch einen über die WNK1-SPAK/OSR1-Achse verlaufenden Mechanismus kompensiert zu werden. Die WNK3-Kinase scheint somit nur ein Teil eines Netzwerks von Kinasen zu sein, die an der Regulation der Nierenfunktion beteiligt sind.
Euphausiden, besser bekannt als Krill, sind kleine, garnelenartige Krebstiere und gehören zum Zooplankton im Benguela-Auftriebsgebiet. Krill stellt die Nahrungsgrundlage für viele Fische und Meeressäuger dar und dient vor Namibia als Ökosystemanzeiger. Im Arbeitsgebiet kommen mindestens acht verschiedene Krill-Arten vor. Zu Forschungszwecken wird Krill vornehmlich mit dem MOCNESS gefangen: ein Netz, mit dessen Hilfe Zooplankton-Proben aus unterschiedlichen Wassertiefen geborgen werden können. Das ist wichtig, da sich der Krill je nach Tages- oder Nachtzeit lichtabhängig in unterschiedlichen Tiefen aufhält. Die Erforschung der Krillarten in Hinblick auf ihre physiologischen Eigenschaften und bezüglich der ökologischen Stellung im Nahrungsnetz ist zentraler Bestandteil der Doktorarbeit von Thorsten Werner (AWI-Bremerhaven). Schwerpunkt seiner Forschung ist die Fragestellung, wie sich der Krill auf die ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Temperatur, Sauerstoff und Nahrungsangebot, im Benguela-Auftriebsgebiet anpasst und welche langfristigen Auswirkungen der Klimawandel in diesem Zusammenhang spielt.
Interdisziplinäre Einsichten: Die vielen Gesichter der Demenz
Die Erforschung von Altersdemenz macht an der LMU große Fortschritte. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst von vier Wissenschaftlern. Professor Christian Haaß, Adolf-Butenandt-Institut, konnte die normale Funktion eines Alzheimerenzyms aufklären. Professor Jochen Herms gelang ein ähnlicher Funktionsnachwei bei dem zentralen Alzheimerprotein. Seine Kollegen am Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung, Privatdozentin Manuela Neumann und Professor Hans Kretzschmar, identifizierten dagegen in internationaler Kooperation das wichtigste Protein der Frontotemporalen Demenz – und eröffneten damit ein neues Gebiet der Neurodegenerationsforschung.
Vor genau fünf Jahren startete die Raumsonde Mars Express, um den Roten Planeten zu untersuchen. Ernst Hauber vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin berichtet über den Beginn der Mission und die Erforschung unseres Nachbarplaneten Mars. DLR-Planetengeologe Ernst Hauber plant die Aufnahmen der hochauflösendeb Stereokamera HRSC (High Resolution Stereo Camera). Sie nimmt den Mars dreidimensional und in Farbe auf. Bei einem Überflug nimmt die Kamera ein Gebiet aus mehreren Blickwinkeln auf. Ernst Hauber analysiert die Bilder. Im Gespräch mit DLR-Reporter Sven Oswald beschreibt Hauber außerdem die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen Mars-Erforschung, insbeondere den Nachweis von Wasser.
Die Hoechstbegabtenstudie Adele Judas als Beispiel fuer die Erforschung des "Genialenproblems"
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Mon, 7 Nov 2005 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4459/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4459/1/Wiedemann_Ute.pdf Wiedemann, Ute ddc:610, ddc:6
Etablierung und Charakterisierung eines Wachstumshormon-transgenen Mausmodells auf Inzuchtbasis (FVB/N)
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/07
Nierenerkrankungen stellen aufgrund ihres häufig chronischen Verlaufs einen langen Leidensweg für den Patienten und einen nicht zu vernachlässigenden Kostenpunkt für das Gesundheitswesen dar. Die Erforschung der Faktoren, die in der Progression von Nierenerkrankungen eine Rolle spielen, ist daher nicht nur von wissenschaftlichem, sondern auch von volkswirtschaftlichem Interesse. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erstellung eines Tiermodells, in dem die Veränderungen im Zuge der progressiven Glomerulosklerose auf Proteom- und Transkriptomsebene optimal charakterisiert werden können. Dafür wurde die Überexpression von bovinem Wachstumshormon, die reproduzierbar zu einer gut charakterisierten Kaskade von Nierenveränderung führt, in transgenen Mäusen gewählt. Zur Elimination der eventuell störenden genetischen Variabilität wurde das Modell auf dem Inzuchtstamm FVB erstellt, der keine spontanen Nephropathien aufweist. Als Promoter wurde der ubiquitär aktive cβa Promoter gewählt, wodurch zirkulierende GH-Konzentrationen in der Größenordnung von 2-4 µg/ml erreicht wurden. Um die Eignung der neuen transgenen Mauslinie für weitere Analysen zu evaluieren, wurden die auftretenden klinischen, klinisch-chemischen, makroskopisch-pathologischen und histologischen Veränderungen eingehend charakterisiert. Die GH-Überexpression führte zu einem deutlich rascheren Gewichtsanstieg unter Aufhebung des Geschlechtsdimorphismus und zu einer stark verringerten Lebenserwartung. Histologisch zeigten sich in der Niere das erwartete Spektrum renaler Alterationen, das weitgehend den in anderen GH transgenen Mauslinien beobachteten Alterationen gleicht. Anhand der histologischen Befunde und der klinisch chemischen Anzeichen einer Nierenfunktionseinschränkung, kann die progressive Nephrosklerose am ehesten als Todesursache angesehen werden. Zusammenfassend wurde mit der cβa-bGH transgenen Mauslinie zum ersten Mal ein Modell für chronisch progredientes Nierenversagen auf dem Inzuchtstamm FVB etabliert. Aufgrund der genetischen Uniformität und der in dieser Arbeit beschriebenen klinischen und histologischen Veränderungen erscheint dieses neue Modell hervorragend geeignet, um Pathomechanismen des chronischen Nierenversagens mit holistischen Untersuchungsansätzen (Transcriptomics, Proteomics) auf molekularer Ebene zu charakterisieren.
Myc-Funktion im Zellwachstum und Identifikation von neuen Myc-regulierten Genen in B-Zellen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Die Überproduktion des Myc-Proteins ist eine Ursache für die Entstehung einer großen Anzahl von humanen Tumoren. Die Erforschung der Myc-Funktionen ist daher ein wichtiges Ziel der Tumorbiologie. Mit einem neuartigen Zellsystem wurde in dieser Arbeit die Rolle von Myc für das Wachstum von Zellen untersucht. Das Zellsystem P493-6 ist eine B-Zellinie, in der die myc-Expression durch ein Tetrazyklin-Vektorsystem regulierbar ist und das erste menschliche Zellsystem, in dem Myc konditional untersucht werden konnte. Diese Linie exprimiert kein endogenes myc, so daß Myc-Funktionen nur von der Expression des exogenen, konditionalen Myc abhängen. Der Zusatz von Tetrazyklin (Tc) im Kulturmedium bewirkt die Repression von myc und den Zellzyklusarrest. Durch Auswaschen von Tc kann myc wieder induziert werden und die Zellen treten wieder in die Zellzyklusprogression ein. In früheren Arbeiten wurde in dieser Zellinie bereits der Einfluß von Myc auf die Zellzyklusregulation untersucht (Pajic et al. 2000). Diese Untersuchungen wurden in dieser Arbeit erweitert, mit Augenmerk auf die Myc- Funktion im Zellwachstum. Myc löste in P493-6 keine Apoptose aus, wenn dem Kultivierungsmedium Serum entzogen wurde. Myc konnte bei Serum-Entzug nicht den Eintritt in die DNA-Synthesephase induzieren. Stattdessen wurden Myc-Funktionen im Zellwachstum beobachtet. Myc steigerte bei Serum-Entzug die Proteinsynthese, die Aktivität von Stoffwechselenzymen und bewirkte so die Zunahme an Zellmasse und -Größe. Zum ersten Mal wurde damit gezeigt, daß Myc-Expression Zellwachstum induziert, ohne daß die Aktivierung des Zellzyklus erfolgen muß. Zellwachstum kann also durch Myc über einen eigenen, Zellzyklus-unabhängigen Weg reguliert werden. Diese Ergebnisse wurden durch andere Arbeiten über Maus- und Drosophila-Myc bestätigt. Da Myc als Transkriptionsfaktor beschrieben wurde, wurden in der vorliegenden Arbeit neue Myc-regulierte Gene mit modernen Array- und Genchip-Analysen identifiziert. Insgesamt konnten 108 Gene identifiziert werden, die neue Kandidatengene für direkte Regulation durch Myc sind. Viele dieser Gene sind am Ablauf von Stoffwechselwegen beteiligt, wie Aminosäure- und Proteinsynthese, Lipid-Metabolismus, Proteinfaltung und –umsatz, Nukleotid- und DNA-Synthese, Transport, Nukleolus-Funktion, Transkription, Spleissen und oxidativem Stress, was die Beobachtungen der Zellwachstumsregulation bestätigt. Die Identifikation von Myc-Zielgenen, die an der Signaltransduktion beteiligt sind, war eine neue Beobachtung. Neben Komponenten der Signaltransduktion wurden auch Wachstumsfaktoren-, und Wachstumsfaktorrezeptoren als Myc-Zielgene identifiziert. Damit ist Myc an der Regulation von autokrinen und parakrinen Stimulierungs-Signalwegen beteiligt, die die Proliferation entscheidend beeinflussen. Die Ergebnisse des Genexpressionsprofils ist außerdem von Bedeutung für das Verständnis der Zellzyklusaktivierung in B-Zellen.
Wie steht es um die Erforschung der Begabtenreserven?
Sun, 1 Jan 1967 12:00:00 +0100 http://epub.ub.uni-muenchen.de/2211/ http://epub.ub.uni-muenchen.de/2211/1/2211.pdf Heller, Kurt A. Heller, Kurt A. (1967): Wie steht es um die Erforschung der Begabtenreserven? In: Die Höhere Schule in Bayern, Vol. 1967, Nr. 2: pp. 34-45. Psychologie und Pädagogik