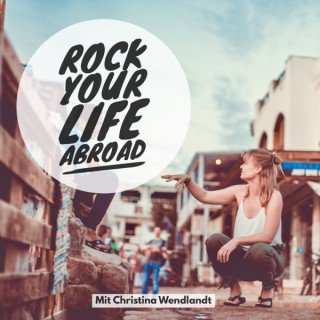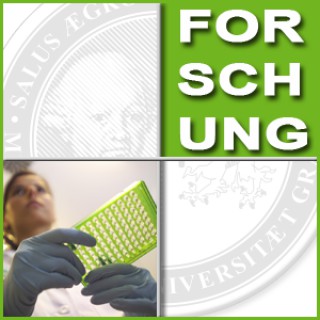Podcasts about nanopartikel
- 36PODCASTS
- 41EPISODES
- 26mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 16, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about nanopartikel
Latest podcast episodes about nanopartikel
AUFGEDECKT: 600 Zusatzstoffe im Brot & Nanopartikel in Cola?! | Ralf Brosius #1260
Das Klima im Zeichen menschlicher Aktivität | Von Felix Feistel
Ein Standpunkt von Felix Feistel.Schon seit Jahrzehnten greift der Mensch aktiv in das Wetter ein, wie in den vorangegangenen Artikeln zum Thema Geoengineering dargestellt wurde. Geoengineering, wie etwa das Cloudseeding wurde schon während des zweiten Weltkrieges vom britischen Militär erprobt und vom US-amerikanischen Militär im Vietnamkrieg eingesetzt, um die Monsunsaison zu verlängern, und so die Bewegungsmöglichkeiten des Vietcong einzuschränken. Cloudseeding zielt wahlweise darauf ab, Wolken abregnen zu lassen, um an anderer Stelle einen wolkenfreien Himmel zu bekommen, oder darauf, bestimmte Regionen zu beregnen. Dabei werden die Wolken mit chemischen Substanzen, meist Silberiodid, besprüht, oder aber mit elektrischen Impulsen stimuliert, um den Regen zu provozieren. Wie bereits thematisiert wird diese Technologie bereits seit Jahrzehnten auf allen Kontinenten angewendet. Die USA, China, Russland, Israel, Marokko, viele europäische Länder und die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen sie, um Regen zu erzeugen, und in Deutschland dient das Geoengineering der Abwehr von Hagel in Weinbaugebieten. Spätestens seit der Olympiade in China im Jahr 2008 ist die Existenz dieser Technologie der breiten Öffentlichkeit bekannt. (1)Darüber hinaus gibt es jedoch Bestrebungen verschiedener Staaten, und hier insbesondere des Militärs und der Geheimdienste, das Wetter vollständig zu kontrollieren. Zahlreiche Berichte und Papiere belegen, dass das US-Militär schon lange daran arbeitet, das globale Wetter bis zu diesem Jahr vollständig unter Kontrolle zu bekommen. Zentral dafür ist die Herrschaft über die Wärmeverteilung in der Atmosphäre, die unter Anderem durch elektromagnetische Wellen beeinflusst werden können soll. Hier kommen Anlagen wie HAARP ins Spiel, deren Existenz gesichert ist, deren Zweck sich aber offiziell auf die Erforschung der Ionosphäre beschränkt. Viele Spekulationen und Theorien, die eine Beeinflussung des Wetters oder die Erzeugung von Erdbeben mittels dieser Anlagen behaupten haben zwar eine wissenschaftliche Grundlage und werden sogar durch die zugrundeliegenden Patente gestützt, allerdings ist die praktische Umsetzung derzeit kaum nachweisbar. (2)Auch das Geoengineering – vielleicht sollte man lieber von Climateengineering sprechen – das momentan in den Medien zur Abwendung des sogenannten menschengemachten Klimawandels vorangetrieben wird, und sich offiziell lediglich in der Testphase befindet, könnte ein Bestandteil dieser angestrebten Herrschaft über das Wetter sein. Hier werden wahlweise die Entfernung des Kohlenstoffdioxids aus der Atmosphäre, oder das Ausbringen von Partikeln zur Abdunkelung der Sonne oder Aufhellung der Wolken angestrebt, um die Rückstrahlung der Sonneneinstrahlung zu erhöhen. Jedoch gibt es zahlreiche Spekulationen und Vermutungen, dass dieses Einbringen von Partikeln in der Atmosphäre bereits seit Jahrzehnten stattfindet. Hier ist die Rede von Aluminium, Strontium, Bor und anderen Metallen, die als Nanopartikel mittels Flugzeugen in der Atmosphäre ausgebracht werden, und die seltsamen, persistierenden Streifen am Himmel erklären. Mittels HAARP in Verbindung mit diesen Partikeln sollen dann, so die Theorie, Luftmassen verschoben und ionosphärische Schichten angehoben werden können, um das Wetter global zu manipulieren und sogar Erdbeben zu erzeugen. Und auch, wenn die Hintermänner einer solchen globalen Operation bislang unbekannt sind, und der technische Aufwand enorm scheint, so gibt es doch immer wieder Hinweise darauf, dass es sich dabei um mehr handeln könnte, als reine Spekulation. Allerdings sind hier einige Aspekte unschlüssig, etwa die Frage, warum die Menschen, die so etwas planen und durchführen, sich selbst dermaßen vergiften sollten, wie es die Anhänger dieser Theorie nahelegen....https://apolut.net/das-klima-im-zeichen-menschlicher-aktivitat-von-felix-feistel/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Medizin der Zukunft – Wie Nanopartikel Krankheiten gezielt bekämpfen können
In der Rubrik geht es um die Frage, ob Düfte unsere Stimmung beeinflussen können. Die Hoffnungsträger sind winzig, die Hoffnung selbst ist riesengroß. Nanopartikel sollen die Medizin revolutionieren. Denn sie können aufgrund ihrer Größe Medikamente direkt in den Körper einschleusen und so viel gezielter Krankheiten bekämpfen. Wo Nanomedizin heute schon eingesetzt wird, wo die Chancen in der Zukunft liegen und welche Risiken es gibt, erklärt in dieser Folge Dr. René Thürmer, Qualitätsassesor und Experte für Nanomedizin am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Hier findet Ihr noch mehr Informationen zum Thema Nanomedizin: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/nanotechnology-based-medicinal-products-human-use-eu-horizon-scanning-report_en.pdf Hier könnt Ihr die Folge von Elisabeth hören, wie Düfte alte Erinnerungen wecken: https://open.spotify.com/episode/4wrvYmXRe9nbRy6ylTENeV?si=Y-P0LmZxQkSLHU57zEUbkw&nd=1&dlsi=a5ef561c7a1e4862 Hier findet Ihr noch mehr Informationen zum Thema Düfte und Stimmung: https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2018.00241/full https://sussex.figshare.com/articles/conference_contribution/As_light_as_your_scent_effects_of_smell_and_sound_on_body_image_perception/23467973?file=41176754 https://einrichtungen.ruhr-uni-bochum.de/de/die-wissenschaft-hinter-dem-duft Mehr Informationen zur Studie zum Kaufverhalten: https://www.aau.at/blog/guter-geruch-gutes-geschaeft-effekte-atmosphaerischer-gerueche-in-konsumumgebungen-in-ueberblicksstudie-nachgewiesen/ Produktion: Serdar Deniz Redaktion: Antonia Beckermann Ab sofort gibt es noch mehr "Aha!" bei WELTplus und Apple Podcasts. Hier bei WELT hören: https://www.welt.de/podcasts/aha-zehn-minuten-alltags-wissen/plus246844328/Noch-mehr-Alltagswissen-Aha-Bonus-Folgen-fuer-Abonnenten-Podcast.html. "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen" ist der Wissenschafts-Podcast von WELT. Wir freuen uns über Feedback an wissen@welt.de. Impressum: https://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html Datenschutz: https://www.welt.de/services/article157550705/Datenschutzerklaerung-WELT-DIGITAL.html
Wärmeschock durch Nanopartikel: Heizbare Gefäßstütze soll Tumore bekämpfen
Grotelüschen, Frank www.deutschlandfunk.de, Forschung aktuell
Nanopartikel-Forschung im Labor für fortgeschrittene Materialien. Invasive Pflanzenarten in der Slowakei. (23.10.2024 15:30)
Die Slowakei hautnah, Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache
Nachrichten, Tagesthema. Magazin: Nanopartikel-Forschung im Labor für fortgeschrittene Materialien. Invasive Pflanzenarten in der Slowakei.
In der Nacht auf Freitag steht das erste TV-Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dem Herausforderer Donald Trump an. Beide haben schon länger nicht mehr zusammen debattiert. Wie bereitet man sich auf eine solche Fernseh-Debatte vor? Wahlkampfstratege Louis Perron im Gespräch Die weiteren Themen: * Die EU macht ernst gegen grosse Tech-Unternehmen. Sie hat sowohl gegen Apple und Microsoft Millionen-Strafen angedroht. Grund: Sie würden gegen Wettbewerbsrecht verstossen. Max Meister, Dozent für Unternehmertum schätzt ein, was das für Auswirkungen für Nutzerinnen und Nutzer hat. * Die Ukraine ist gestern an der EM ausgeschieden. Wie gross ist die Enttäuschung im Land? Der freie Journalist Denis Trubetskoy berichtet aus dem Land. * Nanopartikel wie Mikroplastik oder Russ sind überall: Auch in der Plazenta von schwangeren Frauen. Sie können die Entwicklung von Embryos stören. Die Biologin Tina Bürki erklärt die Gefahren.
Genschere, Kohlenstoffspeicher, Nanopartikel und Rassismus
In dieser Ausgabe von "Die Profis" sprechen wir über die weltweit erste Therapie auf Basis der Genschere, die in Großbritannien zugelassen wurde. Natürliche Kohlenstoffsenken sind enorm wichtig für den Klimaschutz. Welches Potenzial Wälder als Kohlenstoffspeicher haben, darüber sprechen wir mit Prof. Martin Herold. Wir blicken auf die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und welche Rolle Nanopartikel dabei spielen könnten. Warum Zauberer weniger anfällig für psychische Störungen sind, das erfahren Sie von Dr. Mark Benecke. Rassismus in der Gesundheitsversorgung – darüber sprechen wir mit dem Sozialwissenschaftler Dr. Cihan Sinanoğlu.
WSR068-Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie: Nanopartikel in Arzneiformen - Interview mit Prof. Dr. Lea Ann Dailey
In dieser Episode diskutieren Prof. Dr. Lea Ann Dailey und Bernd Rupp über Parameter, welche die Arzneiformen von Medikamenten bestimmen. Außerdem werden die Charakterisierung von Nanopartikeln als Hilfsstoffe und in der Umwelttoxikologie beleuchtet.
Leopoldina x UnderDocs: Prof. Viola Vogel über ihre Faszination Wissenschaft
In der (vierten) Folge der Reihe UnderDocs x Leopoldina spricht Liska mit Prof. Dr. Viola Vogel, Professorin an der ETH Zürich. Sie war u.a. die Gründungsdirektorin des Zentrums für Nanotechnologie der University of Washington und hat sogar im wissenschaftlichen Beratungsteam von Bill Clinton gearbeitet. Ihre Forschung dreht sich um Nanopartikel und darum, wie Bindungen zwischen Proteinen und Molekülen entstehen und verstärkt werden. So entwickelte sie etwa einen bakteriellen Nanokleber. In dieser Folge erklärt sie, was Bakterien können und wie ihr Forschungsprojekt dazu in der Klinik angewendet werden kann, vergleicht die Forschungslandschaften in den USA zu denen im deutschsprachigen Raum und spricht über das Vertrauensverhältnis zwischen Laien und Wissenschaftler*innen.
Wirtschaftsnews vom 14. Oktober 2022
Thema heute: KIT: Hochreflektierende Spiegel aus dem Tintenstrahldrucker Dielektrische Spiegel, auch Bragg-Spiegel genannt, können Licht fast vollständig reflektieren. Damit eignen sie sich für zahllose Anwendungen, etwa in Kamerasystemen, in der Mikroskopie, in der Medizintechnik oder in Sensorsystemen. Bisher mussten diese Spiegel aufwendig in teuren Vakuumapparaturen hergestellt werden. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun erstmalig Bragg-Spiegel in hoher Qualität mit Tintenstrahldruckern gedruckt. Das Verfahren könnte den Weg zu einer digitalen Fertigung von maßgeschneiderten Spiegeln eröffnen. Für Bragg-Spiegel werden mehrere Materialschichten dünn auf einen Träger aufgebracht. Diese Spiegel, die aus einer Vielzahl von dünnen Schichten bestehen, bilden einen optischen Spiegel, der dafür sorgt, dass Licht bestimmter Wellenlänge gezielt reflektiert wird. Wie stark Bragg-Spiegel reflektieren, hängt von den Materialien ab, aber auch davon, wie viele Schichten man aufbringt und wie dick diese sind. Bisher mussten Bragg-Spiegel mit kostspieligen Vakuum-Produktionsanlagen hergestellt werden. Dem Karlsruher Team ist es erstmals gelungen, sie auf verschiedene Träger zu drucken. Damit lässt sich die Produktion erheblich vereinfachen. Tinten aus Nanopartikeln „Es war eine große Herausforderung, geeignete Tinten zu entwickeln und ein zuverlässiges Verfahren zur Herstellung mehrerer Schichten zu etablieren“, so Professor Uli Lemmer vom Lichttechnischen Institut (LTI) des KIT, der das Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters „3D Matter Made to Order“ leitet. Die Bestandteile der Tinten müssen passende optische Eigenschaften haben und außerdem löslich sein. Darüber hinaus sollte jede Schicht so gleichmäßig wie möglich sein, um einen einheitlichen Stapel an Schichten zu gewährleisten. Außerdem muss sich der Druck genau steuern lassen und die Ergebnisse müssen reproduzierbar sein, um verlässlich hervorragende optische Eigenschaften, das heißt ein hohes Reflektionsvermögen der Bragg-Spiegel, zu garantieren. Das Forschungsteam setzte dabei auf Nanopartikel: „Aufgrund der rasanten Entwicklung in der Nanochemie werden Nanopartikel immer preiswerter und vielfältiger“, so Lemmer. Sein Team verwendete als optisch wirksame Bestandteile der Tinten einen Mix zweier unterschiedlicher Materialien. Mit diesen Tinten gelang es ihnen, die optischen Eigenschaften und die Dicke einer einzelnen Schicht mit extremer Präzision im Tintenstrahldruck zu erzeugen. „Wir haben einen ultrahohen Reflektionsgrad von 99 Prozent mit nur zehn Doppelschichten erreicht“, sagt Lemmer. Diesen Beitrag können Sie nachhören oder downloaden unter:
Minkorrekt Folge 150 „Der nächste Puff läuft voll“
Mikroplastik im Mensch - Erstmals Kunststoffpartikel im menschlichen Blut nachgewiesen
Winzige Plastikpartikel finden sich inzwischen überall – im Boden, in der Atmosphäre, auch in entlegenen Gebieten wie der Arktis. Niederländische Forschende haben nun erstmals solche Nanopartikel auch im menschlichen Blut nachgewiesen. Welche gesundheitlichen Folgen Plastik im menschlichen Körper hat, ist noch nicht ausreichend erforscht.Westerhaus, Christinewww.deutschlandfunk.de, Forschung aktuellDirekter Link zur Audiodatei
Die Konzentration von Plastik in den Meeren werde in den nächsten Jahrzehnten ansteigen – und zwar dramatisch. Das sagt eine neue Studie. Und eine andere aktuelle Studie beschreibt, wie Plastik im Alpen-Schnee vorkommt. Mikro- und Nanoplastik finden sich heute fast überall. An den Stränden am Mittelmeer – oder zuoberst auf den Gipfeln der Schweizer Berge. Eine neue Meta-Studie des deutschen Alfred-Wegener-Instituts hat hunderte Forschungsarbeiten zum Thema der letzten Jahrzehnte ausgewertet und daraus eine Art Zukunftsmodell erstellt. Die Autor:innen warnen: Die Verschmutzung mit Plastik habe exponentiell zugenommen. Und ein Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung hat jüngst sogar Nanoplastik – also Plastik in Feinstaub-Format – im Schnee in den Alpen nachgewiesen. Nehmen wir die Nanopartikel also längst in unserem Körper auf? Und was bedeutet es für die Weltmeere, wenn die Verschmutzung weiter zunimmt? Lust, die Themen von «News Plus» mitzubestimmen? Schickt uns eine Nachricht per WhatsApp: 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus@srf.ch. Link zum «Konsumentenschutz»-Ratgeber: https://www.konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/mikroplastik-was-tun-gegen-das-problem
703 Komplikationen nach Pieks? : Florian Schilling 3/3
Sind die aktuellen Pieksstoffe wirklich nebenwirkungsfrei, wie der neue Gesundheitsminister behauptet? Welche klinischen Hinweise gibt es? Welche labortechnischen Parameter können nachgewiesen werden? Wie reagiert das Immunsystem? Welche Folgen wird das ganze kurz- und langfristig haben? Florian Schilling bemüht sich um Aufklärung für Laien und Therapeuten. >>Hier geht's zu den Shownotes>mehr erfahren 360 Energy ist die wohl innovativste Mitochondrienformel die es derzeit gibt.>> Hol dir jetzt die pure Energie!
702 Komplikationen nach Pieks? : Florian Schilling 2/3
Sind die aktuellen Pieksstoffe wirklich nebenwirkungsfrei, wie der neue Gesundheitsminister behauptet? Welche klinischen Hinweise gibt es? Welche labortechnischen Parameter können nachgewiesen werden? Wie reagiert das Immunsystem? Welche Folgen wird das ganze kurz- und langfristig haben? Florian Schilling bemüht sich um Aufklärung für Laien und Therapeuten. >>Hier geht's zu den Shownotes>mehr erfahren Versorge dich jetzt mit allen essentiellen Nährstoffen mit dem wahrscheinlich umfangreichsten Multi-Nährstoffpräparat am deutschen Markt. Höchste Rohstoffqualität, keinerlei Zusatzstoffe und meine ganz eigene Rezeptur, ohne Kompromisse >> Jetzt zuschlagen
701 Komplikationen nach Pieks? : Florian Schilling 1/3
Sind die aktuellen Pieksstoffe wirklich nebenwirkungsfrei, wie der neue Gesundheitsminister behauptet? Welche klinischen Hinweise gibt es? Welche labortechnischen Parameter können nachgewiesen werden? Wie reagiert das Immunsystem? Welche Folgen wird das ganze kurz- und langfristig haben? Florian Schilling bemüht sich um Aufklärung für Laien und Therapeuten. >>Hier geht's zu den Shownotes>mehr erfahren Mit Regeneration Tag wird dein Leben entspannter und genussvoller. Mit Regeneration Nacht kannst du besser ein- und durchschlafen. >>Jetzt gleich anschauen
25.11.2021 – Dr. med. Jürgen-Detlef Theuer, Facharzt für Kardiologie, in Seelow und Luzern, Dr. med. Stefanie Theuer, niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Seelow (Brandenburg), sowie Dr. med. Wolfgang Wodarg, Facharzt für Lungenheilkunde und langjähriger Gesundheitspolitiker, erörtern die aktuelle Lage an der Corona-Front (Gesprächsleitung: Burkhard Müller-Ullrich).
Urbane Umweltdienste der Zukunft - Mit Marc Nodorft, Co-Founder & Managing Director DEUS POLLUTRACK
Zu Gast im Podcast-Studio hat Nick Sohnemann heute den Geschäftsführer des Spin-Offs DEUS POLLUTRACK. Ein Zusammenschluss verschiedener Unternehmen und wissenschaftlicher Einrichtungen aus Europa zur Generierung von Umweltdaten mit dem Ziel, Lösungen für einen nachhaltigen Umwelt- und Gesundheitsschutz zu entwickeln.Im POD#68 hören wir von cleverem Ingenieurwesen und überzeugtem Unternehmertum. Es geht um sehr feinen Feinstaub und die Möglichkeiten der Stadtplanung durch Detailwissen. Dieses Datenwissen sammelt DEUS POLLUTRACK in stationären und mobilen Messstationen.Mit dem Co-Founder des deutsch-französischen Unternehmens, Marc Nodorft, hat sich Nick Sohnemann auf der IAA getroffen - mit vielen Fragen im Gepäck.Wie wirken sich Nanopartikel auf unsere Atemwege und das Allgemeinbefinden aus, reicht es aus, das Problem zu erkennen, ohne es zu lösen und wie funktionieren die mobilen Messstationen? Marc Nodorft ist Geschäftsführer der internationalen Company Digital Environment Urban Solutions und erläutert im POD#68 mit großer Expertise die Zusammenhänge von Wissen und Lösungen.Wir erfahren in dieser Folge viel Umweltrelevantes – von Stadtcanyons der Gründerzeit und den Gefahren von Verdichtung in den Städten. Aber auch konkrete Lösungsvorschläge, die sich aus der Datenanalyse ergeben und den Stadtplanern vorgelegt werden. An welchen Plätzen macht der Bau von Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern Sinn und wo muss man in die Straßenplanung eingreifen? Erkenntnis als erster Schritt zur Lösung. DEUS ist eine europäische Kooperation und Marc berichtet von der Vision, das größte zusammenhängende Flächen-Mess-Netz (SMART AIR GRID) für urbane Umweltdienste in Europa aufzubauen. In welchen Städten das Programm bereits gestartet wurde und warum Hamburg nicht dabei ist, besprechen die beiden Gründer in dieser Folge.Umweltschutz beginnt zuhause im Innovations-Podcast #68. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Eure Kleinkinder können sich nicht benehmen und würden sich am liebsten mit Bauklötzen abwerfen. Saskia ist in bad mood: Die rote Tante ist zu Besuch und die Impfung hat ihr dann den Rest verpasst. Da kann ihr nur das Lebenselixier Kombucha weiterhelfen. Außerdem schlägt sie ihren Bruder mit seinen eigenen Waffen: Sie verbessert ihn und fällt ihm ins Wort! (Anmerkung von Pierre: Für eine kleine Schwester ist dieses Verhalten inakzep- und indiskutabel!) Pierre hingegen ist in lovely mood: Er war auf der Hochzeit eines Jugendfreundes, bei der ihm klar wird, dass er selber nächsten Monat die Liebe seines Lebens heiraten wird. *.* Beim Rhepretik-Tipp werden wir euch eine schmieren! Und zwar Sonnencreme auf die Haut. Aber ohne Plastik und Nanopartikel, ist ja wohl klar. Um der Bundesstiftung 'Mutter Kind' mit einer Spende erfolgreich unter die Arme greifen zu können, muss Sassi beim Quiz beweisen, wie gut sie den menschlichen Körper kennt. Sollte ja wohl für so ein Sport-Ass kein Thema sein!?! Vielen Dank fürs Reinhören und habt ganz viel Spaß! Eure Eulen
Umweltfreundliche Sonnencreme: so schützt du dich und unsere Gewässer – Interview mit Stefanie Böck
#41 Wie kannst du mit der Wahl deiner Sonnencreme zum Schutz unserer Ozeane beitragen? Im heutigen Interview mit Stefanie Böck erfährst du alles rund um das Thema Sonnenschutz. Warum ist herkömmliche Sonnencreme so schädlich für unsere Gewässer? Was ist der Unterschied zwischen herkömmlichem und mineralischem Sonnenschutz? Wie funktioniert mineralische Sonnencreme vs. konventionelle? Was sind Nanopartikel und sind sie gefährlich? Wie findest du die richtige Sonnencreme für dich und worauf solltest du achten? Warum du dich nicht nur im Sommer vor UV-Strahlung schützen solltest Welcher Lichtschutzfaktor ist sinnvoll? u.v.m. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören! Deine Christina > Codecheck - die App, um Inhaltsstoffe zu checken MEHR ÜBER STEFANIE: > Instagram _____________________________________ Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie gern mit anderen und lasse mir ein Feedback da! Ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Auf diese Weise kannst du meine Arbeit unterstützen. Ich danke dir von Herzen! Du möchtest mehr Leichtigkeit in deinem Leben? Melde dich bei mir für ein Erstgespräch: 1:1-Coaching "weniger ist mehr" dein digitaler Guide: Natürliche Pflege leicht gemacht Abonniere meinen Newsletter "Fairschickt" Christina auf Instagram christina-wendlandt.com hallo@christina-wendlandt@.com >>> Unterstütze mich mit einem Beitrag auf Steady.com
Die Wissenschaft setzt auf Nanopartikel - unter anderem in der Krebstherapie. Astrid Wulf gibt einen Einblick in die medizinische Forschung.
Nr 725 Japanische Arzneimittelbehörde: Nanopartikel von mRNA-Impfung in (fast) allen Organen nachgewiesen
Artikel zum Podcast: https://bit.ly/2RsTmai Japans Arzneimittelbehörde veröffentlichte auf Anfrage Daten zu Tierversuchen mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer/BioNTech. In dem teilweise geschwärzten und unvollständigen Bericht zeigte sich, dass die in der mRNA-Impfung eingesetzten Nanopartikel in nahezu alle Organe gelangen – unter anderem ins Knochenmark, die Schilddrüse und die Geschlechtsorgane.
Folge 21: Impfung für Jugendliche und Forschung ohne Tierversuche
In dieser Woche wirft Benedikt Richter im Podcast einen Blick in die Zukunft – eine Zukunft ohne Tierversuche, mit COVID-19-Impfstoffen für Jugendliche und Nanopartikel gegen resistente Keime.
Zusatzstoffe im Essen: Nanopartikel wie Titandioxid - giftig für (Darm-)Gesundheit & Mikrobiom?
Mindful Microbia - alles über einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf & wie du beides bekommst
Nanopartikel wie u.a. Titandioxid findet man mittlerweile in so ziemlich ALLEM: Wandfarben, Lacken, Kosmetika, Medikamenten, Sonnencreme, Nahrungsergänzungsmitteln etc, vor allem aber auch da, wo man es man wenigsten vermutet - in unseren Lebensmitteln. Titandioxid steht im Verdacht gesundheitlich hoch bedenklich zu sein, wie aktuelle Untersuchungen zeigen: Zellstress, Stoffwechselstörungen, Mikrobiom Dysbiosen, entzündliche Darmerkrankungen oder Darmkrebs stehen mit Nanopartikel Aufnahme durch unsere Lebensmittel in Verbindung. Inhaliert gelten Titandioxid Partikel mittlerweile als "potentiell karzinogen" bei der ECHA: vermutlich krebserregend. Warum ist es immer noch zugelassen als Zusatzstoff E171 in der EU und welche Effekte hat es auf die Gesundheit des Menschen? __________________ Website & Kontakt [https://drschwitalla.com](https://drschwitalla.com/)
#36 Ein schadstoffarmes Leben mit Kindern - Interview mit Susanne von sunatuerlich
Susanne von "Sunatuerlich" hat mein Lieblingsinstagram-Profil. Warum? Weil ich von ihr einfach schon wahnsinnig viel lernen konnte. Sie beschäftigt sich mit einem schadstoffarmen Leben mit Kindern. Und geht dabei richtig in die Tiefe. Ihre Leidenschaft für ein schadstoffarmes und nachhaltiges Leben wurde ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt. Und Mittelweile können wir alle von dieser Recherche-Leidenschaft profitieren. Ob es um Windeln, um Babypflege oder Haushalt geht, Susanne liest so wirklich alles, was sie zu diesen Themen in die Finger bekommt und lässt uns an ihrem Fazit teilhaben. Ohne dabei dogmatisch zu sein gibt sie Denkanstöße, wie wir unsere Produktentscheidungen besser treffen können. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich sie für ein Kinderleibundseele Interview gewinnen können. Unser Gespräch touchiert alle Bereiche einmal so grob und soll Lust auf mehr machen: wir sprechen über Neurodermitis, Babypflege, Mikroplastik, Aluminium, und Nanopartikel und wie sooft: habe ich mal wieder viel von ihr gelernt. Hier ist übrigens die Seite, über die wir gesprochen haben: https://www.codecheck.info Nun, viel Spaß mit der heutigen Folge, deine Nikola Du findest diesen Podcast bei Spotify, iTunes und Deezer. Ich freu mich über deine Gedanken, Fragen und Input auf meinem Instagram Kanal oder auf meiner Website. Wenn dir die Folge gefallen hat, freu ich mich riesig über eine Bewertung bei Apple Podcasts ! Teile diese Folge gerne mit anderen Eltern, die nach Antworten auf Fragen zur Kindergesundheit suchen. Disclaimer: Sämtlich Inhalte auf kinderleibundseele dienen der allgemeinen Information. Alle Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, können jedoch in medizinischer Hinsicht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit erheben. Insbesondere sind sie in keiner Weise ein Ersatz für professionelle Diagnosen, Beratungen oder Behandlungen durch Ärzte/Ärztinnen. Genauso wenig dürfen die hier angebotenen Informationen als Grundlage für eigenständige Diagnosen sowie Behandlungen oder Änderungen an einer bereits empfohlenen Behandlung dienen. Konsultiere bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den behandelnden Arzt/behandelnde Ärztin. kinderleibundseele übernimmt keine Haftung – weder direkt noch indirekt – für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise ergeben.
Wir am Feierabend-Der Podcast. #48: Nanopartikel, Nostalgie und Paralleluniversen
Diesmal ratschen wir, Dani und Manu, mit Manus altem Freund Andi über unsere Schulzeit, Musik und Entscheidungen, die unser Leben verändert haben. Außerdem erzählt uns der Chemiker Andi viel Interessantes über Nanopartikel! Song-Tipp: Coldplay - Viva La Vida https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
Beschwerden durch Drucker im Büro
In vielen Verwaltungen werden an den Arbeitsplätzen Drucker, Multifunktionsgeräte oder Kopierer in den Büroeinheiten aufgestellt. An manchen Arbeitsplätzen klagen die Beschäftigten über Atemwegsreizungen, mein persönlich letzter bzw. aktueller Fall insbesondere über Augenprobleme bis hin zu Bindehautentzündung und Kopfschmerzen. In diesem Zusammenhang wird dann häufig behauptet, es sei doch verboten die Drucker und Kopierer im Büro bei den Arbeitsplätzen aufzustellen um die möglichen Gefährdungen durch Emissionen auszuschließen. Auch die Nanopartikel sind hier ein Thema. Hier muß ich leider immer wieder sagen, dass mir kein Gesetz bekannt ist, welches es verbietet die Drucker und Kopierer am Arbeitsplatz aufzustellen. Es gibt allerdings Seit Januar 2014 neue Grenzwerte für die Vergabe des Umweltsiegels Blauer Engel für Laserdrucker. Allerdings gibt es auch bereits kritische Stimmen von Experten und Tonerstaub-Erkrankten bei der Stiftung nano-control. Sie halten die Begrenzung von 350 Milliarden Partikel weiterhin für zu hoch. Kritisiert wird zudem, dass größere Drucker von der Begrenzung befreit seien. Bei Tests seien bei solchen Geräten schon Werte gemessen worden, die 69 % über dem Blauen Engel-Wert lagen Es ist allerdings so, dass bei der Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz für Emissionen aus Laserdruckern und Kopiergeräten der Allgemeine Staubgrenzwert von Relevanz ist. Dieser wird an Büroarbeitsplätzen in der Regel um etwa Faktor 100 unterschritten. Somit besteht für Beschäftigte im Büro theoretisch kein Anlass zur Besorgnis. Da in aller Regel die stoffliche Zusammensetzung anderer Emissionen nicht bekannt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall andere Wirkungen (z. B. allergische Reaktionen) auftreten können. Eines ist jedoch klar – wenn die Leute über solche Probleme klagen, dann halte ich es für unterlassene Hilfeleistung, auf dessen oder deren Probleme nicht zu reagieren. Eine gute Hilfestellung bieten Informationsblätter der BAUA und der Verwaltungsberufsgenossenschaft. https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis-kompakt/F43.pdf?__blob=publicationFile&v=7
Nanotechnologie an der richtigen Stelle
Bessere Methoden zur Frühdiagnose und Therapie von Atherosklerose, einer Entzündungskrankheit, die Herzinfarkt und Schlaganfall auslösen kann? Mit Hilfe der Nanomedizin soll das in Zukunft möglich sein. Harald Mangge berichtet vom aktuellen Forschungsprojekt "Nanoathero", bei dem Nanopartikel in die erkrankten Regionen gesendet werden sollen.
Nano-Partikel in der Medizin – „Smarte“ Medikamente für zielgerichtete Therapien
Die Plazenta ist durchlässig für Nanopartikel – das können Empa-Forscher zeigen.
Schwerpunkt: Monika Fleischer von der Universität Tübingen über kollektive Schwingungen von freien Elektronen in Metallen, deren Eigenschaften man sich bereits in Biosensoren oder in der Mikroskopie zunutze macht || Nachrichten: Kohlefasern aus Treibhausgas | Supraleitung bei Rekordtemperatur | Wie Gasplaneten entstehen
Unter die Haut - Wie gefährlich sind Nanopartikel in Kosmetik? - Beitrag bei Radio KIT am 16.07.2015
Schwerpunkt: Peter Banzer vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen über eine neue Form von Lichtwellen, die optische Pinzetten und damit die Kontrolle über winzige Partikel vielseitiger macht || Nachrichten: Neue Art heller Supernovae | Nobelpreis für Physik 2013 | Nanodiamant als ultraschneller optischer Schalter || Veranstaltungen: Jena | Berlin | Bad Münstereifel
Thermophoresis and cooperative binding of nucleotides
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/05
Thermophorese beschreibt die von Temperaturegradienten angetriebene, gerichtete Bewegung von Partikeln. Obwohl dieser Effekt seit 1856 bekannt ist, werden die zugrundeliegenden Prinzipien immer noch aktiv diskutiert. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ein lange vorhergesagter größenabhängiger Übergang der Thermophorese zum ersten Mal experimentell verifiziert. Die Experimente untersuchen ein sphärisches Kondensator Modell für Thermophorese. Um Vorhersagen über ionisches Abschirmen geladener Partikel zu testen, sind Nanopartikel erforderlich, deren Größe im Bereich der Debye Länge liegt: DNA und RNA Oligonucleotide. Der theoretisch prognostizierte Übergang vom Plattenkondensator- über das sphärische Kondensator- bis hin zum isolierte Sphäre-Modell wurde über einen weiten Bereich von Verhältnissen zwischen Partikelgröße und Debye Länge erfolgreich beobachtet. Die Kombination dieser ionischen Thermophorese mit einer etablierten Beschreibung der Temperaturabhängigkeit von Thermophorese von ungeladenen Partikeln reicht aus, um Thermophorese von einzel- und doppelsträngiger DNA und RNA von 5°C bis 75°C und unter Salzkonzentrationen von 0.5mM bis 500mM abzudecken. Dies umfasst einen Großteil biologisch relevanten Bedingungen. Damit lassen sich nicht triviale Abhängigkeiten der Thermophorese in sehr breiten Bereichen von Salzkonzentration und Temperaturen für hoch relevante DNA und RNA Längen mit dem bestätigten Modell vorausberechnen. Diese Experimente geben neue Impulse in der Diskussion über die Rolle von sekundären elektrischen Feldern bei der Thermophorese. Zudem kann dieses neu gewonnene theoretische Verständnis die Quantifizierung von Biomolekülaffinitäten verbessern. Kooperatives Binden, das im zweiten Teil untersucht wird, ist entscheidend für das Verständnis vieler intrazellulärer Prozesse wie z.B. der Transkription. Mithilfe von Thermophoresemessungen wird das komplette Bindungsverhalten von mehr als zwei Partnern inklusive der kooperativen Effekte untersucht, die komplexe Molekül-Interaktionen formen. Die hier präsentierte, neu entwickelte Prozedur ist sehr flexibel und setzt nur einen fluoreszierzmarkierten Bindungspartner voraus. Im Gegensatz zu Methoden, die auf der Sättigung einer Bindung bei gleichzeitiger Untersuchung einer anderen beruhen, macht dieser neue Ansatz viele zusätzliche kooperative Molekülsysteme zugänglich. Kooperatives Binden eines sternförmigen, dreiteiligen DNA-Komplexes wird mit einer einzigen Messung aufgedeckt. Bindungskonstanten und thermophoretische Eigenschaften der Komplexe werde mit Messungen von Titrationsreihen innerhalb des Konzentrationswürfels untersucht. Diese Methode kann zu einer bisher fehlenden, flexiblen Messtechnik für kooperative Effekte bei geringer Veränderungen der untersuchten Systeme werden.
Diese Frage kann heute noch keiner beantworten. Denn wir wissen nicht genau, was Nanopartikel im Körper bewirken. Unter Nanopartikeln können sich viele Menschen nicht viel …
Optische und mechanische Manipulation plasmonischer Heißpunkte an Goldnanopartikelspitzen
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/05
In der vorliegenden Dissertation wurden auf alternativen Nanopartikelmorphologien basierende Hybridsysteme hinsichtlich ihrer optische Eigenschaften untersucht, um die bekannten Limitierungen und Unzulänglichkeiten der etablierten Nanopartikelsysteme und -formen, wie stäbchenförmige oder sphärische Nanopartikel, weitgehend zu beseitigen. Es werden sternförmige Goldnanopartikel und ihre besonderen plasmonischen Eigenschaften vorgestellt. Mit Methoden der Dunkelfeldspektroskopie, der Photoemissionelektronenmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie (SEM) werden die Nah- und Fernfeldeigenschaften einzelner Nanosterne mit ihrer Morphologie korreliert. So konnte der erstmalige experimentelle Nachweis der Lokalisierung von optisch angeregten Heißpunkten an den Spitzen der einzelnen Nanosterne geliefert werden. Durch geeignete Wahl der Polarisation und Wellenlänge werden Heißpunkte an mehreren oder ausschließlich an einzelnen Spitzen eines Nanosterns selektiv anregt und die detektierten Plasmonresonanzen nur aufgrund experimenteller Daten einzelnen Nanosternspitzen zugeordnet. Desweiteren werden Feldverstärkungsfaktoren im Bereich von 58-79 an den Nanosternspitzen zum ersten Mal direkt quantitativ bestimmt. Die hohen und für Moleküle leicht zugänglichen Heißpunkte an den Spitzen der Nanosterne werden verwendet, um die hervorragende Verstärkung der Ramanstreuung auf der Ebene einzelner Nanosterne zu demonstrieren. Die Ramanverstärkungsfaktoren von 10^7 für die untersuchten Nanosterne ohne Ausnutzung plasmonischer Kopplungseffekte, zeichnen die Nanosterne als wichtige Kandidaten für die Verwendung in komplexen dynamischen Umgebungen aus. Eine weitere Möglichkeit der Ausnutzung der an Spitzen lokalisierten Heißpunkte bieten Nanobipyramiden. Durch Manipulation mit einem Rasterkraftmikroskop lässt sich eine Positionierung der Heißpunkte bis zu 1 nm oberhalb der Oberfläche und an beliebigen Stellen auf einem Probensubstrat erreichen. Nanoresonatoren aus zwei Nanobipyramiden können in drei verschiedenen Adsorptionskonfigurationen hinsichtlich der zueinander weisenden Spitzen der zwei Nanopartikel mechanisch hergestellt werden. Durch die mechanische Änderung der Konfiguration des Nanoresonators kann die Position des im Partikelzwischenraum entstehenden Heißpunktes in der Höhe bewegt werden ohne wesentliche Änderung der spektralen Lage der gekoppelten Plasmonresonanz.
Was Feinstaub im Körper anrichten kann
3700 Menschen sterben in der Schweiz jährlich an den Folgen der Feinstaubverschmutzung. ForscherInnen der Empa und der Universität Bern zeigen, wie selbst kleinste Nanopartikel gemessen werden, wie sie aussehen, wie sie ins Blut gelangen und welche Schäden sie im Körper anrichten können.
Aufklärung der Struktur-Wirkungsbeziehungen von CpG-A- und CpG-C-Oligodesoxynukleotiden als Grundlage für die Entwicklung immunstimulatorischer Nanopartikel
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 06/19
Hintergrund und Ziele der Arbeit: Bakterien und DNA Viren werden anhand unmethylierter CpG-Motive innerhalb ihrer DNA von den TLR 9 tragenden PDCs und den B Zellen des humanen Immunsystems als Gefahrensignale erkannt. Mittels synthetischer, CpG-enthaltender ODN nutzt man diese Grundsatzmechanismen, um vergleichbare Immunantworten auszulösen. Auf Grundlage eines unterschiedlichen immunologischen Aktivierungsprofils wurden bislang drei CpG-Klassen definiert: CpG-A, CpG-B und CpG-C. Mit Hilfe von CpG-A war es erstmals möglich, IFN-α in PDCs (den endogenen Hauptproduzenten dieses Zytokins) in Mengen zu induzieren, wie es bislang nur mit Viren selbst möglich war. Auch CpG-C stimuliert PDCs zur Sekretion von IFN α und aktiviert darüber hinaus B Zellen - eine Eigenschaft, die CpG-A nicht besitzt. Die sequenzspezifischen und strukturellen Voraussetzungen für diese differenziellen Wirkprofile waren bislang unzureichend verstanden, auch weil die Struktur-Analysen nur begrenzt auf die tatsächlichen Vorgänge im physiologischen Milieu übertragbar waren. Um CpG-ODN für die therapeutische Anwendung zu optimieren, sind die genauen Kenntnisse der Struktur-Wirkungsbeziehungen jedoch unverzichtbar. Ein zweiter Ansatzpunkt zur Optimierung der Anwendung liegt in der Verbesserung der systemischen Stabilität von CpG-ODN. Die Bindung von CpG-ODN an partikuläre Trägersysteme (z.B. Gelatine-Nanopartikel) wurde bereits in unserer Abteiliung als mögliches drug-delivery-System etabliert. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips wären partikuläre Strukturen, die aus immunstimulatorischen Nukleinsäuren aufgebaut keiner weiteren Trägermaterialien bedürfen. Beide Ansatzpunkte führen zu den Zielen dieser Arbeit: 1) Die Aufklärung der Struktur-Wirkungsbeziehungen der CpG-Klassen A und C durch Etablierung geeigneter Methoden zur Untersuchung im physiologischen Milieu. 2) Die Entwicklung immunstimulatorischer partikulärer Strukturen auf Basis der in Teil 1) identifizierten wirksamen Strukturelemente beider CpG-Klassen. Ergebnisse: 1) Struktur-Wirkungsbeziehungen von ODN 2216 (CpG-A) und ODN M362 (CpG-C): CpG-A bildet im physiologischen Milieu spontan multimolekulare Strukturen, deren mittlere Durchmesser mit 24 40 nm im Größenbereich von Viren liegen. Es zeigte sich, dass für diese Multimerisierungen das Zusammenspiel aus flankierenden Poly-G-Motiven, palindromischem Zentrum und eingelagerten Natrium- oder Kaliumionen entscheidend ist. Physiologisches Milieu wirkt sich sowohl den Umgebungs-pH und die Na+/K+-Konzentrationen als auch die Temperatur (37 °C) betreffend optimal förderlich auf die Strukturbildung aus. Die Identifizierung dieser maßgeblichen Faktoren machte es möglich, den Strukturaufbau von CpG-A experimentell zu kontrollieren und die immunologischen Wirkungen der verschiedenen Strukturen direkt zu vergleichen. Für die rasche und hohe Induktion von IFN-α und anderen inflammatorischen Zytokinen durch PDCs sind große Partikel verantwortlich. Die Multimerisierungen von ODN 2216 werden bei pH < 6 zunehmend aufgehoben. Unterbindet man die Multimerisierungen durch Präinkubation der ODN bei Temperaturen > 60 °C oder durch Entzug der stabilisierenden Natriumionen (indem man sie zuvor in Aqua ad inj. löst), so verliert ODN 2216 seine immunstimulatorische Aktivität in Bezug auf PDCs. Die schwache Wirkung der CpG-A-Monomere kann jedoch durch Präinkubation von PDCs mit IFN β deutlich gesteigert werden. Im Gegensatz zu den ebenfalls einzelsträngig vorliegenden ODN 2006 (CpG-B) haben auch Monomere von ODN 2216 keine aktivierende Wirkung auf B Zellen. CpG-C hat durch die palindromische Sequenz die Möglichkeit, Hairpins und Duplices zu bilden. ODN M362 zeigt jedoch keine Hairpinstrukturen. Die Duplexformationen sind bei 37 °C in vitro nicht stabil und spielen keine Rolle bei der durch diese ODN initiierten B-Zell-Aktivierung. Duplices haben jedoch Anteil an der Induktion von IFN-α in PDCs. Die in dieser Arbeit etablierten Protokolle der Temperatur-Präinkubation ermöglichen erstmalig eine experimentelle Kontrolle der Strukturbildungen von CpG-A und CpG-C und dadurch den Vergleich von Struktur und Wirkung. Das Standardprotokoll für Gelelektrophorese wurde dahingehend modifiziert, dass ein physiologisches Milieu sowohl durch die anwesenden Ionen als auch durch die Umgebungstemperatur (37°C) simuliert werden konnte. 2)Design Nukleinsäure-basierter Nanopartikel: Zentrale Elemente von CpG-A und CpG-C (palindromische Sequenz, gerüstartige Verbindung mehrerer Nukleinsäuren) wurden eingesetzt, indem ODN M362-Sequenzen (CpG-C) an bi- und trivalenten Grundgerüsten (Linkern) für den Strukturaufbau optimiert wurden. Trivalente Linker ermöglichen die variierende Zusammenlagerung der palindromischen Nukleinsäuren in drei Richtungen des Raumes und dadurch die Bildung großer Partikel. Diese sind den bisher bekannten Maximalstimuli CpG-B und CpG-C hinsichtlich der Aktivierung von B-Zellen gleichwertig. Erstmalig konnten auf diese Weise B-Zellen durch partikuläre Strukturen stark aktiviert werden. Nach Vor-Komplexierung der Partikel mit Poly-L-Arginin wird die Aktivität bei B-Zellen nochmals verstärkt. Kurze, nicht-palindromische CpG-DNA-Sequenzen an trivalenten Grundgerüsten induzieren nach Vor-Komplexierung mit Poly-L-Arginin deutlich mehr IFN-α in PBMCs als CpG-A, obwohl sie selbst nicht multimerisieren. Wird die (palindromische) RNA-Sequenz von CpG-C an einem trivalenten Linker verwendet, so können ebenfalls große Strukturen generiert werden, die nach Transfektion vergleichbare Mengen IFN-α in PBMCs induzieren wie CpG-A. Ausblick: Die vorliegende Dissertation verbindet Fragestellungen der Immunologie und der pharmazeutischen Technologie mit den Möglichkeiten der Biochemie. Es werden nicht nur verschiedene Methoden zur strukturellen Untersuchung von CpG-ODN im physiologischen Milieu etabliert, sondern auch die experimentelle Kontrolle der Strukturbildung von CpG-A ermöglicht. Die entwickelte Technik der Generierung dreidimensionaler, über palindromische Nukleinsäuren aufgebauter Partikel ist nicht auf CpG-Motive in DNA begrenzt, sondern kann auf eine andere für Viren charakteristische Nukleinsäure (Einzelstrang-RNA) übertragen werden. Dadurch würde zusätzlich möglich, die immunologischen Profile von ssRNA, dsRNA und CpG in einem Partikel zu kombinieren und die Art der Immunantwort je nach Zusammensetzung der Partikel gezielt zu bestimmen. Die klinische Relevanz dieser Arbeit ergibt sich aus den neuen Erkenntnissen über die Multimerisierungen von CpG-A, welche dessen therapeutischen Einsatz optimieren und besser standardisierbar machen sollen. Außerdem werden neue Hinweise auf die unterschiedlichen Aufnahme- und Erkennungsmechanismen beider CpG-Klassen und deren Aktivierung der Synthese von IFN-α gewonnen. Darüber hinaus wurde durch die Entwicklung der Polyvalenten Linker eine grundsätzlich neue Technik im Stil eines Baukastensystems etabliert, welche als Grundstein einer neuen Generation von immunstimulatorischen Multimeren dienen soll. Die Koadministration von Adjuvans und Antigen in direkter räumlicher Nähe bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Vakzineentwicklung. Zudem ist zu erwarten, dass unter Einbeziehung der RNA basierten immunologischen Wirkprofile innerhalb eines Partikels der Einsatz von CpG-ODN zur Therapie von Virusinfektionen und Tumoren weiter verbessert werden kann.
Zeitaufgelöste Messungen an CdSe Nanopartikeln
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/05
Mit den Mitteln der Infrarotspektroskopie wurde der Einfluss der organischen Hülle auf Struktur und Dynamik von CdSe Nanopartikeln untersucht. Zunächst wurde ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, aus dem statischen Infrarotspektrum Informationen über die Qualität der organischen Hülle und das Bindungsverhalten der Liganden zu gewinnen. An qualitativ hochwertigen und gut charakterisierten Proben wurde anschließend die Dynamik des niederenergetischsten Elektronenniveaus 1S nach optischer Anregung im Sichtbaren zeitaufgelöst gemessen. Als Referenz diente CdSe TOPO, das durch Proben mit den Liganden Octanthiol, Octansäure, Octylamin, Naphthoquinon, Benzoquinon und Pyridin ergänzt wurde. Die untersuchten Nanopartikel hatten einen Durchmesser von 4.86 nm. Mit Hilfe des Anreg-Abtast- oder Pump-Probe-Verfahrens wurden zunächst Messungen im Pikosekundenbereich durchgeführt. Die Anregungswellenlängen wurden dabei spektral eingeschränkt und so gewählt, dass selektiv die Übergänge 1S-1S und 1P-1P, nicht aber der dazwischenliegende 2S-1S-Übergang, angeregt wurden. Die Anregungsintensitäten wurden bewusst so niedrig gehalten, dass die Anregung mehrerer Exzitonen in einem Kristall vermieden werden konnte. Die Abtastwellenlänge im Infraroten entsprach der Energiedifferenz zwischen den Elektronenniveaus 1S und 1P. Die Transienten im Pikosekundenbereich zeichnen sich durch einen steilen Anstieg des Signals aus, auf den ein multiexponentieller Zerfall folgt. Der Anstieg, der die Bevölkerung des angeregten Zustands widerspiegelt, ist unabhängig von der Wahl der Liganden. Der Einfluss der organischen Hülle wird erst in den unterschiedlichen Zerfallszeiten der angeregten Elektronenniveaus sichtbar. Der Zerfall des Messsignals von CdSe TOPO lässt sich näherungsweise mit drei Zeitkonstanten beschreiben: eine Zerfallszeit im frühen Pikosekundenbereich, eine Zeitkonstante um die hundert Pikosekunden und eine Zeitkonstante bei einigen Nanosekunden. Bei ansteigender Abtastwellenlänge werden die Zerfallszeiten länger. Durch gezielte Anregung des 1S-1S und des 1P-1P-Übergangs konnte der Zerfall des 1P-Zustands in den energetisch günstigeren 1S-Zustand beoachtet werden, der im verzögerten Anstieg des Messsignals bei Anregung des 1P-1P-Übergangs sichtbar wird. Dem Übergang zwischen den Elektronenniveaus 1P und 1S konnte eine Zeitkonstante von ca. 190 fs zugewiesen werden, die nicht von der Wahl der organischen Hülle beeinflusst wird. Nanopartikel mit den Liganden TOPO, Pyridin und Octanthiol zeigen auch nach 3 ns noch ein gut sichtbares Messsignal. An diesen Proben wurden Messungen im Nanosekundenbereich durchgeführt. Auch hier ist der Einfluss der organischen Hülle auf die Dynamik der Nanopartikelprobe deutlich zu erkennen. Mit der Kombination beider Messreihen konnte erstmals ein Zeitbereich abgedeckt werden, der sich von einigen hundert Femtosekunden bis in den Mikrosekundenbereich hinein erstreckt.
Analyse des Mechanismus der zellulären Aufnahme und des Einflusses zytoplasmatischer Bestandteile auf die Dissoziation DNA-beladener Nanopartikel
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Tue, 29 Nov 2005 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4582/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4582/1/Huth__Stephanie.pdf Huth, Stephanie
Optische Charakterisierung von Hybridsystemen aus Gold Nanopartikeln und Farbstoffmolekülen
Fakultät für Physik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/05
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Fluoreszenz von Hybridsystemen aus Gold Nanopartikeln und Farbstoffen zeitlich und spektral aufgelöst untersucht. Neben einer ultraschnellen Fluoreszenzemission, welche direkt von den Gold Nanopartikeln stammt, wurde insbesondere die dipolinduzierte Auslöschung der Fluoreszenz von Farbstoffen, welche auf der Partikeloberfläche chemisch gebunden sind, als Funktion der Partikelgröße und des Molekülabstandes untersucht. Hierzu wurden für drei verschiedene Farbstoffe Serien von Hybridsystemen hergestellt, in denen stets nur ein Parameter, nämlich die Nanopartikelgröße oder der Abstand des Farbstoffes, systematisch über eine Größenordnung geändert wird. Die experimentell bestimmten Transienten der Hybridsysteme zeigen, dass bereits die kleinsten Nanopartikel mit einem Radius von nur 1 nm die Quanteneffizienz bei einem Farbstoffabstand von 1 nm um 99,8 % verringern können. Des Weiteren wird nachgewiesen, dass die Quanteneffizienz der Farbstoffe sogar bis zu Abständen von 16 nm noch um über 50 % gesenkt ist. Eine derart hohe Auslöschungseffizienz wird in Energie-Transfer Systemen, welche nur aus organischen Farbstoffen bestehen, nicht erreicht. Gold Nanopartikel sind damit in der Tat viel versprechende Energieakzeptoren für eine zukünftige Generation von Nanosensoren. In dieser Arbeit kann zum ersten Mal die Ursache der effizienten Fluoreszenzauslöschung durch Gold Nanopartikel anhand der experimentellen Bestimmung der strahlenden und nichtstrahlenden Zerfallskanäle des Hybridsystems nachgewiesen werden. Sie resultiert aus einem strahlungslosen Energie-Transfer zum Partikel und einer gleichzeitigen Absenkung der strahlenden Rate des Farbstoffs. Die experimentell ermittelten strahlenden und nichtstrahlenden Raten der Hybridsysteme werden mit Modellrechnungen nach Gersten und Nitzan verglichen. Es zeigt sich, dass bei konstantem Molekülabstand, aber unterschiedlichen Partikelgrößen, eine qualitative Übereinstimmung der Messergebnisse mit den Modellvorhersagen vorliegt, die absoluten Energie-Transfer Raten sich jedoch um zwei Größenordnungen unterscheiden. Die Abweichung von den experimentellen Ergebnissen wird auf das Vorhandensein nichtlokaler Effekte zurückgeführt, welche im Modell nicht berücksichtigt, aber von aufwendigeren Modellierungen vorhergesagt werden. Bereits ohne oberflächengebundene Farbstoffe zeigen die experimentellen Ergebnisse eine Photonenemission aus Gold Nanopartikeln. Die Emission ist in ihrer spektralen Form der Plasmonresonanz sehr ähnlich und weist ebenfalls eine mit zunehmender Partikelgröße charakteristische Rotverschiebung auf. Gold Nanopartikel mit Radien von 1 – 30 nm zeigen, dass die Quanteneffizienz der Emission unabhängig von der Partikelgröße ist. Die quantitative sehr gute Übereinstimmung der Messergebnisse mit Modellrechnungen nach Shabhazyan et al. erlaubt zum ersten Mal eine mikroskopische Erklärung der verantwortlichen physikalischen Prozesse für die beobachtete Fluoreszenz. Sie wird als der strahlende Zerfall eines Partikelplasmons identifiziert: In den Gold Nanopartikeln rekombinieren optisch generierte d-Bandlöcher strahlungslos mit sp-Bandelektronen und emittieren dabei ein Partikelplasmon. Die Rate der Plasmonemission sinkt mit dem Volumen des Nanopartikels. Die Wahrscheinlichkeit dieser generierten Plasmonoszillation, strahlend via Photonenemission zu zerfallen, steigt wiederum mit dem Partikelvolumen. Die Quanteneffizienz des gesamten Prozesses ist daher unabhängig von der Partikelgröße. Sie ist um vier Größenordnungen über derjenigen einer direkten Aussendung eines Photons durch Rekombination von d-Bandlöchern mit sp-Bandelektronen an Goldfilmen. Der Grund liegt in der weitaus stärkeren Polarisierbarkeit und entsprechend höheren strahlenden Rate des Partikelplasmons gegenüber einzelnen Elektron-Loch Paaren.