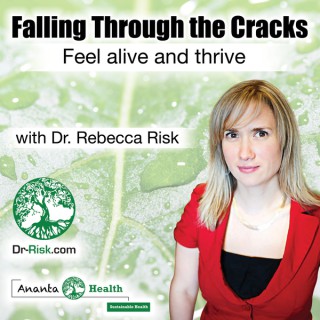Podcasts about patien
- 32PODCASTS
- 42EPISODES
- 36mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jun 20, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about patien
Latest news about patien
- Drive Medical Full Body Patien...esh with Commode Cutout, Large - down 14.38% ($9.91) to $59.00 from $68.91 Top Amazon Price Drops - Sep 29, 2024
- CVE-2022-46497 | Hospital Management System 1.0 his_doc_view_single_patien.php pat_number sql injection VulDB Updates - Aug 28, 2024
- Rush Hour Chaos Dribbble - Popular Shots - Oct 1, 2023
- ASRT launches patient shielding resource webpage AuntMinnie.com Headlines - Dec 9, 2022
Latest podcast episodes about patien
S1 #2 Der Mensch ist mehr als seine Krankheit | Wie kann man das verhindern
Der Mensch ist mehr als seine Krankheit. So lautet der Titel des vielgelobten Buches von Ursula Pabsch zu Systemischer Sozialer Arbeit im Krankenhaus. Der mehrteilige Podcast bei Sounds of Science Specials mit Ursula Pabsch beleuchtet detailliert und auf dem Hintergrund der immensen praktischen Erfahrung der Gesprächspartnerin viele Kontexte und Anforderungen dieses wichtigen Arbeitsfeldes. Anhand von Fallbeispielen werden die Vorzüge systemischen Denkens und Handelns direkt erfahrbar. Eine Auswahl von Reflexionsfragen lädt die Hörer:innen in jedem Post ein, die Arbeit und sich selbst weiter zu beobachten und zu professionaliseren. Im heutigen Gespräch – überschrieben mit „Wie kann man das verhindern?“ – steht die Geschichte eines dialysepflichtigen Patienten nach einer OP im Mittelpunkt und deren dramatische Wende. Fragen zu Neutralität gegenüber Entscheidungen von Patien:tinnen und deren Willensfreiheit kommen zum Tragen. Ursula Pabsch, Dipl. Päd., ist Systemische Therapeutin, Beraterin, Supervisorin und Organisationsentwicklerin; langjährige Tätigkeit in der klinischen Sozialarbeit; selbstständig in außerklinischem Case Management und Supervision; Inhaberin des Intensivpflegeportals www.leben-mit-intensivpflege.de; Beraterin von Intensivpflegediensten. Weitergehende mögliche systemische Fragen. An den Patienten: Zu wem haben Sie Vertrauen? Auf einer Skala von 0 – 10, wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf? Was hätten Sie sich im ganzen Verlauf gewünscht? Wie zufrieden sind Sie mit der Wohngemeinschaft, auf einer Skala von 0 – 10? Gibt es etwas, was Ihnen dort fehlt? Wie haben Sie es geschafft, beim letzten Aufenthalt so große Fortschritte zu machen? Angenommen, Sie erholen sich wieder und können die Intensivpflicht beenden, was wäre Ihr nächstes Ziel? An die Betreuerin: Was hätten Sie gebraucht, um klarer gegenüber der Oberärztin auftreten zu können? Angenommen es wäre Ihnen gelungen, was würden Sie dann über sich denken? Wie können Sie für zukünftige Klienten sicherstellen, dass deren Selbstbestimmung gewahrt wird? An die Oberärztin: Angenommen, der Patient muss wieder beatmet werden, was würden Sie über sich denken? Wie erklären Sie sich die bisherigen Fortschritte in der Wohngemeinschaft? Angenommen, die Dekanülierung wäre ein therapeutisches Ziel in der Wohngemeinschaft, was hätte das für Auswirkungen auf Ihre Behandlung? Der Blick zu mir: Wie gelingt es mir, die Neutralität im gesamten Verlauf mit der Parteilichkeit für den Patienten zu bewahren? Welche Fakten brauche ich, um entsprechende Formalitäten einleiten zu können? Wie schaffe ich es, den Behandlungsfaden bei vielen Behandlern intern nicht zu verlieren? Was braucht ein gutes internes Casemanagement? Wie müsste es strukturiert sein? Welches Verhalten von Mitarbeitern oder auch extern lässt mich aufhorchen? Welche Patienten/Diagnosen fordern mich und oder begeistern mich? _____________ Folgt auch den anderen Podcasts von Carl-Auer: autobahnuniversität https://www.carl-auer.de/magazin/autobahnuniversitat Blackout, Bauchweh und kein` Bock https://www.carl-auer.de/magazin/blackout-bauchweh-und-kein-bock Cybernetics of Cybernetics https://www.carl-auer.de/magazin/cybernetics-of-cybernetics Genau Geschaut: https://www.carl-auer.de/magazin/genau-geschaut Frauen führen besser https://www.carl-auer.de/magazin/frauen-fuhren-besser Formen (reloaded) Podcast https://www.carl-auer.de/magazin/formen-reloaded-podcast Heidelberger Systemische Interviews https://www.carl-auer.de/magazin/heidelberger-systemische-interviews Zum Wachstum inspirieren https://www.carl-auer.de/magazin/zum-wachstum-inspirieren Zusammen entscheiden https://www.carl-auer.de/magazin/zusammen-entscheiden-2
Bible Readings: Luke 4:1-13 James 5:7-20 Sermon Outline: James 5:7–11 (NKJV) 7Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. 8You also be patient. Establish your hearts, for the coming… The post 23/02/2025 – Morning Service: Be patien appeared first on Maroubra Presbyterian Church.
Please consider supporting this podcasthttps://www.patreon.com/drumwithmikeandeddyIn this engaging conversation, Mike and Eddy discuss their excitement for an upcoming guest, the challenges of booking studio time, and the impact of social media on productivity. They explore the resurgence of recording studios and the evolution of music production, emphasizing the value of live recording experiences and the importance of minimizing distractions in a digital age. Chapters00:00 Excitement for a Special Guest02:59 The Journey to Book the Guest06:04 Navigating Phone Addiction and Minimalism08:57 The Impact of Social Media on Productivity11:56 The Resurgence of Recording Studios14:53 The Evolution of Music Production17:53 The Value of Live Recording Experiences25:13 Cherishing the Creative Process29:02 The Studio as a Creative Playground30:39 The Importance of Patience in Music Creation33:12 Modern Technology and Its Impact on Music34:46 The Value of Studio Experience36:53 The Challenge of Simplicity in Drumming41:00 Navigating the Recording Environment45:43 The Excitement of Industry EventsSupport the show
Balbalakad iti Anak kin Nagannak
Balbalakad iti Anak kin Nagannak-Part 3
Balbalakad iti Anak kin Nagannak
#79: Die Klimasprechstunde
E-Health Pioneers | Der Business Podcast für den digitalen Gesundheitsmarkt
Was hat unsere Gesundheit mit Klimaschutz zu tun und was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, um klimafreundlich und gesund zu leben? Dazu spricht Host Andrea Buzzi mit Dr. Jens Ulrich Rüffer, Onkologe, Buchautor und Gründungsmitglied der Klimadocs. Den Klimadocs können sich alle Ärzt:innen anschließen, die ihre Patien:innen über die gesundheitlichen Vorteile einer klima- und umweltfreundlichen Lebensweise informieren möchten. Im Podcast erklärt PD Dr. med. Jens Ulrich Rüffer, ob es Zusammenhänge zwischen Klimaschäden und Krebs gibt, was eine „Klimasprechstunde“ ist und warum ein „Turnschuh auf Rezept“ sinnvoll wäre. Dies ist die erste von 3 Folgen unserer Serie „Nachhaltige Gesundheit“. Spannend, unterhaltsam und visionär!
Narigat a Makastrek Dagiti Nabaknang Sadi Langit
Narigat a Makastrek Dagiti Nabaknang Sadi Langit
Narigat a Makastrek Dagiti Nabaknang Sadi Langit
Plano Iti Panacaisalacan
Ayat, ti mangpasingked ti Relasyon, Rukbab
Ayat, ti mangpasingked ti Relasyon
Ayat, ti mangpasingked ti Relasyon, Rukbab
Expedition Arbeit #129 - kne:buster >> Management-Moden. Mit Jungwirth & Knecht
Show Notes zur Sendung 129 "Management-Moden" Für Kleidungsmoden gibt es drei Theorien[3]: die trickle-down theory:[4] untere soziale Klassen imitierten die Gebräuche der höheren was jene zwingt, sich laufend anders zu kleiden um Differenzierung unten/oben und damit die bestehende soziale Distanz aufrecht zu erhalten. die collective selection theory:[5] Auswahlmöglichkeiten werden durch Kosten oder Verfügbarkeit reduziert und gewähren wenigstens für einen absehbaren Zeitraum Stabilität. die marionette theory[6] erklärt Moden als das natürliche Ergebnis des Kapitalismus, als die Manipulation des Konsumenten durch Massenmedien, Werbung und Hersteller weil alle Teilnehmer von immer neuen Modewellen profitieren. Moden funktioniert also so lange, wie alle Teilnehmenden einer in-group davon Nutzen haben. Die Aufmerksamkeit der Arena wandert weiter, sobald eine nächste Methode noch mehr Differenzierung, Effizienz oder Zeitgeist verspricht. 3 Schnierer, Thomas. 1995. Modewandel und Gesellschaft: die Dynamik von „in“ und „out“. Opladen: Leske + Budrich. 4 McCracken, Grant. 1985. „The Trickle-Down-Theory Rehabilitated“. In The Psychology of fashion, 39–54. The Advances in retailing series. Lexington, Mass: Lexington Books. 5 Blumer, 1969 - auf S. 283 wird Zeitgeist erwähnt, Blumer war deutschstämmig und lehrte in Berkeley. Eine Kernaussage ist ‘fashion performs in a moving society a function which custom performs in a settled society' (S. 289). Blumer, Herbert. 1969. „Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection“. The Sociological Quarterly 10 (3): 275–91. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x. 6 Berger, Arthur Asa. 1992. Reading matter: multidisciplinary perspectives on material culture. New Brunswick, U.S.A: Transaction Publishers. Seit mehr als dreissig Jahren ist ausgeforscht, welche Zutaten ein Management-Blockbuster braucht:[17] Ein blinder Fleck und bislang ignorierter Umstand. Sofortiges Handeln: eine drohende Krise ist so furchterregend, dass ohne Verzug gehandelt werden muss. Geteilte Werte stehen auf dem Spiel, präsentiert als cleverer Mix aus Einfachheit und Mehrdeutigkeit[18] Entdeckt in der Praxis von herausragenden Führungspersönlichkeiten, eine Prise Wissenschaft hilft der Glaubwürdigkeit. Umsetzung nur mit Experten zügig möglich: wäre es einfach, könnte es jeder. Das Ansinnen muss einfach und verständlich formuliert sein. Kurze Sätze und keinesfalls akademischer Jargon. Der Autor kommt aus der Praxis und formuliert für seine peer group, verwendet aus Sitzungen und Seminaren vertraute Formate und Charts. Wesentlich: das Timing muss passen, der Nerv des Zeitgeist will getroffen werden.[19] Diese Eigenschaften decken sich mit den Bedürfnissen der Teilnehmer der Arena. 'Blinder Fleck' und 'sofortiges Handeln' erlauben emotionalisierten Alarmismus und lose Forderungen in die Weite des sozialen Diskursraumes. 'Geteilte Werte' koppeln und gestatten jedem Teilnehmenden Anschluss, Teilhabe, das Mitreden oder wenigstens das Signalisieren flüchtiger Zustimmung. 'Herkunft aus der Praxis' stiftet Vertrauen, die Referenz zu 'Studien' adelt den praktischen Handwerker. Die Nennung von 'Experten' wiederum öffnet die Tür für kommerzielle Dienstleistungen beliebiger Qualität. In der Manege freuen sich alle Teilnehmer: jede/r bekommt, was benötigt wird. 17 Abrahamson, Eric. 1996. „Management Fashion“. The Academy of Management Review 21 (1): 254. https://doi.org/10.2307/258636. siehe auch Eccles, Robert G., Nitin Nohria, und James D. Berkley. 1992. Beyond the hype: rediscovering the essence of management. Boston, MA: Harvard Business School Press. 18 Clark und Salaman, 1996 - zitiert nach Kieser, Alfred. 2020. „Kann man Managementprobleme im Prinzip so diagnostizieren und ‚heilen‘ wie die Probleme von Patienten? Zur Kritik des Evidenzbasierten Managements“. BFuP - Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 2020 (06): 601–22. https://www.researchgate.net/publication/348834976_Kann_man_Managementprobleme_im_Prinzip_so_diagnostizieren_und_heilen_wie_die_Probleme_von_Patien-_ten_Zur_Kritik_des_Evidenzbasierten_Managements. 19 Roberts, Joanne. 2005. „The Ritzerization of Knowledge“. Critical Perspectives on International Business 1 (1): 56–63. https://doi.org/10.1108/17422040510577906. sowie Peters, Thomas J., und Robert H. Waterman. 1983:488. In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. London]: Profile Books. kne:buster - ein Podcast-Satelliten-Experiment mit Stefan Knecht und Alex Jungwirth Expedition Arbeit, das heißt auch: Immer wieder Experimente, mal fast unmerkliche Veränderungen in der Community, mal gewagte Neuheiten, manchmal einfach das kreative Stochern im Nebel oder das lustvolle Ausprobieren dessen, was Spaß und Spannung verspricht. Stochern, Spaß und Spannung, das wird es bis auf Weiteres donnerstags geben, im Kurz-Podcast-Gesprächs-Format “kne:buster”. Der Titel enthält den Namen des Gastgebers, Stefan Knecht und die Funktion des “busting”, was irgendetwas zwischen “auf den Arm nehmen”, “Pleite gehen” und “sprengen” bedeutet. Im Kern geht es um die Aufdeckung von Mythen, einem Hobby, dem Stefan Knecht schon seit geraumer Zeit krawallfrei aber messerscharf und wissenschaftlich fundiert auf seiner Seite digitalien.org betreibt. Seit nun schon langer Zeit regelmäßig dabei ist ein weiterer “pragmatischer Skeptiker” namens Alexander Jungwirth. Alex ist den Hörerinnen und Hörern des Mitglieder Radios aus seiner Audio-Kolumne “Linzer Worte” bestens bekannt und fungiert im Duo Jungwirth & Knecht tendenziell als der Fragesteller an den Viel- und Intensiv-Leser Knecht. Wer beim lustvollen Dekonstruieren lauschen will, ist herzlich eingeladen. MITGLIED WERDEN Expedition Arbeit wünscht sich viele, neue Mitglieder: Denn dann können wir gemeinsam mehr bewirken, außerdem schaffen wir nur ab einer gewissen Größe die gewünschten Netzwerk- und Matching-Effekte. Vor allem aber glauben wir, dass wir nur mit ganz vielen auch ganz viel in Sachen sinnstiftender, selbstbestimmter und wirksamer Arbeit erreichen können. Mitglied werden ist einfach. Kündigen übrigens auch. Weil es eben kein Abo ist, sondern eine Mitgliedschaft. Alles dazu findet Ihr auf unserer Website oder direkt auf der Crowdfunding-Plattform Steady: https://steadyhq.com/de/expeditionarbeit/about Kommt an Bord, seid dabei, lasst uns etwas bewegen! ALLGEMEINE LINKS zu Expedition Arbeit Ideen, Anregungen und Kritisches an die Redaktion: florian@expedition-arbeit.de Expedition Arbeit-Mitglied werden Mitglied bei Expedition Arbeit werden Du willst in der Community mitmachen? Dann melde dich bei Der öffentliche Expedition Arbeit-Newsletter Unsere halböffentliche LinkedIn-Gruppe Unsere öffentliche LinkedIn-Seite Expedition Arbeit bei Twitter Expedition Arbeit, Event-Kalender Community Management und Host Community Radio: Florian Städtler bei LinkedIn Redaktionsleitung: Wolfgang Pfeifer Sprecherin Zwischenmoderationen: Stefanie Mrachacz Schnitt und Mix: Yannik Mattes Die Musik und SFX (Sound-Effekte) in allen Sendungen stammen von der Plattform bzw. von Florian Städtler
Iti Aldaw ti Panakaukom
We’re coming to the last couple of messages in the CL 168 Series until after Easter, but we must continue to put into practice all that we have learned. We must work hard to become a church that leverages every hour of every week to move the needle on the Kingdom of God — not just the one hour of the week that we are together. Our foundational scripture in Ephesians 5 tells us that we all have something God wants us to do and that we all must live thoughtfully and wisely, maximize every Kingdom opportunity, come together for corporate worship and have a private personal connection with the Lord ourselves. This week, we are exploring what a CL168 life looks like on a daily basis.
We’re coming to the last couple of messages in the CL 168 Series until after Easter, but we must continue to put into practice all that we have learned. We must work hard to become a church that leverages every hour of every week to move the needle on the Kingdom of God — not just the one hour of the week that we are together. Our foundational scripture in Ephesians 5 tells us that we all have something God wants us to do and that we all must live thoughtfully and wisely, maximize every Kingdom opportunity, come together for corporate worship and have a private personal connection with the Lord ourselves. This week, we are exploring what a CL168 life looks like on a daily basis.
Ti Natda nga Iglesya
#14 Prof. Wilhelm Bloch (Teil 2) – Langfristig gesund bleiben: durch Sport
Auf Molekül- und Zellebene verändert sich etwas, wenn Menschen Sport treiben. Die Muskulatur schüttet zum Beispiel entzündungshemmende Stoffe aus und das beugt Erkrankungen vor. Welche Mechanismen körperliche Aktivität so wertvoll machen, um langfristig gesund zu bleiben, erklärt Prof. Wilhelm Bloch vom Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Seine persönliche Leidenschaft ist die Elektronenmikroskopie. Sie hilft ihm, kleinste Veränderungen sichtbar zu machen und so die positiven Effekte des Sports besser zu verstehen. 00:00 - 01:20 – Übergang zu Teil 2: die Themen dieser Folge 01:20 - 04:53 – Kleinste Strukturen sichtbar machen und verstehen 04:53 - 16:00 – Auf Molekül- und Zellebene erklärt: Wieso tut Sport dem Körper gut? 16:00 - 18:58 – Sport in der Krebsvorsorge: das Protein Netrin 4 18:58 - 23:35 – Hochintensives Intervalltraining bei Patien:innen mit Multipler Sklerose: ein Erfolg? 23:35 - 28:38 – Welches Training ist am besten für die Gesundheit: kann man das sagen? 28:38 - 33:26 – Wie wirkt sich Sport auf unsere Gene aus? 33:26 - 42:27 – Prof. Blochs Beziehung zum Wein und die Frage: Wieso ist Rotwein gesund? 42:27 - 42:59 – Outro Zum Forschungsprofil von Prof. Bloch www.dshs-koeln.de/einerundemit
In this episode, Ryan discusses why the market is never going back to normal and shares some insight with his audience on what he has observed over the past few weeks, months, and years pertaining to the real estate market in Omaha and all over the country. This is one you won't want to skip over!
When do you get impatient? Can you pinpoint when and what causes you to lose patience? Or maybe your symptoms show up as frustration, anger or abrupt or rude responses to people or situations. You have the power on how you react to people and situations unless you hand it away. Knowing yourself is half the battle and today your host, Carol DeChaine looks into not only the causes and symptoms of impatience, but also 3 long term strategies to make patience a habit and 12 helpful hacks to use when you need patience right now! And she'll even give you the secret to how you can stay patient 100% of the time. Curious? Rate and review this podcast: https://lovethepodcast.com/connect2joy Host Carol DeChaine is an intuitive spiritual guide for practical matters; a certified spiritual, life and business coach, and Marconic multidimensional energy lightworker and teacher. For more information on the host and her business, Connect2Joy, check out https://connect2joy.com/ or www.marconics.com for additional Marconics energy information and to receive the energy or become a practitioner. Subscribe to the host's YouTube Channel here.Follow Connect2Joy and Carol DeChaine on Instagram @connect2joyTo contact the host, Carol DeChaine, directly email carol@connect2joy.com to schedule a free 30 minute get to know you session and to ask about life coaching, Marconic energy, energy space clearing or intuitive readings. She is also available for workshops and motivational speaking.Music - Rainbow After Rain by Pavel YudinVoiceover by Robert Rossmann - http://www.robertrossmann.com/#marconics #ascension #ascensionenergy #empowerment #enlightenment #transformation #spiritualawakening #connect2joy #dechaine #imagination #manifest #patience #patient #lostpatience #findmypatience #tolerance #endurance #composure #restraint #fortitude #calmness #remaincalm #frustration
Folge 59 "Umwegsantisemitismus nennt man das"
Michael Grunst weist auf neue Impf-Angebote nach der Schließung des Lichtenberger Impf-Drive-in hin, blickt zurück auf den Super-Wahlsonntag in Berlin und Lichtenberg, erzählt von neuen Straßennamen in Rummelsburg, die an die DEFA erinnern und vom Besuch beim Klub 7 in der Kunstfabrik HB 55, ruft zu Bewerbungen als Patient:innenfürsprecher:innen auf, freut sich auf die Verleihung des Kabarettpreises Der EDDI und empfiehlt zum Wochenende die Veranstaltungen der Woche der Generationen am Samstag. Zu Gast ist André Wartmann, Antisemitismusbeauftragter im Bezirksamt Lichtenberg. Bewerbungen als Patien:innenfürsprecher:innen an: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin Abteilung Familie, Jugend, Gesundheit und Bürgerdienste OE Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes Dr. Roland Scheil Alt-Friedrichsfelde 60 10315 Berlin oder per E-Mail an Mandy.Pangse@lichtenberg.berlin.de
Using Technology to Improve Patient Experience with Dyan Bryson, Owner/Founder of Inspired Health Strategies
Dyan Bryson from Inspired Health Strategies discusses Patient-Focused Drug Development, best practices for designing diverse and patient-centric trials, and how to use technology to improve the patient experience. She also dives into virtual clinical trials and gives her tips for building and enhancing patient advocacy, adherence, and education programs.Schedule a meeting with Natalie Yeadon: https://www.meetwithnatalie.comNatalie Yeadon LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalieyeadon/Impetus Digital Website: https://www.impetusdigital.com/Impetus Digital LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/impetus-digital/Impetus Digital Twitter: https://twitter.com/ImpetusadboardsImpetus YouTube: https://www.youtube.com/ImpetushealthcareDyan Bryson: https://www.linkedin.com/in/dyanbryson/Inspired Health Strategies: https://inspiredhealthstrategies.com/
Multiple stabbings case, Sami election, intensive care patien numbers down
Radio Sweden brings you a round-up of the main news in Sweden on May 14th, 2021. Presenter: Dave Russell Producer: Sujay Dutt
This episode is an entrepreneurial highlight for Patient Rhino. The goal of this sub-series is to showcase the talents of people around the world who excel at what they do. Feel free to email me at connor@syntacz.com if you would like to get more information about Patien. To learn more about the host, please visit www.syntacz.com.
Professor Peter Doherty: No Covid-19 magic bullets yet
We're still hearing about patient trials of the Remdesivir and Hydroxychloroquine for treatment of Covid-19 patients, but Nobel Prize-winning professor Peter Doherty says neither option is shaping as a potential remedy to the pandemic.
Professor Peter Doherty: No Covid-19 magic bullets yet
We're still hearing about patient trials of the Remdesivir and Hydroxychloroquine for treatment of Covid-19 patients, but Nobel Prize-winning professor Peter Doherty says neither option is shaping as a potential remedy to the pandemic.
#54: Building an in-house specialty pharmacy within an IDN with Brett McClain
This week, John sits down with Brett McClain, chief operating officer for Dignity Health’s St. Joseph’s Hospital and Medical Center, where he recently oversaw the launch of Dignity’s systemwide specialty pharmacy. Brett speaks to the development of the specialty pharmacy through a strategic partnership, how pharma engages with his health system, the Dignity-CHI merger, and more. Speaker Bios Brett McClain is the Chief Operating Officer for Dignity Health’s St. Joseph’s Hospital and Medical Center, and St. Joseph’s Westgate Medical Center. Brett has been with Dignity Health since 2008. His career spans nearly 25 years of health care management experience overseeing various hospital and medical clinic operations. He is an active leader within St. Joseph’s Hospital and Medical Center with roles in a variety of operational and strategic committees and councils. Brett earned degrees in both finance and marketing from the University of Arizona and an MBA from Regis University. He is a Fellow of the National Association of Public Hospitals and board member of Catholic Charities. John Marchica is a veteran health care strategist and CEO of Darwin Research Group, a health care market intelligence firm specializing in health care delivery systems. He’s a two-time health care entrepreneur, and his first company, FaxWatch, was listed twice on the Inc. 500 list of fastest growing American companies. John is the author of The Accountable Organization and has advised senior management on strategy and organizational change for more than a decade. John did his undergraduate work in economics at Knox College, has an MBA and M.A. in public policy from the University of Chicago, and completed his Ph.D. coursework at The Dartmouth Institute. He is a faculty associate in the W.P. Carey School of Business and the College of Health Solutions at Arizona State University, and is an active member of the American College of Healthcare Executives. About Darwin Research Group Darwin Research Group Inc. provides advanced market intelligence and in-depth customer insights to health care executives, with a strategic focus on health care delivery systems and the global shift toward value-based care. Darwin’s client list includes forward-thinking biopharmaceutical and medical device companies, as well as health care providers, private equity, and venture capital firms. The company was founded in 2010 as Darwin Advisory Partners, LLC and is headquartered in Scottsdale, Ariz. with a satellite office in Princeton, N.J.
Patien plays saxophone while doctors remove brain tumor • Woman can't pee for over three years --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app
52 Approach to the bleeding patient Today we talk to Stefano Cortellini, lecturer in emergency and critical care here at the RVC about an approach to the bleeding patient. Where do you start, what you should be thinking and what investigations can you do. We hope it clarifies your approach. Pet blood bank has lots of information on how to choose the right products and FAQs https://www.petbloodbankuk.org Suggested reading. http://www.cuvs.org/pdf/article-bleeding-disorders-diagnostic-approach.pdf If you have any comments about this podcast, please get in touch (email dbarfield@rvc.ac.uk; tweet @dombarfield;or use the RVC facebook page). We would greatly appreciate your time to rate us on the Apple podcast store and kindly write us a review.
E016: Repertory with Roger- Case of the Restless Child
This month I bring you another round of "Repertory with Roger". If you missed our first round, this is a regular monthly component where Roger Van Zandvoort of Complete Dynamics and I look at a case from his Clinical Case Comparison Project. Roger chooses cases from the old Homeopathic Recorder Journal issues, and enhances his repertory by making sure the remedies in those cured cases are represented under their corresponding rubrics. In this way, he is expanding the CD repertory, and small and lesser known remedies are better represented and more likely to come up- all from reliable cured cases. All of these cases are accessible on his Facebook page, and as always there will be a link in the show notes to that Facebook page, as well as the case. I have gone through and chosen about a dozen cases, copied, pasted and removed the remedy information so that when I sit down to repertorize them, they are “blind” to me. I apologize for the audio on my end, which has an echo. I hope it’s not too distracting to listen to… I’m going to do some troubleshooting to see what can be done to prevent that on future recordings. The case chosen for this month is a pediatric case, a young girl with restlessness keeping her up at night, with symptoms you likely run into in your own practices today- croupy cough, nasal obstruction, aggravations at night keeping everyone up! I chose this case because while many of the old Homeopathic Recorder cases might feel so different from the longer, more involved cases of today, this pediatric case felt like I could have taken it yesterday in my own clinic. Here's the write up of the case, as published in the Journal: Homoeopathic Recorder 1939, vol. 9., p. 33. Julia M. Green: A child of five years, plump with firm flesh, light complexion, has many common symptoms and some unusual ones, e. g.: Tendency to mouth breathing. Nose stopped tight with mucus welling forth. Tonsils not large, uvula long, swollen. Grinding teeth in sleep. Perspiration free, head, neck, hands, feet. Desire sweets, rich foods. Cannot stand soap around nose, causes sneezing. Tendency to chest colds and asthma. Cough croupy, alternating with sneezing all night long. Wheezing all over chest. Dyspnoea accompanied by yawning. Extreme restlessness. Pulling hair, clapping hands, throwing herself, finally weeping. Itching all over so cannot sleep, very restless. Attacks of pain mid-abdomen, cramp-like, accompanied by nausea and vomiting. Aching legs prevent sleep, wants them rubbed. Itching eyes and nose, keeps rubbing them. Nose red; sore. xxxx has made this child over in six months; potencies from 2c. to 1M. to 10M. so far. She has milder attacks farther apart, is far less nervous, can sleep all night. Before the call, I previewed some of the main points that came out of our discussion of how to repertorize this case, with suggestions that will hopefully help you in clinic. First- Determine the where the deepest pathology is- what tissues are affected? In the heavily mentalized cases of the west, we can quickly become distracted by the story and emotions. But we must never forget the physical pathology- what is affected the most, and is of the most important. In a case where there are many symptoms, in order not to over repertorize, focus your rubrics on the deepest pathology. Second- To cover the specific symptom of your patient, choose the specific rubric that may be smaller- a sub-rurbic- but also choose the larger General Rubric. That way, you will not omit a potential remedy in the sub-rubric. By including the smaller more descriptive rubric- rather than only going with the General- you are more likely to push the smaller remedies to the surface. Third- The descriptive rubrics of the patient’s symptoms are always better than the clinically defined rubrics. You will miss some remedies if you only rely on the clinical rubrics… the descriptive symptoms show you the dynamics of what is going on in the person- and that is what we are treating, the dynamic vital action of the patient. Fourth- Listen closely to the section where Roger talks about crossing three rubrics to give you a dimension to the final rubric that make it like repertorizing in 3D! For example- two concomitants and a modality or direction- Fifth- Have you ever wondered when to use coryza, catarrh or discharge? Me too. Roger clears it up! (pun intended!!) Sixth- The idea that an aggravation or amelioration can be - an often should be- looked at beyond face value. In this case, we talk about a nighttime aggravation, but *why* nighttime makes more sense if you consider the overall pathology of the case, rather than simply taking aggravation at night as a one dimensional descriptor. I don’t spend as much time on these cases as I would my own, but it was a good reminder that the way I typically work a case- to find connections and themes across all dimensions of the case: generals, particulars, mentals, modalities, etc… to find the coherent whole, supports this idea. The Bottom Line: Understand what is happening in the case, that is the ‘red line’ that Roger refers to, and where the deepest pathology is. And then, choose rubrics that represent that line, and when you may pick the smaller rubrics for the SRP’s or the exact sx of your patient, be sure to use some larger general rubrics as well. Seems so simple, doesn’t it? But whatever you do- make sure it is, as Roger says a “ Patien-tien” repertorization. Thanks again for listening, and for all you do to support the podcast, sharing it with others and giving me feedback. You can support the podcast with a one-time or regular donation at https://www.patreon.com/1mpodcast Subscribe through your podcast app of choice so you don’t miss an episode, and check out the show notes for links. I’ll be back next month with a regular episode, diving deeper into how we fail, so we can rise up higher. Until then, take care and stay observant!
Sollte man Fair Play abschaffen? Darum, um Johan Cruyff, den 28. Spieltag und die internationalen Patien unserer deutschen Teams dreht sich das Gespräch von Ralle, Nils, Etienne und natürlich Tobi. 90 Minuten geballte Fußballexpertise.
Asst. Pastor Travis Jackson
Evaluation histologischer und immunhistochemischer Kriterien zur Differenzierung von Psoriasis palmoplantaris und unterschiedlichen Formen des Hand- und Fussekzems
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Die histologische Differenzierung zwischen Psoriasis und Ekzem in palmoplantarer Region kann äußerst schwierig sein. Zur Anwendung kommen im Wesentlichen diesel-ben Kriterien wie in nicht-palmoplantarer Region. Es stellt sich daher die Frage, in wie weit diese Kriterien überhaupt und im Speziellen in palmoplantarer Region zur Unter-scheidung beider Erkrankungstypen geeignet sind. Wir führten eine Studie an 80 Patien-ten mit entzündlichen Dermatosen in palmoplantarer Region durch. Die Patienten wur-den in 3 Gruppen eingeteilt: in „höchstwahrscheinlich Psoriasis (n=29) bzw. Ekzem (n=20)“ bei Übereinstimmung von klinischer und histologischer Verdachtsdiagnose und in „diskrepante Fälle“ (n=31) bei Nichtübereinstimmung. Zur Evaluation kamen 32 Un-terscheidungsmerkmale, davon 17 histologische und ein klinisches Kriterium für Pso-riasis sowie 9 histologische und 5 klinische für Ekzem. Von diesen waren 17 statistisch signifikant zwischen den Krankheitsgruppen Psoriasis und Ekzem verteilt und somit zur Differenzierung geeignet. Diese 17 Kriterien wurden in ein einfaches numerisches Dia-gnosesystem eingebracht (+1 pro Psoriasiskriterium; -1 pro Ekzemkriterium). Hierdurch ergab sich eine korrekte Zuordnung in 84% der Fälle. Eine Streichung ähnlicher histo-logischer Kriterien erbrachte eine Vereinfachung des Systems auf nur noch 10 Kriterien bei gleichbleibender diagnostischer Genauigkeit. Eine Anwendung dieses Systems auf die 31 diskrepanten Fälle ermöglichte eine Zuordnung von 23 Patienten (13 Psoriasis, 10 Ekzem). Die verbleibende Grauzone und damit Schwäche des Systems lässt sich am ehesten durch einen chronifizierten Zustand der Dermatosen erklären, bei dem sowohl die klinischen als auch die histologischen krankheitstypischen Merkmale verloren gehen und sich Psoriasis und Ekzemformen in ihrem Erscheinungsbild annähern. Unter der Kenntnis einer Zuordnungsquote von 84% sollte das vorgestellte numerische Diagnosesystem zukünftig in der Differenzierung von Psoriasis und Ekzem in palmo-plantarer Region Anwendung finden. Aufgrund der in der Literatur beschriebenen Überexpression von JunB bei Psoriasis, versuchten wir diesen als Differenzierungsmarker zu etablieren. Bei beiden Erkrankun-gen fand sich eine relativ hohe JunB Expression durch alle Epidermisschichten, die kei-nerlei Differenzierung zwischen den Erkrankungen ermöglichte.
Der Wnt/ß-Catenin-Signaltransduktionsweg in humanen und murinen mesenchymalen Stammzellen
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/06
Mesenchymale Stammzellen (MSC) stellen aufgrund ihres Differenzierungspotentials einen großen Hoffnungsträger in der regenerativen Medizin dar. Entsprechend zahlreicher zell- und tierexperi-menteller Untersuchungen scheint die klinische Anwendung dieser adulten Stammzellpopulation im Rahmen einer Zelltherapie in greifbare Nähe zu rücken, wobei MSC als Basis für einen Patien-ten-spezifischen Zell- und Gewebeersatz dienen könnten. In welcher Weise die regenerative Kapazität der MSC durch spezielle Signaltransduktionsmechanismen gesteuert wird, ist jedoch noch weitgehend unbekannt. Vor diesem Hintergrund wurde in der hier vorliegenden Arbeit der Wnt/β-Catenin-Signaltrans-duktionsweg sowohl in humanen (hMSC) als auch in murinen (mMSC) mesenchymalen Stamm-zellen untersucht. Diesem komparativen Ansatz lag das Ziel zugrunde, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen beiden Zellentitäten zu evaluieren, um damit langfristig den Grundstein für die Übertragbarkeit von Daten aus nachfolgend geplanten murinen in vivo-Modellen auf die klinische Situation legen zu können. Hierzu wurden zunächst die Basis-Komponenten des Wnt/β-Catenin-Signalweges vergleichend analysiert. Eine Aktivierung des Wnt-Signalweges wurde über Stimulation mit Wnt3a bzw. LiCl in beiden Zellspezies sowie in einem RNA-Interferenz (RNAi)-basierten Ansatz durch Knockdown der für den β-Catenin-Abbaukomplex essentiellen Proteine APC und Axin2 in hMSC erreicht, während eine Inhibtion durch die Transfektion von small interfering RNAs (siRNAs) gegen das transkrip-tionsaktivierende Protein β-Catenin bzw. den Wnt-Korezeptor LRP5 induziert wurde. Dabei zeigten sich neben zahlreichen Gemeinsamkeiten unter anderem hinsichtlich der Proliferation auch klare Unterschiede zwischen hMSC und mMSC. Dies betraf insbesondere die Steuerung von Matrix-Metalloproteinase (MMP)-mediierten Invasionsprozessen, die im Falle von hMSC eine deutliche Wnt-Abhängigkeit aufwiesen, während die Invasionsfähigkeit von mMSC nicht durch den Wnt-Signalweg reguliert wurde. Diese Unterschiede in den zellulären Phänotypen spiegelten sich vorwiegend in einer Spezies-divergenten Regulation der Matrix-Metalloproteinase MT1-MMP wider, da nur in hMSC die Aktivierung der Wnt-Signaltransduktionskaskade mit einer vermehrten MT1-MMP-Expression einherging. Darüber hinaus konnte das Tcf/Lef-Reporter-System in mMSC etabliert werden, das die Quanti-fizierung β-Catenin-abhängiger Expression ermöglicht. Dies erfolgt mit Hilfe eines Reporter-proteins, dessen Expression nur nach Translokation von β-Catenin in den Zellkern induziert wird. Mit diesem System konnte unter anderem auch der Nachweis der funktionellen Plasmid-kodierten Wnt3a-Expression erbracht werden. Derartig generierte Reporter-mMSC könnten vor allen Dingen hinsichtlich einer Anwendung im in vivo-Mausmodell von großem Vorteil sein, da Wnt-aktive MSC mittels eines in vivo-Imaging-Systems visualisiert werden können, um ihre Rolle bei Geweberegenerationsprozessen aufzuklären. In einem weiteren Teilprojekt wurde die Wirkung von Dkk-1, einem Inhibitor des kanonischen Wnt-Signalweges, in hMSC eingehend untersucht. Dabei stand die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Dkk-1 und seinem Rezeptor LRP6 im Vordergrund. Versuche zum LRP6-Knockdown brachten ein komplexes Regulationssystem zutage, das eine feinjustierte Balance zwischen akti-vierenden und inhibierenden Signalen impliziert. Die Ergebnisse zusätzlicher RNAi-basierter Experimente wiesen außerdem auf eine funktionelle Divergenz von LRP5 und LRP6 hin. So vermittelt der Wnt-Korezeptor LRP5 vornehmlich aktivierende Signale, wie sie z.B. durch Wnt3a ausgelöst werden, während LRP6 hauptsächlich eine repressive Funktion beispielsweise durch Bindung von Dkk-1 zuzuordnen ist. Da neben den LRP-Rezeptoren auch Frizzled-Rezeptoren (Fzd) eine wesentliche Rolle bei der Wnt-Signalerfassung spielen, wurde zunächst das Fzd-Expressionsprofil in hMSC und mMSC mittels semiquantitativer RT-PCR-Analysen näher untersucht. Dabei zeigte sich, dass alle bisher bekannten 10 Fzds auch in MSC exprimiert werden, dieses jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Zudem ergaben Wnt3a-Stimulationsexperimente in hMSC, dass die Expression von Fzd8 negativ durch Wnt3a beeinflusst wird. Um die Bedeutung von Fzd8 näher zu evaluieren, wurden daher Fzd8-Knockdown-Experimente durchgeführt. Diese ließen erkennen, dass die hMSC-Proliferation maß-geblich von der Fzd8-Expression abhängt, wobei allerdings Fzd8 keinen direkten Rezeptor für Wnt3a darstellt. Zusammenfassend spiegeln die in der vorliegenden Promotionsarbeit erhobenen Daten zum Teil eindeutige Unterschiede zwischen basalen Wnt-regulierten Prozessen in hMSC und mMSC wider, denen insbesondere bei der präklinischen Validierung von therapeutischen Strategien in Maus-modellen eine tragende Rolle zukommt. Da der Wnt/β-Catenin-Signalweg maßgeblich an der Steuerung des invasiven Verhaltens von hMSC beteiligt ist, wie dies in ähnlicher Weise von anderen Forschergruppen auch für die Metastasierung von Tumorzellen nachgewiesen werden konnte, erscheint es zukünftig von vorrangigem Interesse, die hier erhobenen in vitro-Daten in einem in vivo-Mausmodell zu evaluieren. In diesem Kontext kann allerdings nur durch einen komparativen Ansatz, wie er dieser Arbeit zugrunde liegt, die Basis für ein Spezies-relevantes drug design bezüglich des Wnt-Signalweges entwickelt werden, um schließlich aussagekräftige Stamm-zelltherapien bzw. Anti-Tumorstrategien entwickeln zu können.
Kann die Diagnostik des Anstrengungsasthmas durch eine ergänzende Kaltluftprovokation verbessert werden?
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Diagnostik der im Kindes- und Jugendalter häufig vor-kommenden Form der belastungsinduzierten Asthmaerkrankung. Dabei haben wir uns die Frage gestellt, ob eine Ergänzung der bislang routinemäßig durchgeführten Diagnostik in Form eines Lauftests in freier Ebene oder auf dem Laufband durch eine ergänzende Diagnostik in Form einer Kaltluftprovokation zu einer Verbesse-rung der Identifikation der Anstrengunsasthmatiker führen kann. Der Grund dieser Überlegung war die Feststellung der erheblichen Diskrepanz der in der Literatur gemachten Angaben der diagnostizierten Anstrengunsasthmatiker unter den an Asthma bronchiale leidenden Kinder. Nach Lemke J (1998) ist diese Diskrepanz auf die Unterschiede im Schweregrad der Erkrankung bei den untersuchten Kindern, unterschied-lich eingesetzte Belastungstests und verschiedene Diagnosekriterien zurückzuführen. Die Infragestellung einer adäquaten Diagnostik ist aber dann angebracht, wenn man unter anderem die Aussage eines Berichtes des Deutschen Ärzteblatts (Ausgabe 19 vom 09.05.2003) berücksichtigt, nach der immer noch etwa ein Drittel der asthmakranken Kin-der und Jugendlichen dauerhaft vom Schulsport befreit sind. Das Unterbleiben einer solchen Diagnostik hat insofern eine hohe Relevanz, weil eine dadurch entstehende ausbleibende oder inadäquate Therapie zu Angst vor körperlicher Belastung führt, die eine entsprechende Vermeidungsstrategie nach sich zieht, was zu ei-ner Fehlentwicklung des betroffenen Kindes führt. Dabei ist nicht zuletzt an die zuneh-mend auftretende Adipositas mit ihren Nachteilen für das heranwachsende Kind und ihre Folgeerkrankungen zu denken. Letztendlich soll die verbesserte Diagnostik dazu führen, dass die betroffenen Kinder eine adäquate Therapie bekommen, so dass sie am Schulsport teilnehmen und sich physisch und psychisch normal entwickeln können. Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten haben wir 41 Patienten mit bereits durch das freie Laufen in der Ebene nachgewiesenem Anstrengensasthma untersucht. Als Kon-trolle wurde eine Gruppe von 27 Patienten mit anderen Asthmaformen, in der Regel aller-gisch bedingtes Asthma bronchiale, herangezogen. Bei diesen wurde ein Anstrengungs-asthma durch einen davor stattgefundenen Lauftest in der Ebene ausgeschlossen. Die Patienten waren Kinder bzw. Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahre. Zur Diagnostizierung eines Anstrengungsasthmas wurde eine von den meisten Autoren favorisierte Grenze des FEV1-Abfalls bezogen auf den jeweiligen Ausgangswert mit ei-nem Abfall von 15% nach der Laufbelastung auf dem Laufband und von 9% nach der Kaltluftprovokation herangezogen. Die Messungen erfolgten vor Beginn sowie unmittel-bar, fünf, zehn und fünfzehn Minuten nach der jeweiligen Belastung. Zieht man beide Belastungsarten zur Bewertung der Ergebnisse heran, dann zeigten in der Gruppe der 41 Kinder mit Belastungsasthma lediglich 15 Patienten in beiden Fällen ein positives Ergebnis, 9 Patienten zeigten eine positive Reaktion lediglich nach der Laufbandbelastung, dagegen nicht nach der Kaltluft, 10 Patienten sind als positiv nur nach der Kaltluftprovokation, jedoch nicht nach dem Laufen diagnostiziert worden und 7 Patienten zeigten in beiden Fällen keine positive Reaktion. Somit hatten 34 Patienten (83%) mindestens ein positives Ergebnis. In der Kontrollgruppe der 27 Kinder mit anderen Asthmaformen wurde ein Patient nach beiden Belastungen als positiv diagnostiziert, zwei Patienten zeigten lediglich nach der Laufbandbelastung eine positive Reaktion, 7 nur nach der Kaltluftbelastung und bei den restlichen 17 Patienten kam es in beiden Fällen zu einem negativen Ergebnis. 10 Patien-ten der Kontrollgruppe hatten fälschlicherweise mindestens ein positives Ergebnis und 17 Patienten (63%) waren richtig negativ. Hervorzuheben ist, dass von den 17 als negativ diagnostizierten Patienten durch das Lau-fen auf dem Laufband 7 durch die Kaltluftprovokation als positiv erfasst worden sind. Daraus ergibt sich nach den oben genannten Grenzwerten von 15 bzw. 9% eine Sensitivi-tät von 59% nach der Lauftestbelastung und 61% nach der Kaltluftprovokation. Der Wert der Spezifität betrug nach der Laufbelastung 89% und nach der Kaltluftprovokation 70%. Demnach ist die Provokation durch den Lauftest spezifischer, die durch die Kaltluft sensi-tiver. Unter Berücksichtigung der Spezifität und Sensitivität ist von einer deutlich niedrigeren optimalen Grenze des FEV1-Abfalls nach der jeweiligen Belastung auszugehen. Sie würde nach der Laufbandbelastung 9,7% (statt 15%) und nach der Kaltluftprovokation 7,5% (statt 9%) betragen. Obwohl sich die Mittelwerte der FEV1-Messungen zwischen den zwei Belastungstests nicht signifikant voneinander unterscheiden, konnte beim Vergleich der Werte der einzel-nen Patienten keine Korrelation nachgewiesen werden. Eine multiple lineare Regression zeigte jedoch in diesem Patientenkollektiv, dass die Iden-tifikation eines Anstrengungsasthmatiker unter den an sonstiger Asthma bronchiale er-krankten Kinder anhand der FEV1-Werte nach Laufband-Belastung durch die FEV1-Messung nach Kälteprovokation signifikant verbessert werden konnte. Welche Schlussfolgerungen sind daraus abzuleiten? Die ergänzende Kaltluftprovokation, die üblicherweise bei positiver Anamnese und nega-tivem Ergebnis nach Lauftestbelastung ergänzend durchgeführt wird, sollte bei jedem Asthmatiker stattfinden. Denn wenn man im Falle vorliegender Ergebnisse berücksichtigt, dass 10 von 41 Kinder mit vordiagnostiziertem Anstrengunsasthma durch Laufen in freier Ebene nach dem Lau-fen auf dem Laufband als negativ jedoch nach der Kaltluftprovokation als positiv einge-stuft wurden und andererseits auch bei 8 von 27 Kindern aus der Kontrollgruppe, bei de-nen kein Anstrengunsasthma nach dem standardisiertem Laufen in der Ebene nachgewie-sen werden konnte, ähnliche Ergebnisse vorlagen, kann die eingangs gestellte Frage nach dem Sinn einer ergänzenden Diagnostik durch Kaltluftprovokation bejaht werden. Vor allem, wenn viele Autoren darauf hinweisen, dass bei den meisten an sonstigem Asthma bronchiale Erkrankten Patienten eine Belastungskomponente vorliegt. Der Nachweis der besseren Identifizierung der Anstrengunsasthmatiker unter den betrof-fenen Patienten durch die ergänzende Kaltluftprovokation gilt nach vorliegenden durchge-führten Berechnungen als statistisch signifikant. Des Weiteren ist bei der Diagnosestellung des Anstrengungsasthmas durch den Lauftest an eine niedrigere Grenze des FEV1-Abfalls zu denken. Die meisten Autoren orientieren sich nach einem FEV1-Abfall nach Laufbelastung in freier Ebene oder auf dem Laufband von 15%. Nach unseren Ergebnissen gilt jedoch diese Grenze bei einem Abfall von 9,7% als optimal. Auch nach neuen Arbeiten von John M. Weiler et al (2007) reicht zur Festlegung der Diagnose Anstrengungsasthma eine Grenze von 10% des FEF1-Abfalls nach Laufbe-lastung aus. Auch kann der zusätzliche Einsatz der Kaltluftprovokation außer der Sicherstellung auch dem Ausschluss der Diagnose Anstrengungsasthma dienen. Ein durchaus akzeptables Ergebnis ist bei der Durchführung beider Tests bei einer Be-schränkung auf zwei Messzeiten zu erzielen, so dass diese bei der Kaltluftprovokation auf die Zeit unmittelbar nach Belastung und bei der Laufbelastung auf die Zeit 10 Minuten nach Belastung stattfinden. Damit könnte Zeit und Arbeit eingespart werden.
Experimentelle Untersuchung zu neurokognitiven Funktionen bei Opiatabhängigen unter Substitution
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Im Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation stand die differentielle Betrachtung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei opiatabhängigen Patienten unter Substitution mit Methadon und Buprenorphin zu Beginn der Substitutionsbehandlung, und deren Entwicklung nach stabiler Einstellung auf das jeweilige Substitutionsmittel. Außerdem wurden beide Gruppen auf einen Zusammenhang zwischen erlebtem chronischem Stress und psychophysischer Beeinträchtigung untersucht. Zu diesem Zweck wurde eine neuropsychologische Testbatterie verwendet, die unter anderem folgende Bereiche kognitiver Funktionen umfasste: Aufmerksamkeit und Konzentration, Kurz- und Langzeitgedächtnis und exekutive Funktionen, wie beispielsweise Problemlösung, kognitive Flexibilität, psychomotorische Grundgeschwindigkeit und divergentes Denken. Für die Erfassung von chronischem Stress kam der TICS2-K zur Anwendung. In der vorliegenden Arbeit konnten kognitive Beeinträchtigungen bei substituierten Patienten festgestellt werden. Bezüglich der Bereiche Kurzzeitgedächtnis (VLMT) und exekutive Funktionen (RWT und TMT) konnten signifikante Unterschiede der medikamentös substituierten Patienten im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe unabhängig vom Substitutionsmittel gefunden werden. Im Bereich des Langzeitge-dächtnisses und der Konzentration bzw. der Aufmerksamkeit, erreichten die Patientengruppen ähnliche Ergebnisse wie die Kontrollgruppe, wobei das Leistungsniveau leicht unterhalb der Ergebnisse der Kontrollgruppe lag und insgesamt eine größere Streuung aufwies. Damit unterstützt diese Untersuchung vorangegangene Studien, bei denen allerdings keine Vergleichsuntersuchungen zwischen Methadon und Buprenorphin stattfanden. Somit erweisen sich die kognitiven Leistungen bei Patien-ten unter Buprenorphin- oder Methadonsubstitution als vergleichbar. In dieser Untersuchung konnten wir eine Verbesserung der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung vom Beginn der Substitution bis zur stabilen Einstellung auf das jeweilige Substitutionsmittel anhand des D2-Aufmerksamkeits-Belastungstests nachweisen. Für beide Substitutionsmittel konnte eine signifikante, erhebliche Steigerung der Konzentrationsleistung aufgezeigt werden. Bisher existierte noch keine Studie, die diesen Effekt im Verlauf der Einstellung auf ein Substitutionsmittel untersuchte. Bezüglich der Einstufung chronischen Stresserlebens zeigten beide Substitutionsmittel höhere Werte für die Subskalen „Arbeitsunzufriedenheit“ und „soziale Isolation“ als die Kontrollgruppe. Methadonpatienten wiesen außerdem eine höhere Beurtei-lung der Besorgnisneigung auf. Niedrigere Werte im Vergleich zur Kontrollgruppe wurden für die Skala „Leistungsdruck bei der Arbeit“ angegeben, was möglicherweise auf einer höheren Arbeitslosenquote unter opiatabhängigen Patienten basieren kann. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Leistungen der kognitiven Tests chronischem Stresserleben konnte für beide Patientengruppen für die Skala „Überforderung bei der Arbeit“ aufgezeigt werden. Patienten mit höherer Einschätzung für diese Skala erbrachten in einigen kognitiven Tests schlechtere Resultate.
Der Einfluss kindlicher Traumatisierung auf eine spätere Drogenabhängigkeit
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Zusammenfassung: Die Auswirkungen von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit auf eine spätere Drogenabhängigkeit werden in der Literatur unterschiedlich diskutiert. In dieser Studie sollte bei drogenabhängigen Patienten der mögliche Einfluss einer Missbrauchserfahrung in der Kindheit – diffe-renziert nach Art und Schweregrad – auf den späte-ren Krankheitsverlauf, insbesondere spezifischer psychischer Symptome sowie der Schwere der Dro-generkrankung, untersucht werden. Methode: Mittels einer Traumsfragebogens wurden 100 drogenabhängige Patienten zu einer potenziellen sexuellen Missbrauchserfahrung, körperlichen Miss-handlung, Vernachlässigung, familiären Gewalt und emotionalen Misshandlung in der Kindheit befragt. Psychische und suchtrelevante Beeinträchtigungen wurden mit Hilfe des EuropASI und der SCL-90 er-faßt. Ergebnisse: Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die untersuchte Studienpopulation einer Vielzahl von belastenden Faktoren in der Kindheit ausgesetzt war. Mittels SCL 90-R konnte für jede der Missbrauchs-gruppen die Art und Schwere der psychischen Sym-ptombelastung, mittels EuropASI die Art und Schwe-re der Belastung in den Lebensbereichen gemessen werden. Hier war zu erkennen, dass vor allem bei den komorbiden psychischen Erkrankungen eine signifikant höhere Symptombelastung bei den Patien-tengruppen mit einer Missbrauchsvorgeschichte zu finden war. Eine Differenzierung der Missbrauchsop-fer nach ihrem Geschlecht erbrachte bei zwei Kate-gorien (Unsicherheit im Sozialkontakt, Phobische Angst) eine signifikant stärkere Belastung der Frau-en, während für die anderen Belastungswerte Män-ner und Frauen keine wesentlichen Unterschiede aufzeigten. Außerdem wurde der Einfluss des Schweregrads des jeweiligen Missbrauchs auf den Krankheitsverlauf untersucht. Hier war vor allem bei den Patienten mit einer sexuellen Missbrauchsvorge-schichte und bei familiärer Gewalt in der Kindheit eine signifikant stärkere psychische Symptombelas-tung in Korrelation mit einem schweren Missbrauch nachzuweisen.
Untersuchungen zur allergen-spezifischen Immuntherapie beim Kleintier
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/07
Im Rahmen einer retrospektiven klinischen Studie wurde die allergen-spezifische Immuntherapie zur Behandlung der CAD und FAD untersucht. Die Ermittlung der Erfolgsrate der beschriebenen Therapie basiert auf der Behand-lung von 117 Hunden. Diesen war über einen Zeitraum von mindestens zwölf Mona-ten eine wässrige Allergenextraktlösung subkutan injiziert worden. In 86 Fällen basierten die Lösungen auf intrakutanen Hauttests, in 27 Fällen auf allergenspezifischen IgE-Serumtests und in vier Fällen auf einer Kombination beider Verfahren. Die Pilzallergenextrakte wurden von den anderen Allergenen getrennt gelagert und injiziert. Dieses Vorgehen beruhte auf Berichten, nach denen proteolytische Enzyme dieser Extrakte die biologische Aktivität von Pollenallergenen reduzieren. Achtzehn Hunde (15,4 %) zeigten exzellente Behandlungsresultate. Bei 57 Hunden (48,7 %) war ein guter Erfolg festzustellen. Eine leichte Besserung trat bei 24 Patien-ten (20,5 %) ein, während die Therapie bei 18 Hunden (15,4 %) nicht von Nutzen war. Die Separierung der Pilzallergene führte zu einer deutlichen Steigerung der Erfolgsraten in der Gruppe der Pilzallergiker im Vergleich zu einer früheren Studie mit identi-schen Allergenen in derselben Praxis, welche keine Trennung dieser Komponente vorgenommen hatte. Das vorliegende Ergebnis deutet darauf hin, dass proteolytische Aktivitäten von Pilzallergenen eine für die Immuntherapie relevante Auswirkung auf die allergenen Eigenschaften anderer Antigene besitzen und durch eine getrennte La-gerung verhindert werden können. So ließen sich hinsichtlich der Allergenart bei Pollen, Milben und Pilzen keine Unterschiede in den Erfolgsraten erkennen. Die beobachteten Parameter wie Alter bei Allergiebeginn, Alter bei Immuntherapiebeginn, Zeitdauer bis Immuntherapiebeginn, Allergenanzahl und der Testlösung zugrunde liegender Testtyp (Serumtest auf allergenspezifisches IgE oder intrakutaner Hauttest) hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Erfolgsquote. Ein Erfolg der Immuntherapie zeigte sich auch an der deutlichen Reduktion der Kor-tisondosis und der verminderten Anzahl der Patienten, die diese Art der Medikation noch benötigten. Die durchschnittliche Dauer bis zum Erkennen erster klinischer Besserung lag bei zwei bis fünf Monaten. Die Behandlung der FAD durch Immuntherapie sowie andere Therapieformen wird am Beispiel von vier Katzen erörtert, bei denen eine Immuntherapie durchgeführt wurde. Die Diagnose der atopischen Dermatitis wurde nach Möglichkeit durch Ausschluss relevanter Differentialdiagnosen gestellt. Zur Allergenidentifizierung wurde der bei der Katze schwieriger als beim Hund zu bewertende und auszuführende Intrakutantest verwendet. Erfahrungen in der Literatur berichten über ähnliche Erfolge von Immuntherapien, die auf Serumtests auf allergenspezifisches IgE beruhen. Bei zwei Tieren kam es zu einer deutlichen Besserung der Erkrankung, während die Immuntherapie bei den beiden anderen nach acht und zehn Wochen abgebrochen wurde, nachdem sich die Symptomatik nicht gebessert hatte. In den beiden nicht auf die Immuntherapie ansprechenden Fällen konnte eine Futtermittelallergie nicht kom-plett ausgeschlossen werden. Aber auch die deutlich unter zwölf Monaten liegende Therapiezeit erschwert die Einschätzung dieser beiden Fälle. Die individuelle Anpassung des Protokolls durch eine Dosisreduktion und Intervallverkürzung bei einer der erfolgreich therapierten Katzen und die Intervallverlänge-rung bei dem anderen Tier macht die Relevanz dieses Aspektes deutlich. Ein Vergleich mit anderen Studien zeigte, dass bei Erfolgsraten von 50 bis 75 % die Immuntherapie eine sinnvolle Alternative zur Behandlung mit Kortison ist. Im Gegensatz zu anderen Behandlungen wie der oralen Gabe von Antihistaminika oder Fettsäuren, denen eine höhere Wirksamkeit als beim Hund zugeschrieben wird, stellt der Weg der Injektion häufig eine attraktive Alternative zu den täglichen - und häufig schlecht akzeptierten - Tablettengaben dar.
Klinische Ergebnisse nach operativer Therapie von ossären Bankart-Läsionen bzw. Glenoidfrakturen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Das Ziel der Studie ist die Erfassung und Darstellung langfristiger Er-gebnisse offener Schulterstabilisierungen bei Skapulafrakturen der Ty-pen D1 bis D3 nach Habermeyer. Zu beurteilen waren die Schultersta-bilität und -funktion, die Schmerzfreiheit im Alltag, das Wiedererlan-gen der Arbeits- bzw. Sportfähigkeit sowie der Versorgungsverlauf. Untersucht wurden 61 Patienten, 47 Männer und 14 Frauen. Das Pati-entenalter lag zum Zeitpunkt des Traumas zwischen 15 und 76 Jahren. Die dominante Seite war in 30 Fällen (50 %) verletzt. Die durchschnitt-liche stationäre Behandlungsdauer betrug 7 Tage, die mittlere Dauer der Arbeitsunfähigkeit war 11 Wochen. Die Zeitspanne zwischen Ope-ration und Nachuntersuchung reichte von 2 bis zu 10 Jahren. Die Bewertung beruht auf den Scores nach Kohn, Rowe und Zarins sowie Constant und auf 2 eigens für die Studie entwickelten Untersu-chungsbögen. Dargestellt wird einmal das Gesamtergebnis für jeden Untersuchungsparameter. Zum anderen erfolgt eine Auswertung unter Berücksichtigung des Versorgungszeitpunktes nach dem Trauma: Gruppe 3T, Versorgung zwischen dem 1. und 3. Tag, Gruppe 14T, Versorgung zwischen dem 4. und 14. Tag, Gruppe 3M, Versorgung zwischen dem 15. Tag und dem 3. Monat sowie Gruppe 3M