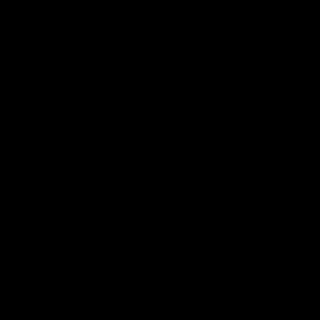Podcasts about das durchschnittsalter
- 30PODCASTS
- 36EPISODES
- 29mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Nov 20, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about das durchschnittsalter
Latest podcast episodes about das durchschnittsalter
Rund 500.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Krebs, schreibt die Deutsche Krebshilfe. Die WHO erwartet einen rasanten Anstieg von Krebserkrankungen, bis 2050 um bis zu 77 Prozent. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 70 Jahren. Es trifft nun auch vermehrt junge Menschen. Ihre Probleme mit der Krankheit unterscheiden sich wesentlich von denen alter Menschen. Die Münchner Initiative „Jung. Krebs. Kontakt. - JuKK“ (https://jukk.de) vernetzt junge Menschen, die dieses Schicksal teilen. Am 29. November feiert die Initiative ihr 10-jähriges Jubiläum im Kunstlabor 2 in der Dachauer Str. 90 u. a. mit Vorträgen. Anmeldung unter: kontakt@jukk.de. Dazu sind alle Interessierten willkommen. Mit der JuKK-Vorsitzenden Christine Kruse hat sich unser Autor Jonny Rieder unterhalten. Zunächst wollte er von ihr wissen, welche Bilanz sie nach zehn Jahren zieht ... Foto: Catherina Hess Radio München www.radiomuenchen.net/ @radiomuenchen www.facebook.com/radiomuenchen www.instagram.com/radio_muenchen/ twitter.com/RadioMuenchen https://odysee.com/@RadioMuenchen.net:9 https://rumble.com/user/RadioMunchen Radio München ist eine gemeinnützige Unternehmung. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. GLS-Bank IBAN: DE65 4306 0967 8217 9867 00 BIC: GENODEM1GLS Bitcoin (BTC): bc1qqkrzed5vuvl82dggsyjgcjteylq5l58sz4s927 Ethereum (ETH): 0xB9a49A0bda5FAc3F084D5257424E3e6fdD303482
60. Generationswechsel: entscheidend für die Zukunft der Landwirtschaft in Europa
Das Durchschnittsalter der Landwirte in der Europäischen Union liegt bei fast 60 Jahren. Der Generationswechsel – also dafür zu sorgen, dass jüngere Landwirte den Beruf ergreifen, um die Kontinuität zu gewährleisten – gehört daher zu den dringendsten Prioritäten der Gemeinsamen Agrarpolitik. Es geht nicht nur darum, die Lebensmittelproduktion aufrechtzuerhalten, so wichtig dies auch ist. Es geht auch darum, die einzigartigen Landschaften Europas zu pflegen und sein ländliches Erbe zu bewahren. Die Landwirtschaft ist eng mit der Geschichte, Kultur und Gesellschaft Europas verflochten, und jedes Mal, wenn ein Landwirt aufhört, verlieren wir ein Stück unserer Identität als Europäer. Für Folge 60 von 'Nahrung für Europa' sind wir nach Irland gereist, um mehr über die Herausforderungen und Chancen des Generationswechsels in einem Land zu erfahren, dessen Wirtschaft von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln für den Export abhängt. Wir treffen den irischen Junglandwirt des Jahres 2024, Chris Cahill, der eine Partnerschaft mit einem älteren Landwirt, Tony McCormack, eingegangen ist. Da Tony keine Nachfolgemöglichkeiten hatte, entschied er sich für eine Partnerschaft, die gut funktioniert: Tony stellt das Land und seine Erfahrung zur Verfügung, während Chris technische Kompetenz und Innovationskraft in den expandierenden Betrieb einbringt. Wir sprechen auch mit Patrick Brady vom Land Mobility Service über dessen Arbeit zur Förderung des Generationswechsels durch für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarungen, die sicherstellen, dass junge Landwirte über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um voranzukommen. Und wir treffen Ruth Fennell, Beraterin bei Teagasc, einem landwirtschaftlichen Beratungsdienst, der Lösungen anbietet, zur Unterstützung junger Landwirte und ihres Traums, ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft zu verdienen.
Zocken in Socken. Die besten Games zum Fest
„Moment mal, ist Weihnachten schon vorbei?!“. Selten verfliegt die Zeit so schnell wie beim Zocken. Für rund 16 Millionen Menschen ist die Weihnachtszeit auch Gamingzeit. Videogames gehören für sie genauso zum Fest wie gutes Essen und Geschenke. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Verbandes der Deutschen Gamebranche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov. Über die Hälfte aller Deutschen (54 Prozent) spielt regelmäßig am Smartphone, PC oder der Konsole. Videogames sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Und noch eine beeindruckende Zahl: Gamer werden immer älter. Das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. Gemeinsam mit Magnus von Keil, Autor und Gamingexperte, nehmen wir die besten Videospiele des Jahres unter die Lupe. Wir sprechen über aktuelle Trends, das erfolgreichste Spiel des Jahres sowie das schlechteste Spiel aller Zeiten. Wir finden heraus, welche Games Weihnachten retten können, welche uns im Advent entschleunigen und welche Computerspiele sich bestens als Geschenk eignen.
Wahl in Südafrika - Regierungspartei ANC könnte absolute Mehrheit verlieren
Die Parlamentswahl in Südafrika könnte für Wandel sorgen. Viele Südafrikaner sind mit der Regierungspartei ANC unzufrieden, so Inge Herbert von der Naumann-Stiftung. Das Durchschnittsalter der Wähler liegt bei 28 Jahren, ihre Erwartungen sind groß. Herbert, Inge www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit
Das Durchschnittsalter der Landwirte in der EU liegt bei 57 Jahren. Es gibt alarmierend wenige junge Menschen, die sich für die Landwirtschaft interessieren – und noch weniger junge Frauen. Darum investiert die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Europäischen Kommission in Massnahmen zur Umkehr dieser Entwicklung, und zur Unterstützung der Erneuerung der Generationen. Die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und die Unterstützung von Junglandwirten bei der Aufnahme oder Ausweitung ihrer Tätigkeit stehen im Mittelpunkt der Bemühungen der GD AGRI, die sich bewusst ist, dass die Ernährungssicherheit, der soziale Zusammenhalt und sogar der historische Charakter Europas ohne die Präsenz und das Engagement junger Menschen verloren gehen werden. Während der jüngsten Europäischen Jugendwoche in Brüssel veranstaltete die GD AGRI eine Breakout-Session für junge Landwirte und Aktivisten im ländlichen Raum. Ziel der Veranstaltung war es, mehr über die Wünsche, Sorgen und Perspektiven dieser jungen Menschen zu erfahren, um die Politik besser auf die Erneuerung der Generationen abstimmen zu können. In unserer 43. Folge von Food for Europe reisen wir nach Irland und Spanien, um zwei junge Menschen zu treffen, die in ländlichen Gebieten leben, und um sie nach Brüer ssel zu begleiten, wo sie an der Europäischen Jugendwoche teilnehmen. Außerdem sprechen wir mit einer Beamtin der GD AGRI, Haude Blanc, die selbst aus einem kleinen Dorf in Südfrankreich stammt, über die Herausforderungen und Chancen der Generationserneuerung auf dem Lande.
Die Bedrohung des Krieges durch Friedensparolen ist gebannt! | Von Rob Kenius
Ein Standpunkt von Rob Kenius.Der Wahnsinn mit Selenskyj, Joe Biden und Netanjahu geht weiter.Die psychotische Situation in den Medien, wo fast jede freie Kommunikation und selbst die Realität der Naturgesetze, der Logik und der Mathematik unterdrückt werden können, wo von acht Milliarden Menschen nur ein paar hundert zu Wort kommen, hat wie die meisten Psychosen einen tiefen Grund, mit Verdrängung als Ursache. Die Täterinnen und Täter der immer neu produzierten Krisen stellen sich aber als Opfer und Betroffene dar und als solche, die alternativlos handeln müssen.Anstatt weiter zu Psychologisieren, wozu ich weder befugt noch Willens bin, möchte ich Beispiele bringen, die leicht nachvollziehbar sind.Die Corona-Psychose wird von denen, die sie angeheizt und initiiert haben, immer noch Pandemie genannt. Dabei war von Anfang an klar, dass dieses Virus kein Killer ist. Das Durchschnittsalter derjenigen, die positiv getestet waren und anschließend verstorben sind, lag immer oberhalb der Lebenserwartung. Das heißt statistisch, die Korrelation mit dem Alter war stärker als die mit dem Virennachweis. Genau das durfte nicht zur Sprache kommen, obwohl viele es wussten, insbesondere Epidemiologen, die ohne Statistik-Kenntnisse nicht auskommen können.... hier weiterlesen: https://apolut.net/die-bedrohung-des-krieges-durch-friedensparolen-ist-gebannt-von-rob-kenius+++Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer „digitalen finanziellen Selbstverteidigung“ unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoinzahlungInformationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/+++Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.+++Apolut ist auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommen Sie zu den Stores von Apple und Huawei. Hier der Link: https://apolut.net/app/Die apolut-App steht auch zum Download (als sogenannte Standalone- oder APK-App) auf unserer Homepage zur Verfügung. Mit diesem Link können Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen: https://apolut.net/apolut_app.apk+++Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/+++Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut+++Website und Social Media:Website: https://apolut.netOdysee: https://odysee.com/@apolut:aRumble: https://rumble.com/ApolutX/Twitter: https://twitter.com/apolut_netInstagram: https://www.instagram.com/apolut_net/Gettr: https://gettr.com/user/apolut_netTelegram: https://t.me/s/apolut Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Darum ist der Pflegeberuf wichtiger denn je | Gaby Schröder | Geschäftsführerin des Alexander-Stift
Das Durchschnittsalter der Menschen in Baden-Württemberg wird immer höher und die Zahl der Auszubildenden für einen Pflegeberuf geht zurück.
… nur noch eine Runde … Die besten Games des Jahres im Experten-Check
„Moment mal, eben war doch noch Wochenende". Selten verfliegt die Zeit so schnell wie beim Zocken. Über die Hälfte aller Deutschen (54 Prozent) spielt regelmäßig am Smartphone, PC oder der Konsole. Knapp 10 Milliarden Euro hat die Branche in diesem Jahr umgesetzt. Und noch eine beeindruckende Zahl: Gamer werden immer älter. Das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. Gemeinsam mit Magnus von Keil, Autor und Gamingexperte, nehmen wir die besten Videospiele des Jahres unter die Lupe. Wir sprechen über aktuelle Trends, das erfolgreichste Spiel des Jahres sowie das schlechteste Spiel aller Zeiten. Wir finden heraus, welche Games Weihnachten retten können, welche uns im Advent entschleunigen und welche Computerspiele sich bestens als Geschenk eignen.
«DOK» wiederholt die erfolgreiche Reiseserie von 2014: Exotische Tiere, Traumstrände, endlose Natur: In Australien lockt das ganz grosse Abenteuer. Die Australier behaupten sogar, auf ihrem Kontinent lebten die glücklichsten Menschen. Darum nennen sie Australien stolz das «lucky country», das glückliche Land. Was ist an dieser Behauptung dran? Sven Furrer will es wissen und reist in der neuen sechsteiligen «DOK»-Serie 12'378 Kilometer durch Australien. In der fünften Folge reist Sven Furrer durch die wildromantischen Kimberleys im Nordwesten Australiens. Für viele Reisende ist dies die schönste Region des «lucky country». Das Glück und die Romantik ist aber plötzlich vorbei, als Svens Geländewagen eigenartige Geräusche von sich gibt. Die Filmcrew hat keine Ahnung, wie man ein Auto repariert. Zum Glück findet Sven im nahen Roadhouse einen versierten Hobbymechaniker. Wie gravierend ist die Panne? Nachdem das Auto geflickt ist, fährt Sven Furrer ins unberührte Buschland der Kimberleys und taucht ein in die Welt der Aborigines. Er lebt drei Tage lang bei Neville Poelina vom Stamm der Nyikina. Die Nyikina haben den 52-Jährigen zum traditionellen Hüter des Stammeslands bestimmt - eine grosse Ehre, aber auch eine grosse Verantwortung. Sven wird mit einer traditionellen Räucherzeremonie begrüsst. Neville Poelina erklärt, die Natur sei seine Apotheke und sein Supermarkt. Er zeigt Sven, wie er mit den Blättern eines bestimmten Baums Schmerzen lindert. Seine kleine Tochter Angelina führt ihn zu einem Platz, wo man wilden Honig findet. Und ihr Bruder Simon zeigt ihm, wie er im nahen Fluss einen schmackhaften Barramundi fangen kann. Weiter geht die Reise in die Minenstadt Newman. Das Durchschnittsalter der rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohner beträgt gerade einmal 32 Jahre. Wer in Newman lebt, arbeitet entweder in der Mine oder für ein zudienendes Unternehmen. Im Tagebau werden fast 40 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr abgebaut. Sven Furrer besucht die riesige Eisenerzmine von Mount Whaleback. Nobby Clark arbeitet seit 20 Jahren als Kranführer hier und ist der Coach der Newman Saints, einer von vier Footballmannschaften in Newman. Sven begleitet ihn zum Match der Saints gegen die ungeschlagenen Erzrivalen der Centrals. Weil viele seiner Spieler Schicht arbeiten, kann Nobby nie verlässlich planen. Auch heute fehlen ihm wichtige Spieler, und er muss selber auf das Spielfeld.
Edgar Brutler - Weinmachen mit der Sensibilität eines Musikers
Mein Interviewgast ist diesmal Edgar Brutler, der erste rumänische Winzer, den ich für Genuss im Bus ans Mikrofon hole. Edgar gehört zur bislang noch recht kleinen Winzerschar, die das vergessene Potenzial des rumänischen Weinbaus reanimieren und der Welt die verborgenen Schätze ihrer Heimat zeigen möchten Sein 2018 gegründetes Weingut liegt in Bildegg im Nordwesten Transsylvaniens in der Weinregion Crisana. Die 4 ha Weingärten, die er seit 2018 ökologisch bewirtschaftet, sind, wie für die Region üblich, überwiegend nach dem Prinzip des gemischten Satzes und in der traditionellen Einzelpfahlerziehung bepflanzt - ein wilder Mix aus fast zwei Dutzend Sorten, darunter etliche, deren Identität bis heute nicht eindeutig ermittelt werden konnte. Das Durchschnittsalter seiner Reben ist immens, in der Spitze älter als 90 Jahre. Bereits für seine ersten Abfüllungen hat er von der internationalen Sommelierszene viel Lob und Zustimmung erhalten, vor allem weil er einen kompromisslos eigenständigen Weg verfolgt und dabei auf die originelle Strahlkraft der lokalen Rebsorten setzt. Er selbst beschreibt seinen Zugang zum Weinmachen heute als „Old School Avantgarde“. Old School Avantgarde mit viel Bauchgefühl wäre präziser. Der sensible Musiker vertraut nämlich ganz und gar seinen Sinnen. Riechen, schmecken und ertasten gehen ihm über alle technischen Analysen. „Diesen Firlefans hinter mir zu lassen, war wie eine große Befreiung. Endlich allein meiner Wahrnehmung und Intuition vertrauen zu dürfen, war ein riesiges Geschenk“, so Edgar im O-Ton.
Computerspiele. Die besten Games im Check.
Uups, eben war doch noch Wochenende �� Seit der Pandemie verbringen wir deutlich mehr Zeit mit Computerspielen als vorher. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene spielen regelmäßig am Smartphone, Tablet oder an der Konsole. Das Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren. Täglich zocken wir durchschnittlich 40 Minuten. Und was zocken wir? Was sind die aktuellen Trends und warum merken wir beim Spielen nicht, wie die Zeit vergeht? Was zeichnet das aktuelle Computerspiel des Jahres aus und welche Games sind sonst noch sehr erfolgreich? Antworten erhalten wir von Magnus von Keil. Er ist Autor und Gamingexperte. Wir fragen, wo die Grenze zur Sucht besteht, wie wir Kostenfallen vermeiden und welches Game wir unbedingt mal wieder hervorholen sollten. Außerdem klären wir, was Super Mario und Micky Mouse verbindet und was wichtig ist, wenn wir Spiele Apps kaufen wollen
#60 - Bentley Managing Director China Bernd Pichler über Rekordjahre, Luxusautos und chinesische Konsumenten
Vom Kreisgymnasium Heinsberg im Regierungsbezirk Köln zum Managing Director China des Luxusautomobilherstellers Bentley nach Beijing, das ist kein gewöhnlicher Lebenslauf, doch um unseren heutigen Gast Bernd Pichler zu zitieren: „Wer will schon ein Durchschnittsleben?“ Trotz Corona hat Bentley Rekordjahre hinter sich. Das ist auch und gerade den chinesischen Autoliebhabern zu verdanken. Das Durchschnittsalter der chinesischen Bentleykunden ist übrigens 39 Jahre, 20 Jahre jünger als in anderen Märkten. Was den chinesischen Markt sonst noch so besonders macht und wie sich ein Bentley auf Eis fährt, das und mehr in dieser Folge. Bernd Pichler: https://www.linkedin.com/in/bernd-pichler-china/ Damian: https://www.linkedin.com/in/damianmaib/Thomas: https://www.linkedin.com/in/afuthomas/
Wird die 35 die neue 25? Mütter sind immer älter: Das Durchschnittsalter fürs erste Kind liegt bei Ü30. Was sind die Ursachen? Gibt es das ideale Alter, eine Familie zu gründen? Man hat ja keine Vorstellung, wie sich das Leben mit einem Kind verändert. Heute geht es um geplante und ungeplante Familienplanung. Wir sammeln gute Gründe für einen frühen und für einen späteren Kinderwunsch. Wir plaudern über die neue Work-Life-Baby-Balance und wie eine gelungene Wiederkehr in das Berufsleben aussehen kann. https://weekly52.de/weekly/290 (00:00) 35 ist das neue 25 (06:00) Als der kleine Bruder Vater wurde (08:00) Wenn Männer schwanger werden (10:00) Unsere ganz jungen Eltern: Kind mit 18? Oje oder Oh ja? (14:00) Gute Gründe für eine frühe Mutterschaft (20:00) Nicht nur Mutter sein, wieder Arbeiten tut gut (23:30) Kinder kosten ein Vermögen (26:00) Gemeinwohl-Ökonomie und Work-Life-Balance (32:00) B Corp und Corporate social responsibility (39:00) Erst Kinder aus dem Haus, dann leben! (45:00) Pia Parolin: Kreativität zum Sorgen lindern
Von Retro bis E-Sports: Münchner Startups und die Gaming-Branche, Vito Ventures
In Episode 48 des Munich Startup Podcasts widmen wir uns dem Thema Gaming. Denn Videospiele gehören zum liebsten Zeitvertreib der Deutschen: Laut Game, dem Verband der deutsche Games-Branche, gamen 58 Prozent der Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren. Dabei machen Spielerinnen rund die Hälfte (48 Prozent) der Spielerschaft aus. Das Durchschnittsalter der Gamer liegt inzwischen bei 37,4 Jahren, mit steigender Tendenz. Allerdings profitieren deutsche Unternehmen kaum von dem positiven Trend. Denn laut Game liegt der Anteil deutscher Spiele-Entwicklungen am Gesamtumsatz von 8,5 Milliarden Euro bei lediglich 4,2 Prozent. Für Startups, die sich an Entwickler und Publisher richten, bedeutet dieser vergleichsweise kleine heimische Markt, dass sie sich früh international aufstellen müssen. Oder aber sie richten sich direkt an die Gamer selbst – davon gibt es ja genug im Land. Dies sind: Earlygame, Megadev, Brainamics und Retroplace. Außerdem: Auch wenn der VC Vito Ventures keine neuen Startups mehr in sein Portfolio aufnimmt, lohnt sich ein genauerer Blick auf ihn. Denn sein Portfolio liest sich ziemlich beeindruckend: Von Quantencomputer über Mobility-Lösungen bis hin zu Spacetech-Startups findet sich bei Vito Ventures alles, was man allgemein als bahnbrechend bezeichnet. Wir gehen ins Detail und verraten, wo die MacherInnen des VC heute zu finden sind. Alle im Podcast erwähnten Links findest Du übrigens im Artikel zur Folge: https://www.munich-startup.de/86595/podcast-gaming/ ---------- Mehr Infos zur Münchner Startup-Welt findest Du natürlich regelmäßig auf unserem News-Portal: https://www.munich-startup.de/ Übrigens: Je nachdem, welchen Podcast-Kanal Du nutzt, freuen wir uns natürlich auch über Likes, Bewertungen, Kommentare und mehr.
Dreimal Digital Episode 34: Demografie und Digitalisierung – Die Wirtschaft in einer alternden Gesellschaft
Die Bevölkerung wird immer älter. Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung in Deutschland um 3 Monate, das sind übrigens 6 Stunden pro Tag. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Geburten stetig ab. Das Durchschnittsalter in Deutschland beträgt derzeit knapp 45 Jahre, Tendenz steigend. Wie können Händler, wie kann sich die Wirtschaft heute schon darauf einstellen, oder besteht vielleicht gar kein Bedarf dazu?
Von Anzug und Krawatte bis Bootcamp – Göttingens FDP-Abgeordneter Konstantin Kuhle über die Arbeit im Bundestag
Das Durchschnittsalter im Bundestag liegt aktuell bei 47,3 Jahren, bei der FDP sind es sogar 47,7 Jahre. Deutlich unter diesem Schnitt liegt der Göttinger FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle. Er feiert diese Woche seinen 33. Geburtstag und absolviert nun schon seine zweite Amtszeit in Berlin. In unserer heutigen Sendung „Eine Stunde – ein Thema“ gewährt er uns einmal einen Einblick, wie es in der Bundespolitik zugeht und verrät dabei auch, was ihn bei seinem Start in Berlin ...
Ahoi ihr Landratten. Wir sind mitten im Atlantik, weit weg vom Festland, den Wogen des Ozeans ausgeliefert. Das Durchschnittsalter ist 66 und unsere beiden Schwiegermütter- Lieblinge steppen Linedance zu Heintje Platten. Der Kreuzfahrt Wahnsinn geht in eine neue Runde. Jeden Tag betrunken, um das Wanken der Wellen auszugleichen wird über das Leben als Labormaus sinniert und ein Online Beef mit youtuber Unge angefangen. Ja, das einsame Leben auf hoher See hinterlässt Spuren und so bleibt Benno und Max nichts anderes übrig als zu Essen und sie verspeisen ganze Schwärme von Tiefseefischen beim Sektfrühstück mit Seenotrettung live. Dann geht es gedanklich noch mal in die Heimat, die Berliner Bezirke werden durch den Klischee Kakao gezogen und am Ende bleiben zwei Fragen: Wie wird die Berliner Polizei es schaffen, die neuen Grünen Minister auf Ihren Fahrrädern zu beschützen Und Warum haben bei Benno und Max alle Brandenburger einen sächsischen Akzent? Lesen wir es zwischen den Zeilen, aber erst mal geht es ab Im Tshirt auf dem Weihnachtsmarkt
#04 Silver CEOs: Durchstarten oder ab in die Rente? – Roger Näf
Bei Erfolgen feiert man sie, bei Tiefschlägen müssen sie die Verantwortung übernehmen und abtreten – die Rede ist von CEOs. Welche Fähigkeiten machen einen CEO in der heutigen Zeit erfolgreich, wie kann man ungeeignete KandidatInnen entlarven, was kann eine junge von einer erfahrenen Führungskraft und umgekehrt lernen, wie sollten CEOs von morgen sein? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir mit Roger Näf. Als leidenschaftlicher Unternehmer im Treuhand- und Nachfolgebereich ist Roger Näf mit seiner T1 Treuhand + Invest AG sowie als Business-Angel aktiv. Diese Key Insights erfahren Sie in dieser Folge unter anderem: Das Durchschnittsalter heutiger CEOs von 55 hat seine Berechtigung: Mit zunehmender Lebenserfahrung wird eine Führungsperson resilienter gegenüber Stress; Ein guter CEO ist ein Profi im Zusammenstellen effektiver Teams, Personalführung ist seine wichtigste Aufgabe; Kleine Unternehmen brauchen Generalisten und Problemlöser als CEOs, keine Fachspezialisten; Wer den perfekten CEO «backen» will, benötigt als Zutaten Empathie, technisches Flair und Finanzwissen; Wer führt, kann nicht schwarz-weiss denken: Jede Entwicklung hat positive und negative Aspekte, die Herausforderung ist es, diese zu erkennen; Die Welt bleibt nicht stehen: Weder jede Entwicklung abzulehnen noch jede zu übernehmen führt zum Erfolg; Der Mix macht's: Junge Führungskräfte sollten auf die Erfahrung der Älteren zurückgreifen; Trotz der Tendenz zur Selbstorganisation wird die klassische Führung nicht aussterben, da nicht alle im Team entscheiden und die Verantwortung übernehmen möchten.
Ich finde unser Rat muss jünger werden. Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei fast 60 Jahren. Wir brauchen junge Leute und junge Ideen. Letztere bringt unter anderem Sabine Kunze mit. Als Friseurin hat sie das richtige Gespür, denn wie sie sagt „ich liege mit dem Ohr auf der Straße von Goslar". Sabine und ich wünschen uns mehr Miteinander im Rat. Wir finden, dass es um die Sache gehen muss und nicht wie man seine Partei nach vorne schiebt. Eine Folge über Kommunalpolitik, Hoffnung, und warum man ein grünes Herz haben und trotzdem für die CDU kandidieren kann.
Sportmarketing Summit 2021: Deutschland ist Pionier im Esports
2021 wird ein Jahr des Spitzensports. Hoffentlich! Fußball-EM, Olympische Spiele, Basketball-EM und vieles mehr bieten für Marken unzählige Möglichkeiten, sich im Sportumfeld zu präsentieren. Spitzen- wie Amateursport wecken Emotionen und schaffen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, wie es kaum eine andere Branche kann. Trotz allem ist die Coronakrise eine große Herausforderung im Sportumfeld. Und auch die Zielgruppen selbst sind anspruchsvoll. Sie dulden keine platte Werbung, sondern möchten von Marken begeistert werden. Hat man sie aber einmal überzeugt, belohnen sie die Marke mit Engagement und Kundentreue. Hier geht es zur Veranstaltung: https://shop.wuv.de/wuv-sportmarketing-summit-2021 Der W&V Sportmarketing Summit 2021 findet am 22. April virtuell statt. Als Partner unterstützt die Veranstaltung u.a. Infront. Moderator Dominik Hoffmann hat im Vorfeld mit dem Head of Gaming & Esports bei Infront, André Fläckel, gesprochen. Anmerkung / Korrektur zur Angabe Anzahl Gamern in Deutschland (2:50min): In Deutschland gibt es im Jahr 2020 mehr als 34 Millionen Gamer und die Spielerzahl ist seit Jahren nahezu unverändert. Laut Statista werden hier Personen gezählt, die zumindest gelegentlich Computer- und Videospiele spielen. Dabei ist es unerheblich, ob auf PCs, Konsolen, Smartphones, Tablets oder Handhelds gespielt wird. Das Durchschnittsalter der Gamer ist mittlerweile auf mehr als 37 Jahre angestiegen, im Jahr 2014 waren die Spieler im Durchschnitt noch 31 Jahre alt. Inzwischen sind 15 Prozent aller Gamer mindestens 60 Jahre alt. (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/712928/umfrage/anzahl-der-computerspieler-in-deutschland/#:~:text=In%20Deutschland%20gibt%20es%20im,gelegentlich%20Computer%2D%20und%20Videospiele%20spielen) Game – Der Verband der Deutschen Games Branche (3:40min) https://www.game.de/ Anmerkung/ Korrektur zur Angabe Höchstes Preisgeld im Esports – The International im Spieletitel Dota2: 34,34 Millionen US-Dollar (7:30min) https://www.zeit.de/news/2020-08/26/preisgeld-der-dota-wm-bricht-erneut-rekord Super Mario Effect – TEDx Talk (20:30min) https://www.youtube.com/watch?v=9vJRopau0g0
Warum das Durchschnittsalter der Corona-Intensivpatienten sinkt
Autor: Jaecker, Tobias Sendung: Studio 9 Hören bis: 19.01.2038 04:14
Wie die betriebliche Krankenversicherung ein gesellschaftliches Problem löst
Warum die betriebliche Krankenversicherung ein gesellschaftliches Problem löst Eine betriebliche Krankenversicherung hat nicht nur Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nein, sie löst im Grunde auch ein gesellschaftliches Problem. Wie das gelingt und was es dafür braucht, erklärt Dirk Keller. Der selbstständige Versicherungsmakler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit in Unternehmen zu bringen. 44 Jahre – das ist derzeit das Durchschnittsalter der Erwerbstätigen. Wie das Statistische Bundesamt festgestellt hat, sind das etwa vier Jahre mehr als 20 Jahre zuvor. Das Durchschnittsalter von Arbeitnehmern steigt also immer weiter an. Einzelne Berufsgruppen sind von dem steigenden Durchschnittsalter besonders stark betroffen – im Grunde sind es genau die Berufsgruppen, die um jede Nachwuchskraft kämpfen müssen. Gesundheits- und Krankenpfleger sind im Durchschnitt 42 Jahre alt, Ärzte sogar 48. Ganz anders sieht das bei Berufen aus, die auch junge Leute wie Auszubildende oder Berufsstarter anziehen: Dazu gehören laut der Studie des Statistischen Bundesamtes beispielsweise die Branche rund um Mechatronik und Automatisierungstechnik. Hier liegt das Durchschnittsalter bei gerade einmal 31 Jahre. Etwas älter, aber dennoch unter dem allgemeinen Durchschnittsalter von 44 Jahren, liegt die Berufsgruppe der Informatiker und Softwareentwickler mit 40 Jahren. Schreib uns Feedback an podcast@dirk-keller.de
Die ländlichen Räume im Osten sind leerer und älter als diejenigen im Westen Deutschlands. Das Durchschnittsalter beträgt circa 50 Jahre; Verfall kennzeichnet viele Dörfer; ungenutzte Läden und Wohnhäuser prägen das Bild zahlreicher kleiner Städte. Das sind die Spuren, die die millionenfache Abwanderung seit den 90er Jahren hinterlassen hat. Doch dieser Trend läuft nicht ungebrochen. Eine junge Familie, ein Künstlerkollektiv, eine neue Landwirtschaftskooperative: In diesem Podcast geht es um engagierte Leute, die den Leerstand als Freiraum begreifen, die neue Impulse setzen und damit diese Räume zu Experimentierfeldern für ein neues kulturelles und wirtschaftliches Landleben machen. Foto: Martin Fisch / Flickr CC-BY-SA 2.0
Die ländlichen Räume im Osten sind leerer und älter als diejenigen im Westen Deutschlands. Das Durchschnittsalter beträgt circa 50 Jahre; Verfall kennzeichnet viele Dörfer; ungenutzte Läden und Wohnhäuser prägen das Bild zahlreicher kleiner Städte. Das sind die Spuren, die die millionenfache Abwanderung seit den 90er Jahren hinterlassen hat. Doch dieser Trend läuft nicht ungebrochen. Eine junge Familie, ein Künstlerkollektiv, eine neue Landwirtschaftskooperative: In diesem Podcast geht es um engagierte Leute, die den Leerstand als Freiraum begreifen, die neue Impulse setzen und damit diese Räume zu Experimentierfeldern für ein neues kulturelles und wirtschaftliches Landleben machen. Foto: Martin Fisch / Flickr CC-BY-SA 2.0
Die ländlichen Räume im Osten sind leerer und älter als diejenigen im Westen Deutschlands. Das Durchschnittsalter beträgt circa 50 Jahre; Verfall kennzeichnet viele Dörfer; ungenutzte Läden und Wohnhäuser prägen das Bild zahlreicher kleiner Städte. Das sind die Spuren, die die millionenfache Abwanderung seit den 90er Jahren hinterlassen hat. Doch dieser Trend läuft nicht ungebrochen. Eine junge Familie, ein Künstlerkollektiv, eine neue Landwirtschaftskooperative: In diesem Podcast geht es um engagierte Leute, die den Leerstand als Freiraum begreifen, die neue Impulse setzen und damit diese Räume zu Experimentierfeldern für ein neues kulturelles und wirtschaftliches Landleben machen. Foto: Martin Fisch / Flickr CC-BY-SA 2.0
Die ländlichen Räume im Osten sind leerer und älter als diejenigen im Westen Deutschlands. Das Durchschnittsalter beträgt circa 50 Jahre; Verfall kennzeichnet viele Dörfer; ungenutzte Läden und Wohnhäuser prägen das Bild zahlreicher kleiner Städte. Das sind die Spuren, die die millionenfache Abwanderung seit den 90er Jahren hinterlassen hat. Doch dieser Trend läuft nicht ungebrochen. Eine junge Familie, ein Künstlerkollektiv, eine neue Landwirtschaftskooperative: In diesem Podcast geht es um engagierte Leute, die den Leerstand als Freiraum begreifen, die neue Impulse setzen und damit diese Räume zu Experimentierfeldern für ein neues kulturelles und wirtschaftliches Landleben machen. Foto: Martin Fisch / Flickr CC-BY-SA 2.0
029: Wir müssen den Gründergeist bei Jugendlichen fördern - Mit Jan Brinker
Das Durchschnittsalter bei Gründern liegt in Deutschland derzeit bei 32 Jahren. Jetzt könnte man keck die Frage stellen, warum das Alter nicht jünger ist. So einfach lässt sich das natürlich nicht beantworten. Aber ein Grund dafür könnte sicherlich sein, dass in Deutschland das Thema Gründen nicht wirklich gefördert wird und eher immer noch als Risiko gilt. Doch zum Glück gibt es Projekte und Initiativen, die den Gründergeist bei den Jüngeren fördern. Ein solches Projekt stellt in dieser Folge des Citizen Circle on Air Podcast Jan Brinker vor. Jan ist Teil des Projektes Next Entrepreneurs, das an Schulen Jugendlichen das Thema Gründen näher bringt. LEARNINGS: Wie der Tag als Entwickler aussieht Warum eine Spezialisierung mehr bringt Warum Kommunikation für einen Entwickler extrem wichtig ist Warum man als Unternehmer oder Unternehmen eine eigene App braucht Wieviel Budget man für eine App benötigt Warum er sich entschlossen hat als Freiberufler zu arbeiten Wie er mit Next Entrepreneurs in Schulen geht, um Jugendlichen das Thema Unternehmertum näher zu bringen Wie sich das Projekt finanziert Wie Schulen auf das Projekt aufmerksam werden Auf was für Ideen die Jugendlichen kommen Wie man mit den richtigen Fragen motivieren kann Hat Jan sich schon immer engagiert Warum wird das Projekt begleitet wird, durch das Sicherheitsdenken der Eltern ALLE LINKS ZU JAN: Jans Webseite Projekt Next Entrepreneurs
Das Durchschnittsalter bei Schlaganfällen liegt bei ungefähr 69 Jahren, doch immer stetiger steigt die Zahl der Menschen, die weit aus früher einen solchen Anfall erleiden. Zu diesen Menschen zählt auch der 17 Jährige Daniel, der mit 14 Jahren bereits zwei Schlaganfälle hinter sich brachte. Er erzählt uns, wie er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmte, er klärt uns auf was ein Schlaganfall eigentlich ist und wann man sich Sorgen machen muss.
Histologische Untersuchungen an Glaukom erkrankten Pferdeaugen
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Hintergrund: Die Glaukomerkrankung beim Pferd ist ein seltenes Erscheinungsbild mit vorsichtiger Prognose für den Bulbuserhalt. Die Therapie erfordert zudem einen finanziellen Aufwand, der mit dem Langzeitergebnis nicht immer zu rechtfertigen ist. Um neue Erkenntnisse zu dieser Erkrankung zu erlangen, wurden 60 Pferdebulbi untersucht, die von augengesunden, an Glaukom und an der equinen rezidivierenden Uveitis (ERU) erkrankten Tieren stammten. Fragestellung: Es war bekannt, dass am Ziliarkörper (ZK), dem Ort der Kammer-wasserproduktion, und der Blut-Kammerwasserschranke im Zuge der ERU Amy-loidablagerungen entstehen. Da die Glaukomerkrankung als Sekundärfolge einer ERU auftreten kann, die Augen im Endstadium der ERU jedoch zumeist atrophieren, sollten Bulbi, die am Glaukom erkrankt waren, gezielt im Bereich des ziliaren Spalts (ZS) auf Amyloid untersucht werden. Hierbei wurde die Rasse Appaloosa aufgrund der erhöhten Prävalenz ein Glaukom zu entwickeln separat betrachtet. Patienten und Methode: Insgesamt wurden 60 Augen untersucht. 47 waren an einem Glaukom erkrankt. Eingeteilt wurde nach Anamnese und intraokularer Leptospirennachweis: 20 Augen waren zuvor an einer Leptospiren induzierten ERU erkrankt, in 22 Augen wurde alleine das Glaukom diagnostiziert ohne Hin-weis auf eine intraokulare Leptospireninfektion. 5 Augen mit Glaukom stammten von insgesamt 7 Augen der Appaloosas, ohne bekannten Leptospirentiter. Zum Vergleich standen 6 Augen mit chronischer ERU und 5 gesunde Augen zur Verfügung. Das Durchschnittsalter der Tiere war bei Enukleation 15,4 ± 4,7 Jahre (7 – 24 Jahre) und 10 verschiedene Rassen waren in den Gruppen vertreten. Alle Augen wurden direkt nach Entnahme in 7 % Formalin gelegt und nach der Fixie-rung wurde von jedem Auge aus 4 Quadranten (dorsal/ ventral/ nasal/ temporal) 5 mm breite Proben entnommen. Die Gewebeproben wurden eingebettet und nach dem Schneiden mit Hämatoxilin/Eosin und Sirirus Rot (SR) gefärbt. Amyloidvorkommen wurde in Anlehnung des isoprismatischen, nichtpigmentierten ZK- Epithel bewertet: 0 (kein Amyloid) bis 3 (drei oder mehr Schichten). Die Auswertung fand mittels Lichtmikroskop und polarisiertem Licht statt. Ein Teil der Präparate, die SR positiv getestet worden waren, wurden zusätzlich mittels Immunohistochemie auf Amyloid A und Amyloid L untersucht. Ergebnis: Bei 49 von 55 erkrankten Augen war eine Amyloidablagerung im Auge vorhanden. In den augengesunden Bulbi war weder Amyloid auf dem ZK noch im ZS vorhanden. Augen die am Glaukom erkrankt waren und einen intraokularen Leptospiren positiven Befund aufwiesen, hatten mehr Amyloidablagerungen (19/20: ZK = 2/3/3/3; ZS = 3/3/3/3) als Glaukomaugen ohne intraokulare Leptospireninfektion (18/22: ZK = 1/1/2/1) (17/22: ZS = 2/2/2/2). In allen Augen von Appaloosas konnte Amyloid gefunden werden (7/7: ZK = 2/3/3/3), hingegen war im ZS kaum Amyloid vorhanden (5/7: ZS = 0/1/0/0). Auch bei den chronischen ERU Augen waren hochgradige Amyloidablagerungen auf dem ZK nachweisbar (5/6: ZK = 2/2/3/1), hingegen im ZS kaum vorhanden (2/6: ZS = 0/1/0/0). Zusätzlich konnten Amyloidablagerungen vor dem Ligamentum pectinatum, entlang der Iris, in Gefäßwänden und im Hornhautstroma und dessen Epithel gefunden werden. Zwei von fünf am Glaukom erkrankte Augen der Rasse Appaloosa hatten geringgradige Amyloidablagerungen im ZS, aber in allen Augen dieser Rasse konnten massive Amyloidablagerungen auf dem ZK gefunden werden. Die meisten Ablagerungen waren im ventralen und nasalen Augenabschnitt zu finden, hier konnten auch weniger Entzündungszellen nachgewiesen werden. In allen 13 immunhistologisch untersuchten Augen konnte Amyloid A und in allen zusätzlich auf Amyloid L untersuchten Augen (n = 5) detektiert werden. Schlussfolgerung: Chronische ERU führt zu Phthisis mit Amyloidablagerungen auf dem Ziliarkörper. Hingegen werden beim Glaukom, mit oder ohne vorherge-hender Leptospireninfektion, neben Amyloidablagerungen auf dem ZK auch diese im ZS gefunden. Die hier vorliegende erstmalige Beschreibung von Amyloid A & L im ZS von an Glaukom erkrankten Augen von Pferden könnte eine Ursache für die Kammerwasserabflussstörung darstellen. Auch konnte gezeigt werden, dass Amyloid sedimentiert und eine vermehrte Ablagerung im Zusammenhang mit Linsenveränderungen festzustellen war. War die Linse subluxiert, so kam es offenbar zu einer lokalen Irritation des ZK in deren Richtung die Linse verrutscht war. An dieser Stelle konnte mehr Amyloid gefunden werden, als an den anderen Stellen des ZK. Weitere Studien sind notwendig um den genauen Mechanismus und die Bedeutung im Zusammenhang mit der Glaukom Entstehung und etwaigen Therapiemöglichkeiten zu verstehen.
Langfristige Ergebnisse nach Revisionsoperationen in der Hüftendoprothetik
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Im Zeitraum von Januar 1987 bis Dezember 1992 wurden in der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinikum Großhadern, 181 Hüftprothesenwechseloperationen durchgeführt. Nachuntersucht werden konnten 107 Patienten, die anderen Patienten waren verstorben, unbekannt verzogen, nicht bereit oder nicht in der Lage sich untersuchen zu lassen. In 55 Fällen (51,4 %) wurde ein kompletter Prothesenwechsel vollzogen, in 38 Fällen (35,5 %) wurde nur die Pfanne gewechselt und in 14 Fällen (13,1 %) nur der Schaft. Von den 107 Patienten konnten im Rahmen der Studie 61 Patienten von uns klinisch nachuntersucht werden und von 46 Patienten konnten subjektive Daten mittels eines dem behandelnden Orthopäden zugesandten Fragebogens oder einer Telephonbefragung erhoben werden. Der Zeitraum zwischen der Wechseloperation und der Nachuntersuchung bzw. die Prothesenstandzeit begrenzenden Ereignis (follow up) betrug im Durchschnitt 88,7 Monate bei einer Spanne zwischen 36 Monaten und 168 Monaten. Das Durchschnittsalter der 67 weiblichen und 40 männlichen Patienten betrug zum Operationszeitraum 63,5 Jahre, wobei die jüngste Patientin 36 Jahre, die älteste 87 Jahre alt waren. Es zeigten sich bis auf die bei Revisionen zu erwartenden Knochenlagerkomplikationen kaum intraoperative Probleme. An intraoperativen Komplikationen traten in 25 Fällen Fissuren des Femurs oder Trochanterabrisse auf. Die Hauptkomplikation, die postoperative Luxationshäufigkeit, betrug 16,8 %. Bis auf eine konnten die Luxationen unblutig reponiert werden. Die Nervenschädigungen lagen mit 3,7 % über der in der Literatur beschriebenen 1 %, aber bis auf 1 Fall (0,9 %) waren sie nur von temporärer Dauer und erholten sich komplett. Der MEAN-HARRIS-HIP-SCORE kann bei Revisionsoperationen aufgrund der überwiegend schlechteren Ausgangsbedingungen nicht mit den von Primärimplantationen verglichen werden. Er erfordert eine eigene Interpretation, solange es keinen speziellen „Revisionsbewertungsscore“ gibt. In dem MHHS ergaben sich in 13,1 % der Fälle „sehr gute“, in 28 % „gute“, in 15,9 % „zufriedenstellende“ Ergebnisse. 43 % der Fälle mussten als „ungenügend“ klassifiziert werden, obwohl alle Patienten rechnerisch eine höhere Punktzahl und auch in den meisten Fällen ein individuell besseres Ergebnis als präoperativ erreichten. Zur Auswertung der Op-Zufriedenheit erfolgt noch die Beurteilung in einem subjektiv ausgerichteten Score (Score nach Merle d’Aubigne und Postel). Hier zeigte sich ein „very good“ in 72,9 % und ein „good“ in 7,5 % der Fälle und gibt somit die Zufriedenheit der Patienten mit dem Revisionsergebnis subjektiv wieder. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Lockerungsrate von der Qualität des acetabulären und femoralen Knochenlagers abhängt. Zunehmende Knochenlagerdefekte verschlechtern die Ausgangssituation der Revision und somit auch die Ergebnisse der Reoperation. Bei unseren Patienten mit einem höhergradigen acetabulären Knochensubstanzverlust zeigte sich im Beobachtungszeitraum von 60 Monaten in 20 % der Fälle eine Lockerung im Vergleich zu 11,5-13,5 % bei einem mäßigen bis schweren Knochenverlust. Hinsichtlich des femoralen Knochenlagerdefektes zeigte sich eine 83,3 – 100%ige 5-Jahres-Überlebenszeit bei Wahl des richtigen Schaftverankerungsprofiles trotz vorhandener Knochendefekte. Insgesamt lag die erneute Revisionsrate im vorliegenden Patientengut bei 22,4 % nach 60 Monaten und damit im mittleren Bereich im Vergleich zur Literatur. Unterschieden nach Art der Implantationsverfahren, zementfrei oder zementiert, lag die Lockerungsrate aber jeweils im mittleren Bereich. Dieses gibt zu bedenken, dass die Schraubpfanne „München“ bei Patienten mit hochgradigem Acetabulumdefekt einer genauen Implantationsprüfung zu unterziehen ist. Aufgrund unserer Ergebnisse ist in diesem Fall die „Slooff-Technik“ vorzuziehen, welche eine 5-Jahres-ÜLR von 100 % aufwies. Bei der radiologischen Beurteilung der Prothesen bzw. des Prothesenlagers haben sich die Standardaufnehmen (Beckenübersicht und Hüfte streng axial) bewährt, die eine weitgehend überlagerungsfreie Darstellung der Pfanne ermöglichen. Ein schmaler Sklerosesaum von bis zu 2 mm um den Implantatschaft war bei 63 % der Patienten zu sehen, um die Implantatpfanne bei 79 % der Patienten, wobei nur bei 3 Patienten die Indikation zur Revision bestand. Die Mehrzahl der zementfreien Pfannen wiesen eine Saumbildung lediglich am Pfannenboden (DeLee-Zone 2) auf, die zementierten Pfannen in den Randbereichen. Die Säume im Schaftbereich verteilen sich unregelmäßig um den Schaft. Die Überlebenszeitanalyse der Implantate bzw. der Implantattechniken nach der Kaplan-Meier-Methode konnte aufgrund der zu geringen Patientenzahl und Lockerungen nur deskriptiv interpretiert werden und zeigte eine 5-Jahres-ÜLR bei den zementfreien Pfannen von 88 %, bei den zementierten Pfannen von 73,7 % und mittels der Slooff-Technik von 100 %. Bei den zementfreien Schäften zeigte sich eine 5-Jahres-ÜLR von 90 % und bei den zementierten Schäften von 95,6 %, welche aber im Verlauf der nächsten Jahre, im Vergleich zu den zementfreien Schäften, dann stark rückläufig war. Einen signifikanten Einfluss auf die Prothesenstandzeit (60 Monate) hat nur die Verankerungstechnik der Pfanne. Das Patientenalter, das Geschlecht, die betroffene Seite, die vorausgegangenen Wechseloperationen, die Verankerungstechnik des Schaftes und der Knochensubstanzverlust haben im Chi-qudrat-Test oder Fisher´s-Exact-Test keinen signifikanten Einfluss auf die Prothesenstandzeit. Eine mögliche Ursache für diese Ergebnisse sehen wir in der niedrigen Fallzahl der Untergruppen. Als Ergebnis der klinischen und radiologischen Nachuntersuchung in dieser Studie treffen wir die Aussage, dass die Auswahl des Revisionsimplantates und die Implantationstechnik die entscheidenden Komponenten für eine erfolgreiche Wechseloperation darstellen.
00:10 Begrüßung zur neuen Episode 00:28 Themenvorstellung – Gesundheit als wichtiges Zukunftsthema. – Das Durchschnittsalter steigt, deshalb überlegen bereits jetzt schon viele Einrichtungen und Unternehmen wie sie sich für die Entwicklung „fit“ machen können. Dafür bietet das Bildungsforum einen besonderen Lehrgang an – der Seniorencoach. 01:13 Studiogast Petra Lampersberger Warum steigt die Nachfrage nach Seniorencoaches? Wo kann man diesen Beruf ausüben? Was genau macht ein Seniorencoach? Diese und weiter wichtige Fragen zu diesem spannenden Thema wird Ihnen diese Episode beantworten. 10:01 Danksagung und Verabschiedung Feedback und weitere Informationen unter www.bildungsforum.at / www.bildungsforum.de oder podcast@bildungsforum.at
00:10 Begrüßung zur neuen Episode 00:28 Themenvorstellung – Gesundheit als wichtiges Zukunftsthema. – Das Durchschnittsalter steigt, deshalb überlegen bereits jetzt schon viele Einrichtungen und Unternehmen wie sie sich für die Entwicklung „fit“ machen können. Dafür bietet das Bildungsforum einen besonderen Lehrgang an – der Seniorencoach. 01:13 Studiogast Petra Lampersberger Warum steigt die Nachfrage nach Seniorencoaches? Wo kann man diesen Beruf ausüben? Was genau macht ein Seniorencoach? Diese und weiter wichtige Fragen zu diesem spannenden Thema wird Ihnen diese Episode beantworten. 10:01 Danksagung und Verabschiedung Feedback und weitere Informationen unter www.bildungsforum.at / www.bildungsforum.de oder podcast@bildungsforum.at
Ergebnisse der Hysteroskopie in Korrelation zum histologischen Befund der Abrasio fracta bei 838 Untersuchungen der Universtiäts-Frauenklinik-München im Zeitraum von 1995 bis 1998.
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
In dieser Arbeit wurden 838 Hysteroskopieberichte der Universitäts-Frauenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München aus den Jahren 1995 bis 1998 ausgewertet. Das Durchschnittsalter der Patientinnen lag bei 53 bis 55 Jahren. Die hysteroskopischen Befunde wurden mit den histologischen Ergebnissen der Abrasio fracta verglichen. Häufigste Indikation zur Untersuchung war die postmenopausale Blutung (34% der Fälle), gefolgt von prä/perimenopausaler Bltung (26%), einem sonographisch suspekten Endometrium und anderen Indikationen. Hysteroskopisch fand sich in 40% (336 Fälle) ein unauffälliges Endometrium. Bei diesem Befund fanden sich in 2% (6 Fälle) histologisch Karzinome. Korpuspolypen und polypöse Schleimhautveränderungen wurden hysteroskopisch in 21% (174 Fälle) diagnostiziert, davon waren histologisch 7% (12 Fälle) maligne. Bei anderen makroskopisch als gutartig klassifizierten Befunden (126 Fälle) fand sich in 3% (4 Fälle) ein bösartiger Tumor. Das wichtigste hysteroskopische Ergebnis war ein „suspektes Endometrium bzw.unklare Veränderungen“ (7%, 55 Fälle). Hier fanden sich histologisch 14 Endometrium-Karzinome und 6 Karzinome anderer Art (36% maligne Befunde). Bei Patientinnen mit postmenopausaler Blutung konnte man in 9% (25/285) ein Endometrium-Karzinom und in 1% (4/285) ein anderes Karzinom nachweisen, Die Häufigkeit nachgewiesener Tumoren bei prä/perimenopaualer Blutung war mit 1% (2/220) deutlich niedriger. 55 Fälle des Krankengutes hatten wegen eines Mamma-Karzinoms Tamoxifen bekommen. Bei diesen Patientinnen wurde die Hysteroskopie besonders häufig wegen eines sonographisch verdickten Endometriums durchgeführt. In jedoch nur 1% (1/55) wurde bei zusätzlich postmenopausaler Blutung ein Endometrium-Karzinom verifiziert.
Belastung von angekauften Diensthunden durch die Haltung und die Grundausbildung im Schutzdienst
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/07
Die Studie wurde an 35 Hunden der Quarantänestation der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr durchgeführt. Die Hunde wurden bei der Ankaufsuntersuchung und während der anschließenden 4-wöchigen Grundausbildung in der Quarantänestation untersucht. Bei der Ankaufsuntersuchung wurden die Körpertemperatur und das Körpergewicht gemessen, das Zahnalter der Hunde bestimmt sowie eine Blutprobe zur Bestimmung hämatologischer und klinisch-chemischer Parameter genommen. Während des 4-wöchigen Aufenthaltes in der Quarantänestation wurden täglich eine Kotproben zur Bestimmung der Kortisolmetaboliten eingesammelt, einmal wöchentlich das Gewicht bestimmt und über die gesamte 1. und 4. Woche die Bewegungsaktivität der Hunde mit Hilfe von Bewegungsmonitoren (ActiTrac, SomnoMedics®) aufgezeichnet. Zusätzlich wurden die Hunde während einer Schutzdienstübungseinheit in der 1. Woche (Übung A) und in der 4. Woche (Übung B) untersucht. Der Untersuchungsaufbau war in der Übung A und B identisch. Jede Schutzdienstübung bestand aus einer 20-minütigen Ruhephase, gefolgt von einer 3-minütigen Schutzdienstübung (= Belastungsphase) und einer anschließenden 60-minütigen Erholungsphase. Während der beiden Übungen wurde die Herzfrequenz mit Sportuhren (Polar, S610i®) und die Aktivität mit Bewegungsmonitoren (ActiTrac, SomnoMedics®) kontinuierlich aufgezeichnet. Die Körpertemperatur sowie die Speichel-Kortisolkonzentration wurde an 6 Messzeitpunkten bestimmt (T1 = vor der Ruhephase, T2 = unmittelbar vor der Belastungsphase, T3 = unmittelbar nach der Belastungsphase, T4 = nach 20 Minuten Erholung, T5 = nach 40 min Erholung, T6 = nach 60 Minuten Erholung). An drei Messzeitpunkten (T2, T3, T6) wurde eine Blutprobe genommen und folgende Parameter bestimmt: Serum-Kortisol, weißes und rotes Blutbild, Laktat, Kreatinkinase, Harnstoff, Kreatinin, Glukose, Alanin-Amino-Transferase, Aspartat-Amino-Transferase und Alkalische-Phosphatase. Das Durchschnittsalter der untersuchten Hunde lag bei 20,5 Monaten. 15 Hunde gehörten dem Rassetypus Belgischer Hütehund, 18 dem Rassetypus Deutscher Schäferhund und 2 dem Rassetypus Rottweiler an. 23 waren Rüden und 12 Hündinnen. Sieben Hunde erwiesen sich nach 1 - 2 Wochen der Grundausbildung als ungeeignet für den Dienst bei der Bundeswehr und wurden ausgemustert. Zur Auswertung der Daten wurden die Hunde in 2 Gruppen unterteilt. In die Gruppe der erfolgreichen Hunde (n = 28) und die der ausgeschiedenen Hunde (n = 7). Die Ruhe-Herzfrequenz (Referenzbereich: 70 - 100 bpm) in der Schutzdienstübung A und B lag bei durchschnittlich 121 bzw. 124 bpm und stieg während der 3-minütigen Belastungsphase signifikant (p≤ 0,001) auf durchschnittlich 154 bzw. 156 bpm an. In der Erholungsphase fiel die Herzfrequenz signifikant ab und erreichte nach 40 Minuten die Ruhe-Herzfrequenz. Die Herzfrequenz der gesamten Ruhe- und Erholungsphase der Schutzdienstübung A lag signifikant (p≤ 0,05) über der Herzfrequenz der Ruhe- und Erholungsphase der Schutzdienstübung B. Die Aktivität der Hunde stieg während der 3-minütigen Belastungsphase der Schutzdienstübung A auf durchschnittlich 296 mG und lag damit signifikant (p≤ 0,001) unter der Belastungsaktivität während der Schutzdienstübung B mit 348 mG. Die Körpertemperatur (Referenzbereich: 37,5 - 39,0°C) lag nach der Ruhephase in beiden Schutzdienstübungen bei 39,0 - 39,2°C. Nach der 3-minütigen Belastungsphase stieg die Körpertemperatur auf Werte zwischen 39,8°C und 40,1°C an und erreichte die Ruhewerte 40 Minuten nach Belastungsende. Die Körpertemperatur der Schutzdienstübung A lag über alle 6 Messzeitpunkte gesehen signifikant (p≤ 0,001) über den Werten der Schutzdienstübung B. Die Speichel-Kortisolkonzentration zeigte nach der 3-minütigen Belastungsphase einen signifikanten (p≤ 0,01) Anstieg und erreichte die höchsten Werte mit 8,9 nmol/l (Übung A) bzw. 9,3 nmol/l (Übung B) 20 – 40 Minuten nach Ende der Belastung. Die Kortisolkonzentration im Serum zeigte keine signifikante Veränderung zwischen den 3 Messzeitpunkten. Im Verlauf der Schutzdienstübung A und B kam es bei den untersuchten Parametern des weißen und roten Blutbildes zu einem signifikanten Anstieg nach der 3-minütigen Belastungsphase und zu einem Abfall auf den Ausgangswert nach der 60-minütigen Erholungsphase. Die Muskelparameter Laktat und Kreatinkinase zeigten nach der 3-minütigen Belastungsphase in beiden Schutzdienstübungen einen signifikanten Anstieg. Die Laktatkonzentration erreichte 4,0 mmol/l (Referenzbereich: 0,2 - 2,9 mmol/l) und fiel nach 60 Minuten wieder auf den Ausgangswert. Die Kreatinkinase war nach der 60-minütigen Erholung weiter angestiegen und erreichte Werte zwischen 151,6 und 183,5 IU/l (Referenzbereich: bis 460 IU/l). Die Konzentration der Kreatinkinase lag im Verlauf der Schutzdienstübung A signifikant über der Konzentration der Schutzdienstübung B. Die Veränderungen in den Konzentrationen von Harnstoff, Kreatinin, Glukose und den Leberwerten Alanin-Amino-Transferase, Aspartat-Amino-Transferase und Alkalische Phosphatase lagen durchweg in den angegebenen Referenzbereichen der einzelnen Parameter. Über den gesamten 4-wöchigen Aufenthalt in der Quarantänestation zeigte die IgG-Konzentration (Referenzbereich: 9,3 – 14,5 mg/ml) von der Ankaufsuntersuchung (14,5 mg/ml) über die 1. Woche (16,7 mg/ml) zur 4. Woche (18,0 mg/ml) einen kontinuierlichen Anstieg. Die Kortisolmetaboliten im Kot zeigten einen kontinuierlichen Abfall in der Konzentration von der 1. (17,6 ng/g) bis zur 4. Woche (11,1 ng/g). Das Körpergewicht fiel während der 4 Wochen um durchschnittlich 0,9 kg. Die Konsistenz der Kotproben wurde zu 4,8 % als geformt, zu 85,0 % als weich, zu 5,3 % als breiig und zu 5,0 % als wässrig eingestuft. Die Bewegungsaktivität während des „Freilaufs“ in der 1. Woche lag bei durchschnittlich 146 mG und während der „Arbeit“ bei 50 mG. Die entsprechenden Bewegungsaktivitäten in der 4. Woche lagen signifikant (p≤ 0,05) höher. Als weitere Einflussfaktoren auf die untersuchten Parameter erwiesen sich das Geschlecht und die Rasse. Die Rüden hatten sowohl in der Ruhe als auch in der Erholung der Schutzdienstübung B und in der 1. und 4. Woche während des „Freilaufs“ sowie in der 4. Woche während der „Arbeit“ signifikant höhere Aktivitätswerte als die Hündinnen. Außerdem hatten die männlichen Hunde in der Schutzdienstübung A signifikant höhere Körpertemperaturen. Dagegen zeigten die Hündinnen im roten Blutbild (Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit) signifikant höhere Werte. Die Belgischen Hütehunde zeigten bei der Herzfrequenz der Ruhe und Erholung in der Schutzdienstübung A, bei der Aktivität in der 1. und 4. Woche während des Freilaufs und der Fütterung sowie in der 4. Woche während der Arbeitszeit und bei den Kortisolmetaboliten im Kot signifikant höhere Werte als die Deutschen Schäferhunde. Die 7 aus der Ausbildung ausgeschiedenen Hunde unterschieden sich durch eine signifikant (p≤ 0,05) niedrigere Ruhe- und Erholungsherzfrequenz in der Schutzdienstübung A, eine signifikant (p≤ 0,01) niedrigere Körpertemperatur zum Zeitpunkt der Ankaufsuntersuchung und eine signifikant (p≤ 0,01) höhere Erythrozytenzahl, Hämoglobinkonzentration und einen höheren Hämatokritwert während der Schutzdienstübung A. In dieser Studie konnte eine deutliche Belastung der Hunde durch den 4-wöchigen Quarantäneaufenthalt und in der Ausbildung im Schutzdienst festgestellt werden. Die Hauptbelastung konnte mit Hilfe der untersuchten Parameter auf den Zwingeraufenthalt in fremder Umgebung zurückgeführt werden. Die täglichen Schutzdienstübungen erwiesen sich als submaximale Belastung, die eher als „Ventil“ für die angestaute Energie der Hunde wirkten.
Schädelmorphologie philippinischer und deutscher Probanden mit Angle-Klasse-1-Okklusion: Eine kephalometrische Studie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Die Aufgaben den vorliegenden Studie sind: 1) Bestimmung der kephalometrischen Normen der philippinischen Probanden mit Angle-Klasse-1-Okklusion in bleibenden Gebiss, 2) Herstellung der philippinischen Harmoniebox, 3) Vergleich der philippinischen Harmoniebox und dortige Normen mit bestehenden deutschen. 81 philippinische Probanden, von denen 44 männlich und 37 weiblich, wurden von den Studenten der Universität Manila Central nach folgenden Kriterien ausgewählt: 1) 100% philippinische Abstammung, bis zu Generation der Ur-Großeltern nachvollziehbar, 2) akzeptables Gesichtsprofil und Gesichtssymmetrie, 3) Angle-Klasse-1 Okklusion ohne Engstand, 4) alle Zähne ohne Berücksichtigung der Weisheitszähne angelegt, 5) keine kieferorthopädische Vorbehandlung. Klinische Untersuchung und Interview wurden durchgeführt, um sicher zu sein, dass alle Kriterien erfüllt wurden. Die deutschen Probanden, 78 männlich und 123 weiblich wurden aus Hamburg und München ausgewählt. Das Durchschnittsalter beider Gruppen betrug 18 Jahre. Die Fernröntgenseitenbilder wurden von einer Person auf Acetatfolie mit einem Bleistift durchgezeichnet. Alle kephalometrischen Referenzpunkte wurden nach Hasunds[31] Methode identifiziert und markiert. Alle relevanten Winkel und Strecken wurden mit dem Computerauswertungsprogramm, DiagnoseFix (Dr. Jörg Wingberg, Diagnostik Wingberg GmbH, Buxtehude, Germany) gemessen. Diese Daten wurden mit bestehenden deutschen Normen verglichen. Die vergleichende Untersuchung erfolgte durch Darstellung der Hauptmesswerte in dafür neu erstellten Harmonieboxen, die auf der Basis der Harmoniebox von Segner und Hasund[71] entwickelt wurden, desgleichen die statische Auswertung (student’s t-test), und die kephalometrische Überlagerung. Ein hoch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen wurde für das untere Gesichtsdrittel gefunden. Die skelettale Morphologie bei philippinischen Probanden wurde charakterisiert durch die posteriore Inklination der apikale Basis mit einem kleineren Kinn. Die dentale Morphologie bei philippinischen Probanden wurde charakterisiert durch die bimaxilläre Protrusion der Incisivi. Das Gesichtsprofil bei philippinischen Probanden zeigt eine Konvexität im Vergleich mit den deutschen Probanden. Die vorangegangenen Befunde lassen vermuten, dass ein ethnischer Unterschied bei den Gesichtsstrukturen existiert. Diese Entdeckungen zeigen, dass die zusammengesetzten kephalometrischen Normen aus einer ethnischen Gruppe kein korrektes Gesichtsmuster für eine andere ethnische Gruppe erbringen.
Klinische und radiologische Ergebnisse modularer unzementierter trikompartimentärer Kniegelenksendoprothetik im Vergleich zwischen posttraumatischen und nicht posttraumatischen Gonarthrosen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Von 1994 bis 2000 wurden an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau 243 Patienten mit einer unzementierten Kniegelenktotalendoprothese (TKA) Typ „Motus“ versorgt. Hiervon konnten insgesamt 197 implantierte Kniegelenke bei 188 Patienten nachuntersucht werden. Der Anteil posttraumatischer Gonarthrosen (PGA) betrug 47,2% (n=93), der Anteil nicht posttraumatischer Gonarthrosen (IGA/RA) 52,8% (n=104). Diese beiden annähernd gleich großen Kollektive wurden bezüglich ihrer präoperativen Voraussetzungen und postoperativen Ergebnisse miteinander verglichen. Epidemiologische Unterschiede konnten v.a. in der Alters- und Geschlechtsverteilung beider Kollektive festgestellt werden. Das Durchschnittsalter im PGA-Kollektiv betrug 56,3 Jahre, das Durchschnittsalter im NPA-Kollektiv hingegen 70,1 Jahre. Bezüglich der Geschlechtsverteilung zeigt sich ein für TKA–Implantation untypisches Geschlechterverhältnis im PGA-Kollektiv mit hohem Männeranteil (w:m = 1:2,3) im Vergleich zum IGA/RA-Kollektiv mit einer im Literaturvergleich charakteristischen Geschlechterverteilung (m:w = 1:0,6). Die Verletzungsmuster, welche zur posttraumatischen Gonarthrose und damit zur Indikation der TKA im PGA-Kollektiv führten, waren v.a. kniegelenksnahe Frakturen und Kniegelenksbinnenverletzungen mit konsekutiver Instabilität. Aufgrund der Primärverletzungen im PGA-Kollektiv war in dieser Gruppe eine höhere Anzahl an operativen Eingriffen vor Prothesenimplantation im Vergleich zur IGA/RA Gruppe im Verhältnis von ca. 6:1 festzustellen (PGA:2.5 vs. IGA/RA: 0,4). Der Nachuntersuchungszeitraum betrug im Mittel 36,4 Monate (9 – 62 Monate). Der Zeitraum zwischen Primärtrauma und Implantation der Totalendoprothese in der PGA-Gruppe betrug im Mittel 14 Jahre. Zur Erlangung der Ergebnisse wurde folgende ausgiebige prä- und postoperative Diagnostik durchgeführt: · Patientenerhebungsbogen mit Selbstauskunft über allgemeine Zufriedenheit, Schmerzen, Gehfähigkeit, Beweglichkeit, Wiederholungsbereitschaft, Hilfsmittel, berufliche Situation · Klinische Evaluierung mittels „Knee Society Clinical Rating Score” mit Scoring von Schmerz, Bewegungsumfang, Stabilität, Gehstrecke, Treppensteigen · standardisierte radiologische Diagnostik mit Kniegelenk a.p. und stl, Patella tangential und b.B. CT-Diagnostik und Ganzbeinaufnahmen Das operative Vorgehen war standardisiert mit unzementierte Implantationstechnik, Erhalt des hinteren Kreuzbandes und generellem Patellarückflächenersatz. In den meisten oben beschriebenen Parametern zeigte sich eine deutliche Verbesserung von prä- zu postoperativem Zustand sowohl im PGA, als auch im IGA/RA-Kollektiv. Im interkollektiven Vergleich zeigten sich überwiegend bessere Ergebnisse im IGA/RA-Kollektiv. Diese Gruppe konnte insgesamt besser von der TKA-Implantation profitieren als die PGA-Vergleichsgruppe. Diese Aussage zeigt sich sowohl durch die subjektiven Patientenangaben, als auch durch die Knee-Score-Befunde und radiologischen Nachuntersuchungsbefunde. Dies deckt sich auch mit der Häufigkeit des Auftretens postoperativer Komplikationen. Diese traten im PGA-Kollektiv in einer Häufigkeit von 26,9%, im IGA/RA-Kollektiv hingegen nur mit einem Anteil von 16,3% auf. Im wesentlichen zu nennen sind hier Gelenkinfektionen, postoperative Bewegungseinschränkung, Thrombose und Embolie und Wundheilungsstörungen. Trotz diesen im Vergleich zum IGA/RA-Kollektiv insgesamt schlechteren Ergebnissen im PGA-Kollektiv ist die Wiederholungsbereitschaft in beiden Kollektiven annähernd gleich groß (PGA:86% vs. IGA/RA:87,5%) Die berufliche Wiedereingliederung im PGA-Kollektiv war zu 25,8% , im IGA/RA-Kollektiv nur zu 7,7% möglich. Diese Werte sind jedoch durch das erheblich unterschiedliche Durchschnittslebensalter in beiden Kollektiven nicht unbedingt vergleichbar (PGA:56,3 Jahre vs. IGA/RA:70,1 Jahre). Die Krankenhausverweildauer ist in beiden Kollektiven höchst unterschiedlich (PGA:61 Tg. vs. IGA/RA:25 Tg.). Dies ist im Wesentlichen auf die häufiger auftretenden postoperativen Komplikationen mit der damit notwendigen längeren stationären Therapie zu erklären. Im Wissen dieser erhobenen Ergebnisse und Befunde sehen wir die Indikation zur Implantation einer TKA bei posttraumatischen Arthrosen auch beim jüngeren Menschen als gegeben. Diese sollte jedoch aufgrund oben beschriebener Besonderheiten und den wesentlich höheren Kosten, die damit verbunden sind, den dafür spezialisierten Zentren vorbehalten bleiben.