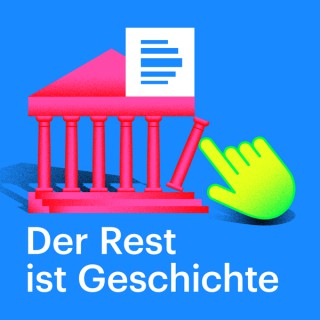Podcasts about kolonialmacht
- 84PODCASTS
- 110EPISODES
- 26mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Oct 28, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about kolonialmacht
Latest podcast episodes about kolonialmacht
Grönland und Dänemark - Koloniale Vergangenheit belastet das Verhältnis
Grönland ist geostrategisch attraktiv. Dänemark erhöht die Militärausgaben für die autonome Region. Doch das Verhältnis zur früheren Kolonialmacht ist angespannt, zuletzt durch einen Skandal um staatlich angeordnete Zwangsverhütung bei Inuit-Frauen. Sofie Donges, Michael Paul, Margarete Wohlan www.deutschlandfunkkultur.de, Weltzeit
Paulus "Ohm" Kruger: Ein Buren-Führer macht Weltgeschichte
Ein Hinterwäldler wird zum Nationalheld: Paulus Kruger, geb. am 10.10.1825, führt den Buren-Aufstand gegen die britische Kolonialmacht an - und prägt Südafrika bis heute. Von Wolfgang Meyer.
„Chinesen essen wirklich alles“ – so lautet eines der gängigsten Vorurteile. Mal wird die „gelbe Gefahr“ beschworen, mal ist davon die Rede, dass China die ganze Welt beherrschen wolle. Aber was ist dran an solchen Behauptungen? Jahrhundertelang rätselhaft und für Ausländer verschlossen ist China heute ein Globalplayer – politisch und wirtschaftlich. Und mit etwas mehr als 1,4 Milliarden Menschen nach Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde. Es waren die Portugiesen im 16. Jahrhundert, die zum ersten Mal an der Südküste in der Nähe des heutigen Kantons siedeln durften. Bis ins 19. Jahrhundert schottete China sich gegen Ausländer ab. Jesuiten waren eine der wenigen Ausnahmen, die ins Land kamen. Die Briten haben in der Mitte des 19. Jahrhunderts China gezwungen, sich zu öffnen. Mit den Opiumkriegen leitete die Kolonialmacht für China das „Jahrhundert der Demütigungen“ ein. Im 20. Jahrhundert folgte der Sturz der Monarchie, der Aufstieg der Kommunisten und der Wandel Chinas vom Agrarstaat zum Hightechland. Eine Podcastfolge über die Lehren des Konfuzius, den Krieg Maos gegen die Spatzen und die Frage: Hat Marco Polo wirklich die ersten Nudeln mit aus China nach Italien gebracht? Gesprächspartner*innen Hans van Ess Françoise Hauser Daniel Leese Debin Ma Klaus Mühlhahn Literatur Che Ruoshui: Jiaoqiji, Biaoji Xiaoshuo, Bd. 4, Rolle 7. Elliott, Mark C. (2009): Emperor Qianlong. Son of Heaven, Man oft he World. Library of World Biography. Haub, Rita u. Paul Oberholzer (2010): Matteo Ricci und der Kaiser von China. Jesuitenmissioni m Reich der Mitte. Echter Verlag, Würzburg. Häring, Volker u. Françoise Hauser (2019): China 151: Das riesige Reich der Mitte in 151 Momentaufnahmen. Conbook, Neuss. Leese, Daniel u. Shi, Ming (2023): Chinesisches Denken der Gegenwart. Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft, C.H. Beck Verlag, München. Ma, Debin (2022): The Cambridge Economic History of China, Cambridge University Press, Tokio/ Los Angeles. Mühlhahn, Klaus (2021): Geschichte des modernen China. Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart, C.H. Beck Verlag, München. Roetz, Heiner (2006): Konfuzius. C.H. Beck Verlag, München. Shelke, Christopher u. Mariella Demichele (Hg) (2010): Matteo Ricci in China. Inculturation Through Friendship and Faith. Greogorian & Biblical Press, Rome. “The Macaroni Journal”, October 1929: https://share.google/enDVhTYXZu1NH6U8j Van Ess, Hans (2023): Konfuzius Gespräche. C.H. Beck Verlag, München. Van Ess, Hans (2021): Chinesische Philosophie. Von Konfuzius bis zur Gegenwart. C.H. Beck Verlag, München. Wickert, Erwin (1997): John Rabe. Der gute Deutsche von Nanking. Deutsche Verlags-Anstalt DVA, München. Internetquellen https://spice.fsi.stanford.edu/docs/the_shang_dynasty_1600_to_1050_bce https://afe.easia.columbia.edu/special/china_general_lunar.htm?utm https://nationalgeographic.de/themen/menschen-und-kultur/2018/05/marco-polo-der-ewig-reisende/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352618116300828?.com https://www.diepresse.com/1354699/china-produziert-80-milliarden-wegwerf-staebchen-pro-jahr https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7451785/.com https://www.spiegel.de/wirtschaft/besteckabgabe-china-fuehrt-essstaebchen-steuer-ein-a-407459.html https://www.sueddeutsche.de/reise/chinesische-mauer-seit-25-jahren-welterbe-legendaer-lang-1.1544278 https://www.britannica.com/biography/Zheng-He https://msjabbar.weebly.com/uploads/1/3/4/7/13476668/zheng_he_aggressor_or_ambassador_documents.pdf https://www.unimc.it/en/about/unimission/ricci https://www.britannica.com/topic/Macartney-Embassy https://www.deutschlandfunk.de/japanische-gewaltorgie-in-china-100.html https://www.iwkoeln.de/studien/juergen-matthes-problematische-entwicklung-des-aussenhandels-mit-china-in-2025.html Mehr zum Thema in der ZDF-Mediathek https://www.zdf.de/dokus/china-die-neue-weltmacht-100 https://www.zdf.de/dokus/chinas-drachenkaiser-100 https://www.zdf.de/play/dokus/imperium-karten-der-macht-100/imperium-karten-der-ma
#169 | HANDEL, HERRSCHAFT & HENTAI: SAARLÄNDISCHE ZINSPOLITIK, TR NUN KOLONIALMACHT & BULLENMARKT AUF KI-ANIMEBILDER
Keine Anlageberatung, keine Marketingberatung und keine saarländische Zinsberatung!Heutige Teilnehmer:u/monchella420u/moulthu/Alpha3Ku/Far_Environment_7543
Kamina - Funkgeschichte zwischen Brandenburg und Togo
• Doku-Fiktion • Bevor die deutsche Kolonialmacht 1914 in Togo besiegt wird, zerstört sie ihre eigene Funkstation. Wohin heute mit den Ruinen? Mit den Dokumenten? Wer sendet, wer empfängt? Wer hält die Fäden der Geschichte in der Hand? Von Lene Albrecht www.deutschlandfunkkultur.de, Hörspiel
Endlich war es soweit: Der Dawes-Plan vom 16. August 1924 hatte sich als belastbar erwiesen, Deutschland sich an die dort neuausgehandelten Reparationsverpflichtungen gehalten, und Franzosen und Belgiern begannen daraufhin im Sommer 1925, vertragskonform, sich aus den von ihnen seit 1923 bzw. teilweise bereits seit 1921 besetzten Gebieten an Rhein und Ruhr zurückzuziehen. Die Bergedorfer Zeitung vom 21. Juli kommentierte es mit Genugtuung, aber nicht ohne den Besatzungsmächten noch ein paar böse Worte nachzurufen. Zum einen höhnte man, dass Paris die bislang in Deutschland gebundenen Truppen wohl äußerst dringend in Marokko benötigte, wo der Rifkrieg in ein für die französische Kolonialmacht sehr herausforderndes Stadium getreten war. Zum anderen ventilierte man die Idee, für entstandene Schäden in den besetzten Gebieten nun seinerseits Reparationen zu verlangen und diese mit den weiterhin ausstehenden deutschen Weltkriegsreparationen zu verrechnen. Es liest Rosa Leu.
Fremd in der Welt – Martin R. Dean über Herkunft und Identität
Der Schriftsteller Martin R. Dean erzählt im Roman «Tabak und Schokolade» seine tabuisierte Familiengeschichte: eine Geschichte des Kolonialismus, der Traumata, der Entwurzelung. Yves Bossart spricht mit ihm über verdrängte Vergangenheiten, über Rassismus und über das Fremdsein in der Welt. Martin R. Dean hat die ersten Jahre seines Lebens in der Karibik verbracht, in Trinidad und Tobago, der Heimat seines Vaters. Die Vorfahren des Vaters stammten aus Indien und wurden Mitte des 19. Jahrhunderts als «Kontraktarbeiter» unter sklavenähnlichen Bedingungen in die Karibik verschifft, um für die britische Kolonialmacht auf den Kakaoplantagen zu arbeiten. Deans Mutter stammt aus dem Aargau und war die Tochter von «Stumpenfabrikarbeitern», die den Tabak aus Übersee in Rauchware umformten. In Deans Familiengeschichte spiegelt sich ein Stück verdrängte Kolonialgeschichte. Seine Hautfarbe wurde schnell zum Tabu im konservativen Dorf. Was hat das mit ihm gemacht? Wie versöhnt man sich mit der eigenen traumatischen Vorgeschichte? Und wie lernt man, das Fremde als solches wertzuschätzen? Wiederholung vom 5. Januar 2025
Fremd in der Welt – Martin R. Dean über Herkunft und Identität
Der Schriftsteller Martin R. Dean erzählt im Roman «Tabak und Schokolade» seine tabuisierte Familiengeschichte: eine Geschichte des Kolonialismus, der Traumata, der Entwurzelung. Yves Bossart spricht mit ihm über verdrängte Vergangenheiten, über Rassismus und über das Fremdsein in der Welt. Martin R. Dean hat die ersten Jahre seines Lebens in der Karibik verbracht, in Trinidad und Tobago, der Heimat seines Vaters. Die Vorfahren des Vaters stammten aus Indien und wurden Mitte des 19. Jahrhunderts als «Kontraktarbeiter» unter sklavenähnlichen Bedingungen in die Karibik verschifft, um für die britische Kolonialmacht auf den Kakaoplantagen zu arbeiten. Deans Mutter stammt aus dem Aargau und war die Tochter von «Stumpenfabrikarbeitern», die den Tabak aus Übersee in Rauchware umformten. In Deans Familiengeschichte spiegelt sich ein Stück verdrängte Kolonialgeschichte. Seine Hautfarbe wurde schnell zum Tabu im konservativen Dorf. Was hat das mit ihm gemacht? Wie versöhnt man sich mit der eigenen traumatischen Vorgeschichte? Und wie lernt man, das Fremde als solches wertzuschätzen? Wiederholung vom 5. Januar 2025
Sie sind nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sie sind das Gedächtnis eines ganzen Volkes in Westafrika. Was sie genau zeigen, ist allerdings noch nicht vollständig entschlüsselt. Und nach einem Raubzug der britischen Kolonialmacht sind tausende Benin-Bronzen in der ganzen Welt verteilt. Wie soll die Rückgabe ablaufen? Autor: Linus Lüring (BR 2023)
Jahrzehntelang inszenierte sich Dänemark als gute und grosszügige Kolonialmacht in Grönland. Seit Frauen wie Hedvig Frederiksen ihre Geschichte erzählen, erhält dieses Bild mehr und mehr Risse. Gast: Linda Koponen, Nordeuropakorrespondentin Host: Simon Schaffer Die berührende[ Geschichte von Linda Koponen über Hedvig und die Spiralkampagne](https://www.nzz.ch/gesellschaft/spiralkampagne-in-groenland-die-dunkle-geschichte-der-kolonialmacht-daenemark-ld.1873141) in Grönland findet ihr bei der NZZ.
Teddybären für Terroristen – Warum Israelhass zum guten Ton gehört Es gehört heute zum guten Ton in vielen Redaktionen, NGOs und Universitäten zu betonen: Im Nahen Osten ist Israel die böse Kolonialmacht, die Hamas eine unterdrückte Befreiungsbewegung, und der Iran – na ja, der will halt auch nur respektiert werden. Wer diesen Kurs hinterfragt, stört die moralische Wohlfühlzone des Westens. Man muss nur „Israel“ sagen – schon explodieren die Postfächer mit Empörung. Wer heute noch wagt, den jüdischen Staat zu verteidigen, steht schnell als Menschenfeind da. Der Gesprächspartner bringt es nüchtern auf den Punkt: Antisemitismus heißt heute „Israelkritik“. Der Judenhass ist nicht weg – er hat sich nur ein neues Outfit übergezogen. Ein Gespräch mit Fritz Goergen darüber, wie der Westen seit 1968 mit jeder Bewegung kuschelt, die sich „Befreiung“ auf die Fahnen schreibt. Ob es sich dabei um Arafats Bombenleger, Ayatollahs Henkersknechte oder woke Straßenblockierer handelt, spielt keine Rolle. Hauptsache: Irgendjemand wird befreit. Wen und wovon, fragt schon keiner mehr. Die schlichte Regel: Wer gegen den Westen kämpft, ist automatisch gut. Hier ist der im Gespräch erwähnte Bericht über die Anfänge eines „Palästinenser-Staates“: „Als der SPIEGEL die Palästinenser erfand“: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/als-der-spiegel-die-palaestinenser-erfand/#google_vignette Webseite: https://www.tichyseinblick.de
Er erwähnte ihn bereits in seiner Antrittsrede: Donald Trump kündigte am 20. Januar an, den Mount Denali in Alaska wieder in Mount McKinley umzutaufen, benannt nach dem 25. US-Präsidenten. Diese Ankündigung betraf nicht nur die Geografie, sondern indizierte, was Trump vorhat in seiner zweiten Amtszeit.William McKinley, von 1897 bis 1901 im Weissen Haus, verfolgte eine imperiale Politik, die von territorialer Expansion geprägt war. Damals traten die USA in die Weltpolitik ein. McKinley baute die Seestreitkräfte aus und führte 1898 die USA in den Spanisch-Amerikanischen Krieg, den «splendid little war», den «herrlichen kleinen Krieg». Die Vereinigten Staaten besetzten unter McKinley ausserdem die Philippinen, Puerto Rico und Guam und annektierten das Königreich Hawaii, womit sie zu einer Kolonialmacht wurden. Was verbindet Donald Trump mit William McKinley? Ist Trump eine Figur aus dem 19. Jahrhundert, die gleichzeitig auf Bitcoins und künstliche Intelligenz setzt? Und was sind die Folgen für die amerikanische Aussenpolitik und den Rest der Welt, wenn sich der 47. US-Präsident am 25. orientiert? Darüber unterhält sich Christof Münger, Leiter des Ressorts International, mit Martin Kilian in Charlottesville, Virginia, in einer neuen Folge des USA-Podcasts «Alles klar, Amerika?».Produzent: Noah Fend Mehr USA-Berichterstattung finden Sie auf unserer Webseite und in den Apps. Den «Tages-Anzeiger» können Sie 3 Monate zum Preis von 1 Monat testen: tagiabo.ch.Feedback, Kritik und Fragen an: podcasts@tamedia.ch
Neuer Selbstwert dank Trump? Grönland erkennt sein geopolitisches Gewicht
Grönland ist reich an seltenen Erden und von großer Bedeutung für die militärische Kontrolle der Arktis. US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, seine territorialen Forderungen zu wiederholen. Was die Bevölkerung der riesigen Eisinsel wollen, interessiert ihn wenig. Bis jetzt hat er vor allem eines geschafft: Die Grönländer sind sich über die geopolitische Bedeutung ihrer Insel bewusster denn je.Ebbe Volquardsen ist Associate Professor für Kulturgeschichte an der Universität Grönlands. Er kennt sich aus mit der Kolonialgeschichte Grönlands, das heutzutage weitgehend autonom ist, offiziell aber zu Dänemark gehört. Trumps aktuelle Forderungen sind für ihn ein "Bruch des Selbstbestimmungsrechts" der grönländischen Bevölkerung. Grönland versuche, sich von der ehemaligen Kolonialmacht Dänemark zu lösen: "Das Letzte, was man möchte, ist, die alte Kolonialmacht durch eine neue zu ersetzen", sagt Volquardsen im Podcast "Wirtschaft Welt & Weit".Rund 57.000 Menschen leben in Grönland, angesichts des internationalen Interesses kennen sie den geopolitischen Wert ihrer Heimat inzwischen genau. Für Ebbe Volquardsen öffnet sich dadurch "ein Fenster der Möglichkeiten", um die Unabhängigkeit von Dänemark voranzutreiben. Kurz vor der Parlamentswahl am 11. März beobachtet er einen Wettstreit der Parteien, um diese "unschöne und belastende Situation" zum Wohl der grönländischen Bevölkerung zu nutzen. Dabei, so Volquardsen, gehe es um mehr Gleichberechtigung innerhalb des dänischen Staates oder auch um eine völlige Neuausrichtung dieser Beziehungen.Ergibt mehr Unabhängigkeit in der aktuellen Situation Sinn? Wäre es strategisch klug zusammenzurücken? "Grundsätzlich sehe ich eine gute Chance, dass diese Zeit der Unsicherheit für Grönland auch im Verhältnis zu Dänemark Chancen eröffnet, die wir vor einigen Jahren so noch als völlig abwegig betrachtet hätten", sagt Volquardsen: "Nämlich einen Weg zu einer völlig neu gestalteten Form der Zusammenarbeit, die man dann eventuell sogar eine Föderation nennen könnte."Ökonomisch will sich Grönland durchaus breiter aufstellen. Aktuell ist Dänemark der mit Abstand wichtigste Handelspartner - und Fisch das wichtigste Exportprodukt. Von daher ist der wirtschaftliche Blick gen Westen, also Richtung Kanada und USA, für Grönland von großem Interesse. Neben dem Ausbau des Handels geht es dabei auch um mögliche Investitionen im Bergbau. Die brauche es, "um das grönländische Wirtschaftssystem auf ein vielfältigeres Fundament zu stellen", erklärt Volquardsen. Auch die Europäische Union hat das erkannt, unter anderem eröffnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Repräsentanz in der grönländischen Hauptstadt Nuuk.Doch bei der Auswahl seiner Partner ist Grönland wählerisch: Die Bevölkerung stammt weitgehend von den Inuit ab, die bereits vom Klimawandel betroffen sind. Traditionelle Jagdtechniken etwa werden gefährlicher, wenn das Eis schmilzt. Deshalb schätzen und schützen die Menschen in Grönland ihre Umwelt und setzen für den Abbau seltener Erden hohe Standards. "Insofern müssen sich alle künftigen Investoren im Klaren darüber sein, dass sie grönländischen Gesetzen Folge zu leisten haben", fasst es Ebbe Volquardsen zusammen.Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html Wir verarbeiten im Zusammenhang mit dem Angebot unserer Podcasts Daten. Wenn Sie der automatischen Übermittlung der Daten widersprechen wollen, klicken Sie hier: https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.htmlUnsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Vietnamkrieg (1/3) – Kolonialherrschaft und Widerstand
Vietnam, 02. September 1945: Ho Chi Minh steht vor einer jubelnden Menge in Hanoi und verliest die Unabhängigkeitserklärung seines Landes. Seine Worte? Ein Zitat aus der amerikanischen Verfassung: „Alle Menschen sind gleich geschaffen…“ Doch die USA, die sich einst selbst aus der Kolonialherrschaft befreit haben, werden seine Hoffnungen enttäuschen. Der Kalte Krieg beginnt, und plötzlich ist Vietnam nicht mehr ein Land, das sich von seinen kolonialen Fesseln befreien will – sondern ein globales Schlachtfeld zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Warum konnte die ehemalige Kolonialmacht die vietnamesischen Guerillas nicht besiegen? Warum verraten die USA ihre eigenen Ideale? Und wie wurde aus einem vietnamesischen Tellerwäscher in Paris der Mann, der Amerika in die Knie zwingen soll? Du hast Feedback oder einen Themenvorschlag für Joachim und Nils? Dann melde dich gerne bei Instagram: @wasbishergeschah.podcastQuellen:Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam von Frederick LogevallA Bright Shining Lie von Neil SheehanAmerica's Longest War: The United States and Vietnam 1950-1975 von George C. HerringUnsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Diese deutschen Verbrechen werden oft verdrängt
Deutschlands Zeit als Kolonialmacht war brutal. Obwohl die Folgen bis heute sichtbar sind, werden sie oft übergangen. SPIEGEL-Redakteur und Historiker Felix Bohr hat recherchiert, warum die Aufarbeitung stockt. Sagt uns, wie euch Shortcut gefällt. Hier geht's zur Umfrage. »SPIEGEL Shortcut« – Schneller mehr verstehen. Wir erklären euch jeden Tag ein wichtiges Thema – kurz und verständlich. Für alle, die informiert mitreden wollen. Neue Folgen von Shortcut gibt es von Montag bis Freitag auf Spiegel.de, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Links zur Folge: Gedenken an den Kolonialismus: Wie Deutschland mit der kolonialen Schuld ringt Rassismus in Deutschland: »Die Kolonialzeit bestimmt bis heute, wie Schwarze Menschen wahrgenommen werden« Decolonize Cologne Decolonizing Hamburg ► Host: Regina Steffens ► Redaktion: Natascha Gmür ► Redaktionelle Leitung: Marius Mestermann ► Produktion: Kim Höbel, Paul Gäbler ► Postproduktion: Philipp Fackler, Natascha Gmür ► Musik: Above Zero ►►► Lob, Kritik, Themenvorschläge? Schreibt uns: hallo.shortcut@spiegel.de +++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Den SPIEGEL-WhatsApp-Kanal finden Sie hier. Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie mit SPIEGEL+. Entdecken Sie die digitale Welt des SPIEGEL, unter spiegel.de/abonnieren finden Sie das passende Angebot. Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.
Fremd in der Welt – Martin R. Dean über Herkunft und Identität
Der Schriftsteller Martin R. Dean erzählt im Roman «Tabak und Schokolade» seine tabuisierte Familiengeschichte: eine Geschichte des Kolonialismus, der Traumata, der Entwurzelung. Yves Bossart spricht mit ihm über verdrängte Vergangenheiten, über Rassismus und über das Fremdsein in der Welt. Martin R. Dean hat die ersten Jahre seines Lebens in der Karibik verbracht, in Trinidad und Tobago, der Heimat seines Vaters. Die Vorfahren des Vaters stammten aus Indien und wurden Mitte des 19. Jahrhunderts als «Kontraktarbeiter» unter sklavenähnlichen Bedingungen in die Karibik verschifft, um für die britische Kolonialmacht auf den Kakaoplantagen zu arbeiten. Deans Mutter stammt aus dem Aargau und war die Tochter von «Stumpenfabrikarbeitern», die den Tabak aus Übersee in Rauchware umformten. In Deans Familiengeschichte spiegelt sich ein Stück verdrängte Kolonialgeschichte. Seine Hautfarbe wurde schnell zum Tabu im konservativen Dorf. Was hat das mit ihm gemacht? Wie versöhnt man sich mit der eigenen traumatischen Vorgeschichte? Und wie lernt man, das Fremde als solches wertzuschätzen?
Fremd in der Welt – Martin R. Dean über Herkunft und Identität
Der Schriftsteller Martin R. Dean erzählt im Roman «Tabak und Schokolade» seine tabuisierte Familiengeschichte: eine Geschichte des Kolonialismus, der Traumata, der Entwurzelung. Yves Bossart spricht mit ihm über verdrängte Vergangenheiten, über Rassismus und über das Fremdsein in der Welt. Martin R. Dean hat die ersten Jahre seines Lebens in der Karibik verbracht, in Trinidad und Tobago, der Heimat seines Vaters. Die Vorfahren des Vaters stammten aus Indien und wurden Mitte des 19. Jahrhunderts als «Kontraktarbeiter» unter sklavenähnlichen Bedingungen in die Karibik verschifft, um für die britische Kolonialmacht auf den Kakaoplantagen zu arbeiten. Deans Mutter stammt aus dem Aargau und war die Tochter von «Stumpenfabrikarbeitern», die den Tabak aus Übersee in Rauchware umformten. In Deans Familiengeschichte spiegelt sich ein Stück verdrängte Kolonialgeschichte. Seine Hautfarbe wurde schnell zum Tabu im konservativen Dorf. Was hat das mit ihm gemacht? Wie versöhnt man sich mit der eigenen traumatischen Vorgeschichte? Und wie lernt man, das Fremde als solches wertzuschätzen?
Folge 1320: SCHLACHT UM ALGIER Vierter Teil – Cinéma Vérité in der Kasbah
In vier Folgen widmen wir uns Gillo Pontecorvos Meisterwerk SCHLACHT UM ALGIER. In der vierten und letzten Folge beschäftigen wir uns mit den filmischen Mitteln. Für diesen wirklich herausragenden Film habe ich mir kompetente Unterstützung geholt: Dr. Joachim Görgen, der sowohl in Frankreich als auch in Algerien als ARD-Korrespondent gearbeitet hat.Worum geht es? Wir sind in Algier 1957. Die Franzosen sind die Kolonialmacht in Algerien, französisches Militär und Polizei kontrollieren alles, sie bilden eine zivile, offenbar wohlhabende Oberschicht. Einige Algerier der FLN beginnen einen Aufstand, ausgehend von der Kasbah, der Altstadt in Algier. Polizisten werden getötet, es werden gegenseitig Bombenattentate verübt. Die französischen Fallschirmjäger werden gerufen – der Kommandeur Colonel Mathieu jagt die Anführer des Aufstands, vor allem Ali la Pointe. Grausamkeiten von beiden Seiten wie die Folter von Verdächtigen durch die Franzosen und die Morde der FLN an „Verrätern“ sehen wir ungeschönt. Der italienische Regisseur Gillo Pontecorvo hat den Film 1966, also bereits vier Jahre nach Ende des Algerienkriegs, gedreht – unter besonderen Umständen.In dieser vierten und abschließenden Folge fragen wir uns: Wer steckt hinter dem Film? (Regie, Schauspieler, Musik, Produktion) Durch welche filmischen Mittel entsteht der „authentische“ Eindruck? (Perspektiven, Schnitt, Kameratechnik). Ist der Film Teil des italienischen Neorealismus, bzw. des Cinéma Vérité? Wir sprechen über den Regisseur Pontecorvo, der Widerstandskämpfer gewesen war, bevor er sich der Fotografie und dem Film zuwandte und über seinen Film KAPO von 1955. Wir reden über den einzigen ausgebildeten Schauspieler Jean Martin (der selbst Widerstandskämpfer und Fallschirmjäger gewesen war), staunen, dass Pontecorvo den Cutter austauschte, um den Film einen rauen, nachrichtlichen Ton zu geben. Und wir diskutieren die Rolle des FLN-Führers Saadi Yacef, der nicht nur als Darsteller und Produzent von großer Bedeutung für den Film war.
Kolonialgeschichte - Ägypten wird britisches Protektorat
1914 hatte sich Großbritannien zur Schutzmacht Ägyptens ausgerufen. Formell war das Land zuvor eine Provinz des Osmanischen Reichs. Aber de facto herrschten die Briten schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als Kolonialmacht. Stryjak, Jürgen www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
Folge 1319: SCHLACHT UM ALGIER Dritter Teil – Die Rezeptionsgeschichte
In vier Folgen widmen wir uns Gillo Pontecorvos Meisterwerk SCHLACHT UM ALGIER. In der dritten Folge beschäftigen wir uns mit der Rezeptionsgeschichte. Für diesen wirklich herausragenden Film habe ich mir kompetente Unterstützung geholt: Dr. Joachim Görgen, der sowohl in Frankreich als auch in Algerien als ARD-Korrespondent gearbeitet hat.Worum geht es? Wir sind in Algier 1957. Die Franzosen sind die Kolonialmacht in Algerien, französisches Militär und Polizei kontrollieren alles, sie bilden eine zivile, offenbar wohlhabende Oberschicht. Einige Algerier der FLN beginnen einen Aufstand, ausgehend von der Kasbah, der Altstadt in Algier. Polizisten werden getötet, es werden gegenseitig Bombenattentate verübt. Die französischen Fallschirmjäger werden gerufen – der Kommandeur Colonel Mathieu jagt die Anführer des Aufstands, vor allem Ali la Pointe. Grausamkeiten von beiden Seiten wie die Folter von Verdächtigen durch die Franzosen und die Morde der FLN an „Verrätern“ sehen wir ungeschönt. Der italienische Regisseur Gillo Pontecorvo hat den Film 1966, also bereits vier Jahre nach Ende des Algerienkriegs, gedreht – unter besonderen Umständen.Nachdem wir uns in der zweiten Folge mit den historischen Hintergründen beschäftigt haben, werfen wir diesmal einen Blick werfen auf die Rezeption und stellen uns folgende Fragen: Wie war die Rezeption damals 1966? Wie lange gab es Aufführungsverbote? Wie war die Rezeption 2004 als der Film einer breiteren frz. Öffentlichkeit bekannt wurde? Und schließlich; Wie schätzen andere Regisseur:innen den Film ein?Bernd Nitzschke schrieb: „In welcher Liga dieser Film angesiedelt ist, kann man durch die Passage eines Briefes verdeutlichen, den Billy Wilder 1994 an Steven Spielberg schrieb, in dem er dessen Film Schindlers Liste mit den Worten würdigte: „Was Sie geschaffen haben, ist mehr als bloß ein Film. Es ist […] ein ‚Panzerkreuzer Potemkin'‘ oder eine ‚Schlacht um Algier‘. Es ist schwarz-weiß. […] Es ist wahr. Es wurde nicht von Hollywood vorgegaukelt. Es ist wahr. Es ist ein leiser, quälender Schrei […]“ (zit. nach Karasek 2006). Genauso kann man den Film Schlacht um Algier charakterisieren: Er ist wahr. Er gaukelt nichts vor. Er ist ein leiser, quälender Schrei, der den Zuschauern durch Mark und Bein geht.“Im Podcast sprechen wir u.a. darüber, dass der Film für verschiedene Seiten als miltärische Lehrstunde eingesetzt wurde. Auch den Offizieren der US-Streitkräfte wurde SCHLACHT UM ALGIER 2003 vorgeführt, um sie auf die Guerilla-Taktiken vorzubereiten. Wir werfen einen Blick auf die Einschätzung verschiedener Filmregisseur:innen, zum Beispiel Spike Lee, Steven Soderbergh und Oliver Stone, diskutieren über die Aufführungsverbote in Frankreich und zitieren Angela Errigo: „Der Film macht keinen Hehl aus seiner antikolonialistischen Überzeugung; aber furchtbare und herzzerreißende Szenen von Gräueltaten und Vergeltungsmaßnahmen sind lobenswert ausgewogen und zeigen beide Seiten des Konflikts und seinen schrecklichen menschlichen Preis. Der Film ist packend von Anfang bis Ende. […] Er hat nichts von seiner leidenschaftlichen Kraft verloren.“Tom Schünemann von filmsucht.org sagt: „Gillo Pontecorvo erzählt diesen Konflikt ohne eine klassische Dramaturgie und verzichtet auch auf eine detaillierte Figurenzeichnung. Der französische Colonel und einige algerische Widerstandskämpfer spielen zwar eine wichtige Rolle, doch wir erleben die Akteure stets von außen; ihre private Seite und ihre innere Überzeugungen enthält uns der Film vor. Indem sich Schlacht um Algier von etwaigen Helden und einer an sie gebundenen Erzählung freimacht, kann sich Gillo Pontecorvo aus einer ambivalenten Position durch den Konflikt bewegen. Statt Einzelschicksale von Protagonisten in ein dramaturgisches Korsett zu pressen, konzentriert sich der italienische Regisseur auf das Gesamtbild und schildert den Krieg in Algier in vielen kleinen Episoden, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (…) Aufgrund seiner eigentlich gegensätzlichen Mischung aus dokumentarischer Übersicht und fesselnder Distanzlosigkeit zählt Schlacht um Algier zu den unkonventionellsten Antikriegsfilmen – und zu den besten.“
Folge 1318: SCHLACHT UM ALGIER Zweiter Teil – Die historischen Hintergründe
In vier Folgen widmen wir uns Gillo Pontecorvos Meisterwerk SCHLACHT UM ALGIER. In der zweiten Folge beschäftigen wir uns mit den historischen Zusammenhängen. Für diesen wirklich herausragenden Film habe ich mir kompetente Unterstützung geholt: Dr. Joachim Görgen, der sowohl in Frankreich als auch in Algerien als ARD-Korrespondent gearbeitet hat.Worum geht es? Wir sind in Algier 1957. Die Franzosen sind die Kolonialmacht in Algerien, französisches Militär und Polizei kontrollieren alles, sie bilden eine zivile, offenbar wohlhabende Oberschicht. Einige Algerier der FLN beginnen einen Aufstand, ausgehend von der Kasbah, der Altstadt in Algier. Polizisten werden getötet, es werden gegenseitig Bombenattentate verübt. Die französischen Fallschirmjäger werden gerufen – der Kommandeur Colonel Mathieu jagt die Anführer des Aufstands, vor allem Ali la Pointe. Grausamkeiten von beiden Seiten wie die Folter von Verdächtigen durch die Franzosen und die Morde der FLN an „Verrätern“ sehen wir ungeschönt. Der italienische Regisseur Gillo Pontecorvo hat den Film 1966, also bereits vier Jahre nach Ende des Algerienkriegs, gedreht – unter besonderen Umständen.In dieser Folge stellen wir uns folgende Fragen: Was passierte in Algerien seit die Franzosen 1830 auftauchten, was passierte vor dem Aufstand, während des Aufstands, danach? Welche Auswirkungen hat das bis in die Gegenwart und: Gewalt, Terror, Folter als Mittel der Politik? Wie war die Rezeption damals, Aufführungsverbote, Rezeption 2004, Rezeption von anderen Regisseur:innen? Was halten die Franzosen heute vom Film? Wir sprechen über eine tragische Geschichte, die 1830 mit der ersten Besetzung begonnen hat, mit dem Fehler, ein Land als Teil der Republik zu betrachten, den Einheimischen aber nicht die Bürgerrechte der Republik zu geben. Wir sprechen über Schwarzstiefel und die grausame „Französische Doktrin“.Die dritte Folge erscheint am 15. Dezember und widmet sich der Rezeptionsgeschichte.
Folge 1317: SCHLACHT UM ALGIER Erster Teil – Der erste Eindruck
SCHLACHT UM ALGIER ist ein Film, den ich in wirklich jeder ausführlichen Bestenliste gefunden habe, als bester politischer Film, als bester Antikriegsfilm, als bester historischer Film, als einer der besten Filme überhaupt.Worum geht es? Wir sind in Algier 1957. Die Franzosen sind die Kolonialmacht in Algerien, französisches Militär und Polizei kontrollieren alles, sie bilden eine zivile, offenbar wohlhabende Oberschicht. Einige Algerier der FLN beginnen einen Aufstand, ausgehend von der Kasbah, der Altstadt in Algier. Polizisten werden getötet, es werden gegenseitig Bombenattentate verübt. Die französischen Fallschirmjäger werden gerufen – der Kommandeur Colonel Mathieu jagt die Anführer des Aufstands, vor allem Ali la Pointe. Grausamkeiten von beiden Seiten wie die Folter von Verdächtigen durch die Franzosen und die Morde der FLN an „Verrätern“ sehen wir ungeschönt. Der italienische Regisseur Gillo Pontecorvo hat den Film 1966, also bereits vier Jahre nach Ende des Algerienkriegs, gedreht – unter besonderen Umständen.Für diesen wirklich herausragenden Film habe ich mir kompetente Unterstützung geholt: Dr. Joachim Görgen, der sowohl in Frankreich als auch in Algerien als ARD-Korrespondent gearbeitet hat. Wir haben uns Zeit genommen und den Film in vier Episoden von verschiedenen Seiten aus betrachtet und die historischen Zusammenhänge beleuchtet. In der ersten Episode geht es um unseren ersten Eindruck und die Frage, ob der Film nach 58 Jahren an Wirkung eingebüsst hat. (Hat er nicht.) Wir sprechen unter anderem über die bewegliche Kamera, über Morricones Musik, über Massenszenen und Joachim erzählt, wie er den Film 1983 in London zum ersten Mal gesehen hat. Zu einer Zeit als ihn in Paris kein Kino gezeigt hätte.Die zweite Folge erscheint am 8. Dezember und widmet sich den historischen Hintergründen.
De Lëtzebuerger Buchpräis an der Kategorie Sachbuch goung dëst Joer un den Yves Schmitz fir säi Wierk "Luxemburg war nie eine Kolonialmacht: Eine kritische Einführung“. E Projet, dee vum Kënschtlerkollektiv Richtung 22 matgedroe ginn ass a bei Capybarabooks publizéiert gouf. Op de Walfer Bicherdeeg waren den Yves Schmitz, d‘Michelle Liesch vu Richtung 22 an d‘Editrice Susanne Jaspers d‘Invitéë beim Valerija Berdi a Michel Delage an der Live-Emissioun Déi wonnerbar Valibrairie.
Kolonialmacht - Der Vernichtungskrieg in Deutsch-Südwestafrika
Was führte zur Eskalation im Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika? Wie veränderte sich die Rolle der deutschen Schutztruppe im kolonialen Machtgefüge? Dr. Dr. Matthias Häusler, Dr. Frank Reichherzer und Oberstleutnant Dr. Christian Stachelbeck sprechen über die Hintergründe dieses dunklen Kapitels der deutschen Kolonialgeschichte. Im Zentrum der Diskussion steht die Verflechtung von Kolonialherrschaft und Gewalt. Die Bedeutung von Deutsch-SüdwestafrikaDeutsch-Südwestafrika nahm eine besondere Rolle unter den deutschen Kolonien ein. Aufgrund seiner gewaltigen Fläche und des Umstands, dass es die einzige deutsche Siedlungskolonie war, verknüpften die Deutschen große Hoffnungen mit dieser Region. Sie wollten die Auswanderungsströme, die bisher nach Amerika gingen, auf deutsches Territorium lenken. Doch dieser Traum blieb unerfüllt. Bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft 1915 lebten in dem Gebiet nur etwa 15.000 Europäer. Zur Stabilisierung der Region wurde die sogenannte Schutztruppe eingesetzt, die 1888 ursprünglich als private Armee gegründet worden war. Sie sollte auf friedlichem Wege für Ordnung sorgen. Doch im Laufe der Zeit eskalierte die Lage und die Schutztruppe wurde immer stärker in gewalttätige Konflikte verwickelt. Die Eskalation des Konflikts ab 1904Die Vernichtungspolitik gegen die Herero und Nama war nicht von Anfang an geplant, sondern entwickelte sich erst nach dem Scheitern der konventionellen militärischen Taktiken. Als es der deutschen Armee 1904 nicht gelang, die Herero in der entscheidenden Schlacht am Waterberg zu besiegen, radikalisierte sich die Kriegführung - dies führte zum Genozid an den Herero und Nama. Dabei spielte die Metropole Berlin eine entscheidende Rolle. Der Druck auf die Kolonialverwaltung, militärische Überlegenheit zu demonstrieren, wuchs, besonders da das Deutsche Reich international unter Beobachtung stand und sich keine Schwäche leisten durfte. So trug die Erwartungshaltung aus der Heimat maßgeblich zur Eskalation des Krieges bei. Neues Forschungsprojekt am ZMSBwDer Podcast ist der Auftakt für das Forschungsprojekt „Deutsches Militär im kolonialen Einsatz 1880 bis 1918“ des Forschungsbereichs Militärgeschichte bis 1945 am ZMSBw. Dieses Projekt wird sich mit der Geschichte kolonialer Gewalt und deren militärischer Dimension auseinandersetzen. Das Projekt beabsichtigt, ein Forum für den Austausch zwischen Militär-, Kolonial- und Gewaltgeschichte zu bieten. Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff „Einsatz“, der als Entsendung und Verwendung von militärischem Personal zur Erfüllung eines hoheitlichen/staatlichen Auftrags einer Kolonial/-Imperialmacht definiert wird. Auch wenn der Fokus auf der deutschen kolonialen Militärgeschichte liegt, sollen ebenso die Bezüge zu weiteren Akteuren des Kolonialstaates, privatwirtschaftlichen Organisationen und insbesondere die Transferbeziehungen zwischen den Kolonialmächten und indigenen Bevölkerungsgruppen sowie die Verknüpfung mit anderen Phasen kolonialer/imperialer Herrschaft zur Sprache kommen.
Gerechtigkeitssinn, Selbstzweifel und Ehrgeiz sind Eigenschaften, die einen US-Präsidenten auszeichnen sollten. Der Charakterdarsteller Henry Fonda hat diese über Jahrzehnte oft auf der Leinwand verkörpert. Ob als Abraham Lincoln, ausgebeuteter Landarbeiter oder Geschworener, Henry Fonda hat nicht nur Hollywood-Geschichte geschrieben, sondern auch die eines bescheidenen, politisch hoch engagierten Privatmanns. Der ehemalige Direktor des Österreichischen Filmmuseums begibt sich in seinem Essaydokumentarfilm "Henry Fonda for President" auf die biografischen Archivspuren einer Legende. Diese verknüpft Horwath nachdenklich mit komplexen Zusammenhängen zwischen Hollywood und der USA als Kolonialmacht, Einwanderungsnation und Vorzeigedemokratie. Petra Erdmann hat Alexander Horwath ins Diagonal-Studio eingeladen. Der reguläre Filmstart von "Henry Fonda for President" ist in Österreich am 10. Jänner.
Im 1904 erhob sich das einheimische Hirtenvolk der Herero gegen die deutsche Kolonialmacht. Denn Siedler und Verwaltung raubten den Herero in "Deutsch-Südwestafrika" das überlebensnotwendige Weideland. Die deutsche Antwort auf den Aufstand war ein brutaler Genozid: Es starben etwa 65.000 Herero.
Folge 111: Jean-Bédel Bokassa Teil 2 - War never changes.
Im zweiten Teil der Geschichte von Jean-Bédel Bokassa sprechen wir darüber, wie er sich an die Macht in der Zentralafrikanischen Republik putscht und seine Herrschaft mit Gewalt und Größenwahn ausbaut, wie er sich schließlich zum Kaiser krönen lässt und schlußendlich doch der ehemaligen Kolonialmacht ein zu großer Dorn im Auge ist.Quellenauswahl:Titley, B. (1997). Dark Age: The Political Odyssey of Emperor Bokassa. United Kingdom: McGill-Queen's University Press.Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Jean-Bédel Bokassa". Encyclopedia Britannica, 18 Apr. 2024, https://www.britannica.com/biography/Jean-Bedel-Bokassa.Dazu noch reichlich ältere Artikel aus "Spiegel" und "Zeit".Mehr musikalischen Kontext zu unseren Folgen findet Ihr hier auf Spotify:https://open.spotify.com/playlist/3V4...Den aktuellen Popkultur-Kontext und viele andere Videos gibt es in dieser Playlist:https://www.youtube.com/watch?v=QpIAKV0OMYQ&list=PLZgnFFgLv7g-AoQi_9mRgbVrLrpVqXUKPBleibt uns gewogen und schreibt uns was!Support the show
Die langen Schatten des Ersten Weltkriegs – Teil 6 | Von Wolfgang Effenberger
Teil 6: Kritische Stimmen aus GroßbritannienEin Kommentar von Wolfgang Effenberger.1897 - zwei Jahre vor Beginn des barbarischen Zweiten Burenkriegs der Briten (Lord Milner´s War) - hielt der deutsche Außenminister und spätere Kanzler Bernhard von Bülow seine berühmte, aber oft auch verkürzt wiedergegebene Rede im Reichstag.Wohl in Anspielung an die Ergebnisse des 1. Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) (1) hob er in dieser Rede hervor:„…Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst den Himmel reserviert, wo die reine Doktrin thront […] - diese Zeiten sich vorüber. Wir betrachten es als eine unserer vornehmsten Aufgaben, gerade in Ostasien die Interessen unserer Schifffahrt, unseres Handels und unserer Industrie zu fördern und zu pflegen. […] Wir müssen verlangen, dass der deutsche Missionär und der deutsche Unternehmer, die deutschen Waren, die deutsche Flagge und das deutsche Schiff in China geradeso geachtet werden, wie diejenigen anderer Mächte. […] Wir sind endlich gern bereit, in Ostasien den Interessen anderer Großmächte Rechnung zu tragen, in der sicheren Voraussicht, dass unsere eigenen Interessen gleichfalls die ihnen gebührende Würdigung finden. […] Mit einem Worte: Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. […] In Ostasien wie in Westindien werden wir bestrebt sein, getreu den Überlieferungen der deutschen Politik, ohne unnötige Schärfe, aber auch ohne Schwäche unsere Rechte und unsere Interessen zu wahren“.(2)Das musste in London als Kampfansage gewertet werden. Hatte das Empire doch in der Mitte des 19. Jahrhunderts in China 2 ausgewachsene Opiumkriege geführt. Ausgelöst wurden sie durch den Umstand, dass Großbritannien zwar Tee, Seide und Porzellan aus China importierte, umgekehrt aber kaum britische Waren nachgefragt wurden. Um dem einseitigen Abfluss von Devisen beizukommen, ließen die Briten - v.a. gesteuert durch die East India Company - in Indien Opium anbauen und verkauften es in China. Das war verboten, lohnte sich aber trotzdem - bis der chinesische Kaiser intervenierte. Im Selbstverständnis beider Nationen wirkt das bis heute nach. In Großbritannien verträgt sich der Anspruch, als Kolonialmacht vor allem Zivilisation verbreitet zu haben, schlecht mit der Förderung des Drogenhandels - in China zählen die Opiumkriege wegen der Zugeständnisse an die Briten zum „Jahrhundert der nationalen Schande“.(3)Um die Frage nach den Hauptinitiatoren des Ersten Weltkriegs beantworten zu können, so lehrt uns jeder Krimi, muss man als Erstes nach möglichen "Motiven" Ausschau halten und darauf achten, wer auf wen mit dem Finger zeigt, um dann alle Fakten zu analysieren und schließlich die Mosaiksteine zusammenzusetzen.Bezieht sich die Eingangsfrage nun darauf, wem die Schuld am Ersten Weltkrieg zuzuweisen ist, sind die Motive nicht leicht zu erkennen, da sie durch die Propaganda äußerst geschickt verschleiert wurden. Denn die britischen Kriegsplaner hatten aus ihrem verlustreichen Zweiten Burenkrieg (1899-1902) gelernt, dass ein Krieg auch an der Propagandafront gewonnen werden muss. Und dafür ist es einerseits wichtig, dass nach außen hin der Gegner als Angreifer dasteht und andererseits, dass der Angriff tatsächlich überraschend kommt.... hier weiterlesen: https://apolut.net/die-langen-schatten-des-ersten-weltkriegs-teil-6-von-wolfgang-effenberger Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Folge 112 - Der Mau-Mau-Krieg
Am 20. Oktober 1952 rief der Gouverneur der Kronkolonie Kenia, Sir Evelyn Baring, den Ausnahmezustand aus. Hintergrund waren die Aktivitäten der Mau-Mau, die immer wieder Anschläge auf Farmen europäischer Siedler sowie auf Vertreter der afrikanischen Eliten verübte. Diese reagierten ihrerseits mit Vergeltungsaktionen gegen echte und vermeintliche Rebellen. Nur langsam gelang es der Kolonialmacht, die Initiative zurückzugewinnen und Methoden zur effektiven Bekämpfung der Mau-Mau zu entwickeln – mit weitreichenden Folgen für die Bevölkerung. Unsere Literaturhinweise zur Folge: - Huw Bennett: Fighting the Mau Mau. The British Army and Counter-Insurgency in the Kenya Emergency, Cambridge 2013. - Daniel Branch: Defeating Mau Mau, Creating Kenya. Counterinsurgency, Civil War and Decolonization, Cambridge 2009.
Nachdem ein Afro-Brite an drei britische Mädchen ermordet hat , haben im ganzen Land Briten gegen de uferlose Zuwanderungspolitik protestiert. Die neue Labour-Regierung geht mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Man will ein Exempel statuieren und damit jegliche Kritik an der Transformation des Landes unterbinden.
Nachfolge von Raisi im Iran, Unruhen auf französischer Pazifik-Insel, Unwetter in Südwestdeutschland
Im Iran sucht das Regime einen Nachfolger für den verunglückten Präsidenten. Im Pazifik wird Frankreich gewaltsam an seine Rolle als Kolonialmacht erinnert. Und auch im deutschen Südwesten ziehen wieder dunkle Regenwolken auf. Das ist die Lage am Dienstagabend. Hier die Artikel zum Nachlesen: Machtpoker in Teheran: „Die Radikalen haben keine Alternative zu Raisi“ Aufruhr in Neukaledonien: Wie Paris aus 17.000 Kilometer Entfernung einen Bürgerkrieg verhindern will Erneute Gewitter und Starkregen erwartet – Warnung vor erhöhter Unwettergefahr +++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie bei SPIEGEL+. Jetzt für nur € 1,- für die ersten vier Wochen testen unter spiegel.de/abonnieren Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.
Indochinakrieg - Frankreich unterliegt in Điện Biên Phủ
Vor 70 Jahren besiegte die vietnamesische Widerstandsbewegung die französische Kolonialmacht in der Schlacht um Điện Biên Phủ. Wer den späteren Vietnamkrieg verstehen will, muss den Indochinakrieg kennen. Er leitete alle späteren Konflikte ein. Ernst, Sonja www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
Am 30. Juni 1960 erlangt der Kongo seine Unabhängigkeit von der belgischen Kolonialmacht. Patrice Lumumba, Premierminister des neuen Staates, hält eine Rede, die der Welt den Atem raubt. Für diese Sternstunde der Menschheit bezahlt er mit seinem Leben. In Folge 190 reden Sabine Rückert und Andreas Sentker mit dem Reporter Bastian Berbner über den verbrecherischen Kolonialismus Belgiens und die grausame Ermordung eines afrikanischen Hoffnungsträgers. Die neue Ausgabe des Kriminalmagazins „ZEIT Verbrechen“ liegt am Kiosk und ist hier online bestellbar. Sie möchten zwei Ausgaben zum Kennenlernpreis testen? Dann klicken Sie hier. Und zu unserem Newsletter geht's hier entlang. [ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER. [ANZEIGE] Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Korea - Aufstand gegen die japanische Kolonialmacht
Die koreanische Unabhängigkeitsbewegung begann im März 1919 und war ein Protest gegen die japanische Kolonialmacht. Millionen Koreaner demonstrierten danach für das Recht auf nationale Selbstbestimmung, das aber erst nach 1945 Wirklichkeit wurde. Fritz, Martin www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
Der Geburtstag von Robert Mugabe, ehemaliger Präsident von Simbabwe (21.02.1924)
Zunächst gilt er als Befreier von der britischen Kolonialmacht, dann wird Robert Mugabe zum gefürchteten Gewaltherrscher in Simbabwe.
21.2.1924: Geburtstag Robert Mugabe
Heute vor 100 Jahren wurde Robert Mugabe geboren, Unabhängigkeitskämpfer gegen die britische Kolonialmacht in Rhodesien, Präsident und zuletzt Diktator von Simbabwe.
Robert Mugabe: erst gefeierter Held, dann gefürchteter Diktator
Zunächst gilt er als Befreier von der britischen Kolonialmacht, dann wird Robert Mugabe, geboren am 21.2.1924, zum gefürchteten Gewaltherrscher in Simbabwe. Von Wolfgang Meyer.
BLACK HISTORY - Die Benin-Bronzen
Sie sind nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sie sind das Gedächtnis eines ganzen Volkes in Westafrika. Was sie genau zeigen, ist allerdings noch nicht vollständig entschlüsselt. Und nach einem Raubzug der britischen Kolonialmacht sind tausende Benin-Bronzen in der ganzen Welt verteilt. Wie soll die Rückgabe ablaufen?Februar ist "Black History Month".Von Linus Lüring (BR 2023)
Im August 1920 rief Mahatma Gandhi die Kampagne der Nichtkooperation in Indien aus, die zu dem passiven Widerstand weiter Bevölkerungsteile gegenüber der britischen Kolonialmacht führte. Nachdem 1922 eine lokale Mobilisierungs-Kampagne, die friedlich und im Geiste Gandhis begonnen hatte, in Gewalt gegen britische Polizisten und zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften umschlug, wurde Gandhi verhaftet und zu 6 Jahren Haft verurteilt, zumal er vor Gericht die Schuld für die Gewalt auf sich genommen hatte. Offiziell wegen einer Blinddarmoperation wurde er aber 1924 vorzeitig freigelassen, um kurze Zeit später der Präsident des Indischen Nationalkongresses zu werden. Die Vossische blickt am 5. Februar 1924 auf die Lage in Indien, beschäftigt sich aber nicht nur mit Mahatma Gandhi, sondern auch mit den Herausforderungen, vor denen die neue britische Labour-Regierung stand. Für uns liest Frank Riede.
Koloniales Brandenburg - Die Anfänge eines deutschen Unterdrückungssystems?
Das deutsche Kaiserreich wurde vergleichsweise spät zur Kolonialmacht. Allerdings hatte Brandenburg-Preußen schon 200 Jahre zuvor einen Handelsstützpunkt an der Küste Westafrikas eingerichtet. Liegen hier die Anfänge des deutschen Kolonialsystems? Wüllenkemper, Corneliuswww.deutschlandfunkkultur.de, Zeitfragen
Der Nahost-Konflikt provoziert Meinungen und Legenden wie kaum ein anderes Thema. Ist der unlösbar? Ist Israel eine Kolonialmacht? Wir prüfen acht verbreitete Annahmen.
Die Benin-Bronzen - Faszinierende Kunst und koloniales Unrecht
Sie sind nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sie sind das Gedächtnis eines ganzen Volkes in Westafrika. Was sie genau zeigen, ist allerdings noch nicht vollständig entschlüsselt. Und nach einem Raubzug der britischen Kolonialmacht sind tausende Benin-Bronzen in der ganzen Welt verteilt. Wie soll die Rückgabe ablaufen? Autor: Linus Lüring
Kricket als Spiegel der indischen Gesellschaft
Kricket ist das einzige Thema, auf das sich in Indien alle einigen können, unabhängig von Religion und sozialer Stellung. Der von der britischen Kolonialmacht eingeführte Sport ist eine Milliardenindustrie – und hochpolitisch. Nun ist Indien Gastgeber der Weltmeisterschaft. Autor: Ronny Blaschke Von WDR5.
Absetzung US-Speaker: "Repubikaner stehen im schlechtesten Licht"
Zum ersten Mal in der Geschichte des US-Parlaments ist der Speaker der grossen Kammer abgewählt worden, Kevin McCarthy. Was treibt die republikanischen Abgeordneten an, die US-Politik zu blockieren? Die Expertin ordnet ein. * In Rom hat die "Weltsynode" begonnen. 365 Delegierte treffen sich im Vatikan. Sie beraten Reformen der römisch-katholischen Kirche. Aus der Schweiz dabei ist der Basler Bischof Felix Gmür. Wir sprechen mit ihm. * Pakistan will 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge ausschaffen. Grund für die massenhafte Ausweisung sei die verschärfte Sicherheitslage in Pakistan, sagt die Regierung. * Die Bettwanzen-Panik hat Paris im Griff. Bettwanzen, ihre Verbreitung und was man dagegen tun kann, diese Themen sind omnipräsent in traditionelle und sozialen Medien. Wie ernst ist die Lage wirklich? * Heute, Donnerstag beginnt in Indien die Kricket-Weltmeisterschaft. Der Sport - der von der britischen Kolonialmacht importiert wurde - ist heute eine milliardenschwere Industrie - und hochpolitisch.
Das Deutsche Reich war zeitweise die flächenmäßig drittgrößte Kolonialmacht der Welt – mit sogenannten „Schutzgebieten“ in Afrika, China und Ozeanien. Es ist ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, das lange verdrängt oder verharmlost wurde. Tran, Anh
In einer namibischen Wüste entsteht gerade ein riesiger Wind- und Solarpark. Der Strom daraus wird zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt, der dann unter anderem nach Deutschland verschifft werden soll. Namibia und Deutschland verbindet eine lange Geschichte – geprägt von Ausbeutung und Gewalt, für die Deutschland als Kolonialmacht in Südwestafrika verantwortlich ist. Entstehen jetzt neue Abhängigkeiten? Oder wird Namibia dieses Mal von dem engen Kontakt zu Deutschland profitieren? Bei 11KM erzählt MDR-Journalistin Heidi Mühlenberg von ihrer Reise nach Namibia. Sie hat mit den Menschen vor Ort über die Auswirkungen des großen Wasserstoffprojekts gesprochen - für Anwohner:innen und die Natur. Hier geht es zum langen Hörfunkfeature von unserem Gast Heidi Mühlenberg: https://www.swr.de/swr2/doku-und-feature/wuestenstrom-aus-afrika-doku-ueber-die-chancen-der-solarenergie-swr2-feature-2023-03-31-100.html Und unser Podcast-Tipp: Gegen jede Überzeugung https://www.ardaudiothek.de/sendung/gegen-jede-ueberzeugung/12331607/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Jasmin Brock Mitarbeit: Mira-Sophie Potten und Marc Hoffmann Produktion: Gerhard Wicho, Ursula Kirstein, Alexander Gerhardt und Eva Erhard Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung dieser Folge liegt beim BR.
Weltweit sprechen 300 Millionen Menschen Französisch - doch Frankreichs Präsident Macron beklagt, dass es etwa in den Maghreb-Staaten immer weniger werden. Er fordert deshalb eine "Rückeroberung" der Frankophonie und hat dafür eine Reihe von Maßnahmen verabschiedet. Doch dahinter steckt keineswegs nur die altbekannte Liebe Frankreichs zur eigenen Sprache: Spätestens seit die ehemalige Kolonialmacht ihre militärischen Truppen aus Westafrika abziehen musste, setzt Frankreich nun bewusst auf eine neue Sprach- und Einflussdiplomatie - auch, um russischen Desinformationsnarrativen in der Region etwas entgegenzusetzen. Kann diese Strategie aufgehen? Und wie passt das mit Macrons jüngsten Äußerungen zusammen, die Zeiten der paternalistischen Afrikapolitik seien vorbei? - Einschätzungen von Kenny Kremer, Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Knapp zehn Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hat das erste deutsche LNG-Terminal seinen Betrieb aufgenommen. Der zur Eröffnung in Wilhelmshaven angereiste Kanzler Olaf Scholz sprach dort vom "neuen Deutschland-Tempo". Wie die Verantwortlichen für die schnelle Fertigstellung des Flüssiggasterminals gesorgt haben, berichtet Wirtschaftsredakteur Marc Widmann. Mit dem Finale Frankreich gegen Argentinien geht die Fußball-WM der Männer zu Ende. Welches der beiden Teams die größeren Chancen auf den Titel hat, schätzt Sportredakteur Oliver Fritsch ein. Und er spricht darüber, wie Katars Politik die WM überschattet hat. Alles außer Putzen: Im Brettspiel "Spirit Island" in die Rolle eines Geistes schlüpfen und eine fremde Kolonialmacht abwehren. Moderation und Produktion: Ole Pflüger(https://www.zeit.de/autoren/P/Ole_Pflueger/index) Mitarbeit: Sarah Vojta, Anne Schwedt Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de. Weitere Links zur Folge: LNG-Terminal in Wilhelmshaven: Zusammen geschweißt(https://www.zeit.de/2022/52/lng-terminal-wilhelmshaven-fluessiggas) LNG-Markt: Angekommen im Wilden Westen(https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-12/lng-terminal-weltmarkt-fluessiggas-gasversorgung) Marokko bei der Fußball-WM: Marokkanischer Rausch(https://www.zeit.de/2022/52/marokko-fussball-wm-erfolg-europa) Fußball-WM: Das Turnier der Alten Männer(https://www.zeit.de/sport/2022-12/fussball-wm-alte-herren)
"Deutschland, Deine Kolonien" - Keine kleine Kolonialmacht
Wie falsch ist unser Bild von Deutschland als "zaghafte, kleine Kolonialmacht"? Ziemlich falsch, sagt Eva-Maria Schnurr. Im Sammelband "Deutschland, deine Kolonien" versammelt die Herausgeberin auch Stimmen aus ehemals kolonisierten Ländern.Eva-Maria Schnurr im Gespräch mit Christian Rabhanslwww.deutschlandfunkkultur.de, LesartDirekter Link zur Audiodatei
#52 Wie Widerstand zur Lebensaufgabe wird – „Annette, ein Heldinnen-Epos“ von Anne Weber
Annette lebt für den Widerstand: In ihrer Jugend ist sie Teil der französischen Résistance gegen den Nationalsozialismus, engagiert sich später im Untergrund gegen die französische Kolonialmacht in Algerien, wird verhaftet, flieht und kehrt schließlich nach Frankreich zurück. Anne Weber schreibt in „Annette, ein Heldinnenepos“ (2020, Matthes & Seitz) über Anne Beaumanoirs Leben (1923-2022). Sie wählt die Form des Epos, um uns diese unglaublich-wahre Geschichte einer viel zu unbekannten Frau zu erzählen. Eine Frau, die hadert, zweifelt, und, so scheint es, nicht anders kann als für ihre Ideale weiterzukämpfen.