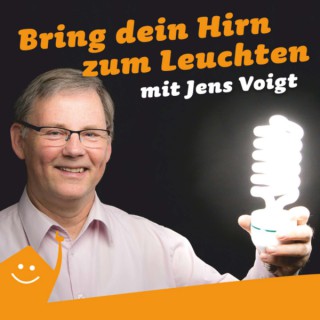Podcasts about hirnstamm
- 33PODCASTS
- 36EPISODES
- 28mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Dec 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about hirnstamm
Latest podcast episodes about hirnstamm
063 - Atem unter Druck – Wie Stress deinen Atem kapert
Weihnachten – die Stille Zeit? Von wegen. Wir funktionieren, organisieren und atmen mehr, als wir denken. Das Herz klopft, der Nacken zieht, die Gedanken rasen – und unser Zwerchfell ? zieht sich gestresst zurück.In dieser Folge erfährst Du, wie Stress im Gehirn entsteht, welche Rolle der Hirnstamm, die Amygdala, das limbische System und die Großhirnrinde spielen. Warum das Zwerchfell, in Stressphasen, seine Aktivität verliert und wie Du über den Vagus Nerv, durch Zwerchfellaktivität und Achtsamkeit, zu Deinen Atem findest, somit wieder leichter in Homöostase kommst.Kein einmal „tief durchatmen“
#70 Warum der Blutdruck im Gehirn reguliert wird & was du gegen Bluthochdruck tun kannst
Training NeuRo gedacht - Alles Rund um Schmerzreduktion und Leistungssteigerung mit Neuroathletik
Warum dein Gehirn dein Blutdruck-Thermostat ist – und was du gegen Hypertonie tun kannstViele denken bei Bluthochdruck sofort an Herz, Gefäße oder den Lebensstil – doch kaum jemand denkt ans Gehirn. Dabei sitzt dort der zentrale Regler deines Blutdrucks. Und genau das wird oft übersehen.In dieser Folge erfährst du, warum die Regulation deines Blutdrucks neurozentriert gedacht werden muss – und was du konkret tun kannst, um dein vegetatives Nervensystem gezielt zu beeinflussen.Dich erwartet in dieser Folge:Warum dein Hirnstamm der entscheidende Schaltkreis für deinen Blutdruck istWas der Nucleus Tractus Solitarius (NTS) mit Barorezeptoren und Gefäßspannung zu tun hatWie du durch beidseitiges Messen unerkannte Asymmetrien im Blutdruck erkennen kannstWas die Inselrinde (Insula) bei zu niedrigem Blutdruck für eine Rolle spieltWie du neuronale Regulation gezielt trainieren kannst – z. B. durch Atmung, vestibuläre Stimulation oder gezielte ÜbungenHighlights aus der Folge:„Viele messen ihren Blutdruck nur auf einer Seite – und übersehen dadurch chronische Dysbalancen.“„Dein Hirnstamm entscheidet mit, ob dein Blutdruck steigt oder sinkt – das ist kein Trick, sondern Training.“
#38 POST-STROKE-DEPRESSION Experten-Talk
Moin aus der KJK! In der aktuellen Folge spricht Host Emma mit unserem Assistenzarzt Mohammad Aboutalebi über ein Thema, das häufig übersehen wird – aber viele Menschen nach einem Schlaganfall betrifft: die Post-Stroke-Depression. Etwa jeder dritte Schlaganfall-Patient entwickelt diese besondere Form der Depression. Spannend und hochaktuell: Neue Studien zeigen, dass bei vielen Betroffenen Veränderungen im Hirnstamm auftreten, die das Risiko für eine Post-Stroke-Depression deutlich erhöhen. Mithilfe eines gezielten Hirnstammscreenings könnten Risikopatient:innen künftig früher erkannt und besser behandelt werden. Über diese und weitere Erkenntnisse, klinische Erfahrungen und Forschungsperspektiven spricht Mohammad Aboutalebi in einer Folge, die all jene anspricht, die sich für die neurologischen und psychiatrischen Herausforderungen nach einem Schlaganfall interessieren.
Pflege Einfach! Das Apallische Syndrom - Smarte Perspektiven
Das Apallische Syndrom, auch bekannt als Wachkoma oder vegetativer Zustand, stellt eine komplexe Herausforderung für Pflege, Medizin und Angehörige dar. Charakterisiert durch den Verlust der Großhirnfunktion bei erhaltenem Hirnstamm, zeigen Betroffene einen Schlaf-Wach-Rhythmus und reflexhafte Bewegungen, während bewusstes Erleben und zielgerichtete Reaktionen fehlen. Die Diagnostik erfolgt über klinische Beobachtung und bildgebende Verfahren wie EEG oder funktionelle MRT, um den Grad der Hirnschädigung und mögliche Restbewusstseinsreaktionen zu erfassen.Pflege und Therapie sind interdisziplinär ausgerichtet und beinhalten medizinische Stabilisierung, basale Stimulation, physiotherapeutische Maßnahmen sowie die Einbindung von Angehörigen. Aktuelle Forschung zeigt, dass manche Patient:innen, die äußerlich reaktionslos erscheinen, über Restbewusstsein verfügen, was neue Ansätze der Kommunikation und Therapie ermöglicht. Innovative Technologien wie Brain-Computer-Interfaces (z. B. Neuralink) eröffnen perspektivisch Chancen, verborgene Bewusstseinsreaktionen zu erkennen und eine partielle Interaktion zu ermöglichen.
Das Gesetz der Annahme und dein retikulres Aktivierungssystem Bedeutung und Nutzen
Souverän in deinem Leben und durch historische Zeiten: Ich liebe Menschen, ihre Ideen, Lebenswege und Lebensideen und begleite Menschen in ihr stimmiges Traumleben & durch diese historischen Zeiten. Wenn dich eine Idee oder ein Traum immer wieder an der Nase kitzelt, ein Bild vor deinem inneren Auge auftaucht und von dir ins Leben gebracht werden möchte, melde dich, begleitet geht es einfacher. Trau dich, für dich loszugehen, deine Träume zu leben! Und trau dich, blockierende Muster und Glaubenssätze zu entdecken und loszulassen. Das macht dir das Leben leichter und erfüllter. UUUUnd wir sind in einem besonderen Zeitalter: Wir sind in einem historischen Prozess, in dem es ausschliesslich um die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins geht. Mein LIeblingsbeispiel dazu ist: Was ein zweijähriges Kind noch alles glaubt und von Kasperltheater fasziniert ist, glaubt ein 10 jähriges Kind nicht mehr. Es hat eine Entwicklung durchlaufen. Genau das ist der historische Prozess, in dem wir Menschen sind. Wie in einem Computerspiel werden wir so Level um Level transformiert. Um dir diese Zeit und dein Leben leichter zu machen, schauen wir uns heute wieder ein spezielles Thema an: Was ist das retikuläre Aktivierungssystem (RAS) und wie kann ich es nutzen? Was hat das Law of Assumption damit zu tun? Der Anlass für dieses Thema ist ganz simpel: ich habe den Begriff "retikuläres Aktivierungssystem" gelesen, bin daran hängen geblieben und ich habe ein bisschen recherchiert, um es besser zu verstehen. Es hat mir das Law of Assumption verwissenschaftlicht und das Verständnis vertieft. Also lass es uns in diesem Video zusammen anschauen. Das Law of Assumption besagt, dass = Das Gesetz der Annahme. = Unsere Annahmen bestimmen unsere Lebensumstände. = optimist oder Pessimist Und das retikuläre Aktivierungssystem ist ein Netzwerk aus Nervenzellen im Hirnstamm, das für uns sämtliche wahrgenommenen Informationen filtert und entscheidet, welche davon für uns wichtig sind. Entscheidend ist also: mit welchem Grundverständnis gehst du durchs Leben? Programmierst du dein retikuläre Aktivierungssystem selber oder lässt du es programmieren? Wie achtsam bist du? Wie sehr setzt du diesen Mechanismus für dich ein? Genau das schauen wir zusammen an. Weil du am Steuerrad deines Lebens sitzen darfst. Weil dein Leben dir gehört. Weil du entscheiden darfst, welche Welt du kreieren möchtest. Du darfst souverän & gelassen durch dein Leben navigieren. Weil dein Leben leicht sein darf. Sei dir wichtig. Du bist unendlich wertvoll. Dicke Umarmung & herzliche Grüsse Deine Nadja ❤️✨✨ ***** Klarheitsgespräch für 1:1 Coaching vereinbaren: https://www.nadjalang.com/termin Newsletter abonnieren: https://www.nadjalang.com/newsletter
Künstliche Intelligenzmodelle werden in Supercomputern verwendet, um Algorithmen und digitale Strukturen zu erschaffen, die direkt auf unseren Hirnstamm zielen. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit binden. Diese Modelle sind nicht neutral, sondern hinter ihnen stehen Firmen die viel Geld verdienen wollen und müssen. Es entsteht ein Aufmerksamkeitssog, aus dem wir nur schwerlich herausfinden. Wo liegen sind Deine Ausstiegspunkte? https://www.youtube.com/watch?v=F6XR0byERZY Tristan Harris: The AI dilemma Wissen & Werkzeuge für Menschen mit Feingefühl Veränderungsprozesse kreativ begleiten: Unsere Tools sind dafür geschaffen, aus einem soliden Freiraum heraus tief in Problematiken einzutauchen und den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. So ermöglichen wir Arbeit mit Substanz – im indivduellen Alltag und im Training von Menschen, die im sozialen und im therapeutischen Feld tätig sind. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig: von Konfliktmoderation über berufliche Profilbildung bis hin zur Klärung von Krisensituationen. Unsere Tools sind geeignet, um am Ball zu bleiben und das Gespür für die stimmige Spur zu behalten und zu vertiefen. https://zks-medien.de Der Freiraum-Kompass® Der Freiraum-Kompass® ist ein sensibles psychologisches Instrument, das dir dabei hilft, Entscheidungen präzise auszurichten. Besonders in Situationen, in denen du nicht weiter weißt, öffnet er dir neue Gestaltungsmöglichkeiten. Auf spielerische Weise kannst du mit diesem kleinen Werkzeug anhand von konkreten Fragen deine persönlichen Antworten finden. https://zks-medien.de/produkt/freiraum-kompass/ Der kleine Kopffreimacher Es gibt Phasen im Leben, in denen du aus persönlichen Gründen in der Schule oder auf der Arbeit keineswegs die volle Leistung erbringen kannst. Es gelingt dir nicht, die benötigte Kraft aufzubringen, um aufgetragene Aufgaben zu lösen. Der kleine Kopffreimacher beschreibt Übungen, die du in persönlichen Problemsituationen anwenden kannst, um deine Konzentration zu steigern. Bei regelmäßiger Anwendung der Übungen gelingt dir ein selbstbewusster Umgang mit herausfordernden Situationen aus eigener Kraft. https://zks-medien.de/produkt/der-kleine-kopffreimacher/
Tag 45 - Clean Pain & das Retikuläre Aktivierungssystem
Was ist Clean Pain und Dirty Pain? Schon mal gehört?Heute habe ich mit meinem Coach dieses Thema angeschaut. Und warum sehe ich überall nur dankbare Menschen?Wie das retikuläre Aktivierungssystem funktioniertDas retikuläre Aktivierungssystem, kurz auch RAS genannt, ist ein Netzwerk im Hirnstamm, welches im Jahr 1957 im Scientific American erstmals beschrieben wurde. Es fungiert als Sortierungssystem und verarbeitet pro Sekunde 400 Millionen Informationseinheiten, welche über unsere Sinne ins Hirn kommen.Fake it until you make it! Funktioniert das wirklich?Hormon Glow Academy:Hormon Glow Academy- Ausbildungsbroschürehttps://www.soulglowveda.com/projects-2Buch dir dein kostenloses Beratungsgespräch- ob Coaching, Hormon Glow Academy, Astrologie. Ich berate dich gerne:https://www.soulglowveda.com/consultationAyurveda Cleanse: Mach dich locker und leicht für den Sommer.Der wunderbare einzigartige Cleanse jetzt als DIY - Version.Ein tolles Yoga, Atem und Detox- Programm für alle Ebenen erwartet dich.Sparpreis - statt 99 € nur noch 79 €https://www.soulglowveda.com/fruhlings-cleanseDu findest mich in den sozialen Medien unter: Instagram: https://www.instagram.com/soulglowveda_claudia/Facebook: https://www.facebook.com/soulglowveda
Stressbedingte Spannungskopfschmerzen - 21 Fragen, die Du Dir stellen solltest, wenn Du Dich unausgeglichen fühlst
Ich möchte meine Herangehensweise mit dir teilen, falls du unter Kopfschmerzen oder Schwindel oder sonst einer wiederkehrenden körperlichen Symptom leidest. Kopfschmerzen sind ein sehr häufiges Problem für uns. Studien zeigen, dass etwa 90 Prozent der Männer und 95 Prozent der Frauen mindestens einmal im Jahr Kopfschmerzen haben. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein Zentrum des Nervensystems tief im Hirnstamm aus dem Gleichgewicht geraten zu sein scheint bei Kopfschmerzen, was die Schmerzen und die Veränderungen der Blutgefäße auslöst. Viele Dinge können Kopfschmerzen oder auch Migräne auslösen, darunter bestimmte Nahrungsmittel, Aktivitäten, Medikamente, Emotionen, Hormone und Sinneseindrücke wie helles Licht oder Lärm. Jeder Mensch hat ein bevorzugtes physiologisches System, das die Anhäufung von Stress und Ungleichgewichten zum Ausdruck bringt. Bei manchen ist es das Verdauungssystem, bei anderen ist es das Immunsystem, in dem sich das Unwohlsein durch angesammelten Stress manifestiert. Im Folgenden möchte ich dir eine Reihe von Fragen mitgeben, die du dir stellen kannst - eine Checkliste für die Wartung, wenn du so willst -, damit du erkennen kannst, warum du dich erschöpft oder unausgeglichen fühlst, warum du Kopfschmerzen oder ein anderes wiederkehrendes körperliches Symptom erleben könntest. Viel Spaß mit der Folge! --- Erlernen des neurogenen Zitterns zum Stressabbau im Gruppenmodus: https://www.karlajohannaschaeffer.com/gruppenkurs-masterclass 1:1 Begleitung der TRE Methode: https://www.karlajohannaschaeffer.com/angebot-angstbewaeltigung --- BONUS I ---> Ich habe einen Spickzettel mit meinen drei besten Möglichkeiten für das Entwickeln von Selbstvertrauen angefertigt, den ich mit dir teilen möchte. Tipps, wie du dich von der Selbstkritik abwenden und Gedanken annehmen kannst, die hilfreich sind und das Selbstvertrauen stärken. Hier kannst du dir diesen Leitfaden herunterladen: https://www.karlajohannaschaeffer.com/spickzettel-selbstvertrauen BONUS II Außerdem findest du auf der selben Seite als Download 12 Tipps, die du kennen solltest, wenn du mit starken Stress, Angst oder Panik kämpfst. Den von mir vorbereiteten Leitfaden kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite (unten in der Fußleiste der Seite) herunterladen. Viel Freude damit. Download auf: www.karlajohannaschaeffer.com
#115 - sanftes Vagusnerv-Yoga für Dein Nervensystem
In dieser Yogasequenz aktivieren wir gezielt Deinen Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der längste unserer 12 Hirnnerven. Er innerviert ab dem Hirnstamm in fast alle Organe unseres Körpers und ist ein wichtiger Teil des Parasympathischen Nervensystems, welches uns in Ruhe, Regeneration und Immobiliersierung versetzen kann.
Als gebürtige Rheinländerin packt Jana Anfang Februar das Karnevals-Fieber. Was passiert mit den Rheinländern, wenn man sie ihres natürlichen Habitats entzieht? In Janas Fall ist es ein unkontrolliertes sich im Bad einschließen in Konfetti duschen und heidnisch klingende Lieder grölen. Als eingewanderter Russe und eingebürgerter Niedersachse packt Alex bei diesem Szenario einzig die blanke Panik. Und damit es anderen Menschen, die mit Rheinländern in dieser Jahreszeit interagieren müssen besser ergeht, haben wir diese Folge gemacht. Wir gehen tief an Herz und Hirnstamm des Rheinländers zur Karnevalssaison. Ist diese Spezies gefährlich? Kann man mit ihr verhandeln? Wohin zieht die Karawane? Die Antworten auf all das und viel mehr. Bei WiLeWo Folge 2. Falls ihr Lust habt uns zu unterstützen, schaut gern hier vorbei: steady.de/wie-wir-leben-wollen
Harzer Sonnenzwerge e.V. bietet Hilfe für Kinder mit der Diagnose DIPG
Ein „diffuses intrinsisches Pongliom“ klingt nach etwas Komplizierten, das zugleich auch etwas schwer greifbar, eben diffus, ist. In Wahrheit ist so ein diffuses intrinsisches Pongliom (DIPG) aber absolut tödlich. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein seltener unheilbarer Gehirntumor, der im Hirnstamm wächst. Er ist leider nicht operabel und tritt häufig bei Kindern auf. Im Schnitt sterben Erkrankte schon nach neun Monaten. Heilbar ist die Krankheit nicht, nur zehn Prozent leben ...
Religiöse oder spirituelle Gefühle sind tief in unserem Gehirn verankert. Das belegen Forschende vom Brigham and Womens Hospital in Boston. Religiosität fanden sie im Hirnstamm. Das ist ein evolutionär sehr alter Teil unseres Gehirns. Basieren Religion und Spiritualität auch auf einer biologischen Grundlage? Diese Frage wird in religiösen Kreisen, aber auch in der Wissenschaft immer wieder diskutiert. Auf der Suche nach Antworten, untersuchten Forschende aus Boston nun die Gehirne von Patient:innen, welche sich Gehirnoperationen unterzogen hatten. Das Resultat: Religiöse oder spirituelle Gefühle veränderten sich, wenn die Operation an einem bestimmten Teil des Gehirns durchgeführt wurde. Was bedeutet das? Kann man spirituelle Gefühle also lernen? Was sagt das über unsere Religiosität oder Spiritualität aus? Diesen Fragen gehen wir in der Sendung Perspektiven zusammen mit dem Harvard-Forschenden Dr. Michael Ferguson nach.
Religiöse oder spirituelle Gefühle sind tief in unserem Gehirn verankert. Das belegen Forschende vom Brigham and Womens Hospital in Boston. Sie meinen Religiosität im Hirnstamm lokalisiert zu haben. Das ist ein evolutionär sehr alter Teil unseres Gehirns. Basieren Religion und Spiritualität auf einer biologischen Grundlage? Diese Frage wird in religiösen Kreisen, aber auch in der Wissenschaft immer wieder diskutiert. Auf der Suche nach Antworten, untersuchten Forschende aus Boston nun die Gehirne von Patient:innen, welche sich Gehirnoperationen unterzogen hatten. Das Resultat: Religiöse oder spirituelle Gefühle veränderten sich, wenn die Operation an einem bestimmten Teil des Gehirns durchgeführt wurde. Was sagt das nun über unsere Religiosität oder Spiritualität aus? Dieser Frage gehen wir in der Sendung Perspektiven nach - zusammen mit dem Harvard-Forschenden Dr. Michael Ferguson.
#103 – Interview mit Dr. Klehmet zu schubassoziierten Symptomen, Vorbeugung weiterer Schübe und dem Verhindern permanenter Defizite
MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast mit Nele Handwerker
Dr. Klehmet spricht über schubassoziierte MS-Symptome, die Vorbeugung weiterer Schübe und wie man permanente Defizite bei MS verhindert. Hier geht es zum Blogbeitrag: https://ms-perspektive.de/interview-mit-dr-klehmet-zu-schubassoziierten-symptomen-vorbeugung-weiterer-schuebe-und-dem-verhindern-permanenter-defizite/ In Folge 103 vom MS-Perspektive Podcast begrüße ich PD Dr. med. Juliane Klehmet. Sie ist ärztliche Leiterin vom MS-Zentrum am Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Wir sprechen über schubassoziierte MS-Symptome. Wie man Schüben der Multiplen Sklerose am besten vorbeugen und wenn es doch dazu kommt, permanente Defizite verhindern oder zumindest möglichst kleinhalten kann. Vorstellung Juliane Klehmet ist verheiratet mit einem Arzt und Mutter von zwei Kindern (12 und 14 Jahre). Die Freizeit verbringt sie sehr gern im Garten und mit Bücherlesen. Wichtigste Stationen bis zur jetzigen Position? Fachärztin in der Charité absolviert. Bis 2018 dort tätig gewesen im Bereich der Neuroimmunologie. Unter anderem untersuchte Dr. Klehmet Krebszellen und deren Autoaktivität. Klinisch arbeitete sie jahrelang in verschiedenen Spezialambulanzen, unter anderem der MS-Ambulanz der Charité. In 2018 übernahm sie dann die Leitung des MS-Zentrums am jüdischen Krankenhaus in Berlin. Persönliche Motivation für den Beruf? Aufgrund der Neuroimmunologie, was schon immer ein Schwerpunkt der Charité war. Die zunehmende Möglichkeit, die Krankheit behandeln zu können, war mit ein Grund, den Weg Richtung Multiple Sklerose einzuschlagen. Außerdem fand sie es spannend, dass sehr viel geforscht wird und dadurch immer mehr Therapieansätze entstehen, um MS-Patienten stetig besser behandeln zu können. Wie viele MS-Patienten betreuen sie insgesamt pro Jahr ambulant? Ambulant werden ca. 1.200 MS-Patienten behandelt, was zu rund 3.200 Patientenkontakten im Jahr führt. Rückbildung schubassoziierter Symptome Wie unterstützen sie ihre Patienten, damit sich MS-Symptome möglichst komplett zurückbilden? Zunächst geht es darum, Patienten darüber aufzuklären, dass es zu Schüben kommen kann und das es wichtig ist, dass sich die Patienten dann zeitnah melden, damit wir reagieren können. Am Anfang bedeutet das oft Verunsicherung für die Patienten, weil gerade frisch diagnostizierte nicht wissen, ob gerade ein Schub vorliegt oder nicht. Dafür ist die Vorstellung vormittags in unserer MS-Ambulanz gedacht. Anhand der Anamnese oder eventueller Untersuchungen oder eines MRTs klären wir, ob es ein neuer Schub ist. Das ist wichtig, weil wir die akute Schubtherapie frühzeitig einleiten müssen, sprich das hochdosierte Cortison. Die hoch antientzündliche Wirkung des Cortisons dämmt den Schub ein und hier gilt, je eher, desto besser. Wir überprüfen dann, wie gut das Cortison im Verlauf anschlägt. Eventuell muss eskaliert werden, was entweder eine doppelte Dosis Cortison ist. Und falls das auch nicht hilft, führen wir eine Plasmapherese durch. Das wird allerdings nur gemacht, wenn es um relevante Behinderungen, nicht bei Taubheitsgefühlen und Kribbeln. Im Fall von Sensitivitätsstörungen bitten wir die Patienten um Geduld. Solche Symptome dauern oft Wochen bis Monaten bis sie sich zurückbilden. Da müssen sie dem Körper Zeit gegeben werden. Bei motorischen Schüben spielt die unterstützende Therapie eine große Rolle, sprich Krankengymnastik, Ergotherapie, Logotherapie sind wichtige Faktoren bei der Rückbildung von Schüben. Und natürlich ist die Unterstützung durch Partner, Familie und das persönliche Umfeld eine wichtige Komponente auf dem Weg der Genesung. Gönnen sie sich im Falle eines Schubes Ruhe und Erholung, damit ihr Körper genug Energie hat sich zu regenerieren. Wie lange dauert es bis sich Symptome zurückbilden? Es sollte eine Dynamik erkennbar sein. Gerade bei Schüben, die durch motorische Symptome gekennzeichnet sind, wie Schwächegefühl und Lähmung, geht das schneller durch die Cortison-Behandlung, als bei sensiblen Schüben. Sensible Symptome dauern meist viel länger, eher Wochen oder Monate. Bei der Sehnerventzündung geht es oft auch etwas langsamer, dennoch muss eine Dynamik erkennbar bleiben, ansonsten eskaliert man. Schließlich geht es um die Sehkraft und dort soll kein Defizit bleiben. Vorbeugung weiterer Krankheitsschübe Welche Elemente gehören zur Prävention von Schüben und können sie diese gewichten? Die verlaufsmodifizierende Therapie ist der wichtigste Pfeiler für die Prävention von neuen Schüben und dem Verhindern von Läsionen im Gehirn. Damit soll verhindert werden, dass Nervenzellen untergehen oder sich auch bestehende Symptome verschlechtern. All diese Faktoren gehören zu den Zielen der MS-Behandlung – NEDA = No evidence of disease activity (keine Krankheitsaktivität – weder sichtbar, noch im Verborgenen). Falls NEDA nicht gelingt, ist das ein Hinweis darauf, dass eine hochwirksamere Therapie begonnen werden sollte (siehe »Hit Hard and Early mit Prof. Schwab«). Indikatoren dafür sind schwere Schübe, Schübe, die sich nicht oder nur schwer zurückbilden, viele Schübe, eine hohe Läsionslast im MRT. Es zählen auch ungünstig gelegene Läsionen dazu, z.B. am Hirnstamm oder im Rückenmark. Wenn einer oder mehrere der Faktoren zutreffen, empfehlen wir eine hochwirksamere Therapie. Natürlich müssen immer Nutzen und Risiko gegeneinander abgewogen werden. Feststeht, immer mehr retrospektive (rückblickende) Daten deuten darauf hin, dass durch den Einsatz verlaufsmodifizierender Medikamente, die Multiple Sklerose deutlich milder geworden ist. Und wenn MS-Patienten mit einem hochaktiven Verlauf frühzeitig in eine hochwirksame Therapie einsteigen, können sie die Krankheit stark abschwächen und eine bessere Langzeitentwicklung erzielen. Dabei ist die verlaufsmodifizierende Therapie gewiss die wichtigste Säule. Natürlich gehören auch Lebensstilfaktoren dazu. Vermeiden sie Nikotin, es verschlechtert den Verlauf deutlich. Vitamin D spielt eine Rolle, weshalb eine ausreichende Substitution erfolgen sollte. Der genaue Zusammenhang ist bisher allerdings noch nicht geklärt. [Anmerkung Nele Handwerker: Daher bitte keine Hochdosiseinnahme.] Die Ernährung sollte auf dem mediterranen Konzept basieren, viel Olivenöl und Gemüse, dafür wenig rotes Fleisch. Wenn Kohlenhydrate, dann ballaststoffreich. Außerdem hat sportliche Betätigung viele positive Effekte, sowohl auf den Krankheitsverlauf, als auch das Wohlbefinden der Patienten. Durch Sport können Schmerzen und Fatigue reduziert werden. Zusätzlich bekommt man als Patient das Gefühl, aktiv etwas machen zu können und der Krankheit nicht nur ausgeliefert zu sein. Deshalb empfehlen wir unseren Patienten von Anfang an, Sport zu machen. Auch im Hinblick auf das Gewicht. Denn Übergewicht wirkt sich ebenfalls eher negativ auf den Krankheitsverlauf aus. Übergewicht reduziert die Wirksamkeit von Medikamenten und verringert die Bildung von Vitamin D. Permanente Defizite verhindern Was können MS-Patienten tun, um permanente Defizite zu verhindern und wie unterstützen sie dabei? Sport und Krankengymnastik sind sehr wichtig für Patienten, gerade mit Spastik-Symptomatik. Muskeln können sich versteifen, wenn sie nicht regelmäßig bewegt werden. Das wurde leider zum großen Problem in der Pandemie, als Behandlungen für Patienten ausfielen, die schwerer betroffen sind. Krankengymnastik und Sport sind wirklich wichtig. Des Weiteren gehört eine ausreichende Versorgung mit Hilfsmitteln dazu. Die Hilfsmittel können sowohl unterstützen, aber auch am Anfang von auftretenden Problemen helfen, diese nicht größer werden zu lassen und Dysbalancen zu reduzieren bzw. diesen entgegenzuwirken. Auch Bewegungstrainer zuhause helfen. Leider erscheint es mir immer schwerer, diese Hilfsmittel bei der Krankenkasse durchzusetzen, obwohl es wichtig ist, frühzeitig gegenzusteuern und nicht erst, wenn die Einschränkungen unumkehrbar sind zu kompensieren. Dauerhafte Einschränkungen kleinhalten Wie versuchen Sie, entstandene Behinderungen gering zu halten und auf dem Level zu stabilisieren? Physiotherapie ist gut. Bewegen sie sich möglichst viel. Beim Thema kognitive Einschränkungen, wie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen ist es wichtig, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nicht zuhause einigeln, sondern Arbeiten gehen, solange das möglich ist. Aus ärztlicher Sicht schauen wir, dass wir das richtige Medikament einsetzen, sowohl für die verlaufsmodifizierende Therapie, aber auch die symptomatische Behandlung. Antispastika, spielen eine große Rolle. Wenn die Spastik und vielleicht begleitende Schmerzen stark ausgeprägt sind, kann medizinisches Cannabis helfen. Blasenstörungen müssen gut behandelt werden, aber auch Depressionen und Schmerzen. Wichtig ist, dass sie als Patient diese Probleme ansprechen, damit sie behandelt werden können. Eine begleitende Psychotherapie kann ebenfalls hilfreich sein, da die Psyche auf alle Bereiche – körperlich, geistig und seelisch – Einfluss hat. Generell gilt, dass die alleinige Immuntherapie sicherlich bei einem Großteil der Patienten nicht allein reichen wird. Blitzlicht-Runde Vervollständigen Sie den Satz: „Für mich ist die Multiple Sklerose… …eine Erkrankungen, die wir zunehmend besser verstehen, kein Grund ist zu verzweifeln, da immer mehr und bessere Optionen bestehen. Und wo ich gespannt bin, was wir in den nächsten Jahren noch an zusätzlichen Möglichkeiten bekommen, um Patienten noch besser zu unterstützen.“ Welche Internetseite können Sie zum Thema MS empfehlen? DMSG.de Amsel.de KNMS – Kompetenznetz Multiple Skerose Welchen Durchbruch in der Forschung und Behandlung zur MS wünschen Sie sich in den kommenden 5 Jahren? Einen Biomarker, der mir sagt, welchen Patienten ich von Anfang an mit welchem Medikament am besten behandle. (Statt bisher eher ein ausprobieren, aufgrund der 1.000 Gesichter der MS.) Bessere Behandlungsoptionen für die chronischen Verläufe, die den Untergang der Nervenzellen verhindern und gegen den degenerativen Verlauf gut anschlagen. Vermutlich wird es auf eine kombinierte Therapie herauslaufen. Verabschiedung Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf dem Weg geben? Die MS ist keine Diagnose zum verzweifeln. Wenden sie sich von Anfang an an einen Experten, damit die richtige Therapie eingeleitet werden kann. Und leben sie möglichst so weiter, wie bisher. Wie erreicht man das MS-Zentrum am Jüdischen Krankenhaus am besten? Über die Webseite und am besten per E-Mail: sekretariat-neurologie[at]jkb-online.de oder per Telefon: 030 4994-2388. Wichtig, wir brauchen eine Überweisung, damit wir mit unserer Arbeit beginnen können. ++++++++++++++++++++ Vielen Dank an Dr. Juliane Klehmet für das geführte Interview, die gebündelten Informationen und den positiven Zuspruch zum guten Umgang mit Multipler Sklerose. Bestmögliche Gesundheit wünscht dir, Nele Mehr Informationen rund um das Thema MS erhältst du in meinem kostenlosen Newsletter. Hier findest du eine Übersicht zu allen bisher veröffentlichten Podcastfolgen.
Werde zum Goldgräber deines Kindes
Wie du die Goldadern „Hirnnerven“ für kindliches Erblühen freilegst Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk und verfügt über unglaubliche Selbstheilungskräfte, diese Erfahrung mache ich täglich in meiner Kinder Osteopathie Praxis. Und innerhalb des in diesem Monat schon erforschten schwebenden Gehirnes gibt es im Hirnstamm, von dem auch die in der letzten Woche von dir erforschten Frühkindlichen Reflexe stammen, Kernbereiche von wichtigen Nerven, die den Schädel direkt verlassen oder ihn durchlaufen: Die sogenannten Hirnnerven Erwecke diese wichtigen Nerven für dein Kind für: Augen, Augenmotorik, Mimik, Kiefer, Saugen, Schlucken, Verdauung, Zungen Bewegung, Gleichgewicht u.v.m zu lebendiger Anatomie! Viele spannende Erkenntnisse und Einsichten wünscht dir Dein Stefan -- Listen on: Stefanrieth.com: http://bit.ly/2y4pWm1 Itunes: https://apple.co/2JoJhlZ111 Stitcher: http://bit.ly/dncst Spotify: https://spoti.fi/2HdY6al Youtube: http://bit.ly/2zUho2h -- Bewerte diese Folge und den Podcast gerne mit 5 Sternen bei Itunes, Spotify oder Stitcher für einen echten Bewusstseinswandel! Kommentiere diese Folge, deinen Mehrwert und deine Erfahrungen bei Instagram:https://www.instagram.com/stefan.rieth/ Oder teile mit anderen bei Facebook deine Gedanken dazu: https://www.facebook.com/stefanriethcom/ Dein Stefan Rieth --- Ausschluss von Heilungsversprechen Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Osteopathie um nicht wissenschaftlich und/oder schulmedizinisch anerkannte und/oder bewiesene Verfahren handelt und die Wirksamkeit wissenschaftlich und/oder schulmedizinisch nicht anerkannt ist. Besonderer Hinweis zum HWG (Heilmittelwerbegesetz) Aus rechtlichen Gründen weise ich besonders darauf hin, das bei keinem der aufgeführten Therapien- oder Diagnoseverfahren der Eindruck erweckt wird , das hier ein Heilungsversprechen meinerseits zugrunde liegt, bzw. Linderung oder Verbesserung einer Erkrankung garantiert oder versprochen wird. Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitte ich um eine entsprechend kostenfreie Nachricht. Ich werde die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernen, ohne dass die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Etwaig ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten jedweder Art werden insgesamt zurückgewiesen. Abmahnungen Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Sollte der Inhalt der Aufmachung meiner Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitte ich um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Ich garantiere, dass die zu Recht beanstandeten Textpassagen unverzüglich entfernt werde, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ferner werde ich von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelösten Kosten vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. Ziel dieses Hinweises ist keine Abmahnung z.B. formlose E-Mail) zu erhalten, sondern nicht mit den Kosten einer anwaltlichen Abmahnung belastet zu werden. Es ist nicht vertretbar, in einem solchen Falle die Notwendigkeit einer anwaltlichen Abmahnung zu bejahen.
52 | Der Vagusnerv: der unbekannte Held in unserem Körper
Der Vagus nimmt eine wichtige Rolle in unserem vegetativen Nervensystem ein. Ist er stark ausgeprägt, dann fühlen wir uns wohl und sind gesund. Ist er hingegen schwach, dann ist davon unsere Gesundheit betroffen. Der Vagusnerv ist ein sehr langer Hirnnerv, der vom Hirnstamm durch den Brustbereich, entlang der Luftröhre, bis in den Bauchraum reicht. Entlang des Weges zweigt er zu den einzelnen Organen ab, wie zum Herzen, zu den Lungen und zum Magen-Darm-Trakt. Der Vagusnerv ist an der Regulation fast aller innerer Organe beteiligt. So steuert er die Aktivität von Herz, Magen-Darm-Trakt, Lunge, Nieren, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse und der Geschlechtsorgane. Der Vagus Nerv ist ein wahrer Underdog. Kaum jemand kennt ihn, dabei nimmt er eine so wichtige Rolle in Deinem Gesundheitssystem dar. Höre Dir diese spannende Episode auf jeden Fall an. Es war eine Wunschepisode von mehreren Hörern. Wir freuen uns wie immer über Spenden via Paypal: Empfänger: info@rebellu.com
# 08 Uli Funke – Erfolg liegt zwischen den Ohren
Uli Funke ist zu Gast. Er ist Experte für angewandte Neurowissenschaft und sagt: "Erfolg liegt zwischen den Ohren®" Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Uli Funke spricht von drei evolutionär bedingten Hirnregionen, die er bildlich als Frosch, Maus und Mensch beschreibt. Wofür ist das Kleinhirn zuständig? Wofür ist der Hirnstamm zuständig? Beide Hirnbereiche stammen aus der Zeit der Amphibien - darum wird diese Hirnregion auch als das Amphibien-Gehirn bezeichnet. Hier sitzen die Affekte: Fresstrieb, Fortpflanzung und Aggressionsverhalten wie Verteidigen, Fliehen und Todstellen. Die Affekte werden schnell umgesetzt und haben einen massiven Einfluss auf unser Leben. Diese Funktionen laufen unbewusst ab und sind daher kaum zu lenken. Das ist auch gut so, da sie unsere Existenz sichern - also das Überleben, Erhalt der Spezies und das soziale Überleben. Wofür ist das Zwischenhirn da? Das Zwischenhirn hat sich bei Säugetieren entwickelt. Uli Funke nennt es bildlich das Mäusegehirn. Hier werden Emotionen, Bindung, Sicherheit und Neugierde gesteuert. Auch dieser Bereich ist unterbewusst und nur schwierig zu beeinflussen. Uli Funke, was macht das Großhirn? Nach allem was wir wissen, hat der Mensch das komplexeste Großhirn mit den meisten Funktionen. Seit ca. 300.000 Jahren unterscheidet sich das Großhirn des verstehenden Menschen und Primaten signifikant. Das Großhirn ist Sitz von Verstand, Bewusstsein, Willen, Rationalität, Logik, Vernunft, Moral, Ethik, Sprache und auch der Kreativität. Diese Funktionen sind uns bewusst. Daher wird hier auch gerne vom Cockpit gesprochen. Fazit: Je älter die Hirnfunktion desto stärker beeinflusst sie unser Leben. Wie funktioniert das Gehirn? Wie werden Reize verarbeitet? Das Gehirn besteht aus Neuronen (Hirnzellen) mit Synapsen. Es gibt keine feste Verdrahtung, sonst gäbe es nur 0 und 1 als Signal. Stattdessen wird der Reiz zwischen Neuron und Synapse biochemisch übertragen. Neurotransmitter, Neuromodulatoren und Hormone verändern diese Reize. Uli Funke beschreibt dies wie einen Dimmer am Lichtschalter. Warum ist das Unterbewusstsein stärker als das Bewusstsein? Es führen viele Nervenbahnen von Frosch- und Mausareal zum Großhirn. Daraus bilden sich dicke Nervenbahnen über die man - bildlich gesprochen - stolpern würde. Während aus dem Cockpit, dem Großhirn, dem Bewusstsein, nur wenige dünne "Drähtchen" hemmend auf die "Datenautobahnen" einwirken. Wie steigere ich meinen Willen, Willenskraft und Disziplin? Durch Meditation und Achtsamkeitstraining lässt sich der Wille ähnlich wie Muskeln trainieren. Die Synapsen werden verstärkt, wenn dieser Reiz häufiger benutzt wird, dadurch wird es immer leichter das wiederholte Verhalten zu zeigen. Welche Beweise gibt es für erfolgreiches Hirntraining? Im Kernspintomographen lässt sich bei Menschen mit langjährigem Achtsamkeitstraining und Meditation erkennen, dass der Mandelkern, Amygdala, das Zentrum für Angst und Stressverarbeitung, verkleinert ist und der präfrontale Cortex (Bewusstsein) stärker vernetzt war. Kurz: Achtsamkeitstraining ist Bewusstseinstraining. Hier gibt es noch einen weiterführenden Blog und Podcastfolge zum Thema bewusstes Wahrnehmen Fazit: Bewusstsein und Willenskraft ist trainierbar Welche Alternativen gibt es zu Meditation? Eine Alternative zu Meditation ist bewusstes Wahrnehmen. Welche Bücher und Filme empfiehlt Uli Funke? Tobias Esch: Der Selbstheilungscode: Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit https://amzn.to/37hOda6 Bernd Hufnagl: "Besser fix als fertig: Hirngerecht arbeiten in der Welt des Multitasking" https://amzn.to/2IOFAKL Der Film: Ex Machina https://amzn.to/3np2G9O Alle Links zu Uli Funke: Hier geht es zu der Akademie für angewandte Neurowissenschaft: https://ulifunke.academy SOCIAL MEDIA: XING: https://www.xing.com/profile/Uli_Funke2 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/uli-funke-0b64b2136
Atem ist Leben. OK das ist jetzt kein neuer Erkenntnisgewinn. Das Atmen ist mir auch so selbstverständlich, dass ich nicht ständig darüber nachdenke. Und doch ist es ein Wunder der Natur. Im Mutterleib ist die Lunge des Kindes noch vollständig mit einer von der Lunge selbst produzierten Flüssigkeit gefüllt. Sie sorgt dafür, dass sich die Lunge entwickelt. Kurz vor der Geburt wird die Flüssigkeit dann nach und nach abgebaut und direkt nach der Geburt sendet der neue Erdenbürger seinen ersten Laut in diese Welt zur Freude der Eltern. Dabei wird der letzte Rest der Flüssigkeit abgehustet und erst dann kann das Kind seinen ersten Atemzug tun. Das Leben beginnt so gesehen mit dem Ausatmen. Das Einatmen ist ein aktiver Vorgang und wird durch Muskelbewegung ermöglicht, während die Ausatmung passiv verläuft. Die Luft fließt beim Ausatmen einfach und unangestrengt aus uns heraus.Das Atemzentrum liegt im Hirnstamm und koordiniert die Arbeit der Atemmuskulatur, so dass mein Körper normalerweise genau soviel an Sauerstoff bekommt, wie er benötigt. Vorausgesetzt ich lasse meinen Körper einfach seine Arbeit machen und mein Kopf - also meine Gedanken - funken nicht immer dazwischen. Wie bereits erwähnt, geht das Atmen völlig unbewusst vor sich – selbst bei Bewusstlosigkeit funktioniert das Atemzentrum im Gehirn. Das Erlernen richtiger Atmung wiederum kann zur Heilung körperlicher und psychosomatischer Störungen beitragen und depressive Phasen lindern. Je länger ich übe, desto höhere Mengen des Stresshormon Noradrenalin braucht es, damit sich mein Blutdruck und meine Herzschlagfrequenz erhöhen. Je achtsamer ich dem Atem gegenüber werde, desto mehr bin ich in der Gegenwart. Ich richte mich wieder auf meine eigene Mitte aus. Der Atem und andere Körperempfindungen dienen mir dabei als Bezugspunkt. Sich zu entspannen bedeutet aus dem Hamsterrad der ständig kreisenden Gedanken bewusst auszusteigen. Das wirkt beruhigend auf den Geist und ich entwickele so eine innere Stabilität, die mir auch in den Belastungssituationen des Alltags zugute kommt. Beim Einatmen nehme ich die Welt in mir auf und beim Ausatmen werde ich Teil dieser Welt. So werden langsam der Atem, das Atmen und der Atmende eins. So nutze ich beim Meditieren die Atmung dazu meine Gedanken zu beruhigen und bewusst ein körperliches und seelisches Wohlbefinden herbeizuführen.
#001: Dein Gehirn – das Wunderwerk der Natur
In dieser Podcastfolge willst du dein Gehirn erstmal kurz kennenlernen. Du wirst hier einige Grundlagen und ein paar interessanten Fakten aus der Gehirnforschung erfahren und die wichtigsten Gehirnfunktionen kennenlernen.
Sei schlagfertig: So konterst du mit Witz und Humor // Margit Hertlein
Margit Hertlein ist Humortrainerin und verrät, was dein Gehirn, dein limbisches System, deine Emotionsregulation und deine Grundbedürfnisse miteinander verbindet. Na, weißt du’s vielleicht schon? Wer die Antwort nicht kennt, der sollte sich selber nicht so ernst nehmen und unbedingt den Podcast anhören. Es lohnt sich. Viel Spaß! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jede Woche neue Videos mit tollen Vorträgen und Impulsen unserer Top-Speaker. Jetzt den GEDANKENtanken Channel abonnieren: https://goo.gl/6VAAHg Wusstest du schon? Du findest jedes Video auch als Podcast! Auf iTunes: https://rebrand.ly/GTiTunesyoutube Castbox: https://rebrand.ly/GTCastboxyoutube Auf Spotify: https://rebrand.ly/GTSpotifyyoutube Du willst nichts mehr verpassen? Werde jetzt Fan auf Facebook: https://goo.gl/ruW6by -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Kommunikations- und Humortrainerin startet ihren Vortrag mit humorvollen Fragen: „Warum lachen Krokodile nicht? Wie ist das Gehirn in meinen Kopf gekommen? Und warum fällt mir kein lockerer Spruch ein, wenn ich blöd angeredet werde?“ Zur Erörterung der Antwort gibt Margit Hertlein einen Einblick in die Entwicklung des Gehirns und stellt den Hirnstamm bzw. das Stammhirn näher vor. Wusstest du, dass dein Stammhirn für Essen, Trinken, Schlafen und deine Atmung verantwortlich ist? Das limbische System regelt deine Emotionen, wohingegen das Großhirn für Rechnen, Lesen, Schreiben und ähnliche Funktionen verantwortlich ist. Margit Hertlein: „Das Fatale ist: Wenn wir uns angegriffen fühlen, dann schicken wir unser Großhirn spazieren.“ Die Lösung: Wer das Leben mit Humor nehmen und über sich selbst lachen kann, dem geht es deutlich besser. Was die Konstruktion unserer Gedanken damit zu tun hat und wie wir im Alltag mehr Schlagfertigkeit und Kreativität anwenden, erfährst du im Podcast. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mach JETZT die kostenlose Business-Erfolgs-Analyse für Selbstständige und identifiziere deine Erfolgskiller für mehr Bekanntheit, Kunden und Umsatz: https://goo.gl/hZdyVL Hier findest du mehr Videos zum Thema… ...Kommunikation & Rhetorik: https://goo.gl/SW9dY4 ...Marketing & Sales: https://goo.gl/rTvFrE ...Persönlichkeitsentwicklung: https://goo.gl/gKcPWW ...Gesundheit & Leistung: https://goo.gl/j3XTY4 ...Mitarbeiterführung: https://goo.gl/tMTSLn ...Organisation & Produktivität: https://goo.gl/qor9QK Du bist Fan von GEDANKENtanken? Hier findest du… ...unseren kostenlosen Persönlichkeitscheck: https://bit.ly/2lFDUnT ...unsere kostenlose Business Erfolgsanalyse: https://bit.ly/2Mu0NWE ...unsere Facebookseite: https://goo.gl/ruW6by ...unsere Rednernächte: https://goo.gl/QkM4tQ ...unsere Business Factory : https://goo.gl/VAU3vT ...unser Führungskräftetraining: https://goo.gl/LrUDgr
Interview mit einer neugierigen Trainerin, die immer mehr über das Lernen wissen möchte. Wenn Lernen schwer fällt, kann es daran liegen, dass alte im Hirnstamm liegende Muster uns hindern. Mit welchen einfachen Übungen sollte man den Schulalltag beginnen, um sich aufs Lernen einzustellen. Erster Tipp: Starte mit Wasser!
10 - Hirnstamm (Basis, Tegmentum, Tectum); Entwicklung der Großhirnbahnen 2016/2017
10 - Hirnstamm (Basis, Tegmentum, Tectum); Entwicklung der Großhirnbahnen 2016/2017
16 - Sensomotorik: Anterolaterales System; deszendierende antinozizeptive Systeme; allgemeiner Aufbau des Hirnstamms 2014/2015
16 - Sensomotorik: Anterolaterales System; deszendierende antinozizeptive Systeme; allgemeiner Aufbau des Hirnstamms 2014/2015
7 - Entwicklung von Hirnstamm, Kleinhirn und Plexus choroideus 2014/2015
7 - Entwicklung von Hirnstamm, Kleinhirn und Plexus choroideus 2014/2015
Dichte von Mikrogefäßen im Kleinhirn beim plötzlichen Kindstod
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
In der hier vorliegenden Arbeit wurde die Hypothese überprüft, ob die mittlere Mikrogefäßlängendichte im Kleinhirn bei plötzlichem Kindstod (SIDS [„sudden infant death syndrome“]) als Ausdruck einer chronischen subklinischen Hypoxie größer ist als bei alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen (d.h. bei Kindern, die innerhalb des ersten Lebensjahres nicht an SIDS verstorben waren). Diese Hypothese basierte auf Literaturangaben über hypoxische Veränderungen im Gehirn bei SIDS, insbesondere im Hirnstamm, aber auch im Kleinhirn. Zwischen Hirnstamm und Kleinhirn besteht eine enge topografische und funktionelle Nähe in Bezug auf die Gefäßversorgung; so werden sowohl der Hirnstamm als auch das Kleinhirn aus Ästen der Arteriae vertebrales und der Arteria basilaris versorgt. Untersucht wurden insgesamt n=23 Kleinhirnhälften (je eine Kleinhirnhälfte pro Fallnummer) von Kindern, die im ersten Lebensjahr verstorben waren. Von diesen n=23 Kleinhirnhälften stammten n=9 von SIDS-Fällen (im Alter zwischen zwei und zehn Monaten verstorben), n=9 von alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen, sowie n=5 weitere von Kontrollen, die entweder in einem früheren oder einem späteren Alter als die SIDS-Fälle gestorben waren. Für jede Kleinhirnhälfte wurde an Serien von 100 µm dicken Schnitten, die immunhistochemisch zum Nachweis von Kollagen IV aufgearbeitet und mit Cresylviolett gegengefärbt wurden, mit modernsten design-based stereologischen Methoden das Volumen aller Kleinhirnschichten sowie die Mikrogefäßlängendichte in diesen Schichten bestimmt. Bei einer Nebenuntersuchung an weiteren Schnitten aus dem Vermis erfolgte ein immunhistochemischer Nachweis von GFAP. Bis auf die äußere Granularzellschicht zeigten alle Schichten des Kleinhirns mit zunehmendem Alter einen statistisch signifikanten, altersabhängigen Anstieg des Volumens. Bis auf die innere Granularzellschicht, die bei den SIDS-Fällen im Mittel statistisch signifikant größer war als bei den gematchten Kontrollen, fanden sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den SIDS-Fällen und den gematchten Kontrollen. Sowohl bei den SIDS-Fällen als auch bei den Kontrollen fand sich die höchste Mikrogefäßlängendichte in der Purkinjezellschicht, und die niedrigste Mikrogefäßlängendichte in der äußeren Granularzellschicht. Die mittleren Gefäßlängendichten der einzelnen Schichten zeigten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den SIDS-Fällen und den gematchten Kontrollen. In allen fünf Kleinhirnschichten wurden altersunabhängig sowohl bei den SIDS-Fällen als auch bei den Kontrollen Gefäßverzweigungen gefunden. Der immunhistochemische Nachweis von GFAP zeigte in der Molekularschicht bei allen Altersstufen immunpositive Bergmann-Gliafasern, und in der Purkinjezellschicht, der inneren Granularzellschicht und der weißen Substanz bei allen Altersstufen immunpositive Astrozyten. Unterschiede zwischen den SIDS-Fällen und den jeweils gematchten Kontrollen lagen bei dem immunhistochemischen Nachweis von GFAP nicht vor. Insbesondere fanden sich bei den SIDS-Fällen keine Anzeichen für Astrozyten-Aktivierung wie z. B. vergrößerte Perikarien oder kürzere, erweiterte Fortsätze. Zusammen mit den Ergebnissen der hier vorliegenden Arbeit und den Publikationen von Kiessling et al. (2013a; 2013b) liegen somit erstmals für Kleinhirne von SIDS-Fällen und gematchten Kontrollen vier verschiedene schichtenspezifische Befunde zum möglichen Vorliegen von akuter und/oder chronische Hypoxie vor, die u. a. mit modernsten design-based stereologischer Methoden erhoben wurden (Mikrogefäßlängendichten, Form und Menge von Astrozyten, Gesamtzahlen von Purkinkjezellen, und Konzentration von Calbindin-D28k in den Purkinjezellen). Dabei fanden sich keinerlei Anzeichen für akute und/oder chronische Hypoxie im Kleinhirn bei SIDS, so dass die eingangs formulierte Hypothese verworfen werden musste.
Eigentlich hatten die Ärzte den Berliner Sven Marx aufgegeben. Seiner Frau sagte man, dass er für den Rest seines Lebens ein Pflegefall bleiben würde. Zu schlimm waren die Auswirkungen eines seltenen Tumors am Hirnstamm. Die Hälfte des Tumors konnte man wegoperieren, es kam aber zu schweren Komplikationen und Marx musste mehrfach wiederbelebt werden. Dann gab es Einblutungen, die Folge war eine halbseitige Lähmung, Marx konnte nicht mehr alleine atmen. Nach drei Monaten Intensivstation hatte man ihn eigentlich abgeschrieben. Trotzdem folgte eine Reha-Behandlung, in der sich Sven Marx ins Leben zurückkämpfte. Nach ersten Schritten am Rollator trainierte er seine Muskeln, wo er nur konnte. Er wollte möglichst bald Schwimmen und Radfahren können. „Mich für diesen schweren Kampf zu motivieren, war überhaupt nicht schwer, denn ich wollte einfach nur leben". In einem langen Trainingsprozess konnte er seine Fähigkeiten nach und nach soweit trainieren, dass immer längere Touren möglich wurden. Reisen nach Usedom oder Kopenhagen oder Paris hat er schon hinter sich, zusammen mehrere tausend Kilometer durch Länder Europas. Als weitere Erkrankung wurde bei Sven Marx auch noch Schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. „Die Ärzte geben mir dafür aber eine ganz gute Prognose". Dies ist kein Betroffenheitsbericht, Sven Marx ist es besonders wichtig, mit seiner Geschichte anderen Betroffenen Mut zu machen. Mut das Leben auch nach oder mit einer schweren Erkrankung wieder in die Hand zu nehmen.
Bildgebende und neurophysiologische Untersuchungen zur Lokomotion bei PSP-Patienten und Anwendungsbeobachtung von Rasagilin
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Analyse der Gangstörung bei der progressiven supranukleären Blickparese, einer Tauopathie, mittels der Auswertung von Sturzprotokollen, der Posturographie und der funktionellen Positronen-Emissions-Tomographie (fPET). Die fPET ermöglichte die exakte Darstellung beteiligter Lokomotionszentren unter realen Bedingungen (aktives Gehen). Ein besseres Verständnis der Funktionskette des Lokomotionsnetzwerkes ließ sich auf diese Weise erarbeiten. Zusammenfassend beinhaltet das supraspinale Lokomotionsnetzwerk die kortikale Lokomotionsregion, die Signale via Basalganglien an die Ganginitiationszentren im dorsalen Hirnstamm sendet. Die mesencephale Lokomotionsregion (MLR) und die cerebelläre Lokomotionsregion (CLR) modulieren den Kraftgrad und die Geschwindigkeit der Bewegung und integrieren Signale der Sinnesorgane. Ein neuer therapeutischer Ansatz, die Gabe von Rasagilin, einem Monoamin-Oxidase-B-Inhibitor mit potentiell neuroprotektiven Eigenschaften, wurde anhand von Sturzprotokollen und der Posturographie dokumentiert und die Ergebnisse mit bisherigen Daten dieses Medikaments bei der Parkinson-Erkrankung verglichen und dessen Einfluss auf verschiedene Krankheitssymptome bewertet. Dabei wurden pathophysiologische Merkmale der PSP dargestellt und mögliche Angriffspunkte der pharmakologischen Intervention erörtert. Im Rahmen der Anwendungsbeobachtung konnte gezeigt werden, dass sich zumindest in den ersten 7 Monaten nach Gabe von Rasagilin bei vielen Patienten eine leichte Verbesserung oder Stabilisierung der Sturzhäufigkeit einstellte. Weitere klinische Parameter wie das verminderte Auftreten einer Pneumonie, die langsamere Entwicklung einer Dysphagie und ein positiver Effekt auf die Stimmungslage fielen uns bei der Behandlung auf. Der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte pharmakologische Ansatz mit Rasagilin und die Bildgebung der Lokomotionszentren mit der funktionellen Positronen-Emissions-Tomographie sind neu im Umgang mit der progressiven supranukleären Blickparese. Sowohl der intrazelluläre Wirkmechanismus von Rasagilin als auch das bessere Verständnis der zentralen Erstellung der Lokomotion sind wichtig, um die PSP in Zukunft besser diagnostizieren und therapieren zu können.
Braincast 118 - Grundsätzliches: Stammhirn
Auch wenn es im Schatten des Großhirns steht – der Hirnstamm trägt nicht nur das ganze Konstrukt, er ist auch für grundlegende und überlebenswichtige Aufgaben verantwortlich. Dies ist seine Episode.
Ursachen und Charakteristik von Kopfverletzungen bei tödlichen Kraftradunfällen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Ursachen und Charakteristik von Kopfverletzungen bei tödlichen Motorradunfällen mit Helmträgern ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Untersucht wurden 116 tödlich verletzte Motorradbenutzer. Es sollen die Zusammenhänge zwischen Kopfaufprallwinkel und daraus resultierender Verletzungsart des Kopfes und deren Mechanismen dargestellt werden. Hierfür wurden fünf nach ihrer Lokalisation definierte Anprallbereiche bestimmt, die Strukturen des Kopfes wurden zur einheitlichen Verletzungserfassung und besseren Vergleichbarkeit in bestimmte Schemata eingeteilt. Auffallend war die hohe Verletzungsbeteiligung der Grosshirnregion, teilweise unabhängig von knöchernen Schädelverletzungen. Kleinhirn und Hirnstamm waren unabhängig von der Anpralllokalisation prozentual in etwa gleich betroffen. Dies lässt den Schluss zu, dass sowohl die direkten als auch die indirekten Verletzungsmechanismen bezüglich der Verletzungsausprägung eine erhebliche Rolle spielen.
Störungen der feinmotorischen Kraftkontrolle nach Schlaganfall
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
In der vorliegenden Studie wurde bei 19 Patienten, die nach einem Schlaganfall feinmotorische Störungen und Sensibilitätsdefizite der oberen Extremitäten aufwiesen, die Steuerung der Griffkraft beim Halten und Bewegen eines Objektes untersucht. Bei allen Patienten lagen unilaterale zerebrale Läsionen vor, die kortikale und subkortikale Bereiche des Großhirns betrafen; Strukturen im Hirnstamm und Kleinhirn waren nicht miteinbezogen. Analysiert wurde die Griffkraft beim ruhigen Halten, Anheben und Transportieren und Auf- und Abbewegen des kabellosen Testobjekts. Neben den auf das Objekt ausgeübten Griffkräften wurden auch die Beschleunigungen und die auf das Objekt wirkenden Lastkräfte bestimmt. Die Patienten übten mit ihrer betroffenen Hand bei allen Objektmanipulationen deutlich höhere Griffkräfte als die Kontrollgruppe auf das Objekt aus. Das Verhältnis von Griff- und Lastkraft, welches als Maß einer ökonomischen Krafteinteilung angesehen werden kann, war bei den Patienten signifikant erhöht. Hinsichtlich der zeitlichen Korrelation von Griff- und Lastkraft zeigte sich, dass die antizipatorische Steuerung der Griffkraft auch bei zerebraler Schädigung erhalten blieb; Griff- und Lastkraft wurden synchron moduliert. Allerdings ergab die Kreuzkorrelation bei den zyklischen vertikalen Bewegungen leichte Defizite in der Feinabstimmung beider Kräfte. Des Weiteren war beim Transportieren des Objektes die Kraftproduktion in der Anhebephase auf der betroffenen Seite verzögert. Mittels eines kleinen zwischen Daumen und Zeigefinger gehaltenen Kraftmessers wurden neben den beschriebenen manipulativen Aufgaben elementare Leistungsaspekte der Griffkraft-Steuerung, wie statische und dynamische Präzision, Schnelligkeit, Maximalkraft und Reaktion auf eine plötzliche Laständerung, erfasst. Es zeigten sich hohe Korrelationen zwischen Kraftniveau bei den Objektmanipulationen und der Auslenkung der Finger bei Reaktion auf eine plötzliche Lastkrafterhöhung. Letzteres stellt ein sensitives Maß für Sensibilitätsstörungen dar. Während also für die Anpassung der Griffkrafthöhe eine intakte sensorische Wahrnehmung Vorraussetzung ist, ist die antizipatorische Modulation der Griffkraft mit der Lastkraft ein automatisierter, von afferenten Inputs weitgehend unabhängiger Prozess. Bei der Feinabstimmung beider Kräfte allerdings spielen sensorische Einflüsse eine Rolle. Die Ergebnisse dieser Arbeit bekräftigen damit das vorherrschende Modell einer antizipatorischen Griffkraft-Steuerung anhand interner Modelle, wobei diese Funktion wohl tiefer liegenden Hirnstrukturen zugeordnet werden kann. In früheren Arbeiten wurde v. a. das Kleinhirn diskutiert. Anhand sensibler afferenter Signale scheint dieser grundlegende feedforward-Mechanismus der Griffkraft-Steuerung von kortikalen Strukturen jedoch noch präzisiert zu werden.
Funktionelle Magnetresonanztomographie zur Darstellung zerebraler Aktivierungen bei thermischen Schmerzreizen ohne Medikation sowie nach Gabe von Remifentanil und Metamizol
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Ziel. Thema der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der zerebralen Schmerzverarbeitung. Mit der Methode der funktionellen Magnetresonanztomographie sollten Kortexareale lokalisiert werden, die bei thermischer Schmerzreizung am linken Vorfuß eine Aktivitätszunahme zeigen. Ziel war es, diese unter standardisierten Bedingungen reproduzierbar nachzuweisen und damit die Voraussetzung zu schaffen, Veränderungen dieser Aktivierungen bei Sauerstoff- und Analgetikagabe zu erfassen. Methodik. Zunächst wurden die physikalischen Grundlagen der Bilderzeugung mittels Magnetresonanztomographie vorgestellt. Dabei wurde insbesondere auf die funktionelle Bildgebung und die zugrunde liegende Physiologie eingegangen. Im speziellen Methodikteil wurden das untersuchte Kollektiv (6 gesunde Probanden) und der Versuchsablauf beschrieben. An einem 1,5 Tesla Magnetresonanztomographen wurden mit Hilfe von T2*-gewichteten Sequenzen funktionelle Bilddaten der Probandengehirne bei schmerzhafter und neutraler thermischer Stimulation am linken Fußrücken aufgezeichnet. An vier der Probanden wurden diese Messungen jeweils viermal wiederholt, um schmerzspezifische zerebrale Aktivierungen zu erfassen und deren intra- und interindividuelle Variabilität zu überprüfen. Im Anschluss wurden diese funktionellen Messungen an allen Probanden ohne und mit Gabe von Sauerstoff durchgeführt, um einen denkbaren negativen Effekt der bei Analgetikagabe erforderlichen Sauerstoffapplikation auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen auszuschließen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die Auswirkungen von Schmerzmedikamenten auf die zerebrale Aktivität bei Schmerzreizen zu untersuchen. In einem Pilotversuch wurde die beschriebene Messmethodik bei drei Probanden unter Gabe von Remifentanil, Metamizol und Kochsalzlösung in randomisierter Abfolge eingesetzt. Die Auswertung der funktionellen Bilddaten erfolgte anhand des General Linear Model (Softwarepaket FSL). Hiermit konnten sowohl individuelle zerebrale Aktivierungen erfasst, als auch Gruppenanalysen durchgeführt werden. Ergebnisse. Bei den Experimenten zur Lokalisation der zerebralen Aktivierungen konnten bei schmerzhafter Stimulation aktivierte Areale am häufigsten im frontalen Operculum und benachbarten Inselkortex, im dorsolateralen präfrontalen Kortex, im Gyrus frontalis medius, im anterioren Cingulum und im parietalen Operculum/SII Kortex nachgewiesen werden. Weniger häufig konnten Aktivierungen im primären somatosensorischen Kortex, im Thalamus, im Temporallappen, in den Basalganglien und im Hirnstamm nachgewiesen werden. Diese waren meist beidseits vorhanden, zeigten jedoch eine Betonung der kontralateral zur stimulierten Körperhälfte gelegenen Hirnhemisphäre. Im Vergleich mit der Neutralmessung stellten sich die aktivierten Areale im frontalen Operculum und der vorderen Inselregion, im anterioren Cingulum und in den Basalganglien als schmerzspezifisch dar. Die Aktivierungen im parietalen Operculum/SII Kortex konnten erst bei niedrigerem Signifikanzniveau nachgewiesen werden. Der interindividuelle Vergleich zeigte bei zwei der Probanden eine gute Übereinstimmung mit den zerebralen Aktivierungen der Gesamtgruppe. Zwei weitere Probanden wiesen jedoch ein deutlich unterschiedliches Aktivierungsmuster auf. Bei der intraindividuellen Analyse zeigte sich eine gute Reproduzierbarkeit der aktivierten Areale. Bei den Experimenten mit Sauerstoffgabe konnte ein negativer Effekt auf die Darstellung der zerebralen Aktivierungen ausgeschlossen werden. Bei Gabe von Remifentanil konnte der aus der klinischen Erfahrung bekannte ausgeprägte analgetische Effekt der Substanz beobachtet werden. In der funktionellen MRT ließen sich nach Gabe von Remifentanil keine zerebralen schmerzspezifischen Aktivierungen darstellen. Allerdings ergaben Kontrollmessungen bei visueller Stimulation ebenfalls eine Abnahme der zerebralen Aktivierungen. Bei Gabe von Metamizol konnte unter den gewählten Versuchsbedingungen kein analgetischer Effekt registriert werden. Als Erklärung kommt einerseits die niedrig gewählte Dosierung, andererseits die Pharmakokinetik der Substanz in Betracht. Eine Änderung des zerebralen Aktivierungsmusters konnte bei den drei untersuchten Probanden nicht objektiviert werden. Schlussfolgerung. Mit der funktionellen Magnetresonanztomographie war es möglich, durch Schmerzreize ausgelöste zerebrale Aktivierungen darzustellen. Diese Daten können als Grundlage für weitere Experimente mit schmerzmodulierenden Medikamenten dienen. Die gewählten Rahmenbedingungen der fMRT-Messungen gewährleisten die notwendige Sicherheit der Probanden während der Applikation von Schmerzmedikamenten, ohne die Darstellbarkeit der zerebralen Aktivierungen zu beeinträchtigen. Aussagen über die Wirkung von opioidartigen und nichtopioidartigen Analgetika müssen jedoch noch an einer größeren Gruppe von Probanden evaluiert werden.
Zur Biomechanik des traumatischen diffusen Axonschadens
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Der diffuse Axonschaden (DAI) ist Thema der vorliegenden Arbeit. Diese spezielle Form des Schädelhirntraumas wurde biomechanisch im Hinblick auf die Entstehungsmechanismen analysiert, mit dem Ziel Toleranzgrenzen zu ermitteln. Eine insbesondere dafür entwickelte, bisher in der Literatur nicht beschriebene, neuropathologische Darstellung des DAI wurde erstmals zugrunde gelegt, womit vor allem traumatische Läsionen in den Bahnsystemen sowohl qualitativ als auch quantitativ aufgezeigt werden können. Aus dem Sektionsgut des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München wurden 16 Fälle analysiert, für die am Institut für Neuropathologie zusätzlich auch eine neuropathologische Untersuchung des Gehirns durchgeführt wurde. Es handelt sich um tödliche Unfälle unterschiedlicher Art, bei denen es möglich war, z.B. anhand der Ermittlungsakten der Polizei und der Staatsanwaltschaft, eine hinreichend genaue Unfallrekonstruktion vorzunehmen und die biomechanisch relevanten Belastungsparameter für das Gehirn zu bestimmen. Kürzlich entwickelte Computerverfahren zur Unfallrekonstruktion wurden dabei angewandt, z.B. PC-CRASH mit integrierten MKSSystemen und dem MADYMO® - Verfahren. Zwei Fälle mit schwersten Kopfverletzungen, wo entgegen den Erwartungen kein DAI eingetreten ist, wurden in das Untersuchungsgut einbezogen. Sie dienen als Beispiele dafür, daß bei hoher Stoßbelastung des Gehirns nicht in jedem Fall DAI auftreten muß. Um festzustellen ob DAI auch als primärer Schaden auftritt, wurden mehrere Fälle ohne Überlebenszeit betrachtet. Entgegen bisher vorherrschender Auffassungen, konnte gezeigt werden, daß sich DAI auch als primäre Erscheinung, d.h. bei sofortigem Todeseintritt, manifestiert. Eine längere Überlebenszeit, z.B. von 6 Stunden wie verschiedentlich genannt, ist zur Ausbildung von DAI nicht unbedingt notwendig. Die Einzelfallanalyse zeigt, daß DAI im Hirnstamm bei hoher axialer Krafteinwirkung in z- Richtung, vor allem bei Zugkräften, wahrscheinlich ist. Für Stoßbelastungen ohne relevante axiale Kraftkomponente, wie z.B. bei einem frontalen Aufprall in der Gesichtsregion, scheint DAI im Hirnstamm nicht aufzutreten. DAI im Balken (Corpus callosum) erscheint charakteristisch für aufgetretene höhere Rotationsbeschleunigungen um die Vertikalachse (z- Achse). DAI in den Hemisphären kann im Falle einer starken Deformation und Fraktur des knöchernen Schädels den dabei wirksamen Scherkräften zugeschrieben werden, womöglich auch, besonders parietal, durch lokale „interne“ Zugkräfte infolge Lageänderung des Gehirns in der Schädelkapsel. Weiter zeigt sich, daß DAI selbst bei extremer Stoßbelastung des Kopfes mit der Folge von ausgedehnten Schädelbrüchen (z.B. einem Scharnierbruch) und Hirnläsionen nicht zwingend auftreten muß. Die quantitative Auswertung relevanter biomechanischer Belastungsparameter des Gehirns ermöglichte die Ableitung erster Annäherungen der bisher nur unzulänglich bzw. zum Teil überhaupt nicht bekannten unteren Toleranzgrenzen für den DAI. Im Hinblick auf die lineare (translatorische) Kopfbeschleunigung läßt sich ein ähnlicher Verlauf erkennen, wie für die bekannte Grenzkurve für die Gehirnerschütterung (Wayne State University Tolerance Curve WSTC). Im Vergleich zur WSTC wird die Toleranzkurve für den DAI, abhängig von der Stoßzeit, von etwa 20 – 50 g höheren Belastungswerten gekennzeichnet. Beispielsweise entspricht dann dem häufig zitierten Grenzwert für die Gehirnerschütterung von 80 g aus der WSTC bei 10 ms Einwirkzeit eine Toleranzgrenze für den DAI von 130 g. Für die Rotationsgeschwindigkeit kann ein unterer Grenzwert von 38 rad/s bei einer Rotationsbeschleunigung um 7.500 rad/s abgeleitet werden, welcher in etwa mit nur sehr vereinzelt verfügbaren Literaturdaten übereinstimmt. Für die Rotationsbeschleunigung wurde ein erster Vorschlag für die untere Toleranzkurve des DAI in Abhängigkeit von der Einwirkzeit aufgezeigt, welche z.B. auf einen Grenzwert von 5.500 rad/s bei 10 ms Einwirkzeit hinweist. Bislang gänzlich unbekannt sind dazu Vergleichsdaten aus der Literatur, so daß weitere Untersuchungen zur Bestätigung oder Präzisierung speziell dieser neuen Toleranzkurve angezeigt sind. Generell sollten die in der vorliegenden Arbeit erstellten ersten Annäherungen von Toleranzkurven für den DAI als Grundlage für notwendige weitere Untersuchungen verwendet werden. Ähnlich wie die WSTC die in einem langjährigen Prozeß durch unterschiedliche Beiträge immer weiter präzisiert wurde, sollten auch die Toleranzgrenzen für den DAI durch weitere Daten ergänzt werden.
Konvergenz afferenter und kommissuraler Signale aus den Bogengängen und den Otolithenorganen beim Grasfrosch (Rana temporaria)
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
In vitro-Experimente wurden am isolierten Hirnstamm von Fröschen durchgeführt. Die einzelnen Nervenäste der Bogengänge und der Lagena wurden auf jeder Seite des Gehirns getrennt elektrisch stimuliert. Afferente und kommissurale Antworten wurden intrazellulär in vestibulären Neuronen zweiter Ordnung (2°VN) gemessen. Das Projektionsmuster eines Teils dieser 2°VN wurde durch antidrome Stimulation der okulomotorischen Kerne und des zervikalen Rückenmarks bestimmt. Bei der Hälfte aller identifizierten 2°VN konnte ein monosynaptisches EPSP nach Stimulation des ipsilateralen Lagena-Nerven registriert werden. Etwa ein Viertel dieser Neurone erhielt einen monosynaptischen Eingang ausschließlich von der Lagena, die anderen drei Viertel der Neurone erhielten zusätzlich noch ein monosynaptisches EPSP von einem oder mehreren ipsilateralen Bogengängen. In den Neuronen mit einem konvergenten monosynaptischen Eingang von der Lagena und einem der drei Bogengänge stammte der Bogengangs-Eingang entweder vom anterioren vertikalen oder vom posterioren vertikalen Bogengang, aber nie vom horizontalen Bogengang. Kommissurale Eingänge nach Stimulation des kontralateralen Lagena-Nerven waren erregender Natur und wurden in vertikalen Bogengangs-Neuronen und in Lagena-Neuronen, nicht aber in horizontalen Bogengangs-Neuronen angetroffen. Diese bemerkenswerte Spezifität der monosynaptischen Konvergenz für Lagena- und vertikale Bogengangsinformationen stimmt mit der Koaktivierung der entsprechenden vestibulären Sinnesorgane bei natürlichen Bewegungen überein. Die andere Hälfte der registrierten 2°VN erhielt ein monosynaptisches EPSP ausschließlich nach Stimulation der ipsilateralen Bogengangs-Nerven. Die Mehrheit (91%) dieser 2°Bogengangs-Neurone erhielt einen monosynaptischen Eingang von nur einem der drei ipsilateralen Bogengänge, der Rest entweder von zwei (8%) oder von allen drei Bogengängen (1%). Die meisten 2°Bogengangs-Neurone (79%) mit einem monosynaptischen Eingang von nur einem Bogengang erhielten eine kommissurale Hemmung vom kontralateralen Bogengang der gleichen Drehebene (koplanar) und eine kommissurale Erregung von einem oder zwei der anderen beiden kontralateralen nicht-koplanaren Bogengänge. Die koplanaren hemmenden Signale wiesen disynaptische (78%) oder trisynaptische Latenzen auf. Im ersten Fall wurde die Hemmung direkt, also ohne weitere Verschaltung von einem 2°Bogengangs- Neuron im gegenüberliegenden vestibulären Kern vermittelt. Im zweiten Fall war ein zusätzliches Interneuron dazwischen geschaltet. Erregende kommissurale Eingänge nach Stimulation des gesamten VIII. Hirnnerven sind auf erregende Signale der kontralateralen nicht-koplanaren Bogengänge und einer daraus resultierenden Maskierung der kommissuralen bogengangs-spezifischen Hemmung zurückzuführen. Somit sind auch beim Frosch die funktionellen Strukturen vorhanden, die als neuronale Grundlage für eine „push-pull- Organisation“ bei Kopfbewegungen bei der Katze dienen. Axone von 2°Bogengangs-Neuronen projizierten absteigend zum Rückenmark, aufsteigend zu den okulomotorischen Kernen oder über Axonkollaterale ab- und aufsteigend. Axone von 2°Lagena-Neuronen projizierten ausnahmslos zum Rückenmark, nicht aber zu den okulomotorischen Kernen. Diese elektophysiologischen Untersuchungsergebnisse sind kompatibel mit in vivo-Studien, die zeigen dass Informationen über vertikale Linearbeschleunigung bei Vertebraten praktisch keine Bedeutung für den makulo-okulären Reflex haben.