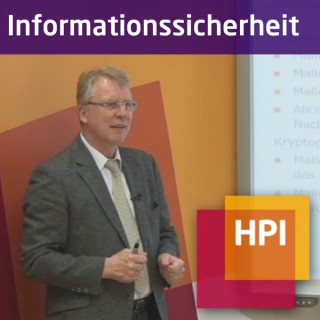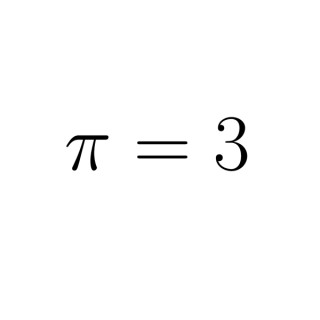Podcasts about zahlentheorie
- 13PODCASTS
- 24EPISODES
- 1h 9mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Mar 26, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about zahlentheorie
Latest podcast episodes about zahlentheorie
Wir springen in dieser Folge ins Frankreich des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Während die Revolution durchs Land fegt, wächst ein Mädchen heran, das – trotz aller gesellschaftlicher Widerstände gegen Frauen in den Wissenschaften – zu einer der bedeutendsten Mathematikerinnen ihrer Zeit werden wird. Wir sprechen über Sophie Germain, die sich nicht nur in der Zahlentheorie, sondern auch der Mathematischen Physik einen Namen machte – und trotzdem zu Lebzeiten nie die Anerkennung erhielt, die sie verdient hätte. //Erwähnte Folgen - GAG361: Gustave Trouvé - der vergessene Erfinder – https://gadg.fm/361 - GAG408: Das kurze und tragische Leben des Évariste Galois – https://gadg.fm/408 - GAG375: Sofia Kowalewskaja, "Königin der Wissenschaft" – https://gadg.fm/375 Literatur - Dora Musielak. Sophie Germain: Revolutionary Mathematician. Springer Nature, 2020. - Hill, Amy Marie. „Sophie Germain : A Mathematical Biography“. University Of Oregon, 1995. https://hdl.handle.net/1794/8965. Hier die Sternengeschichte zu Sophie Germain: https://sternengeschichten.podigee.io/185-sternengeschichten-folge-185-sophie-germain Das Episodenbild zeigt eine junge Sophie Germain. //Aus unserer Werbung Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/GeschichtenausderGeschichte //Wir haben auch ein Buch geschrieben: Wer es erwerben will, es ist überall im Handel, aber auch direkt über den Verlag zu erwerben: https://www.piper.de/buecher/geschichten-aus-der-geschichte-isbn-978-3-492-06363-0 Wer Becher, T-Shirts oder Hoodies erwerben will: Die gibt's unter https://geschichte.shop Wer unsere Folgen lieber ohne Werbung anhören will, kann das über eine kleine Unterstützung auf Steady oder ein Abo des GeschichteFM-Plus Kanals auf Apple Podcasts tun. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer dies möglich ist rezensiert oder bewertet. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder sogar Nachbarinnen und Nachbarn von uns erzählt! Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
„Die Gleichung ihres Lebens“ – Hochbegabte Mathestudentin zwischen Zahlentheorie und Selbstfindung
Die Zukunft von Marguerite (Ella Rumpf), einer brillanten Mathematikstudentin an der prestigeträchtigen Pariser École Normale Supérieure, scheint vorgezeichnet zu sein. Doch nach einem Fehler in einer Beweisführung lässt ihr Doktorvater sie fallen. Desillusioniert bricht Marguerite ihre Dissertation ab und stürzt sich ins Leben jenseits der Wissenschaft.
Wenn a+b=c gilt, wie verhalten sich die Primfaktoren von a, b und c? Ausgehend von einer "einfachen" Frage der Zahlentheorie, kommen wir über die Suche nach außerirdischem Leben zu Fermats letztem Satz und fake news in der Mathematik.
Heute geht es zum zweiten Mal nicht um Physik, sondern wir tauchen wieder in die tiefen der Mathematik ab. Als zweites der Millennium-Probleme nehmen wir uns die Birch und Swinnerton-Dyer Vermutung vor. Wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Viel Vergnügen! #MillenniumProbleme #Mathematik #Swinnerton-Dyer #Birch #Zahlentheorie #Algebra ********** Anmerkungen, Fragen, Kritik oder interessante Themenvorschläge bitte an physikgeplaenkel@gmail.com ********** Unsere Instragram Seite: https://www.instagram.com/physikgeplaenkel/ Unsere Facebook Seite: https://www.facebook.com/Physik-Geplänkel-1153934681433003/ Unser Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCD1CT-nTdEagwMF16P6gIKQ/ Folgt uns unter "Physik-Geplänkel" auf Spotify, iTunes, Deezer, PocketCasts oder als Amazon Alexa Skill. Oder am besten direkt unter https://physik-geplaenkel.podigee.io/
7.6.1742: Der Mathematiker Christian Goldbach äußert die Goldbachsche Vermutung
Nicht bewiesen - aber auch nicht widerlegt. Christian Goldbachs Vermutung bleibt eines der ältesten, bedeutsamsten und ungelöstes Problem der Zahlentheorie. Ist jede gerade Zahl, die größer als 2 ist, die Summe zweier Primzahlen? Er formulierte diese Vermutung am 7. Juni 1742.
BROsnien Herzegowina
Alleine ist schwer - Der Sportpodcast mit Jonas und Mats Hummels
Don't call it a comeback. Die Jungs sind aus der Sommerpause zurück. Zwar braungebrannt, dafür aber kaum erholt (Mats angeschlagen, Jonas mit der nächsten Knie-Katastrophe, aber wenigstens ist Lukis Tennisarm durch ganz besonders ausgeklügelte Behandlungsmethoden geheilt). Versprechen gebrochen haben sie auch, denn es gab, wie eigentlich nicht anders zu erwarten war, nicht die angekündigte Zwischenfolge. Aber dafür wird’s heute umso gehaltvoller und witziger. Witzig im Sinne vom Prototypen Check mit Chadwick Philips, Chatroulette als Insta Live, schlechten Wortwitzen und absurdesten Videos zum Edgy Touch der Woche: Einrad fahren. Und gehaltvoll im Sinne von kompliziertester Zahlentheorie, Konstitutionslehre und tatsächlich auch relativ viel Sport. Es geht um die Bundesliga-Saisonvorbereitung und Trainingslager, um die Veränderungen und den teilweise doch sehr ungewöhnlichen Umgang mit Corona in der MLB, im internationalen Fußball und in der NBA sowie allgemein um den Restart der NBA oder anders gesagt „America in a nutshell“. Drei große Fragen bleiben am Ende offen: Wie würden sich Jonas, Luki und Mats verhalten, wenn sie zu dritt wochenlang in der NBA Bubble eingesperrt wären? Werden wir Luki bald im Rhönrad bei Jonas zu Hause vorfahren sehen? Und ganz wichtig: Ist Jonas ein Schaufler? Alleine ist schwer 25... 26... was auch immer.
Gudrun spricht in dieser Folge mit Tanja Hagedorn, die Geschäftsführerin des KIT-Zentrums MathSEE ist. Das Karlsruher Zentrum für Technologie (KIT) besteht aus sehr vielen Instituten, die in fünf thematischen Bereichen zusammengeschlossen sind. Andererseits gibt es die eher horizontal durch alle Bereiche hindurch sortierenden Gremien, die KIT-Zentren heißen. Hier sind Forscherinnen und Forscher Mitglied und es "werden Fragestellungen, die von fundamentaler Bedeutung für die Existenz und Weiterentwicklung der Gesellschaft sind oder die aus dem Streben nach Erkenntnis resultieren, bearbeitet." ( lt. Webseite). Sieben solche Zentren gibt es seit Gründung des KITs: Energie Information · Systeme · Technologien Mobilitätssysteme Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik Klima und Umwelt Materialien Mensch und Technik Allerdings gab es ursprünglich kein Thema, unter dem die vielen Aktivitäten, die die Mathematik am KIT für die Gesellschaft leistet (und die auch nicht nur in der KIT-Fakultät für Mathematik stattfinden), ein Zuhause finden könnte. Deshalb entstand der Wunsch nach einem passenden Zentrum im KIT. Das KIT-Zentrum Mathematics in Sciences, Engineering, and Economics, kurz "MathSEE", gibt es nun seit Oktober 2018. In MathSEE kooperieren theoretisch-mathematisch und anwendungsorientiert arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in gemeinsamen Forschungsprojekten. Aufgabe von MathSEE ist es auch, diese Forschung nach außen hin sichtbar zu machen sowie neue interdisziplinäre mathematische Forschung am KIT zu fördern. Da gilt es vor allen Dingen auch, Vermittlung zwischen Großforschungs- und Universitätsbereich zu betreiben. MathSEE bietet unter anderem eine Anschubförderung für neue interdisziplinäre Projekte] an, deren erste Ausschreibungsrunde gerade erfolgreich abgeschlossen wurde und die ersten sieben Projekte eine Förderung erhalten haben. Die nächste Bewerbungsfrist ist Ende Juni 2019. Keimzelle von MathSEE war insbesondere der Sonderforschungsbereich 1173: Wellenphänomene: Analysis und Numerik. Doch auch andere bestehende große Drittmittelprojekte in der Mathematik wie das Graduiertenkolleg 2229: Asymptotic Invariants and Limits of Groups and Spaces bilden die Grundlage für die Entstehung von MathSEE. Sie haben dazu geführt, dass die besondere Stellung der Mathematik an der technischen Forschungseinrichtung KIT und die Forschungsstärke der Mathematik sichtbarer wurden. Die Initiative der Sprecherin Marlis Hochbruck hat die Gründung von MathSEE dann ins Rollen gebracht. Der engagierte Wissenschaftliche Sprecher von MathSEE, Prof. Martin Frank, ist in seiner Doppelrolle als Professor in der Mathematik und SCC-Direktor perfekt für die Aufgabe. Um gezielter zusammen arbeiten zu können, ist MathSEE mit seinen momentan knapp 130 Mitgliedern weiter untergliedert in Methodenbereiche: MB 1: Mathematische Strukturen: Formen, Geometrie, Zahlentheorie und Algebra MB 2: Mathematische Modellbildung, Differentialgleichungen, Numerik, Simulation MB 3: Inverse Probleme, Optimierung MB 4: Stochastische Modellbildung, statistische Datenanalyse und Vorhersage Mitglieder arbeiten oft in mehreren Methodenbereichen mit. Die Methodenbereiche werden jeweils durch ein Paar interdisziplinär geleitet, d.h. eine Person aus der Mathematiker und eine Person aus einem anderen Forschungsbereich. Wichtig in MathSEE ist, dass insbesondere auch Promovierende Mitglied sein können und hier Kooperationspartner für Fragestellungen in ihrem Promotionsprojekt finden können. Für sie bietet die Graduiertenschule MathSEED außerdem ein umfassendes Qualifikationsprogramm an. MathSEE fördert darüber hinaus zwei Veranstaltungsformate: In der MathSEE Modellierungswoche im August entwickeln Studierende Lösungsansätze zu aktuellen interdisziplinären mathematischen Fragestellungen von Problemstellenden aus MathSEE. Studierende erhalten dabei einen ersten Eindruck von der Forschung in angewandter Mathematik und die Problemstellenden können erste Ergebnisse erwarten. Bald wird auch ein MathSEE ScienceSlam stattfinden, da MathSEE versucht, auch für Mathematik bei einem größeren Publikum zu werben. Literatur und weiterführende Informationen MathSEE Veranstaltungen und Termine Podcasts M. Frank, G. Thäter: Kinetische Theorie, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 152, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017. K. Wohak, M. Hattebuhr, E. Bastian, C. Beizinger, G. Thäter: CAMMP-Week, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 174, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018. M. Hattebuhr, K. Wohak, G. Thäter: Simulierte Welten, Gespräch im Modellansatz Podcast, Folge 179, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2018.
Zur 100. Folge haben sich Gudrun und Sebastian bei Gudrun getroffen, um sich zum Jubiläum einfach mal in Ruhe über den Podcast, den Ursprung, was wir so erlebten und was vor uns liegt. Für Sebastian öffnete die Raumzeit-Folge zu Tandem-X die Augen, wieviel wissenschaftlicher Inhalt in einem Podcast übertragen werden kann. Schnell war Gudrun begeistert und nahm mit Sebastian die erste Folge zu ihrer Vorlesung über mathematische Modellbildung auf. Nach zwei weiteren Aufnahmen zur Aorta-Challenge und zur Unsichtbarkeit machten wir unsere ersten Versuche öffentlich. Schon früh stellte sich heraus, dass uns die Themen zur Mathematik nicht schnell ausgehen, da es so viele Abschlussarbeiten, Forschungsthemen und Vorlesungen gibt, die jeweils auch noch unter unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet werden können. Im Storify sieht man, wie wir schon früh vielseitig unterstützt wurden und unsere Hörerzahl stieg schnell an: Ein besonderer Unterstützer war dabei Henning Krause, der uns eine Grußbotschaft sendete und ganz besonders die Qwirkle-Folge schätzt. Einen weiteren Gruß sandte uns Katrin Leinweber vom KonScience Podcast. Weitere Grüße erreichten uns aus Kanada von Anja Randecker aus unserer Folge zu Wilden Singularitäten, die nun in Toronto als Post-Doc weiter zu Translationsflächen forscht. Sehr haben wir uns auch über die Grüße aus dem Grünen von Martin Rützler gefreut, der selbst im Radio Mono Podcast, im DKG-Podcast und im Sendegarten regelmäßig zu hören ist, die deutschen GanzOhr-Wissenschaftspodcast-Treffen initiierte und die Wissenschaftspodcasts-Seite mit begründete. Neben Gesprächen über Vorlesungen, wie zur Analysis, Höhere Mathematik oder Digitale Währungen, hat nun Gudrun auch eine Vorlesung aufgenommen: Den Schnupperkurs zur Verkehrsmodellierung, der jeweils auf viele Gespräche im Podcast verweist. Bei Konscience gibt es interessante Konzepte zur Verknüpfung von Vortrag und Podcast, die auch auf Vorlesungen angewendet werden könnten. Ganz besondere Grüße erreichten uns von Lorenz Adlung, den wir in der Folge 39 zur Systembiologie im Podcast hatten. Lorenz ist auch ein begnadeter Science-Slammer, wie auch Anastasia August aus unserer Folge 37 zum Metallschaum. Sie ist weiterhin als Mathematikerin am Institut für Angewandte Materialien, wo sie aktuell an Gradierten Schäumen und Magischen Schäumen forscht und ein Graduiertenkolleg vorbereitet. Sebastian hat die Folge 98 zu Primzahlen und Gruppen sehr gefallen, wo Rebecca Waldecker den Einstieg in die Algebra und Zahlentheorie sehr anschaulich beschrieben hat. Besonders spannend sind auch Themen, die inzwischen zu Ausgründungen geführt haben: Markus Dahlem in M-Sense mit dem Thema Migräne, Tobias Hahn mit der Chromatographie, sowie Carlos Falquez, Iris Pantle und Balazs Pritz zu Strömungslärm. Im Zuge des SFB zu Wellenphänomenen haben wir auch ein Special zum Cooking Math Projekt durchgeführt, wo durch Gespräche die vielseitigen Kunstobjekte zur Mathematik dargestellt werden. Ein persönliches Special war für uns aber auch die Nullnummer in Folge 73, die wir mit Nele Heise aufnehmen konnten. Ebenso haben wir uns sehr über die Grüße von Melanie Bartos gefreut, die mit ihrem Podcast Zeit für Wissenschaft immer wieder über spannende wissenschaftliche Themen aus der Uni Insbruck berichtet. Natürlich haben uns auch Annika Brockschmidt und Dennis Schulz vom Science Pie Podcast aus Heidelberg einen wunderschönen Gruß gesendet, und auch Nora Ludewig und Markus Völter vom Omega Tau Podcast schlossen sich mit einer lieben Botschaft an. Und wir freuen uns die beiden im Oktober beim GanzOhr2016-Treffen der Wissenschaftspodcasts wieder zu sehen. Unsere Audiodaten laufen inzwischen durch die Open Source Podcast Audio Chain (OSPAC). Einen Einblick kann man im Vortrag zu OSPAC auf der Subscribe7 oder dem erweiterten Vortrag zu OSPAC auf der GPN16 erhalten, und auch LIGO-Rohdaten auswerten. Informationen zum Aufnehmen von Podcasts mit dem iPhone habe ich auf dem Sendegate hinterlegt. Spannend waren auch die Podcast Nachbarschafts-Graphen, die nun auch eine neue Fortsetzung auf dem FYYD Podcast-Verzeichnis. Wir haben einige Überraschungen in den bisher beliebtesten Folgen und am längesten gehörten Folgen im Modellansatz- welches dies sind, muss man sich beim Interesse im Podcast anhören.
Auf der Gulasch Programmiernacht (GPN16) des Entropia e.V. in der Hochschule für Gestaltung und dem ZKM in Karlsruhe trafen sich Stephan Ajuvo und Sebastian Ritterbusch für einen Cross-Over Podcast vom damals TM Podcast und dem Modellansatz Podcast um über die Geschichte von Finanzen und Mathematik zu plaudern. Der damalsTM Podcast befasst sich damit, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist- und hatte in der letzten Zeit schon eine Reihe zu Geld (Geld I, Geld II, Geld III), wo die Entwicklung der Zahlungsmittel bisher bis zum 2. Weltkrieg behandelt wurden. Die Ökonomie zählt zu den Sozialwissenschaften, die oft Theorien auf Annahmen behandeln, während die Mathematik als Geisteswissenschaft sich gerne auch mal sehr exakt mit Theorien fernab der Realität befassen kann. Die Kryptographie ist jedoch ein schönes Beispiel, wie aus abstrakten mathematischen Theorien der Algebra und der Zahlentheorie plötzlich sehr reale Anwendungen aus unserem Alltag wurden. Mit Kryptoanalyse konnte man sowohl einfache Transpositionschiffren als auch die Enigma durch mathematische Verfahren knacken. Bevor vereinheitlichte Geldeinheiten eingeführt wurden, waren schon früh Objekte mit Geldfunktion eingesetzt, wo oft die Seltenheit und Wertigkeit des Materials schon für sich einen gewissen Wert sicherte. Ebenso früh kam es zu Geldversprechen wie dem Agrarkredit (zurück bis hin zum Codex Hammurapi), mit denen jetzige Ausgaben durch versprochene spätere Erntegewinne beglichen werden konnten. Dies führte zum Konzept des Zinses, mit dem das Verlustrisiko durch Ausfall und die erst spätere Zugängigkeit des Geldes bewerten kann. Das Größenordnung des Zehnt war gesellschaftlich zwar als Steuer akzeptiert, wurde jedoch als Zins schnell als Wucher gesehen, da der Zinseszins sehr schnell anwuchs. Daraus entstand auch die Gegenbewegung des Zinsverbots, das auch heute noch im Islamischen Bankwesen zu Umgehungsgeschäften führt. Die mit Geldgeschäften oft assoziierten Geldwechsler hatten als Arbeitsmittel eine Bank, die namensgebend für unsere heutigen Banken ist, und woran das Wort bankrott auch heute noch erinnert. Neben astronomischen Berechnungen, wie der Berechnung des Osterfests, war die Geldwirtschaft früh ein großes Anwendungsfeld für die Mathematik. Ein wichtiges Berechnungsmodell waren die Abzinsung und die Zinsformel, mit der man die Werte zwischen jetzt und in Zukunft unter Berücksichtigung des Zinses umrechnen konnte. Hier war das exponentielle Wachstum der Kreditentwicklung unter Zinseszinsen für viele nicht zu übersehen. Aber selbst, wenn man diese Berechnung beherrschte, so gab es das Zinsänderungsrisiko, das besonders bei langfristigen Verträgen zu erheblichen Änderungen zu den Kalkulationen führen konnte. Verschiedene Zinssätze verschiedener Landesherren führte auch unmittelbar zu unterschiedlichen Wechselkursen zwischen den lokalen Währungen der Landesherren. Zusätzlich gab es schon früh den Effekt der Teuerung oder Inflation oft durch unkontrolliertes Geldmengenwachstum. Ein Beispiel ist hier die Inflation durch die Entdeckung Amerikas. Es war damals noch nicht klar, wie der tatsächliche Wert des Geldes auch durch einen Warenkorb identifiziert werden kann. Ein sehr grobes aber dafür sehr leicht zugängiges aktuelles Indiz für den Wert verschiedener Währungen ist der Big-Mac Index. Aus der Anforderung des waren- und ortsübergreifenden Handels wurden die Börsen geboren: Hier konnten Waren und Währungen im Jetzt, aber auch in der Zukunft in Termingeschäften gehandelt werden. Schnell etablierte sich hier auch die Spekulation, die über Risikoübernahme zu einem wichtigen Bestandteil der Wirtschaft wurde. Ein bekanntes Beispiel für eine Fehlentwicklung ist die Tulpenkrise, bei der es zu einer Finanzblase bis hin zum Börsencrash kam, und exemplarisch für spätere Immobilienblasen wurde. Die Effekte konnten durch Hebeleffekte noch verstärkt werden, wenn Fremdkapital für mehr erwartete Rendite eingesetzt wurde. Eine Renditebetrachtung ist auch für die persönliche Finanzplanung sehr wichtig- so sollte jeder die Altersvorsorge frühzeitig angehen und dabei Risikoklassen und die Diversifikation zur Risikoverteilung beachten. Aus der Erfahrung, dass viele Finanzprodukte und Anlageberater die zugrunde liegenden Indices oft nur in der Vergangenheit schlagen, haben sich Finanzcommunities wie The Motley Fool gebildet, um sich gegenseitig zu informieren. Mathematisch kann man die Optimalität einer Investition auch als Multikriterielle Optimierung zwischen Rendite und Risiko im Sinne der Volatilität verstehen: Hier stellt sich heraus, dass hier zwischen den Kriterien abgewogen werden muss, und es nicht ein Optimum gibt, sondern die Linie der Pareto-Optimalität. Jedoch darf man nicht einfach aus der vergangenen Entwicklung auf Rendite und Risiko schließen: Gerade Ponzi-Systeme scheinen eine hohe Rendite bei geringer Volatilität und Risiko zu liefern, wo die Zinsen früherer Anleger nur durch die Investitionen durch angelockte Neuanleger bezahlt werden, und was natürlich nicht ewig funktionieren kann, und viele werden ihren Einsatz verlieren. Plant man Investitionen in Güter, so sollte man daher genau recherchieren, wie es um den Gegenstand steht. Bei Immobilien gibt ist eine Begehung mit Fachpersonen möglich und ein Blick in Bodenrichtwertkarten ist sehr sinnvoll. Bei Aktien kann man hingegen auf Basis der veröffentlichten Informationen und Kennzahlen Fundamentalanalysen bilden. Alle diese Modelle sind aber immer Komplexitätsreduktionen, die irgendwann ihre Gegenbeispiel finden können und dann zu Geldverlust führen. Neben der schwierigen Bewertung von Aktien wird es richtig spannend, wenn notwendigerweise auch Termingeschäfte oder Derivate der Aktien oder Wirtschaftsgüter berücksichtigt werden: Diese werden im Markt unmittelbar benötigt, sind jedoch vom Basiswert und der allgemeinen Marktsituation abhängig. Optionen können auf der einen Seite Geschäfte absichern, können jedoch auf der anderen Seite bei einem hohem Hebel auch sehr spekulativ und entsprechend gefährlich sein. Für eine mathematische Bewertung von Optionen wird ein Markt mit Arbitragefreiheit vorausgesetzt, um andere künstliche Einflüsse auszuschließen. Dann können analytisch Optionskennzahlen (die Griechen) bestimmt werden, um aus dem komplexen Markt ein Gefühl für den Wert zu erhalten. Umgekehrt kann man aber auch konstruktiv eine Bewertung mit dem Cox-Ross-Rubinstein-Modell berechnen. Der Kursverlauf wird hier vereinfacht wie der Kugellauf durch ein Galtonbrett angenommen, wo eine Richtung für einen fallenden Kurs, die andere für einen steigenden Kurs steht. Dies führt im vereinfachten Fall zu einer Binomialverteilung oder im Grenzfall zu einer Normalverteilung der möglichen Kurse am Ende der Laufzeit. Damit kann die Option auf Basis von Volatilität und Rendite des Basiswerts mit einem diskreten Modell bewertet werden. Das vereinfachte Cox-Ross-Rubinstein-Modell lässt sich unter weiteren Annahmen immer feiner diskretisieren und man erhielt 1973 das Black-Scholes-Modell, wo nun in dieser stochastischen Differentialgleichung der Brownsche Prozess Anwendung findet. Der Brownsche Prozess ist der beobachteten zufälligen brownschen Molekularbewegung entlehnt. Aus diesem komplexen Modell können nun einfache geschlossene Formen für die Bewertung von vielen Optionenstypen berechnet werden, was 1997 zur Verleihung des renommierten Preises der Wirtschaftswissenschaften geführt hatte. Leider ergaben sich schnell Widersprüche in der Überprüfung des Modells am echten Markt: Es entsteht der Volatilitäts-Smile, der den Unterschied der Vorhersage zur tatsächlichen Situation darstellt. Interessanterweise trat der von Devisen bekannte Effekt bei Aktien erst nach dem Börsencrash von 1987 auf. Podcasts S. Ritterbusch: Digitale Währungen, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 32, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2014. W. Härdle: Risikobewertung, Gespräch mit G. Thäter im Modellansatz Podcast, Folge 41, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2014. S. Ajuvo, L. Schult: Geld I, Gespräch im damalsTM Podcast, Folge 2, 2015. S. Ajuvo, Steffen P., L. Schult: Geld II, Gespräch im damalsTM Podcast, Folge 5, und im VorHundert Podcast, Folge 18, 2015. S. Ajuvo, L. Schult: Geld III, Gespräch im damalsTM Podcast, Folge 21, 2016. L. Mirlina, F. Dehnen: Qwirkle-Gruppe. Gespräch mit S. Ritterbusch im Modellansatz Podcast, Folge 76, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2015. http://modellansatz.de/qwirkle-gruppe GPN16 Special J. Breitner: Incredible Proof Machine, Gespräch mit S. Ritterbusch im Modellansatz Podcast, Folge 78, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/incredible-proof-machine M. Fürst: Probabilistische Robotik, Gespräch mit S. Ritterbusch im Modellansatz Podcast, Folge 95, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/probabilistische-robotik S. Ajuvo: Finanzen damalsTM, Gespräch mit S. Ritterbusch im Modellansatz Podcast, Folge 97, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016. http://modellansatz.de/finanzen-damalstm
#01 Der Mathematiker Christian Goldbach äußert die Goldbachsche Vermutung
Nicht bewiesen - aber auch nicht widerlegt. Christian Goldbachs Vermutung bleibt eines der ältesten, bedeutsamsten und ungelösten Probleme der Zahlentheorie. Autor: Martin Trauner
Diesmal traf sich Gudrun zum Gespräch mit Anke Pohl, die zur Zeit am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn arbeitet. Das Thema der Unterhaltung ist Mathematisches Quantenchaos. Anke Pohl untersucht nämlich, welchen Zusammenhang die geometrischen und spektralen Eigenschaften Riemannscher Mannigfaltigkeiten haben. Historisch ist das Interesse an diesen Eigenschaften und ihren Wechselwirkungen bei physikalischen Betrachtungen entstanden, wie z.B. bei den Studien der Schwingungen einer Membran. Im Jahre 1910 vermuteten Lorentz und Sommerfeld, dass der Flächeninhalt einer Membran (die ein Beispiel für eine Riemannsche Mannigfaltigkeit ist) durch die (Ober-)töne dieser Membran (die durch die Eigenwerte eines gewissen Operators bestimmt sind, der die Schwingungen der Membran beschreibt) bestimmt sind. Bereits kurze Zeit später gelang es Hermann Weyl, diese Vermutung mathematisch zu beweisen. Im Laufe der Zeit ist die Untersuchung solcher Zusammenhänge zu einem Teilgebiet der Mathematik und Mathematischen Physik angewachsen, welches sowohl hinsichtlich Motivation als auch in Bezug auf Methoden eng mit diversen anderen Teilgebieten der Mathematik, wie z.B. der Geometrie, der Zahlentheorie und der Analysis, zusammenhängt. Und auch heute noch liefern physikalische Erkenntnisse und Intuitionen gute Heuristiken bzw. sind wegweisend für mathematische Ansätze. Aktuelle große Vermutungen mit sowohl mathematischer als auch physikalischer Motivation sind beispielsweise die Rudnick-Sarnak Vermutung über eindeutige Quantenergodizität auf gewissen kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeiten (Gleichverteilung von Eigenfunktionen im Mittel bei wachsendem Eigenwert; für den Beweis von eindeutiger arithmetischer Quantenergodizität wurde E. Lindenstrauss 2010 eine Fieldsmedaille verliehen), die Phillips-Sarnak Vermutung über die (Nicht-)Existenz von quadrat-integrierbaren Eigenfunktionen auf gewissen nicht-arithmetischen Mannigfaltigkeiten, die Sarnaksche Vermutung über das Größenwachstum von Eigenfunktionen bei wachsendem Eigenwert, oder die Sjöstrandsche Vermutung über die asymptotische Anzahl von Resonanzen in Streifen bei hyperbolischen Flächen unendlichen Inhalts. Details und weiterführende Informationen zu diesen und anderen Vermutungen sind beispielsweise in den Übersichtsartikel in den untenstehenden Referenzen enthalten. Anke Pohls befasst sich zur Zeit mit bestimmten Flüssen, den sogenannten geodätischen Flüssen, auf einer speziellen Klasse von Riemannschen Mannigfaltigkeiten. Als erste, recht elementare, Beispiele für Mannigfaltigkeiten kann man sich zunächst Oberflächen vorstellen. Wenn man auf ihnen Größen definiert hat, die zum Messen von Abständen und Winkel dienen, werden sie Riemannsche Mannigfaltigkeit genannt. Wie bei den oben genannten Membranen sind Geodäten. Mathematisch werden die Schwingungen als Lösungen des Laplaceoperators in der zugrundeliegenden Geometrie beschrieben bzw. mit Hilfe der Eigenwerte und Eigenfunktionen des Operators. Aus der Anschauung ist klar, dass die Schwingungen von den geometrischen Eigenschaften der Fläche abhängen. Wenn z.B. die Fläche oder Membran eingerissen ist oder ein Loch hat, klingt sie anders als wenn sie geschlossen ist bzw. gut eingespannt ist. Für kompakte Flächen ist bekannt, dass es unendlich viele solcher Eigenfunktionen gibt. Je nach Grad der Offenheit (also z.B. eine Fläche mit Riss oder Loch) ist es jedoch schwierig zu sagen, wie sich die Schar der Lösungen verändert. Ein interessantes Beispiel wäre z.B. zu betrachten, dass an einer Stelle die eingespannte Fläche im Unendlichen verankert ist, aber das darunterliegende Volumen endlich ist. Vorstellen kann man sich das etwa so, dass man an dieser Stelle die Fläche samt ihren Abständen unendlich weit zieht. Man fragt sich dann, ob eine Welle auf der Fläche auch diese Singularität überlebt. Ein methodischer Ansatz, solche und andere Fragen zu studieren, ist es, Beziehungen zu anderen Objekten, vor allem rein geometrischen, zu finden. Selbergs Beweis zur Unendlichkeit der Anzahl der Eigenfunktionen auf gewissen hyperbolischen Flächen zeigt zunächst, dass die Eigenwerte der Eigenfunktionen (spektrale Objekte) durch die Längen der geschlossenen Geodäten (geometrische Objekte) bestimmt sind. Genauer, sie sind unter den Nullstellen einer generierenden Zetafunktion für das Längenspektrum der Geodäten. Ausnutzung zusätzlicher Eigenschaften der Flächen, wie z.B. Kompaktheit oder zusätzliche Symmetrien, erlaubt dann (manchmal) zu bestimmen, ob Nullstellen existieren und ob sie von Eigenwerten stammen. Anke Pohl schaut sich die Geodäten auf bestimmten hyperbolischen Flächen an, diskretisiert sie und findet ein assoziiertes diskretes dynamisches System auf dem reellen Zahlenstrahl. Für dieses diskrete System sucht sie gewisse invariante Größen, z. B. invariante Maße oder Dichten. Genauer fragt sie nach Eigenfunktionen des assoziierten Transferoperators mit gewissen Parametern (inversen Temperaturen). An dieser Stelle sieht man wieder einen Einfluss aus der Physik: Transferoperatoren entstammen dem thermodynamischen Formalismus der statistischen Mechanik. Sie zeigt dann, dass die Eigenfunktionen dieser Transferoperatoren bijektiv zu den L_2 Eigenfunktionen des Laplaceoperators der hyperbolischen Flächen sind. Da die Eigenfunktionen der Transferoperatoren alleine durch die geschlossenen Geodäten bestimmt sind und somit also geometrische Objekte der Fläche sind, stellt auch sie eine Beziehung zwischen gewissen geometrischen und gewissen spektralen Objekten dieser Flächen her. Zum Abschluss noch eine kurze Erklärung zur Bezeichnung "Quantenchaos" für dieses Themengebiet: Der Laplaceoperator ist gerade, bis auf Skalierung, der Schrödingeroperator in der Physik. Quantenmechanisch werden seine L_2 Eigenfunktionen als gebundene Zustände verstanden. Das zugehörige Objekt in der klassischen Mechanik ist gerade das Hamiltonsche Vektorfeld des geodätischen Flusses, d. h. die Bildungsvorschrift für die Geodäten oder die Bewegungsvorschrift für Kugeln auf der Fläche. Das Korrespondenzprinzip der Physik besagt nun, dass im Grenzfall (hier: Eigenwerte der Eigenfunktionen gehen gegen unendlich) die Gesetze der Quantenmechanik in die der klassischen Mechanik übergehen sollten. Hier fragt man also gerade danach, wie die spektralen und die geometrischen Eigenschaften Riemannscher Mannigfaltigen wechselwirken. Daraus ergibt sich der Bestandteil "Quanten" in "Quantenchaos". Der Bestandteil "Chaos" ist wie folgt motiviert: Bei den in diesem Gebiet studierten Flüssen verhalten sich Bahnen, die sehr nah beieinander starten, typischerweise nach recht kurzer Zeit sehr unterschiedlich. Mit anderen Worten, kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen wirken sich typischerweise sehr stark aus, d.h., das System ist in gewisser Weise chaotisch. Frau Pohl hat Mathematik an der TU Clausthal studiert, an der Universität Paderborn promoviert und habilitiert gerade an der Universität Göttingen. Literatur und Zusatzinformationen William P. Thurston: The Geometry and Topology of Three-Manifolds, Mathematical Sciences Research Institute, 2002. A. Pohl: Symbolic dynamics for the geodesic flow on locally symmetric good orbifolds of rank one, Dissertation Uni Paderborn, 2009. A.Pohl: A dynamical approach to Maass cusp forms, arXiv preprint arXiv:1208.6178, 2012. M. Möller und A. Pohl: Period functions for Hecke triangle groups, and the Selberg zeta function as a Fredholm determinant, Ergodic Theory and Dynamical Systems 33.01: 247-283, 2013. P. Sarnak: Recent progress on the quantum unique ergodicity conjecture, Bull. Amer. Math. Soc 48: 211-228, 2012. S. Zelditch: Recent developments in mathematical quantum chaos, Current developments in mathematics 2009: 115-204, 2010.
Die Nullnummer eines Podcasts behandelt die Hintergründe, Themen und Motivation für die Reihe. Dazu ist Nele Heise zu Besuch nach Karlsruhe gekommen, und spricht mit Gudrun Thäter und Sebastian Ritterbusch über Podcasts, Wissenschaftskommunkation und den Modellansatz. Nele Heise, M.A., (@neleheise) ist freie Medienforscherin, Mitglied der Graduate School am Research Center Media and Communication Hamburg und beschäftigt sich in ihrem Promotionsprojekt mit den technischen und sozialen Rahmenbedingungen von Podcasting. Von 2005 bis 2011 studierte sie Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt und war anschließend bis Sommer 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem DFG-Projekt 'Die (Wieder-)Entdeckung des Publikums' am renommierten Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg. Als freie Medienforscherin setzt sie sich in Vorträgen, Gastartikeln, Workshops oder Paneldiskussionen mit Prozessen und Folgen des digitalen Wandels, ethischen Aspekten der Onlinekommunikation oder medialer Teilhabe auseinander. Nele kommt ursprünglich aus der freien Radio-Szene und hat 2003/2004 die Thüringen-Redaktion der Jugendzeitschrift SPIESSER aufgebaut. Im Haus der Fakultät für Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) befindet sich auch das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) und Nele Heise wurde von Prof. Dr. Annette Lessmöllmann eingeladen, im assozierten Master-Studiengang Wissenschaft - Medien - Kommunikation vorzutragen: In Wissen to Go (Folien) stellte sie die Frage: "Was hat Wissenschaftskommunikation mit Podcasts zu tun?". Sie kam neben der Einführung in Podcasts und aktuellen Themen der Wissenschaftskommunikation zu Formaten, die von Wissenschaffenden selbst getragen werden. Besondere Beispiele waren hier Methodisch inkorrekt, der KonScience Podcast und natürlich auch der BredowCast, der mit von ihr initiiert wurde. Diese Darstellung der Wissenschaft, fernab von Hierarchien, sieht sie als ein Produkt des Digitalen Wandels, das zeigt, welche neuen Rollen und Modelle sich in der Wissenschaftskommunikation etablieren könnten. Der Podcast SciComm – wissen, was läuft von den Studierenden des Studiengangs befasst sich entsprechend offensiv mit den aktuellen Themen der Wissenschaftskommunikation und dem Bild der Wissenschaft in den Medien: In SciComm Folge 2 im Gespräch mit Dr. Sven Stollfuß geht es um die Nerds in Big Bang Theory oder CSI und das daraus resultierende Bild der Wissenschaft. Für den Modellansatz Podcast war der von der DLR und ESA ins Leben gerufene Raumzeit Podcast ein prägendes Element, in dem die Gespräche komplexe Themen nicht scheuen oder simplifizieren, sondern sie in der erforderlichen Breite spannend erklären und so die Hörerschaft ernst nehmen. Dieser Ansatz scheint sich auch daran zu bestätigen, dass das vergleichsweise komplizierte Thema der L-Funktionen in der Zahlentheorie eine der gefragtesten Folgen des Modellansatz Podcasts ist. Dies steht im erstaunlichen Widerspruch zum Selbstverständnis der Wissenschaft in abstrakteren Themenbereichen, bei denen oft von einem Desinteresse der Öffentlichkeit ausgegangen wird. Viele Gesprächspartnerinnen im Podcast sind am Ende positiv über die Art der Themenbehandlung überrascht, und das liegt sicher auch an den Eigenheiten des besonderen Mediums. Der Podcasts ist laut Tim Pritlove das "mit Abstand persönlichste Medium überhaupt". Der Raum für Fragen, für die Themen selbst statt Klischees, erleichtert die Kommunikation für die Wissenschaffenden ungemein. So werden auch Ideen, Fehlschläge und überraschende Ansätze der Forschenden zu einem faszinierenden und lehrreichen Kommunikationsthema im Gegensatz zu Publikationen oder vereinfachenden Zusammenfassungen, die sich oft nur auf Resultate reduzieren. Gleichzeitig wird den Forschenden auf eine sehr menschliche Art die Möglichkeit geboten, über ihre mathematischen Ideen, die Faszination und Ergebnisse ihrer Arbeit zu sprechen. Dies trifft natürlich auch auf andere Forschungsgebiete zu, wie beispielsweise Daniel Meßner in den Stimmen der Kulturwissenschaft demonstriert. Auch beim BredowCast oder beim Forschergeist werden die Forschenden im Gespräch mit ihren vielfältigen Facetten und Interessen in natürlicher Weise zum Medium dargestellt. Daher waren die Forscherinnen, Absolventen und Lehrenden für den Modellansatz schon von Anfang an ein Schwerpunkt für die Auswahl der Gespräche. So fanden Themen der aktuellen Wissenschaft und faszinierende Abschlussarbeiten ihren Weg in den Podcast. Aber auch in der Lehre kann der Podcast die traditionellen Angebote unterstützen und häufige Fragen aus Sprechstunden im Dialog sehr zielgerichtet adressieren. Hier ist die Interaktion mit dem Podcast ein spannendes Thema, und Frameworks wie Podlove bieten eine umfassende Lösung, wie Publikation und Feedback für Podcasts gelöst werden kann. Ein Podcast aus der Praxis der Forschung und Lehre bietet auch die Chance, einen ausgewogeneren Einblick in die Realität der Wissenschaft zu liefern: So sprechen im Modellansatz neben Professorinnen auch junge Absolventinnen und Schüler. Dies bietet einmal einen größeren Grad an Identifikation und dies passt auch gerade zu den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 2015, die eine höhere Podcastnutzung gerade bei jüngeren Personen aufzeigt. Ebenso zeigt der Podcast den selbstverständlichen Querschnitt von Frauen wie Männern in der Wissenschaft. Auch in der allgemeinen Podcastlandschaft werden die Frauenstimmen immer zahlreicher, wie die von Nele Heise initiierte Liste zeigt, die von der Hörsuppe in ein Flattrboard gebracht wurde: Frauenstimmen im Netz - die Podcasterinnen-Liste. Leider haben Podcasts in der deutschsprachigen Wissenschaftskommunikation noch keinen hohen Stellenwert, obwohl das Medium einzigartige Vorteile besitzt, wie Henning Krause im Beitrag Wissenschaft auf die Ohren: Audiopodcasts beschreibt. Hier können kuratierte Angebote wie die Wissenschaftspodcasts-Seite (@wisspod) den Einstieg erleichtern und die Verbreitung der Angebote im Wissenschaftsraum fördern. Das soll natürlich auch alle interessierten in der Wissenschaft motivieren, selbst das Mikro in die Hand zu nehmen und über ihre Berufung zu sprechen - denn wer kann authentischer die eigene Motivation, Ideen und Ergebnisse vermitteln als man selbst? Für den Start gibt es viele Anlaufpunkte, wie das Sendegate, das jährliche Wissenschaftspodcaster Treffen #GanzOhr, die Podlove Podcaster Workshops oder Podcast MeetUps in der Nähe. Die Community bietet viel Unterstützung, und so war Toby Baier beispielsweise eine große Hilfe beim Start des BredowCast. Eine Besonderheit von Podcasts ist auch die Verknüpfung des gesprochenen Worts mit den Sendungsnotizen oder Shownotes. Gerade in der Wissenschaft haben Referenzen einen hohen Stellenwert: Es geht hier um Sichtbarkeit, die Herstellung des Kontexts, die Vernetzung mit weiteren Quellen und die Belege für Aussagen. Dies kann und sollte daher in wissenschaftlichen Podcasts eine besondere Aufmerksamkeit erhalten: Neben der traditionellen Referenzierung können sprachliche Ungenauigkeiten detailliert oder korrigiert werden, und die im erwünscht flüssigen Gespräch schwierigen Querverweise nachträglich im Text erfolgen. Letztlich bieten die Texte auf dem Stand der Technik von Suchmaschinen noch eine besonders gute Auffindbarkeit der sonst schwer durchsuchbaren Audiodateien. Eine weitere interessante Ergänzung ist die Erstellung von EBooks, wie Helfrich et al. in Visualization of lithosphere subduction: application to the mantle evolution beneath the Japanese Islands demonstrieren. Hier können schriftliche Medien mit Videos und Tonmedien interaktiv zum erlebenden Lernen zusammengeführt werden. Gerade im Bereich der Lehre können Podcasts den Studierenden und den Lehrenden große Vorteile bringen: Neben dem Ansatz im Flipped Classroom das passive Lernen nach Hause und das aktive Lernen in die Vorlesung zu bringen, haben sich schon die Zusammenfassungen von ganzen Vorlesungen sehr bewährt. Im Modellansatz gibt es dazu die Beispiele der Vorlesungen zur Analysis oder die digitalen Währungen. Dabei sind die Folgen aber keine traditionellen Vorlesungsmitschnitte, sondern spannende Gespräche mit Dozent oder Übungsleiter, wo durch die Unterhaltung die Motivation deutlich steigt. Dabei müssen natürlich nicht alle Darstellungen so spektakulär sein wie das Intro der Folge 62 von Methodisch Inkorrekt (mit dem Reinhard Remfort nichts zu tun hatte). Für den Spracherwerb und auch zur Behandlung von Trauma- und Suchtpatientinnen haben sich Audiopodcasts als begleitendes Medium bewährt und es gibt in der Artikelliste von Nele Heise zum Thema Podcasts wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Interessant sind auch Podcast-Konzepte mit einem vordefiniertem Umfang, wie beispielsweise dem Grounded Theory Podcast (Grounded Theory auf Soundcloud). Die Gespräche werden von den Stimmen getragen - seien es so erfahrene Podcasterinnen wie Annik Rubens oder der Wissenschaftler, der zuvor nie in ein Mikro gesprochen hat - sie alle stellen die Vielfalt der Mitwirkenden dar. Gerade im Audiopodcast werden unterschiedliche Stimmen sehr offen aufgenommen und bieten einen viel tieferen persönlichen Bezug zwischen Hörerin und Sprecherin. Der Blick in die USA zeigt, welchen Stellenwert Podcasts in der Gesellschaft haben können, der sich laut Marco Arment auch noch deutlich erweitern wird. Auch die Entwicklung der Wissenschaftskommunikation ist laut dem SciComm Gespräch mit Prof. Scheufele deutlich weiter. Was sich von diesen Entwicklungen in den deutschsprachigen Raum überträgt, wird sicher auch auf die Wissenschaftspodcasts einen großen Einfluss haben. Literatur und Zusatzinformationen Nele Heise: Podcast Forschung, 5. Podlove Podcaster Workshop, Berlin, Mai 2015. Nele Heise: Forschungserkenntnisse zur Hörerschaft von Podcasts, 6. Podlove Podcaster Workshop, Berlin, November 2015. Vorträge von Nele Heise auf Slideshare Nele Heise: Studien und Artikel zum Thema Podcasts / Podcasting Forum Wissenschaftskommunikation 2015: Der kommunizierende Wissenschaftler- das (un)bekannte Wesen
Eine alte Fragestellung lautet, was die Summe der Kehrwerte aller natürlicher Zahlen ist. Mit anderen Worten: existiert der Grenzwert der Harmonischen Reihe ? Die Antwort, die man im ersten Semester kennenlernen ist: Diese Reihe ist divergiert, der Wert ist nicht endlich. Über die spannenden Entwicklungen in der Zahlentheorie, die sich daraus ergaben, berichtet Fabian Januszewski im Gespräch mit Gudrun Thäter. Eine verwandte Fragestellung zur harmonischen Reihe lautet: Wie steht es um den Wert von ? Diese Frage wurde im 17. Jahrhundert aufgeworfen und man wußte, daß der Wert dieser Reihe endlich ist. Allerdings kannte man den exakten Wert nicht. Diese Frage war als das sogannte Basel-Problem bekannt. Eine ähnliche Reihe ist Ihr Wert läßt sich elementar bestimmen. Dies war lange bekannt, und das Basel-Problem war ungleich schwieriger: Es blieb fast einhundert Jahre lang ungelöst. Erst Leonhard Euler löste es 1741: Die Riemann'sche -Funktion Die Geschichte der L-Reihen beginnt bereits bei Leonhard Euler, welcher im 18. Jahrhundert im Kontext des Basel-Problems die Riemann'sche -Funktion' entdeckte und zeigte, dass sie der Produktformel genügt, wobei die Menge der Primzahlen durchläuft und eine reelle Variable ist. Diese Tatsache ist äquivalent zum Fundamentalsatz der Arithmetik: jede natürliche Zahl besitzt eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Eulers Lösung des Basel-Problems besagt, daß und diese Formel läßt sich auf alle geraden positiven Argumente verallgemeinern: , wobei die -te Bernoulli-Zahl bezeichnet. Im 19. Jahrhundert zeigte Bernhard Riemann, dass die a priori nur für konvergente Reihe eine holomorphe Fortsetzung auf besitzt, einer Funktionalgleichung der Form genügt und einen einfachen Pol mit Residuum bei aufweist. Letztere Aussage spiegelt die Tatsache wieder, dass in jedes Ideal ein Hauptideal ist und die einzigen multiplikativ invertierbaren Elemente sind. Weiterhin weiß viel über die Verteilung von Primzahlen. Setzen wir dann zeigte Riemann, daß die so definierte vervollständigte Riemann'sche -Funktion auf ganz holomorph ist und der Funktionalgleichung genügt. Da die -Funktion Pole bei nicht-positiven ganzzahligen Argumenten besitzt, ergibt sich hieraus die Existenz und Lage der sogenannten "trivialen Nullstellen" von : für . Konzeptionell sollte man sich den Faktor als Eulerfaktor bei vorstellen. John Tate zeigte in seiner berühmten Dissertation, daß dies tatsächlich sinnvoll ist: Die endlichen Eulerfaktoren werden von Tate als Integrale über interpretiert, und der "unendliche" Eulerfaktor ist ebenfalls durch ein entsprechendes Integral über gegeben. Er legte damit den Grundstein für weitreichende Verallgemeinerungen. Die Riemann'sche -Funktion ist der Prototyp einer -Funktion, einem Begriff, der langsam Schritt für Schritt verallgemeinert wurde, zunächst von Richard Dedekind, Lejeune Dirichlet und Erich Hecke und weiter von Emil Artin, Helmut Hasse, André Weil, Alexander Grothendieck, Pierre Deligne, Jean-Pierre Serre und Robert Langlands et al. -Funktionen spielen in der modernen Zahlentheorie eine zentrale Rolle, und bis heute ranken sich fundamentale Vermutungen um diesen Begriff. Selbst die Mysterien der Riemann'schen -Funktion sind auch heute bei weitem nicht vollständig ergründet. Die berühmteste Vermutung in diesem Kontext ist die Riemann'sche Vermutung. Riemann zeigte 1859 nicht nur, daß die Riemann'sche -Funktion eine holomorphe Fortsetzung auf besitzt, sondern stellte auch einen engen Zusammenhang zwischen der Verteilung der Primzahlen und den Nullstellen von her. Eulers Produktenwicklung von für zeigt, dass stets für . Aus der Funktionalgleichung von ergibt sich, dass für natürliche Zahlen . Die sind die sogenannten trivialen Nullstellen der -Funktion. Riemann vermutete, dass sämtliche nicht-trivialen Nullstellen auf der Geraden liegen. Euler bestimmte im wesentlichen die Werte für positives . Bis heute wissen wir sehr wenig über die Werte an positiven ungeraden Argumenten. Ein Satz von Apéry besagt, daß irrational ist. Wir haben allerdings keine einfache Formel für diesen Funktionswert. Konzeptionell unterscheiden sich die ungeraden von den geraden positiven Argumenten darin, daß der in auftretende Faktor der -Funktion für ungerades positives dort einen Pol besitzt, was ebenfalls das Verschwinden von zur Folge hat. Über die Werte an negativen ungeraden Argumenten wissen wir aus der Funktionalgleichung, daß . Insbesondere gilt . Dieser Wert kann in gewissen Kontexten als Grenzwert (der divergierenden!) Reihe interpretiert werden (formal ergeben diese Identitäten natürlich keinen Sinn). In gewissen Situationen ist der Funktionswert ein sinnvoller endlicher Ersatz für den nicht existierenden Grenzwert der Reihe . Derartige Phänomene treten in Zahlentheorie an vielen Stellen auf. Literatur und Zusatzinformationen Haruzo Hida, Elementary theory of -functions and Eisenstein series, Cambridge University Press, 1993. Jean-Pierre Serre, "Cours d'arithmétique", Presses Universitaires de France, 1970. Goro Shimura, "Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions." Princeton University Press, 1971. Jürgen Neukirch, Algebraische Zahlentheorie, Springer Verlag, 1992. André Weil, Basic Number Theory, Springer Verlag, 1973. Podcast Modellansatz 036: Analysis und die Abschnittskontrolle Bernhard Riemann, Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1859 John T. Tate, "Fourier analysis in number fields, and Hecke's zeta-functions", Algebraic Number Theory (Proc. Instructional Conf., Brighton, 1965), Thompson, 1950, S. 305–347. Andrew Wiles, "Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem." Annals of Mathematics 142, 1995, S. 443–551. Richard Taylor, Andrew Wiles, "Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras." Annals of Mathematics 142, 1995, S. 553–572. Brian Conrad, Fred Diamond, Richard Taylor, "Modularity of certain potentially Barsotti-Tate Galois representations", Journal of the American Mathematical Society 12, 1999, S. 521–567. Christophe Breuil, Brian Conrad, Fred Diamond, Richard Taylor, "On the modularity of elliptic curves over Q: wild 3-adic exercises", Journal of the American Mathematical Society 14, 2001, S. 843–939. Frobeniushomomorphismus Galois-Darstellungen Weil-Vermutungen Standard-Vermutungen Automorphe Formen Das Langlands-Programm Wikipedia: Automorphe L-Funktionen Emil Artin, Über eine neue Art von -Reihen, Abh. Math. Seminar Hamburg, 1923. Armand Borel, "Automorphic L-functions", in A. Borel, W. Casselman, "Automorphic forms, representations and L-functions" (Proc. Sympos. Pure Math., Oregon State Univ., Corvallis, Oregon, 1977), Teil 2, Proc. Sympos. Pure Math., XXXIII, American Mathematical Society, 1979, S. 27–61. Robert P. Langlands, "Problems in the theory of automorphic forms", in "Lectures in modern analysis and applications III," Lecture Notes in Math 170, 1970, S. 18–61. Robert P. Langlands, '"'Euler products", Yale University Press, 1971. Wikipedia: Spezielle Werte von L-Funktionen Pierre Deligne; "Valeurs de fonctions L et périodes d’intégrales." , in A. Borel, W. Casselman, "Automorphic forms, representations and L-functions" (Proc. Sympos. Pure Math., Oregon State Univ., Corvallis, Oregon, 1977)'', Teil 2, Proc. Sympos. Pure Math., XXXIII, American Mathematical Society, 1979, S. 313–346.
Jonathan Zachhuber war zum 12. Weihnachtsworkshop zur Geometrie und Zahlentheorie zurück an seine Alma Mater nach Karlsruhe gekommen und sprach mit Gudrun Thäter über Teichmüllerkurven. Kurven sind zunächst sehr elementare ein-dimensionale mathematische Gebilde, die über den komplexen Zahlen gleich viel reichhaltiger erscheinen, da sie im Sinne der Funktionentheorie als Riemannsche Fläche verstanden werden können und manchmal faszinierende topologische Eigenschaften besitzen. Ein wichtiges Konzept ist dabei das Verkleben von Flächen. Aus einem Rechteck kann man durch Verkleben der gegenüberliegenden Seiten zu einem Torus gelangen (Animation von Kieff zum Verkleben, veröffentlicht als Public Domain): Polynome in mehreren Variablen bieten eine interessante Art Kurven als Nullstellenmengen zu beschreiben: Die Nullstellen-Menge des Polynoms ergibt über den reellen Zahlen den Einheitskreis. Durch Ändern von Koeffizienten kann man die Kurve verformen, und so ist die Nullstellenmenge von eine Ellipse. Über den komplexen Zahlen können diese einfachen Kurven dann aber auch als Mannigfaltigkeiten interpretiert werden, die über Karten und Atlanten beschrieben werden können. Das ist so wie bei einer Straßenkarte, mit der wir uns lokal gut orientieren können. Im Umland oder anderen Städten braucht man weitere Karten, und alle Karten zusammen ergeben bei vollständiger Abdeckung den Straßenatlas. Auch wenn die entstehenden abstrakten Beschreibungen nicht immer anschaulich sind, so erleichtern die komplexen Zahlen den Umgang mit Polynomen in einem ganz wichtigen Punkt: Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass der Grad des Polynoms gleich der Anzahl der Nullstellen in ihrer Vielfachheit ist. Also hat nun jedes nichtkonstante Polynom mindestens eine Nullstelle, und über den Grad des Polynoms wissen wir, wie viele Punkte sich in der Nullstellenmenge bewegen können, wenn wir an den Koeffizienten Veränderungen vornehmen. Eine gute Methode die entstehenden Flächen zu charakterisieren ist die Bestimmung möglicher geschlossener Kurven, und so gibt es beim Torus beispielsweise zwei unterschiedliche geschlossene Kurven. Die so enstehende Fundamentalgruppe bleibt unter einfachen Deformationen der Flächen erhalten, und ist daher eine Invariante, die hilft die Fläche topologisch zu beschreiben. Eine weitere wichtige topologische Invariante ist das Geschlecht der Fläche. Die Teichmüllerkurven entstehen nun z.B. durch das Verändern von einem Koeffizienten in den Polynomen, die uns durch Nullstellenmengen Kurven beschreiben- sie sind sozusagen Kurven von Kurven. Die entstehenden Strukturen kann man als Modulraum beschreiben, und so diesen Konstruktionen einen Parameterraum mit geometrischer Struktur zuordnen. Speziell entstehen Punkte auf Teichmüllerkurven gerade beim Verkleben von gegenüberliegenden parallelen Kanten eines Polygons; durch Scherung erhält man eine Familie von Kurven, die in seltenen Fällen selbst eine Kurve ist. Ein Beispiel ist das Rechteck, das durch Verkleben zu einem Torus wird, aber durch Scherung um ganz spezielle Faktoren zu einem ganz anderen Ergebnis führen kann. Die durch Verklebung entstandenen Flächen kann man als Translationsflächen in den Griff bekommen. Hier liefert die Translationssymmetrie die Methode um äquivalente Punkte zu identifizieren. Für die weitere Analyse werden dann auch Differentialformen eingesetzt. Translationen sind aber nur ein Beispiel für mögliche Symmetrien, denn auch Rotationen können Symmetrien erzeugen. Da die Multiplikation in den komplexen Zahlen auch als Drehstreckung verstanden werden kann, sind hier Rotationen als komplexe Isomorphismen ganz natürlich, und das findet man auch in den Einheitswurzeln wieder. Literatur und Zusatzinformationen A. Zorich: Flat Surfaces, Frontiers in Number Theory, Physics and Geometry, On Random Matrices, Zeta Functions, and Dynamical Systems, Ed. by P. Cartier, B. Julia, P. Moussa, and P. Vanhove. Vol. 1. Berlin: pp. 439–586, Springer-Verlag, 2006. M. Möller: Teichmüller Curves, Mainly from the Viewpoint of Algebraic Geometry, IAS/Park City Mathematics Series, 2011. J. Zachhuber: Avoidance of by Teichmüller Curves in a Stratum of , Diplomarbeit an der Fakultät für Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2013. C. McMullen: Billiards and Teichmüller curves on Hilbert modular surfaces, Journal of the AMS 16.4, pp. 857–885, 2003. C. McMullen: Prym varieties and Teichmüller curves, Duke Math. J. 133.3, pp. 569–590, 2006. C. McMullen: Dynamics of SL(2,R) over moduli space in genus two, Ann. of Math. (2) 165, no. 2, 397–456, 2007. Weitere Paper von C. McMullen, u.a. The mathematical work of Maryam Mirzakhani Podcast: Modellansatz 040: Topologie mit Prof. Dr. Wolfgang Lück
Im Herbst beginnen die neuen Studiengänge der Mathematik am KIT und neben den Vorlesungen zur Linearen Algebra, Stochastik oder Numerik gehört die Analysis zu den mathematischen Vorlesungen, mit dem das Studium der Mathematik in den ersten Semestern beginnt. Dazu spricht Sebastian Ritterbusch mit Johannes Eilinghoff, der im letzten Jahr den Übungsbetrieb der Analysis-Vorlesungen mit großem Anklang organisiert hat.Die Analysis befasst sich besonders mit der Mathematik um Funktionen auf reellen Zahlen, welche Eigenschaften sie haben, und wie man diese differenzieren oder integrieren kann. Vieles zur Geschichte der Analysis findet man besonders in den Büchern von Prof. Dr. Michael von Renteln, der unter anderem über die Geschichte der Analysis im 18. Jahrhundert von Euler bis Laplace, die Geschichte der Analysis im 19. Jahrhundert von Cauchy bis Cantor, über Aspekte zur Geschichte der Analysis im 20. Jahrhundert von Hilbert bis J. v. Neumann und über die Die Mathematiker an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1825-1945 geschrieben hat.Grundlage für die Mathematik in der Analysis sind die Zahlenmengen, wie die abzählbaren natürlichen Zahlen , ganzen Zahlen , rationale Zahlen und schließlich die überabzählbaren reellen Zahlen . Während die natürlichen Zahlen direkt mit dem Beweisprinzip der vollständigen Induktion in Verbindung stehen und für sich schon ein Thema der Zahlentheorie sind, benötigt man für die Analysis mindestens die reellen Zahlen. Diese kann man über konvergente Folgen bzw. Cauchy-Folgen rationaler Zahlen einführen. Für den Beweis der Äquivalenz dieser beiden Konvergenzbegriffe kann man die Dreiecksungleichung sehr gut gebrauchen. Ein Beispiel für eine Folge rationaler Zahlen, die gegen eine irrationale Zahl konvergieren ist , die gegen die Eulersche Zahl konvergiert, d.h. . Aus jeder Folge kann man eine Reihe bilden, indem man die Folgenglieder aufsummiert. Wichtige Reihen sind die geometrische Reihe mit Summenwert , wenn , und die divergente Harmonische Reihe, mit der man sogar Brücken bauen kann.Über den Begriff der Folge kann man auch offene Mengen und abgeschlossene Mengen definieren, so wie dies auch mit Epsilon-Umgebungen definiert werden kann. Diese Eigenschaften werden im Bereich der mathematischen Topologie noch viel umfassender eingeführt, aber schon diese Darstellungen helfen, den wichtigen Begriff der Funktion in der Analysis und deren Eigenschaften einzuführen. Zur Definition einer Funktion gehört neben der eigentlichen Abbildungsvorschrift die Angabe der Definitionsmenge und der Wertebereich. Ohne diese Informationen ist es nicht möglich Surjektivität und Injektivität nachzuweisen.Eine wichtige Eigenschaft von Funktionen ist der Begriff der Stetigkeit, die man für den Zwischenwertsatz benötigt. Damit kann man zum Beispiel wackelnde Tische reparieren oder mit Anastasia im Science Slam Orte gleicher Temperaturen auf der Erde suchen. Der Zwischenwertsatz gilt zunächst nur für reelle Funktionen, es gibt den Zwischenwertsatz aber auch in allgemeinerer Form.Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist die Differenzierbarkeit und das Berechnen von Ableitungen mit ihren Ableitungsregeln. Sehr wichtig ist dabei die Exponentialfunktion, die mit ihrer eigenen Ableitung übereinstimmt. Diese Funktion findet man im Alltag in jeder Kettenlinie in der Form des Cosinus Hyperbolicus wieder. Eine wichtige Anwendung für differenzierbare Funktionen ist der Mittelwertsatz, ohne den die Abschnittskontrolle auf Autobahnen zur Geschwindigkeitsüberprüfung nicht denkbar wäre. Aber auch in höheren Dimensionen kann man Differentialrechnung betreiben, und man führt dazu den Gradienten, Richtungsableitungen und z.B. die Divergenz eines Vektorfelds ein.Als Umkehrung der Differentiation erhält man die Integralrechnung. Jedoch ist das Bilden einer Stammfunktion nur bis auf eine Konstante eindeutig. Daher kann man zum Beispiel mit Beschleunigungssensoren im Handy nicht wirklich eine Positions- und Geschwindigkeitsmessung durchführen, sondern muss für die Trägheitsnavigation viele weitere Sensoren mit einbeziehen. Eine andere Einführung des Integrals ist das Lebesgue-Integral oder das Riemannsche Integral, wo man bei letzterem in einem Intervall die Fläche unter einer Kurve durch Treppenfunktionen annähert. Den Zusammenhang dieser beiden Begriff liefert der Fundamentalsatz der Analysis. Leider kann man nicht zu allen Funktionen analytische Stammfunktionen bestimmen. Hier kann dann die numerische Integration zum Einsatz kommen. Die Integration ist aber keine rein abstrakte Idee, sondern wir finden mathematische Zusammenhänge wie den Gaußsche Integralsatz direkt in der Natur wieder.Für den Start im Studium erhält man in Karlsruhe viel Unterstützung: Es gibt Vorkurse und die von der Fachschaft für Mathematik und Informatik organisierte Orientierungsphase, oder kurz O-Phase, in der man die zukünftigen Mitstudierenden kennenlernen kann. Mit diesen sollte man sich gemeinsam den Stoff von Vorlesungen, Übungen und Tutorien erarbeiten, um sich mit gelösten Übungsblättern zur Klausteilnahme zu qualifizieren, und letztlich auch die Prüfungen gemeinsam vorzubereiten.Literatur und Zusatzinformationen W. Reichel: Kurzskript Analysis 1, Vorlesung am KIT, 2012/2013. W. Reichel: Kurzskript Analysis 2, Vorlesung am KIT, 2013. H. Amann, J. Escher: Analysis 1, 3. Auflage, Birkhäuser-Verlag, 2008. O. Forster: Analysis 1, 7. Auflage, Vieweg-Verlag, 2004. H. Heuser: Lehrbuch der Analysis, Teil 1, 15. Auflage, Teubner-Verlag, 2006. K. Königsberger, Analysis 1, 5. Auflage, Springer-Verlag, 2001. W. Rudin, Analysis, 4. Auflage, Oldenbourg-Verlag, 2008. R. Strichartz, The Way of Analysis, Jones and Bartlett-Verlag, 1995. W. Walter, Analysis 1, 7. Auflage, Springer-Verlag, 2007. Konscience Podcast KNS026: Effizienz der photovoltaischen Wasserspaltung erhöht
Um im digitalen Umfeld elektronischen Handel zu betreiben, benötigt man einen gesicherten Datenaustausch für Angebote, Verhandlungen und Verträge, aber letztlich auch eine Form von elektronischem Geld auf dem der Handel basiert. Ganz zentral ist dabei die moderne Kryptographie und insbesondere die Public Key-Verfahren, die durch mathematische Verfahren das ganze ermöglichen, soweit die Verfahren sicher, korrekt implementiert und richtig benutzt werden, und es nicht zu einem Fiasko wie dem Heartbleed-Bug kommt. Im Gespräch mit Gudrun Thäter erläutert Sebastian Ritterbusch die Mathematik hinter digitalem Geld und der Kryptowährung Bitcoin. Dazu geht es zunächst in die Zahlentheorie der Restklassenkörper und spezielle Restklassenringe . Mit dem kleinen Satz von Fermat versehen wir eine Einwegfunktion mit einer Falltür und kommen auf Hash-Funktionen und das RSA-Verfahren. Damit kann man auch digital Unterschreiben (sogar bei Bedarf blind signieren), wir diskutieren, wie Verträge durch einen Kollisionsangriff und dem Geburtstagsparadoxon gefälscht werden können, und wie damit erfolgreich ein Root-Zertifikat fingiert wurde. Für das zentral organisierte und anonyme digitale Geld benötigt man dann nur noch das Prinzip des geteilten Geheimnis. Leider kommt das Verfahren gegenüber weniger anonymen Verfahren heute kaum zum Einsatz, im Gegensatz zum Bitcoin-Verfahren, das sich wachsender Beliebtheit erfreut. Hier ersetzt ein Peer-to-Peer-Netzwerk und eine Hash-Kette die zentrale Instanz, und verhindert so das doppelte Ausgeben durch die gemeinsame Vergangenheit von Transaktionen, die über einen Merkle-Baum in die Block-Chain platzsparend integriert werden. Literatur und Zusatzinformationen D.Chaum, A.Fiat, M.Naor: Untraceable electronic cash, Proceedings on Advances in Cryptology, S. Goldwasser, Ed. Springer-Verlag New York, New York, NY, 319-327, 1990. S.Nakamoto: Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Whitepaper, The Cryptography Mailing List, 2008. A.Sotirov, M.Stevens, J.Appelbaum, A.Lenstra, D.Molnar, D.A.Osvik, B.Weger: MD5 considered harmful today, Creating a rogue CA certificate, Crypto 2009 Proceedings, 2009. Z.Durumeric, E.Wustrow, J.A.Halderman: ZMap - der IPv4-Scan J.A.Haldermann: Fast Internet-wide Scanning and its Security Applications, Vortrag 30C3, 2013. Heise.de, bbe: Virenscanner warnt vor Bitcoin-Blockchain, 17.5.2014. Heise.de, axk: Bitcoin: Erstmals gefährliche Konzentration der Mining-Leistung, 16.6.2014. Podcast: T.Pritlove und A.Bogk: CRE182, Elektronisches Geld Podcast: M.Richter und A.Bogk: Die Wahrheit 005, Bitcoins Podcast: F.Blue, X.Initrc, M.Malik: Death of a traveling salesman Podcast: D.Jäckel und A.Schildbach: Bitstaub, Ein Bitcoin Podcast Podcast: Bitcoin Austria: Bitcoin Update Podcast: M.Völter, G.Andresen: Omega Tau 59, Bitcoin
"Wozu brauche ich das", ist eigentlich ein Hilferuf im Mathematikunterricht. Im Gespräch mit dem Mathematik-Didaktiker Stefan Götz. In der Schulmathematik und Mathematik-Didaktik geht es darum, wie Mathematik von der Universität an die Schulen gebracht wird. Geometrie, Algebra, Arithmetik, Analysis, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. In der Fachdidaktik gibt es nie einen der Recht hat, denn man auch beschäftigt sich mit vielen Dingen, die es gar nicht gibt. In der Mathematik gibt es keine Schüttbilder. Mathematik - ein Thema, das frei von Befindlichkeiten ist. Ob Geraden parallel sind, oder nicht, hängt nicht davon ab, welche politische Anschauung man vertritt. Gründlichkeit, Genauigkeit und Hartnäckigkeit schaden dabei nicht. Modelle helfen dabei, mit der Wirklichkeit umzugehen. Ähnlich dem "Jahn'schen Turnen", das sich mit schrecklichen Felgaufschwüngen zu einem zugänglicheren "Bewegung und Sport" verändert hat, hat sich über die Jahre auch das Fach "Mathematik" in der Schule gewandelt. Alle sollen heute mitmachen können. Mathematik "mit ohne Angst". Eine "Optimalmathematik" gibt es aber leider nicht. Lehren hat immer etwas mit Persönlichkeit zu tun. "Mathematik für das Lehramt" zu studieren, bedeutet für Studierende heute die Teilnahme an einem 4-Säulen-Modell: 1) Fachliche Ausbildung 2) Didaktik der Mathematik 3) Allgemeine pädagogische Ausbildung 4) Schulpraxis [caption id="attachment_471" align="alignright" width="225"] Ein Kran, der einen Kran hebt, der einen Kran hebt. Folgen und Reihen. (Foto: Liebherr)[/caption] Inhalte: Stefan Götz, Schulmathematik, Hans Christian Reichel, Erfolg, Unterricht, Fehlvorstellungen, erklären, Fehler, sicher fühlen, Jahn'sches Turnen, Lehramtsausbildung, Fachdidaktik, Lineare Algebra, Analysis, Folgen und Reihen, Approximation des Kreisumfangs, Lernpfade, Gründlichkeit, Abstrakt, Regeln, Linguist, stetig, diskret, Grenzwert, Asymptote, Unendlichkeit, Traditionen, Felix Klein, Meraner Reform, Differenzialgleichungen, Differenzengleichungen, reelle Zahlen als Kontinuum, Modell, Wahlverfahren, Religion, relativieren, Podcast: Modellansatz, Liebherr Kranmobile, Politik, paritätische Besetzung von Lehrplankomissionen, Fermats Großer Satz, Andrew Wiles, Zahlentheorie, Rindler, Gödel, Beweisbarkeit, Mathematische Logik, Ergodentheorie, Differenzialgleichungen, Kombinatorik, Biomathematik, Finanzmathematik, Drittmitteleinwerbung, Öffentlichkeit, Presseabteilung, Kooperationsschulen, Didaktische Schulen, Wien, Klagenfurt, Schulbücher, Götz Reichel, Bürger Fischer Malle, Lechner Dorfmayr, Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung, BIFIE, Didaktisches Konzept, Grundkompetenz, Aufgaben, Geld, Co-Autoren, Pisa, Deutschlandfunk "Pisa Plus", IMST, Datensicherheit, Kommunikationsproblem, Prüfungs- und Unterrichtsbeispiele, Schwerpunkte setzen, systemische Therapie, Zusammenarbeit von Lehrer/innen, Selektion, Ressourcen der Gesellschaft, Nachmittagsangebote, Defizite, Wettbewerbe, Sprache: rechnen, argumentieren, begründen, interpretieren, darstellen, modellbilden, Bildungsstandards, Interlokutor, Technologieeinsatz, Geogebra, Wolfram Alpha, programmierbare Taschenrechner, soziale Komponente, auf- und abrüsten, Assessment, Eigenschaften eines Dreiecks, Geometrie, Origami und Mathematik, Kompetenz, Distraktoren, mehr Stellen, Lehre an der Universität, Gesprächspartner: Stefan Götz, Fakultät für Mathematik der Universität Wien Das Gespräch wurde am 20.03.2014 aufgezeichnet. Ausschnitte daraus werden in der Radiosendung "Sprache der Bildung" (Moment Leben heute) am 6. Mai 2014 im ORF Radioprogramm Österreich 1 ausgestrahlt.
Das ist die gesprochene Version des Artikels Zahlentheorie.Diesen Artikel herunterladen (Hilfe)Dauer: 22:11Sprecher: WidzardGeschlecht: männlichDialekt: Deutsch (Hochdeutsch)Version: 29. Dezember 2013Autoren: Siehe Autoren-Aufschlüsselung oder Versionen/AutorenSiehe auch: WikiProjekt gesprochene Wikipediamp3-Datei herunterladen
085 – Zahlentheorie
In dieser Episode, die wir im Rahmen unserer OmegaTour Pott aufgenommen haben, spreche ich mit Professor Ulrich Görtz, Leiter der Arbeitsgruppe Zahlentheorie an der Universität Duisburg-Essen, über die Grundlagen der Zahlentheorie sowie über aktuelle Forschungsthemen und Anwendungsgebiete. Professor Görtz beschreibt dabei sehr anschaulich anhand einfacher Beispiele, womit sich die Zahlentheorie befasst und welche Herangehensweisen an ihre Fragestellungen es gibt. Es geht unter anderem um Primzahlen, Polynome, die Fermatsche Vermutung und Codierungstheorie.
Unterricht in Kryptologie
Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/02
Kryptologie, die Wissenschaft von den Geheimschriften und ihrer Entschlüsselung, erfährt in der gegenwärtigen Zeit zunehmend praktische Bedeutung. Sie gewährleistet nicht nur Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität beim Nachrichtenaustausch, sondern bestimmt auch die Sicherheit des elektronischen Geschäftsverkehrs, des Datenschutzes und ermöglicht digitale Signaturen. Gleichzeitig stützen sich moderne Verfahren der Kryptologie auf die Zahlentheorie, deren Grundlagen bereits in der Sekundarstufe I bereitgestellt werden. In der Vereinigung von mathematischen Inhalten, historischen Entwicklungen und aktuellen gesellschaftspolitischen Aspekten bietet Kryptologie vielfältige Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen. Dass kryptologische Inhalte dennoch nicht in den Schulunterricht integriert sind, ist Anlass dieser Arbeit. Ausgehend vom Bildungs- und Erziehungsauftrag allgemeinbildender Schulen wird zunächst die Berechtigung eines Unterrichts in Kryptologie nachgewiesen. Anschließend wird dessen didaktischer Ort festgelegt, es werden geeignete Lerninhalte ausgewählt und in eine zeitliche Abfolge gebracht. In einer Unterrichtssequenz werden diese kryptologischen Lerninhalte didaktisch aufbereitet, auf Verständnisebene der Schüler transferiert und mit methodischen Hinweisen für Lehrkräfte versehen.