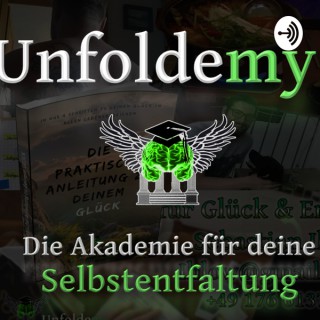Podcasts about insuffizienz
- 35PODCASTS
- 47EPISODES
- 27mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jul 11, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about insuffizienz
Latest podcast episodes about insuffizienz
DocCheck FlexTalk – wichtige Ventile: Die Herzklappenfehler
Erst Anhören – dann Abhören: Frank und Moritz tauchen in dieser Folge ein in die klinische Kardiologie und besprechen die Herzvitien der vier Herzklappen. Neben der Unterscheidung von Stenose und Insuffizienz sowie konzentrischer oder exzentrischer Hypertrophie erfahrt ihr dabei auch, wie man die einzelnen Herzklappenfehler diagnostisch feststellt und jeweils therapiert. Also Stethosk.. – nein, erst Kopfhörer auf – und reingehört! Du willst noch mehr zum Thema Hals wissen? Dann schau doch mal in unseren Flexikon-Artikel zum Thema. Übrigens: Schickt uns eure Fragen und euer Feedback zum Podcast gerne an: podcast@doccheck.com
Beide im Norden, fernab von der Arbeit und dennoch voll mit Medizin. Wir besprechen eine Mail von jemandem mit einem Ehlers-Danlos-Syndrom, wir sprechen über unsere erste Begegnung und wie alles begann. Es geht um THC und warum auch hier Set und Setting essentiell sind. In einem Selbstversuch hat einer von uns tatsächlich erfolgreich seine Migräne mit THC therapiert! Wir sprechen über die neue Studie aus dem Bereich der Notfallversorgung der respiratorischen Insuffizienz: die PREOXI Trial in der ein klarer Vorteil für eine Preoxygenierung und Denitrogenisierung mit NIV gegenüber der Sauerstoffmaske bewiesen wird. Ein Fallbeispiel über eine unklare Vigilanzminderung… voll mit Infos und spannenden Geschichten und Timo erzählt mal kurz angerissen vom ersten Teil seines Selbstexperiments mit der kontinuierlichen Blutzuckermessung. Ozempic Babies: https://www.zeit.de/gesundheit/2024-05/ozempic-schwangerschaft-medikament-nebenwirkung Cannabis % https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/152064/EU-Behoerde-warnt-vor-immer-staerkeren-Cannabisprodukten Wenn ihr Teil unseres Podcasts seien wollt: schreibt eine Email an info@mtma.tv und erzählt uns eure Geschichte, stellt medizinische Fragen, verteilt Lob und oder auch Kritik! Wir freuen uns auf euch!
Präklinischen NIV Profi: Mit effektiver Strategie zur Patiententoleranz
Mit der präklinischen NIV Therapie rettest du Leben. Das hört sich erstmal nach Clickbait an, ist aber ganz pragmatische Evidenz. Statistisch rettest du jeden 5. Patienten mit einer akuten, hyperkapnischen, respiratorischen Insuffizienz vor der Intubation und jeden 12.(!) vor dem Tod. Rettungsdienst LUKS - Der Notfallmedizin Podcast macht dich deswegen mit dieser Folge zum Präklinischen NIV Profi: Mit effektiver Strategie zur PatiententoleranzIn dieser Folge: - Die akute, respiratorische Insuffizienz erklärt.- Kontraindikationen der NIV Therapie ganz einfach merken mit dem Akronym SAFE- Darf ich vorstellen?: FiO2, PEEP, Pressure Support, Rampe und Flow Trigger- Mit Strategie zur Patiententoleranz. Vorbereiten, gewöhnen und therapieren.Das SAFE AkronymS - Schnappatmung, Apnoe, und KomaA - Verlegter AtemwegF - Fraktur (Schweres SHT oder Gesichtstrauma), PneumothoraxE - Erbrechen, Ileus oder GI-BlutungHomepage des Rettungsdienst LUKSLink zur letzten Folge zum Thema Notfall: Akut exazerbierte COPD - Obstruktion im Bronchialwald (und zu allen anderen Folgen)Aus den Rettungsdienst LUKS Nachrichten: SINNHAFT Übergabeschema: https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-023-01167-4DSI von Dr. Daniel Freidorfer (Ab 32:38): https://www.youtube.com/watch?v=IKqM8BTrJJkDSI Kurzfassung von Fomamina: https://foamina.blog/2017/06/13/dsi/Kochrezept a la Nerdfallmedizin findest du unter diesem Link. Alle Evidenzen zu dieser Folge findest du hier: Ambühl, M. "Nicht-Invasive Ventilation - Ein praxisorientierter Ansatz für Präklinik und Schockraum" 20. Oktober 2023, https://www.youtube.com/watch?v=VG_aytxd7KEWesthoff, M., Neumann, P., Geisler, J., et. al. (2023). 10 Kernaussagen zur S2k-Leitlinie „Nichtinvasive Beatmung als Therapie der akuten respiratorischen Insuffizienz“. Abgerufen am 01. Januar 2024, von https://link.springer.com/article/10.1007/s00063-023-01017-8Scheschkowski, T., Budweiser, S. (2019). Akute respiratorische Insuffizienz bei chronischen Lungenerkrankungen. Nofallmedizin up2date, DOI: 10.1055/a-0868-2242Gruneberg, D., Schneider, N., Weilbacher, F., et. al. (2021). Nicht-invasive Beatmung in der Präklinik. Notarzt, DOI: 10.1055/a-1580-3036
Notfall: Akut exazerbierte COPD - Obstruktion im Bronchialwald
Eine akute Exazerbation einer COPD - Die AECOPD - ist ein lebensbedrohlicher Notfall. Wir widmen uns bei Rettungsdienst LUKS - Der Notfallmedizin Podcast gleich zwei Folgen der Volkskrankheit COPD. Neben den Auslösern einer akuten Verschlechterung schauen wir uns auch gaaanz genau die Therapie an. Und wir klären die Frage, wie viel Sauerstoff ich meinen dyspnoischen Patienten denn nun geben darf. Natürlich evidenzbasiert und leitlinienkonform. Notfall: Akut exazerbierte COPD - Obstruktion im BronchialwaldIn dieser Folge: - AECOPD: Was ist das? - Fallbeispiel: Woran erkenne ich im Scene Assessment eine COPD? - Klinisch relevante Befunde bei der COPD- Wie viel Sauerstoff darf es denn bitte sein? - Pharmakotherapie: Das sabbernde Lama kommt zur HilfeHomepage des Rettungsdienst LUKS: https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/rettungsdienst-und-sanitaetsnotruf-144-zentralschweizLink zur letzten Folge zum Thema COPD Kompakt - Pack Years sammeln bis zur Obstuktion (und zu allen anderen Folgen):https://pod.link/1672980207Aus den Rettungsdienst LUKS Nachrichten: Psychcast Podcast: https://psychcast.de/psychiatrische-notfaelle/Spinaler "Schock": https://dasfoam.org/2023/09/02/spinaler-schock-der-schock-der-kein-schock-ist/Alle Evidenzen zu dieser Folge findest du hier: Amboss. (n.d.). Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Abgerufen am 19. November 2023, von https://www.amboss.com/de/wissen/chronisch-obstruktive-lungenerkrankung/Agusti, A., et. al. (2023). Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD). Abgerufen am 19. November 2023, von https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/Scheschkowski, T., Budweiser, S. (2019). Akute respiratorische Insuffizienz bei chronischen Lungenerkrankungen. Nofallmedizin up2date, DOI: 10.1055/a-0868-2242Genzwürker, H., Stuhr, M. (2022). Akuttherapie mit Sauerstoff beim Erwachsenen – Aktuelle Leitlinienempfehlungen. Der Notarzt, DOI: 10.1055/a-1954-5343
COPD Kompakt - Pack Years sammeln bis zur Obstuktion
Wir löschen die GOLD 1-4 Stufeneinteilung ebenso von deiner Festplatte wie die veralteten Begriffe Blue Bloater und den Pink Puffer. Stereotypen und Langeweile adé. Wir beschäftigen uns heute bei Rettungsdienst LUKS - Der Notfallmedizin Podcast mit der Volkskrankheit COPD. Und das gleich in zwei Folgen. Teil 1 heute befasst sich mit der Ätiologie und Pathophysiologie der COPD. In dieser Folge: - "Morgen höre ich auf!" Rauchen bis zur COPD. Ätiologie der COPD.- Am Anfang stand die chronische Bronchitis. Pathophysiologie der COPD. - Obstruktion und Emphysem. Homepage des Rettungsdienst LUKS: https://www.luks.ch/standorte/standort-luzern/rettungsdienst-und-sanitaetsnotruf-144-zentralschweizLink zur letzten Folge zum Thema Der RACE - Score erklärt. Zukunft der Schlaganfalltriage - Präklinische Herausforderungen (und zu allen anderen Folgen):https://pod.link/1672980207 Aus den Rettungsdienst LUKS Nachrichten: Webinare bei der Sirmed https://www.paraplegie.ch/sirmed/de/profis/wissen/webinare-und-booster-fuer-profis/WhatsApp Kanal der Nerdfallmediziner: https://nerdfallmedizin.blog/2023/10/29/nerdfallmedizin-jetzt-auch-auf-whatsapp/WhatsApp Kanal der Pin-up-Docs: https://whatsapp.com/channel/0029VaE0Vc5G3R3oExpT8w2xAlle Evidenzen zu dieser Folge findest du hier: Amboss. (n.d.). Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Abgerufen am 19. November 2023, von https://www.amboss.com/de/wissen/chronisch-obstruktive-lungenerkrankung/Agusti, A., et. al. (2023). Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD). Abgerufen am 19. November 2023, von https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/Scheschkowski, T., Budweiser, S. (2019). Akute respiratorische Insuffizienz bei chronischen Lungenerkrankungen. Nofallmedizin up2date, DOI: 10.1055/a-0868-2242
Osteoporose, Amalgam ausleiten, vegan und schwanger – Eure Fragen
Dr. Anne Fleck - Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN!
Wir bereden heute wieder alles, was Euch auf der Seele liegt – oder helfen kann, unbeschwerter zu leben und zu genießen. Anne Fleck beantwortet Fragen von eingerissenen Mundwinkeln bis zur Bauchspeicheldrüsen-Insuffizienz. Auf geht's! +++ Alle Rabattcodes und Infos zu unseren Werbepartnern findet ihr hier: https://linktr.ee/gesundheitundernaehrung +++ Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html+++Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Krampfadern - Kennst du diese naturheilkundlichen Mittel, die du dagegen einsetzten kannst?
Die Beine sind schwer Vielen Frauen kennen Besenreiser, oder sogar Krampfadern. Krampfadern oder Varizen, sind Venen, die deutlich erweitert und oftmals auch geschlängelt an der Oberfläche der Haut, vorallem an den Beinen verlaufen. Grund für diese Krampfadern ist zum einen eine Schwäche der Venenwand, so dass sich diese Wand erweitert und mehr Blut fasst, als bisher. Das führt allerdings auch dazu, dass die Beine schwerer werden, weil praktisch das Blut in diesen Venen "versackt". Venen besitzen allerdings auch Klappen, um den Rückfluss zu verhindern. Schließen diese Klappen nicht mehr zuverlässig, dann "rutscht" ebenfalls das Blut in der Venen zurück. Die Folge: Schwere Beine, Schmerzen, manchmal auch Spannungsgefühl oder Juckreiz. Als Folge der Krampfadern kann sich eine chronisch venöse Insuffizienz entwickeln Werden die Krampfadern nicht rechtzeitig behandelt, dann kann sich im Verlauf eine sog. chronisch venöse Insuffizienz entwickeln. Das heißt, die Venen können immer weniger den venösen Rückfluss zum Herzen bewerkstelligen und das Blut versackt immer mehr in den Beinen. Dadurch steigt allerdings immer mehr der Druck, was zur dauerhaften Schwellung und zu Hautveränderungen führen kann. Als Folgen könnten zum Beispiel Verletzungen nicht mehr richtig am Bein abheilen und möglicherweise dadurch schwere Geschwüre entstehen. In der heutigen Podcastfolge erzähle ich dir - zu den Krampfadern und zur chronisch venösen Insuffizienz. - Ich erkläre dir, welche vorbeugenden Maßnahmen du unbedingt dauerhaft unternehmen solltest - und welche naturheilkundlichen Pflanzenstoffe, die Stabilität deiner Venen fördern können. Ich freue mich auf dich. "Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand!" Herzlichst deine Alex ______________________________________________ Hier sind Links, um raus aus dem Hormonchaos zu kommen: Webseite: www.alexbroll.com Kennenlerngespräch: www.alexbroll.com/sprechstunde Youtube: https://bit.ly/2hzB6dl Instagram: https://www.instagram.com/alex_broll/
Stell dir mal vor du bekommst für dein recht junges Tier die Aussage Niereninsuffizienz. Man rät dir zu präventiven Gaben zur Nierenunterstützung, spezieller Kost... Natürlich setzt du es um. Irgendwann nimmst du eine Tierheilpraktikerin ins Boot, die die Befunde von dir anfordert. Und nun stell dir vor, dass sie aus den Befunden keine Insuffizienz erkennen kann. Nierenwerte in einem vernünftigen Rahmen.... So geschehen in meiner Praxis. Ich möchte hier nicht Fingerpointing Richtung Ärzte betreiben, sondern vielmehr dich dazu animieren, dass du in jedem Fall immer Befunde mitnimmst und ggf. im Zweifel nochmal bei einem anderen Arzt nachfragst oder einen Tierheilpraktiker ins Boot nimmst. Denn gerade bei jungen Tieren, bei denen auch im Ultraschall die Organe unauffällig waren, ist so eine Diagnose eher selten und u.U. nicht korrekt. Hey, ich bin Sonja Tschöpe, ausgebildete Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Ich freue mich, dass Du meinem Podcast zur Tiergesundheit folgst. Du möchtest mehr von mir erfahren, mehr von mir lesen oder aber mit mir in Kontakt treten? Homepage: [www.animal-visite.de](https://www.animal-visite.de) Facebook: [https://www.facebook.com/sonja.tschoepe/ ](https://www.facebook.com/sonja.tschoepe/) Instagram: [https://www.instagram.com/animal.visite/](https://www.instagram.com/animal.visite/) Und wenn Du es wagen magst mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde Dich einfach über meine Online-Beratung, die Du hier findest: https://www.animal-visite.de/online-beratung/
Beatmungsunterstützung bei Früh- und kranken Neugeborenen - mit Dr. Markus Waitz
In der aktuellen Folge haben wir Dr. Markus Waitz, Kinderarzt, Neonatologe und pädiatrischer Intensivmediziner, und aktuell in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf in der Kinderkardiologie tätig, zu Gast. Wir sprechen mit ihm darüber, warum ihm dieses Thema so sehr am Herzen liegt, wie die Behandlung vor 30 Jahren aussah und was sich verändert hat. Wir fragen ihn, ob es den optimalen „one fits all“ Ansatz zur Atemunterstützung gibt und wie der junge Assistenzarzt im Nachtdienst das reife Neugeborene mit CPAP versorgen soll. Außerdem gibt Dr. Waitz eine Einschätzung, wie wir zukünftig Neugeborene mit respiratorischer Insuffizienz behandeln werden, welche Literatur empfehlenswert ist und was er den Zuhörern für die berufliche Laufbahn mitgeben möchte.
In dieser Folge AWFNR wird die aktuelle Lage in der Ukraine nicht thematisiert. Bei LeaveNoOneBehind kannst du helfen: https://teamukrainelove.com/ ___ Zwei Freunde nach einer kleinen Joggingrunde in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, nackt auf einer schwarzen Ledercouch, bedeckt von zwei weißen Handtüchern, den Blick aufs Kaminfeuer. - Das beschreibt die Aufnahmesituation der heutigen Folge ziemlich genau. Wer könnte wohl Pauls heutiger Gesprächspartner sein? Natürlich niemand Geringeres als monatlicher Special-Guest Marteria. Für diese Folge hat Paul seinen 98. Länderpunkt ergattert und Marten gönnt es ihm, obwohl es immer mehr danach aussieht, als würde er das Länderpunkte-Spiel verlieren. Damit steht thematisch heute alles im Rahmen des Reisens. Marten und Paul erinnern sich an die schönsten Länder, das geilste Essen, die schlimmsten Taxifahrten und fragen sich, ob man Flüge rechtfertigen kann und grün reisen überhaupt möglich ist. Wie der Zufall es will, kommt Marten gerade von einer Angeltour im Regenwald am Guaviare zurück und kann frisch und ungefiltert berichten… Und zwar vom vollen Programm: Moskitos, Spinnen, Schlangen, Kaimane (NICHT Cayman!) und die große grüne Anakonda. Klingt gefährlich, doch wie die Leute dort wirklich sterben, wirst du nicht glauben. Dabei kommen zwei höchst spannende Fragen auf den Tisch: Wie und warum zur Hölle rettet Marten ein Stachelschwein mit einer Rettungsweste und was sind die drei Lieblingstiere eines Paul Ripkes? So viel kann ich verraten. Pferde gehören dazu, da Paul vor Kurzem bei einer Produktion mit ihnen in Berührung kam. Etwa für die Wendy? Wenn wir schonmal beim Thema Tiere sind, hier ein kleiner Sidefact: Pablo Escobar importierte eine Handvoll Nilpferde von Afrika nach Kolumbien – als exotische Haustiere. Nun stehen die mehr als 100 Tiere vor einer ungewissen Zukunft. Deshalb spricht DER Marteria in dieser Folge einen klaren Appell an DEN Leonardo DiCaprio aus: Rette die kolumbianischen Nilpferde, Leo! Back to Business sprechen die zwei über musikalische Uneinigkeiten, Fettleibigkeit und respiratorische Insuffizienz auf der Bühne, weil Marten seine Atemübungen nicht gemacht hat. Nach dieser Blamage, gleich bevor die Fantas abgeliefert haben, NIE WIEDER. Freut euch auf jede Menge kostenlose Werbung für Apps, schlechte bis sehr gute Wortwitze und intime Geschichten. Du willst doch auch wissen, warum Marten so ein Gönner ist und Paul seinen Traum, bei GNTM in der Jury zu sitzen, bisher nicht erfüllen könnte. Oder? Sichere dir noch bis zum 31.05.2022 20% Rabatt auf deinen Städte-Trip in den 25hours Hotels mit dem Code „PAUL" – mehr Infos findest du unter https://www.25hours-hotels.com/paul KoRo (https://www.korodrogerie.de) bietet gesunde, qualitativ hochwertige und köstliche Lebensmittel zu fairen Preisen in Großpackungen. Mit dem Code „PAUL" sparst du auf das gesamte Sortiment von KoRo 5%. Post von Paul abonnieren: https://postvonpaul.substack.com
Die Herzinsuffizienz (von „Insuffizienz“ im Sinne von „Unzulänglichkeit“; in der Medizin unter anderem ungenügende Leistungsfähigkeit eines Organs; lateinisch Insufficientia cordis ) oder Herzschwäche ist die krankhafte Unfähigkeit des Herzens, das vom Körper benötigte Herzzeitvolumen ohne Anstieg des enddiastolischen Drucks zu fördern. Die „Pumpschwäche“ äußert sich in reduzierter körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit und anderen schwerwiegenden Symptomen für den Betroffenen. In meinem Podcast erfahrt ihr alles zum Thema und die Schwerpunkte für Eure Abschlußprüfung oder euer Examen. Der Podcast richtet sich nicht an Patienten zum Ersatz eines ärztlichen Beratungsgesprächs. Viel Erfolg beim Examen und weiterhin alles Gute. Eure Sophia Montag
Der Begriff Ulcus cruris venosum (lateinisch ulcus = Geschwür, crus = Wade, vena = Blutader) bezeichnet ein Ulcus cruris („offenes Bein“, Unterschenkelgeschwür), das infolge eines fortgeschrittenen Venenleidens wie das Ulcus cruris varicosum als Zeichen einer so genannten chronisch venösen Insuffizienz. In Ihrem Podcast erklärt euch Sophia Montag die Ursachen des Leidens, Risikofaktoren und aktuelle Gesichtspunkte der Behandlung unter Berücksichtigung der pflegerischen Komponenten, die für einige von Euch wichtig sein könnten. Viel Spaß mit dem Podcast Eure Sophia Montag
Die chronisch-venöse Insuffizienz (CVI) ist eine vor allem im zunehmenden Alter auftretende Erkrankung der Beinvenen, die eine in Stadien verlaufende Rückflussstörung des venösen Blutes mit sich bringt. Diese führt zu krankhaften Veränderungen an den Blutgefäßen, dem Bindegewebe und der Hautoberfläche. Die CVI entsteht meist durch einen erhöhten Druck in den Beinvenen. Im weiteren Verlauf kann sich ein Krampfaderleiden (Varikosis) entwickeln. Symptome der chronisch-venösen Insuffizienz sind Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, Hautveränderungen in der Pigmentierung, rote juckende Hautpartien und nässende Stellen.
50 Wochen, 50 Folgen Training Ohne Limit. Wir feiern mit euch das große Jubiläum! In Zukunft gibt es große Veränderungen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet und natürlich noch ein kleines Q&A. Viel Spaß! 0:52 Ein Jahr Podcast 5:40 News und Veränderungen 11:18 Training und Physiotherapie 14:36 Was ist die beste MT Fortbildung? 16:05 Schmerzmittel nach Verletzung? 17:04 Training bei Bandscheibenvorfall? 18:32 Aktive und passive Insuffizienz? 20:33 Schmerzgedächtnis bei chronischen Schmerzen? 22:07 Wann arbeitet man als Physio mit Massage? 24:00 "Lieblings"-Verletzungen? 25:40 Wochenplanung Hypertrophietraining? 27:37 Schmerzen beim Hook-Grip? 29:32 Low Carb vs High Carb? 31:36 Trendwende zum Home Office Training? 33:31 Ein Leben ohne Wettkämpfe? 36:34 Was denken Breitensportler über Leistungssportler? 39:08 Ausblick in die Zukunft ------------------------------------------------ Unsere Website: www.trainingohnelimit.de ------------------------------------------------ Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden. Abonniert uns bei Spotify und Apple Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Startet gut in die Woche! Instagram ToL: https://www.instagram.com/trainingohnelimit Instagram Silvan: https://www.instagram.com/silvanschlegelpt Instagram Hendrik: https://www.instagram.com/hendrik_senf
NEBENNIERENSCHWÄCHE: Symptome einer Insuffizienz (Arzt erklärt die Nebenniere!)
Die Nebennierenschwäche (Insuffizienz) bezeichnet eine unzureichende Funktion bzw. ein Versagen der Produktion der lebenswichtigen Hormone des Nebennieren-Gewebes. In der Alternativmedizin wird Nebennierenschwäche bzw. 'Adrenal Fatigue' als eine Art Burnout Syndrom des Organs aufgrund chronischer Stress-Situationen interpretiert. In dem Video betrachten wir Funktion und Versagen der Nebennieren aus medizinischer Sicht. Was ist dran an dem Konzept der Nebennieren-Schwäche? Schwere Autoimmunerkrankungen, wie die Krankheit Morbus Addison bewirken eine Attacke des Nebennieren-Gewebes, der bis zum kompletten Funktionsverlust der Nebennieren-Rinde führen kann. Auch Infektionskrankheiten können bei z.B. Meningokokken-Infektionen zum Versagen der Nebennieren-Rinde führen (sog. Waterhouse-Fridrichsen Syndrom). Für eine durch chronischen Stress ausgelöstes "Burnout-Syndrom" wie von der Alternativmedizin postuliert, gibt es jedoch keine gesicherte schulmedizinische Basis. Thumbnail modifiziert von: DataBase Center for Life Science (DBCLS) 201405 adrenal medulla.png 0:00 Intro 0:21 Nebennieren sind lebenswichtige Hormonproduzenten 1:05 Addison-Krise: Immunzerstörung der Nebenniere + Infektion 2:10 Waterhouse-Friderichsen Syndrom (Blutvergiftung mit Meningokokken bewirkt Schock) 3:00 Chronische Nebennierenschwäche (Regelkreis und Beispiele) 4:34 Typische Merkmale bei Morbus Addison 5:41 Störung des Salz = Elektrolytspiegels (Natrium und Kalium) 6:16 Medikamente als Ursache für Nebennierenschwäche 8:15 Nebennierenschwäche in der Medizin 9:00 Nebennierenschwäche in der Alternativmedizin 11:05 Medizinische Tests der Nebennieren-Insuffizienz Meine Website: https://medizinmensch.de Kaffee spenden: https://buymeacoffee.com/Medizinmensch Glossar: Morbus Addison: Eine seltene Autoimmunkrankheit (Körper zerstört sich teilweise selbst); diese kann zum Ausfall der Nebennieren-Rinde führen Waterhouse-Friderichsen Syndrom: Ausfall der Nebennierenfunktion bei einer Blutvergiftung (Sepsis) z.B. durch Streptokokken Nebennierenschwäche: 1. Nebenniereninsuffizienz, d.h. eine unzureichende Hormonproduktion Cortisol: Ein Stresshormon, wird in der mittleren Schicht der Nebennierenrinde, der sog. Zonula fasciculata, gebildet und bei bedarf ins Blut freigesetzt ACTH: Das sogenannte adrenocorticotrope Hormon (= Wachstumshormon der Nebenniere) das im Gehirn gebildet wird, und die Nebenniere stimuliert, sowie die Bildung von Cortisol anregt Addison-Krise: Eine akute Krise, meist ausgelöst durch eine Infektion bei bestehender Addison Krankheit Melasma: Hyperpigmentierung im Gesicht Wichtiger Hinweis: Die Videos dienen ausschließlich der Allgemeinbildung. Die Informationen ersetzen keine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose. Die zur Verfügung gestellten Inhalte ermoeglichen nicht die Erstellung eigenständiger Diagnosen. Medizinisches Wissen unterliegt fortwaehrendem Wandel und es kann nicht garantiert werden dass die Informationen zu jedem Zeitpunkt noch korrekt sind, oder selbst korrekt waren. Haftung ausgeschlossen. Merk-würdiges Medizinwissen für Alle. Abonniere jetzt und erhalte neue Folgen, jeden Medizin-Mittwoch. Folge direkt herunterladen
Hörverstehen, Teil 1, Gespräch 1 Arzt: Guten Tag, mein Name ist Niehaus. Herr Voßwinkel: Voßwinkel, oh Gott, oh Gott. Herr Dr. Nie … Arzt: Dr. Niehaus … Herr Voßwinkel: Das ist vielleicht … oh Mann, oh Mann … Ich brauche irgendwas gegen die Schmerzen. Arzt: Herr Voßwinkel, Sie müssen sich nicht anstrengen. Versuchen Sie, ruhig zu atmen. Ich werde Ihnen, während wir uns unterhalten, einen venösen Zugang legen, und Sie sagen mir, wo genau Sie die Schmerzen haben. Herr Voßwinkel: Hier an der Seite, an der rechten Seite hinten. Oh! Und im Bauch, sie ziehen bis hier unten in den Bauch. Es ist der Wahnsinn! Arzt: Nicht erschrecken! Es piekst jetzt mal kurz. Herr Voßwinkel: … ja, ja, ja, ist gut … Arzt: Sind die Schmerzen plötzlich gekommen? Herr Voßwinkel: Ja. Vor zwei Stunden hatte ich schon mal so eine Attacke! Dann war's wieder besser. Ich dachte, das sind so eine Art Muskelverkrampfungen, weil ich gestern so lange Tennis … oh, oh Mann, oh Mann. Arzt: Ich habe Ihnen ein krampflösendes Medikament und etwas gegen die Schmerzen gegeben. Und soweit es geht, versuche ich, Sie zu untersuchen. Meinen Sie, dass Sie es schaffen, Ihr Hemd ein wenig hochzuheben? Herr Voßwinkel: Das muss klappen! Hier, da zieht es rüber. Arzt: Wenn ich auf der linken Seite klopfe, tut das weh? Herr Voßwinkel: Das geht, das kann ich ertragen. Arzt: Und wenn ich jetzt hier drücke? Herr Voßwinkel: Ah, Mann, das zieht ja den ganzen Rücken lang! Arzt: Ihr Unterbauch ist ziemlich angespannt. Wir warten die Wirkung der Medikamente ab, und dann werde ich noch eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Es spricht alles dafür, dass Sie einen Harnleiterstein haben. Und der macht diese kolikartigen Schmerzen. Herr Voßwinkel: Harnleiterstein? Was soll das denn? Wie kommt man denn an so was? Arzt: Da gibt es verschiedene Gründe. Ein ganz banaler ist zum Beispiel, wenn Sie bei dieser Hitze in den letzten Tagen zu wenig getrunken haben. Herr Voßwinkel: Gestern drei Stunden Tennis … Ich bin sogar gejoggt die Tage über! Arzt: Dann kann sich ein kleiner Stein bilden. Herr Voßwinkel: Meine Frau hat noch geschimpft: „Du trinkst zu wenig, bei der Hitze!“ Arzt: Ihr Gesicht ist nicht mehr so blass. Haben Sie das Gefühl, dass es besser wird? Herr Voßwinkel: Ja, ein bisschen besser schon. Jetzt, wo Sie es sagen! Arzt: Okay, Herr Voßwinkel, dann werden wir gleich die Ultraschalluntersuchung durchführen, Ihren Urin und Ihr Blut untersuchen. Und ich denke, dann wissen wir Genaueres. Hörverstehen, Teil 1, Gespräch 2 Arzt: Guten Tag, Frau Goldmann. Das ist toll, dass ich Sie gerade treffe. Ärztin: Hallo, ja, stimmt, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Arzt: Seit den Umbauten und dem Umzug liegen unsere Abteilungen jetzt ziemlich weit auseinander. Ärztin: Dafür haben wir in dem neuen Gebäude jetzt richtig viel Platz. Arzt: Was ich Sie fragen wollte: Ich habe einen knapp sechzigjährigen Patienten mit einem chronisch rezidivierenden Erysipel im Bereich des rechten Unterschenkels. Neben einer Adipositas per magna hat er noch einen Diabetes mellitus … Ärztin: … wahrscheinlich bei einer verbesserungsbedürftigen Compliance! Arzt: Genau so ist es. Ärztin: Ist ein Alkoholabusus bekannt? Arzt: Hmm, dafür gibt es keinen Hinweis. Aber zusätzlich hat er eine chronisch venöse Insuffizienz beider Beine. Ärztin: Hmm, ich verstehe. Arzt: Ich habe neulich in einer Kurzmitteilung gelesen, dass eine antibiotische Prophylaxe über ein Jahr die Rezidivrate deutlich vermindern soll. Haben Sie diesbezüglich Erfahrungen? Ärztin: Ja, wir haben einige Patienten über sechs bis zwölf Monate antibiotisch therapiert. Und die Ergebnisse sind recht erfreulich. Aber schicken Sie den Patienten doch einfach mal zu mir. Arzt: Das hätte ich sowieso getan. Aber da ich Sie gerade hier treffe, ist das natürlich eine günstige Gelegenheit, sich im Vorfeld auszutauschen. Ärztin: Kein Problem. Und sagen Sie an der Anmeldung, dass ich mit Ihnen schon über den Patienten gesprochen hätte. --- Support this podcast: https://anchor.fm/heidar-sadeghzadeh/support
Hamsterkäufe, Ausgangssperren, Homeoffice: Die Pandemie mit dem SARS-CoV-2-Virus hat unlängst Deutschland erreicht und stellt nicht nur das alltägliche Leben eines jeden Einzelnen, sondern vor allem auch die Arbeit von Medizinern auf den Kopf. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte müssen sich alle Behandler nun einem solch dynamischen Ausbruch stellen. Während nach aktueller Datenlage rund 80% der Infektionen asymptomatisch bis mild verlaufen, führen die schweren Verläufe von COVID-19 hingegen häufig zu einer respiratorischen Insuffizienz mit der Notwendigkeit einer maschinellen Beatmung - eine Herausforderung, nicht nur für jüngere, unerfahrene Mediziner. Damit ihr in solch einer Beatmungssituation die Ruhe bewahrt, haben wir Benjamin Junge am Telefon, Intensivmediziner am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Gründungsmitglied des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. Gemeinsam gehen wir noch mal die Grundlagen der maschinellen Beatmung und des ARDS durch und führen Schritt für Schritt durch die Beatmungssituation: Wann beginne ich damit und wie stelle ich meine Beatmungsparameter optimal ein? Welche Blutgasanalyse-Ziele strebe ich an und wie reagiere ich auf Abweichungen? Wann und warum ist die Bauchlage so wichtig? Diese und viele weitere Fragen klären wir in einem umfassenden Gespräch und hoffen, dass ihr gut ausgerüstet der Ausbruchswelle entgegentreten könnt. Passt auf euch auf und bleibt gesund!
Hamsterkäufe, Ausgangssperren, Homeoffice: Die Pandemie mit dem SARS-CoV-2-Virus hat unlängst Deutschland erreicht und stellt nicht nur das alltägliche Leben eines jeden Einzelnen, sondern vor allem auch die Arbeit von Medizinern auf den Kopf. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte müssen sich alle Behandler nun einem solch dynamischen Ausbruch stellen. Während nach aktueller Datenlage rund 80% der Infektionen asymptomatisch bis mild verlaufen, führen die schweren Verläufe von COVID-19 hingegen häufig zu einer respiratorischen Insuffizienz mit der Notwendigkeit einer maschinellen Beatmung - eine Herausforderung, nicht nur für jüngere, unerfahrene Mediziner. Damit ihr in solch einer Beatmungssituation die Ruhe bewahrt, haben wir Benjamin Junge am Telefon, Intensivmediziner am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Gründungsmitglied des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. Gemeinsam gehen wir noch mal die Grundlagen der maschinellen Beatmung und des ARDS durch und führen Schritt für Schritt durch die Beatmungssituation: Wann beginne ich damit und wie stelle ich meine Beatmungsparameter optimal ein? Welche Blutgasanalyse-Ziele strebe ich an und wie reagiere ich auf Abweichungen? Wann und warum ist die Bauchlage so wichtig? Diese und viele weitere Fragen klären wir in einem umfassenden Gespräch und hoffen, dass ihr gut ausgerüstet der Ausbruchswelle entgegentreten könnt. Passt auf euch auf und bleibt gesund!
DM II: Dapagliflozin erneut Herz-Hoffnungsträger!
Erfolge bei Insuffizienz elektrisieren Diabetologen. Weitere Informationen: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911303
Podcast-Episode #45: Interview mit Lisa Glockner über Lip- & Lymphödem
Podcast- Episode #45: Interview mit @lisag140500 (Lisa Glockner) über #Lip- & #Lymphödem Wir unterhalten uns über ihre #Krankheiten, die Möglichkeiten einer Behandlung und wie sie damit in ihrem Leben umgeht. Einen kleinen Überblick über die Krankheiten, von denen speziell Frauen betroffen sind, sind hier zu finden (Mit Links zu den entsprechenden Wikipedia-Einträgen): Das Lipödem ist eine voranschreitende Erkrankung, die besonders bei Frauen auftritt und mit der Schwellungen aufgrund der Einlagerung von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem (Ödem) einhergehen können. Diese können Schmerzen und Druckempfindlichkeit sowie der Neigung zu blauen Flecken bewirken. Es liegt dabei keine Schädigung des Lymphsystems vor. Das #Lipödem ist NICHT die Folge von #Übergewicht. Es ist im Bereich seitlich an den Hüften und Oberschenkeln angesiedelt, wo eine Gewichtsreduktion generell wenig erfolgversprechend ist. Eine chirurgische Behandlung ist sehr kostspielig und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Da die Ursachen von Lipödemen nicht bekannt sind, ist eine vollständige Heilung ausgeschlossen. Das Lymphödem ist eine sicht- und tastbare Flüssigkeitsansammlung im Interstitium, d.h. Zwischenzellraum. Die interstituelle Flüssigkeit kann hier nicht mehr ausreichend über die Lymphgefäße abtransportiert werden weil eine mechanische Insuffizienz des Lymphgefäßsystems vorliegt. Der dadurch verursachte Rückstau führt zu einer Ansammlung von Flüssigkeit in den Zellzwischenräumen. Neben den Extremitäten können auch das Gesicht, der Hals, der Rumpf und die Genitalien betroffen sein. Als Therapiemaßnahmen werden Lymphdrainagen und Kompressionsbandagen & - strümpfe angelegt. Keine alleinige Therapieoption sind Diuretika (entwässernde Medikamente). Lymphödeme benötigen jahrelange Behandlung und sind somit nicht heilbar. ************** WEBINAR ZUR PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 2.0 ************ In unserem ersten Webinar mit Kirill von @mindupdate am 1.3.2020 packen wir so extrem viel wertvollen Inhalt über deine 4 wichtigsten Lebenssäulen wie Finanzen, Berufung & Selbstbestimmung, Beziehungen und Fitness rein, dass es alles bisherige sprengen wird! Ebenso stellen wir in diesem GRATIS Webinar unser Konzept von Persönlichkeitsentwicklung 2.0 vor - wie du in allen Lebensbereichen triumphierst und zu der Persönlichkeit wirst, die du schon immer sein wolltest! Unter ⏩ https://ziele-auf-dein-glueck.de/webinar_anmeldung kannst du dich zum Webinar über Persönlichkeitsentwicklung 2.0 anmelden. ************** ERSTELLE NOCH HEUTE DEIN EIGENES ONLINE BUSINESS ************ Erstelle jetzt GRATIS deine eigene unschlagbar schnellen und einfach zu erstellenden Webseiten: ⏩ https://covl.io/builderalltester Ich bin absoluter Fan von Builderall und werde mein Leben lang dieses einzigartige geile Online Marketing Tool benutzen um Webseiten aufzubauen, Emails Funnels zu erstellen, Online Produkte zu vermarkten und Builderall weltweit mit auszubauen! Da ich felsenfest davon überzeugt bin - durch meine eigene Erfahrungen und Erkenntnisse geprägt -, dass dieses revolutionäre Werkzeugtool fast alle Wünsche im Online Marketing Segment abdecken kann und wird, will ich dir die Chance geben jetzt den SCHNELLSTEN und EINFACHSTEN Webseiten Builder aller Zeiten für deinen Erfolg zu benutzen: Klicke jetzt hier um deine eigene Webseite aufzubauen - ein lebenlang kostenlos! ⏩ https://covl.io/builderalltester ************** GRATIS GESCHENKE ********************* Unter ⏩ https://unfoldemy.de findest du alles KOSTENLOS über: - Die praktische Kurzanleitung zum Glücklich sein - Mein geheimes Erfolgstagebuch für 100x mehr Erfolg im Leben - Your first € - die praktische 1:1 Anleitung zu deinem ersten € im Internet - Der 10 Schritte Plan alle deine Ängste zu überwinden
Claudia Urbschat-Mingues ist eine der bekanntesten deutschen Synchronschauspielerinnen, wusstet ihr, dass die gelernte Diplom-Schauspielerin ursprünglich ein Problem mit ihrer Stimme hatte: Sie hat eine Insuffizienz der Stimmbänder! Und ist trotzdem, oder gerade deshalb jetzt eine ganz Große der Szene. Na eigentlich hatte sie kein Problem mit ihrer Stimme aber durchaus die Essener Folkwang Uni der Künste. Sie wurde damals mit den Worten: “Mit der Stimme kann man ja nicht mal Lehrer werden.” abgelehnt. Diesen Fehler machte die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover nicht und bildete eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands aus.
Claudia Urbschat-Mingues ist eine der bekanntesten deutschen Synchronschauspielerinnen, wusstet ihr, dass die gelernte Diplom-Schauspielerin ursprünglich ein Problem mit ihrer Stimme hatte: Sie hat eine Insuffizienz der Stimmbänder! Und ist trotzdem, oder gerade deshalb jetzt eine ganz Große der Szene. Na eigentlich hatte sie kein Problem mit ihrer Stimme aber durchaus die Essener Folkwang Uni der Künste. Sie wurde damals mit den Worten: “Mit der Stimme kann man ja nicht mal Lehrer werden.” abgelehnt. Diesen Fehler machte die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover nicht und bildete eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands aus.
Wir sind ein Ärzteteam, das eine neue Ära in der Didaktik der Medizin einleitet. Der Zugang zur Lehre: jederzeit und überall online auf Deinem Smartphone. Podcasts, Online- und Vor-Ort-Kurse für Chirurgie, Botulinumtoxintherapie, Dermatoskopie und vieles Mehr. www.derma-to-login.com
Untersuchungen zu Auftreten und Vermeidung der Anastomoseninsuffizienz nach tiefer anteriorer Rektumresektion durch eine lokale antimikrobielle Prophylaxe
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 19/19
In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass mit einer topischen Dekontamination eine Reduktion der postoperativen Anastomoseninsuffizienzrate bei der tiefen anterioren Rektumresektion erreicht werden kann. Eine Vermeidung von nicht Anastomoseninsuffizienzassoziierten Infekten oder ein Einfluss auf die Mortalität konnte nicht beobachtet werden. Es zeigte sich ausserdem dass Patienten mit einer Anastomoseninsuffizienz ab dem 3. postoperativen Tag höhere CRP-Werte aufweisen und somit ein steigendes oder persistierend hohes CRP eventuell als Indiz für das Auftreten einer Insuffizienz gedeutet werden kann. Basierend auf den vorliegenden Daten sollte die topische Dekontamination mit Polymyxin B, Tobramycin, Vancomycin bei der tiefen anterioren Rektumresektion zur Vermeidung der Anastomoseninsuffizienz in Erwägung gezogen werden.
Sie ist die deutsche Stimme von Angelina Jolie und in unzähligen Filmen, Serien, Animes und Hörspielen zu hören. Claudia Urbschat-Mingues spricht mit Julian heute über ihre spannende Arbeit. Weshalb sie nicht für alle Jolie-Filme als Synchronsprecherin engagiert wurde, warum eine Insuffizienz der Stimmbänder ihre Stimme so besonders macht und was es ihr bedeutet, dass ihre Stimme jeden Abend die "Tagesschau" ansagt, das verrät Claudia Urbschat-Mingues in unserem Interview. Übrigens: ihre 10-monatige Tochter ist während unseres Gesprächs dabei.
Sie ist die deutsche Stimme von Angelina Jolie und in unzähligen Filmen, Serien, Animes und Hörspielen zu hören. Claudia Urbschat-Mingues spricht mit Julian heute über ihre spannende Arbeit. Weshalb sie nicht für alle Jolie-Filme als Synchronsprecherin engagiert wurde, warum eine Insuffizienz der Stimmbänder ihre Stimme so besonders macht und was es ihr bedeutet, dass ihre Stimme jeden Abend die "Tagesschau" ansagt, das verrät Claudia Urbschat-Mingues in unserem Interview. Übrigens: ihre 10-monatige Tochter ist während unseres Gesprächs dabei.
Sie ist die deutsche Stimme von Angelina Jolie und in unzähligen Filmen, Serien, Animes und Hörspielen zu hören. Claudia Urbschat-Mingues spricht mit Julian heute über ihre spannende Arbeit. Weshalb sie nicht für alle Jolie-Filme als Synchronsprecherin engagiert wurde, warum eine Insuffizienz der Stimmbänder ihre Stimme so besonders macht und was es ihr bedeutet, dass ihre Stimme jeden Abend die "Tagesschau" ansagt, das verrät Claudia Urbschat-Mingues in unserem Interview. Übrigens: ihre 10-monatige Tochter ist während unseres Gesprächs dabei.
Risikofaktoren für eine erhöhte Mortalität von Patienten mit hämato-onkologischer Grunderkrankung auf der Intensivstation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 16/19
Einleitung: Die Aufnahme von Patienten mit hämato-onkologischer Grunderkrankung auf eine Intensivstation ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die hohe Mortalität intensivpflichtiger Patienten mit hämato-onkologischer Grunderkrankung scheint jedoch oft nicht in Zusammenhang mit der Grunderkrankung zu stehen. Fragestellung: Die Identifikation von Risikofaktoren für die Intensivstations-Mortalität von hämato-onkologischen Patienten auf der Intensivstation. Patienten und Methoden: Daten von 90 Patienten mit hämato-onkologischer Grunderkrankung und Aufenthalt auf der internistischen Intensivstation vom 01.11.2005 bis zum 31.11.2006 wurden ausgewertet. Retrospektiv wurden die Variablen: Alter, Geschlecht, Art der hämato-onkologischen Grunderkrankung, Aufnahmediagnose auf die Intensivstation, Dauer des Intensivstations-Aufenthaltes, SAPS-II-Score und Leukozytenzahl bei Aufnahme auf die Intensivstation, der höchste Katecholaminbedarf, Einsatz von Nierenersatzverfahren und Einsatz mechanischer Ventilation während des Intensivstations-Aufenthaltes, positive mikrobiologische Diagnostik oder der Nachweis einer bestimmten Gruppe von Erregern oder der Nachweis von Erregern in einer bestimmten Patientenprobe in Bezug auf ihren Einfluss auf die Intensivstations-und 100-Tage-Mortalität untersucht. Ergebnisse: Von n=90 Patienten waren 67,8% männlich, das mittlere Alter der Patienten lag bei Aufnahme bei 56 Jahren (21-85 Jahre). Alle Patienten litten an einer hämato-onkologischen Grunderkrankungen: Leukämien lagen in 47,8% vor, Lymphome in 50,0%. Die Aufnahmediagnose auf die Intensivstation war meist respiratorische Insuffizienz (38,9%) oder Sepsis (27,8%). Die mediane Liegedauer der Patienten auf der Intensivstation betrug 5 Tage (1-52 Tage). Der mediane SAPS-II Score der Patienten lag bei Aufnahme bei 55 Punkten (18-118). 54,4% der Patienten waren bei Aufnahme leukopen, 67,8% waren im Verlauf des Aufenthaltes katecholaminpflichtig, 57,8% mussten maschinell beatmet werden. Nierenersatzverfahren brauchten 21,1% der Patienten. 45,6% der Patienten verstarben während des Intensivstations-Aufenthaltes, hierbei stellte die Sepsis mit 22,2% die größte Gruppe der Todesursachen. Bei 72/90 (80 %) Intensiv-Patienten wurden zur infektiologischen Diagnostik und Erregersurveillance mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt. Im Mittel hatte jeder Patient 1,63 (0-8) verschiedene Pilz- und Bakterienspezies und 1,61 (0-4) verschiedene Arten von Viren. Unter den Bakterien stellen die gram-positiven Erreger mit 55% die größte Gruppe, mit 23,1% dominierten die koagulase-negativen Staphylokokken. Bei den nachgewiesenen Pilzen stellen Candida species mit 68% den Großteil, darunter meist C. albicans. Bei den nachgewiesenen Viren stelle die Familie der Herpesviridae mit 93% den größten Anteil dar. 9 mal konnte ein multiresistenter Erreger nachgewiesen werden. Als signifikante Einflussgrößen für die Intensivstations- und/oder die 100-Tage Mortalität fand sich in der multivariaten Analyse die Aufnahmediagnose, ein hoher SAPS-II Score bei Aufnahme, hoher Katecholaminbedarf, Vasopressinbedarf und der Einsatz von Nierenersatzverfahren. Nicht signifikant waren Alter, Geschlecht, maschinelle Beatmung, Leukozytenzahl und Art der Grunderkrankung. Im Chi-Quadrat-Test konnten für die Intensivstations-Mortalität folgende Variablen als signifikante Einflussgrößen bestimmt werden: das Vorliegen eines pathogenen Erregers, das Vorliegen einer Virusinfektion mit Herpesviren oder anderen Viren, das Vorliegen einer bakteriellen Infektion, einer gram-positiven bakteriellen Infektion sowie der Nachweis von Staphylokokkus epidermidis in einem Kulturmedium. Zudem der Nachweis von non-albicans-Candida in einem Kulturmedium, der Nachweis eines Erregers in der Lunge bzw. in der endotrachealen Absaugung (ENTA) sowie ein Erregernachweis auf einer Katheterspitze. Für das 100 Tage-Überleben waren das Vorliegen eines pathogenen Erregers, das Vorliegen einer Virusinfektion mit Herpesviren, das Vorliegen einer bakteriellen Infektion sowie einer gram-positiven Infektion, der Nachweis eines Erregers in der Lunge bzw. in der ENTA sowie der serologische Nachweis eines Erregers signifikant. Der Nachweis von non-albicans-Candida und koagulase-negativen Staphylokokken in einem Kulturmedium waren ebenfalls signifikant. Sputum war das Kulturmedium mit dem größten Prozentsatz an positiven Ergebnissen, jedoch ohne Relevanz für die Mortalität. Schlussfolgerung: Die Intensivstations- und Tag 100 Mortalität scheinen eher von der akuten Erkrankung als von der malignen Grunderkrankung beeinflusst zu werden. Nichtsdestotrotz ist die Mortalität von Krebspatienten auf der Intensivstation hoch. Die Intensivstations-Behandlung scheint post-interventionell indiziert. Andere Indikationen sollten auf einer individuellen Basis diskutiert werden. Der Nachweis von Erregern ist für die Mortalität von Intensivstations-Patienten relevant.
Audiovortrag zum Thema Insuffizienz Simple und komplexe Fakten und Meinungen rund um dieses Thema aus dem Yoga Blickwinkel von Sukadev, dem Gründer des gemeinnützigen Vereines Yoga Vidya e.V. Dieser Audiovortrag ist eine Ausgabe des Audiovortrag zum Thema Fastenaufbau Simple und komplexe Fakten und Meinungen rund um dieses Thema aus dem Yoga Blickwinkel von Sukadev, dem Gründer des gemeinnützigen Vereines Yoga Vidya e.V. Dieser Audiovortrag ist eine Ausgabe des Naturheilkunde Podcast. Er ist ursprünglich aufgenommen als Diktat für einen Lexikonbeitrag im Yoga Wiki Bewusst Leben Lexikon. Zum ganzheitlichen Yoga kann man auch die Theorie von Karma und Reinkarnation dazu zählen. In Ayurveda Ausbildungen erfährst du mehr zum Thema Gesundheit und Prävention. Vielleicht magst du ja deine Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Anmerkung: Gesundheitliche Informationen in diesem Podcast sind nicht gedacht für Selbstdiagnose und Selbstbehandlung, sondern Gedankenanstöße. Bei eigener Erkrankung brauchst du einen Arzt oder Heilpraktiker. Hier findest du: Seminare mit Sukadev Seminarübersicht Themenbezogene Seminare Yoga Vidya YouTube Live Kanal Online Seminare Video Seminare Yoga Vidya kostenlose App Yoga Vidya Newsletter Unseren Online Shop Schon ein kleiner Beitrag kann viel bewegen... Spende an Yoga Vidya e.V.! kunde-podcast.podspot.de">Naturheilkunde Podcast. Er ist ursprünglich aufgenommen als Diktat für einen Lexikonbeitrag im Yoga Wiki Bewusst Leben Lexikon. Zum ganzheitlichen Yoga kann man auch die Theorie von Karma und Reinkarnation dazu zählen. In Ayurveda Ausbildungen erfährst du mehr zum Thema Gesundheit und Prävention. Vielleicht magst du ja deine Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Anmerkung: Gesundheitliche Informationen in diesem Podcast sind nicht gedacht für Selbstdiagnose und Selbstbehandlung, sondern Gedankenanstöße. Bei eigener Erkrankung brauchst du einen Arzt oder Heilpraktiker. Hier findest du: » » » »
Klinische Verlaufsstudie zur Enzymersatztherapie mit Alglucosidase alfa über 36 Monate bei Morbus Pompe im Erwachsenenalter
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 14/19
Die Stoffwechselkrankheit Morbus Pompe ist eine seltene autosomal-rezessiv vererbte, multisystemische lysosomale Speichererkrankung. Ursächlich für die Krankheit sind Mutationen im Gen GAA (Chromosom 17), das für das Enzym saure α-Glukosidase kodiert. Dieses Enzym setzt normalerweise Glukose aus Glykogen in Lysosomen frei. Ein Mangel dieses Enzyms, das bei Gesunden in allen Geweben aktiv ist, führt zu Strukturveränderungen in Muskulatur, Leber, Herzmuskel, Gefäßsystem und Nervensystem und damit zu einem breiten und heterogenen Spektrum an klinischen Symptomen. Die schwere juvenile Verlaufsform mit hypertropher Kardiomyopathie und ausgeprägter Muskelschwäche führt in den ersten beiden Lebensjahren zum Tod, die mildere adulte Form beginnt erst im Erwachsenenalter und führt zu progredienter Muskelschwäche und respiratorischer Insuffizienz. Die verschiedenen Verläufe sind abhängig von der verbleibenden Enzymaktivität. Unbehandelt verläuft die Erkrankung progredient in unterschiedlicher Schnelligkeit und Ausprägung. Seit 2006 kann der Morbus Pompe durch eine Enzymersatztherapie mit Alglucosidase-alfa behandelt werden. In einer offenen klinischen nicht-verblindeten Beobachtungsstudie wurde an 7 deutschen Zentren die Wirksamkeit und Verträglichkeit dieser Enzymersatztherapie über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht. An der Studie teilgenommen haben 38 adulte gesichterte Morbus Pompe Patienten mit variabler Ausprägung der Krankheit. Zur Verifizierung der Therapieauswirkung wurden die Patienten vor und nach jeweils 12 Monaten Enzymersatztherapie je 11 Untersuchungen unterzogen, die aus Muskelfunktions- und Kraftmessungen sowie Lungenfunktion, Serum-Kreatininkinase-Messung, einem Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität, einem Schmerzfragebogen und einer Bestimmung der Antikörpertiter bestanden. Bei den meisten Tests zeigten sich keine signifikanten Veränderungen im Verlauf der drei Jahre. Ausnahmen waren der 6-Minuten Geh-Test, der SF36 und die Serum-Kreatinkinase. Mit länger dauernder Therapie entwickeln nahezu alle Patienten Antikörper gegen das therapeutische Enzym, trotzdem zeigen die wenigsten anaphylaktische Reaktionen. Die klinischen Testergebnisse aus dieser 3-Jahres-Studie sowie auch die Ergebnisse anderer Studien deuten insgesamt auf eine Stabilisierung der neuromuskulären Funktion mit milden funktionellen Verbesserungen hin. Da der natürliche Verlauf progredient ist, ist eine Stabilisierung mit teilweiser Tendenz zur Verbesserung für die Patienten ein Therapieerfolg. Da diese Therapie lebenslang durchgeführt werden muss, sind weitere Studien über einen längeren Verlaufszeitraum nötig.
Wed, 09 May 2012 14:32:40 GMT http://saveyourskin.ch/podcast/DE/5.1.1.Varicous_veins.mp4 Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Burg, MD Zürich 2013-03-10T14:32:37Z Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Burg, MD Zürich no Varikose und chron
Klinische Verlaufsdokumentation der Enzymersatztherapie mit Alglucosidase alfa über ein Jahr bei 44 adulten Patienten mit Glykogenose Typ II
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Hintergrund: Die Glykogenose Typ II (Morbus Pompe) vom adulten Typ ist eine autosomal rezessiv vererbte, progressive, lysosomale Glykogenspeicherkrankheit, die durch den Mangel des lysosomalen Enzyms saure α-1,4-Glukosidase, durch Mutationen im Gen für dieses Enzym verursacht, geprägt ist. Klinisch ist sie charakterisiert durch eine Schwäche und Atrophie der Skelett- und Atemmuskulatur, resultierend in motorischer, v.a. Gehschwäche bis Rollstuhlpflichtigkeit und respiratorischer Einschränkung bis Insuffizienz. 2006 wurde das rekombinante humane Enzym alglucosidose alfa der Firma Genzyme zur Enzymersatztherapie (EET) für alle Formen des Morbus Pompe zugelassen. Methoden: In einer multizentrischen, offenen klinischen Beobachtungsstudie wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit der EET mit alglucosidase alfa in einem Patientenkollektiv von 44 adulten Morbus Pompe Patienten mit variablen Krankheitsausprägungen untersucht. Die zehn Untersuchungen bestanden aus einem Arm Function Test (AFT), dem Walton Gardner Medwin Scale (WGMS), den vier Timed Funktion Tests 10 Meter gehen, 4 Stufen Steigen, 6 Minuten Gehen und Aufstehen aus dem Liegen, der Erfassung des MRC-Summenscores, der Messung der Vitalkapazität in der Lungenfunktion, der Messung des CK-Serumlevels sowie dem selbstauszufüllenden Fragenbogen SF-36. Alle diese Tests wurden vor Beginn der EET sowie alle drei Monate und nach Abschluss eines Jahres der Therapie durchgeführt. Ergebnisse: Unter der EET kam es bei ca. 10 % der Patienten zu geringeren allergischen Reaktionen, die erfolgreich mit Antihistaminika und Kortikosteroiden behandelt werden konnten. Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Kein Patient brach die Therapie ab, kein Patient verstarb und kein Patient wurde neu beatmungspflichtig. Bei den meisten Tests zeigten sich keine signifikanten Veränderungen nach einem Jahr EET im Vergleich zur Anfangszeitpunkt. Ausnahmen waren das CK-Serumlevel, das sich signifikant in der Gesamtgruppe sowie besonders in der Untergruppe der Frauen verringerte, sowie die beiden Timed Funktion Tests Aufstehen aus dem Liegen und 6 Minuten Gehen, bei denen sich signifikant die Zeit verringerte bzw. die Gehstrecke verlängerte. Letzteres traf besonders auf eine Untergruppe von fünf gehfähigen Patienten zu, die während der EET auf einem Fahrradergometer trainierten. Fazit: Alglucosidase alfa stellt sich bisher als sichere Therapie für Patienten mit Glykogenose Typ II vom adulten Typ dar. Die klinischen Testergebnisse aus dieser 1-Jahres-Studie sowie aus anderen Studien deuten auf eine Stabilisierung der neuromuskulären Funktion mit milden funktionellen Verbesserungen, v.a. unter begleitendem Training, hin [Angelini et al., 2009; Van der Ploeg et al., 2010; Bembi et al., 2010]. Trotz der hohen Jahrestherapiekosten von ca. 500.000,- EUR sollte die EET bei Patienten mit gesicherter Glykogenose Typ II daher fortgeführt werden. Ausblick: In weiteren, länger angelegten Studien sind die langfristige Verträglichkeit sowie klinische Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum als ein bis zwei Jahre hinaus zu untersuchen. Außerdem ist die Rolle der Ernährung sowie des körperlichen Trainings unter EET bisher nicht bekannt. Ausblickend werden schließlich neue Therapieformen wie Chaperon-Therapie oder Gentherapie erforscht.
Vergleich dreier Methoden zur standardisierten Refluxerzeugung bei chronisch venöser Insuffizienz mittels Duplexsonographie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 13/19
Thu, 9 Jun 2011 12:00:00 +0100 https://edoc.ub.uni-muenchen.de/13308/ https://edoc.ub.uni-muenchen.de/13308/1/Bernhardt_Constanze.pdf Bernhardt, Constanze Franziska Claudia
Surfactantproteine und ihre Vorstufen bei interstitiellen Lungenerkrankungen im Kindesalter
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Veränderungen des intrazellulären Metabolismus der Surfactantproteine SP-C und SP-B sowie ihrer Vorstufen, sind in manchen Fällen verantwortlich für chronische interstitielle Lungenerkrankungen sowie unklare respiratorische Insuffizienz im Kindesalter. Um Häufigkeit und mögliche diagnostische Bedeutung dieser Veränderung zu untersuchen, analysierten wir die bronchoalveolären Lavagen von Kindern mit unklaren ILE (ILD n=49), unklarer respiratorischer Insuffizienz bei Neugeborenen (NG n=36) und unklarer respiratorischer Insuffizienz bei nicht Neugeborenen (n=7), im Vergleich zu Kindern ohne Lungenerkrankungen (n=12). Matures SP-B fand sich in allen untersuchten Fällen und schloss so eine SP- Defizienz biochemisch bei diesen Kindern aus. Die Vorformen von SP-B, pro-SP-B fanden sich bei der überwiegenden Mehrzahl der Kinder, neue oder unerwartete Banden ließen sich nicht nachweisen. Eine biochemisches Fehlen von SP-C fanden wir bei elf Proben; von diesen wurde eine genetisch auf Mutationen im SP-C Gen untersucht, eine genetische SP-C-Defizienz ließ sich nicht nachweisen. Zwei der elf Proben wurden für Mutationen im ABCA-3-Transporter untersucht, diese ließen sich bei beiden nachweisen. Des Weiteren zeigten sich bei vier Kindern Mutationen im ABCA-3-Transporter ohne das SP-C biochemisch untersucht worden war, sodass wir insgesamt bei sechs Kindern Mutationen im codierenden Bereich für den ABCA-3-Transporter nachweisen konnten. Fehlendes oder erniedrigtes SP-C in der Lavage weißt bei entsprechender Klinik auf Defekte im SP-C oder ABCA-3-Gen hin. Normalerweise findet sich kein pro-SP-C in der Lavage; wir konnten allerdings Signale nachweisen. Bei einem der drei Patienten mit genetisch determinierter SP-C-Defizienz zeigte die Probe Signale. Die quantitative Auswertung der Surfactantproteinmengen ergab keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Leider wurde (und konnte aufgrund fehlender DNA oder Einverständniserklärungen) nur bei einem kleinen Teil der Kinder eine genetische Untersuchung durchgeführt. Ebenso zeigte unsere Auswertung der durchgeführten Diagnostik, dass viel zu selten weiterführende diagnostische Maßnahmen wie HR-CT oder Biopsien vorgenommen wurden. Bei persistierender Symptomatik sollte auch in dieser Altersgruppe entgegen der aktuellen klinischen Alltagsvorgehensweise, nach Ausschluss exogener Ursachen sowie von Systemerkrankungen, eine definitive Diagnosestellung vorangetrieben werden. Nur so kann eine ätiologische Einordnung erfolgen und es können rationale Therapieeinsätze geplant werden.
Lebensqualität von heimbeatmeten Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) und ihren Angehörigen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/19
Im Verlauf der Amyotrophen Lateralsklerose kommt es zu einer Beteiligung der gesamten Willkürmuskulatur, d.h. auch die Atemmuskulatur wird davon betroffen, so dass die dadurch entstehende respiratorische Insuffizienz die häufigste Todesursache bei ALS darstellt. Wann jedoch die ersten Symptome der respiratorischen Insuffizienz auftreten, ist individuell sehr unterschiedlich und kann, wenn auch nur in wenigen Fällen, wie u.a. in dieser Studie gezeigt werden konnte, als erstes klinisch relevantes Symptom zur Diagnosestellung führen. Die Symptome einer respiratorischen Insuffizienz können aber auch lange vor dem Tod im Verlauf der Erkrankung auftreten und die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen und somit eine Behandlung erfordern. Durch die vielfältigen Ergebnisse dieser Studie konnte ein umfassender Eindruck über die Situation von heimbeatmeten Patienten und ihren Angehörigen in Deutschland gewonnen werden: 1. Die nicht-invasive Beatmung über Maske, ein Instrument zur Symptomkontrolle und auch Lebensverlängerung, wurde sowohl von Patienten und als auch deren Angehörigen als eine gute Möglichkeit zur Behandlung der Symptome einer respiratorischen Insuffizienz angenommen. Sowohl die Patienten als auch die Angehörigen bewerteten ihre Lebensqualität relativ hoch. 2. Die invasive Beatmung über Tracheostoma wurde häufig im Rahmen einer Notfallsituation eingeleitet, ohne dass Patienten und Angehörige in den Entscheidungsprozess miteinbezogen wurden. Trotzdem zeigten die Patienten eine gute Lebensqualität in der Untersuchung, jedoch zu Lasten einer deutlich höheren Belastung der Angehörigen. 3. Sowohl Patienten als auch Angehörige beider Gruppen (M+T) werteten die Möglichkeit in der gewohnten häuslichen Umgebung leben zu können als Hauptvorteil der Heimbeatmung 4.Schulung der behandelnden Ärzte, rechtzeitige Aufklärung des Patienten und seiner Angehörigen über die Terminalphase der Erkrankung sowie der Einsatz von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht erscheinen in Hinblick auf den zu erwartenden Verlauf der Erkrankung und die damit verbundene Entwicklung einer progredienten respiratorischen Insuffizienz dringend notwendig. Somit könnte schrittweise eine dem Patientenwunsch entsprechende Therapie erfolgen und entstehende Probleme, insbesondere in der häuslichen Versorgung, bereits im Vorfeld ermittelt und ggf. unterstützt werden. Eine invasive Beatmung über ein Tracheostoma würde damit letztendlich nur bei Patienten in speziellen Situationen bzw. Indikationen [ultima ratio] und eingehender Diskussion zum Einsatz kommen und könnte dann auch eine gute Symptomkontrolle und Lebensqualität bieten. 5. Abschließend zeigt diese Studie aber auch, dass ein krankheits-spezifisches Messinstrument zur Erfassung der Lebensqualität, nicht nur bei ALS, sinnvoll erscheint. Insbesondere die Fokussierung auf die körperlichen Probleme der Erkrankung scheint zu einer Verzerrung der tat¬sächlichen Lebensqualität zu führen. Außerdem sollte bei jeder Erkrankung, die zu einer Versorgung in der häuslichen Umgebung führt, eine Mituntersuchung der pflegenden Angehörigen unbedingt eingeplant werden. Nur dadurch kann ein realistisches Bild der Situation der Erkrankten und ihrer Familien sowie der Behandlungsmethoden und deren Nutzen erstellt werden. Die vorgestellte Studie wirft noch unbeantwortete Fragen und Hypothesen auf. So könnte angenommen werden, dass die Lebensqualität der Familien, die den Fragebogen nicht beantwortet haben, geringer einzuschätzen ist und eine Bewertung der Lebensqualität nach unter beeinflussen würde. Ein weiterer Studienbedarf ist hier gegeben. Ebenso scheint die insgesamt kleine Anzahl der Patienten in beiden Gruppen ein Hinweis auf die auch in Deutschland und weltweit noch geringe Verfügbarkeit der Heimbeatmung für ALS-Patienten zu sein. Ferner sind die verwendeten validierten Fragebögen zur Lebensqualität (POMS, MLDL, FKV) möglicherweise nicht sensitiv genug, um einen Unterschied in kleinen Gruppen darzustellen. Schließlich war diese Studie auf Patienten in Deutschland begrenzt, die im Gegensatz zu Patienten, wie z.B. in den USA, eine gute professionelle Unterstützung in der häuslichen Pflege erhalten können. Dadurch eröffnen die Ergebnisse im internationalen Vergleich eine erfreulicherweise positive Perspektive für ALS-Patienten und ihre Angehörigen in Deutschland. Trotz all dieser Kritikpunkte handelte es sich um die erste Studie, die einen Vergleich der beiden Beatmungsarten und ihrer Wirkung auf die Lebensqualität der Patienten und sie pflegenden Angehörigen untersuchte. Eine Beschäftigung mit den noch offenen Fragen in weiteren Studien erscheint sinnvoll.
Einfluss der Aktivierung dendritischer Zellen auf die Immunantwort in vitro
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Im Angesicht der augenscheinlichen Insuffizienz vorhandener Optionen in der Behandlung des metastasierten Pankreaskarzinoms stellt die Immuntherapie mit dendritischen Zellen einen möglichen neuen Therapieansatz dar. Bei einer Vielzahl von Malignomen wird diese Art der Therapie experimentell bereits klinisch getestet, bisher jedoch nicht mit ausreichendem Erfolg. Ziel dieser Arbeit war es, zu eruieren, welchen Einfluss der Modus der Aktivierung dendritischer Zellen auf eine gegen Pankreaskarzinomzellen gerichtete Immunantwort besitzt. Dabei sollten Wege identifiziert werden, eine aus dendritischen Zellen bestehenden Vakzine durch eine effektive Stimulation der enthaltenen Zellen möglichst potent in der Induktion dieser Immunantwort zu machen. Zu diesem Zwecke wurden von Monozyten abgeleitete dendritische Zellen mit dem Überstand apoptotischer Tumorzellen eines duktalen Pankreaskarzinoms inkubiert und dann nach verschiedenen Schemata stimuliert. Die Potenz der dendritischen Zellen wurde eruiert über die Expression von Reifemarkern und kostimulatorischen Molekülen, die Zytokinproduktion und die Induktion von Aktivierungsmarkern auf T-Zellen sowie der CTL-getragenen spezifischen Immunantwort gegen Pankreaskarzinomzellen in einer halbautologen Kokultur von dendritischen Zellen und naiven T-Zellen. Zur Stimulation der dendritischen Zellen kamen ATP mit TNFalpha und die Kombination von IL-1beta, IL-6, TNFalpha und PGE2 mit und ohne die Zugabe von CD40-Ligand, einem zellgebundenen, DC-aktivierenden Oberflächenmolekül, zur Anwendung. Die kombinierte Anwendung von CD40L und proinflammatorischen Mediatoren (TNFalpha, IL-6, IL-1beta und PGE2 bzw. ATP plus TNFalpha) besaß, verglichen mit der getrennten Anwendung dieser Stimuli, einen synergischen Effekt bei der Aktivierung dendritischer Zellen. So stimulierte Zellen zeigten eine hohe Expression von Aktivierungsmarkern und des Zytokinrezeptors CCR7, induzierten effektiv ein Th1-gerichtetes Zytokinmillieu und eine CTL-vermittelte spezifische Immunantwort gegen Pankreaskarzinomzellen. Die Zugabe von CD40-Ligand 12 h nach der Stimulation der dendritischen Zellen mit ATP und TNFalpha bzw. der Kombination von IL-1beta, IL-6, TNFalpha und PGE2 erwies sich dabei als optimal. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass die Art der Stimulation der dendritischen Zellen im Rahmen der Immuntherapie des duktalen Pankreaskarzinoms einen wesentlichen Einflussfaktor in Bezug auf die Potenz der verwendeten Vakzine darstellt. Geht man von einer Übertragbarkeit dieser in-vitro-Daten auf das menschliche Immunsystem aus, so kann mit Hilfe einer optimalen Aktivierung dendritischer Zellen die Effektivität einer Vakzine wesentlich gesteigert werden.
Charakterisierung der Atmungsketten-Enzyme NADH-CoQ-Reduktase und Cytochrom-C-Oxidase in verschiedenen humanen Geweben und Darstellung ihrer Bedeutung bei Defekten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
Mitochondrial verursachte Erkrankungen beim Menschen wurden erstmals 1959 entdeckt und 1962 von Rolf Luft beschrieben. Diese Erkrankungen sind nicht so selten, wie bisher angenommen: ihre geschätzte Prävalenz liegt bei 10-15 Fällen pro 100 000 Personen. Der Verdacht einer mitochondrialen Dysfunktion stellt sich immer dann, wenn es zu einer unerklärbaren Zusammensetzung von Symptomen bei scheinbar nicht verwandten Organen kommt. Es sind hauptsächlich das stark von der Atmungskette abhängige Muskel- und Nervengewebe betroffen. Ursächlich können Fehler in der Atmungskettenfunktion sein. Komplex - I - und IV -Mangel stellen dabei die zwei häufigsten Atmungsketten-Defekte dar. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, diese beiden Enzyme der Atmungskette NADH-CoQ-Reduktase (Komplex I) und Cytochrom-C-Oxidase (Komplex IV) in verschiedenen menschlichen Geweben (Skelettmuskulatur, Fibroblasten und Chorionzotten) zu charakterisieren. Die zu untersuchenden Variablen waren dabei die Nachweisbarkeit, die Proteinkonzentrationsabhängigkeit, die Aktivität, die Haltbarkeit und die Kinetik der Enzymkomplexe. In Bezug auf die pränatale Diagnostik sollte die Verwendbarkeit von Chorionzotten geprüft werden. Aktivitätsmessungen von Patienten wurden dargestellt und diskutiert. Die Skelettmuskulatur wies die am höchsten messbaren Aktivitäten bei beiden Komplexen auf. Bei den enzymkinetischen Studien zeigten alle untersuchten Gewebe für beide Komplexe lineare Verläufe der Lineweaver-Burk-Diagramme. Die sich aus den Diagrammen ableitende Maximal-Geschwindigkeit war für den Skelettmuskel in beiden Enzymen am höchsten. Das Muskelgewebe wies jedoch gegenüber den Fibroblasten und Chorionzotten eine geringere Affinität zum Substrat auf. Im Stabilitätstest wurde deutlich, dass sowohl die NADH-CoQ-Reduktase wie auch die Cytochrom-C-Oxidase bei -20°C extrem lagerungsinstabil waren. Es konnte bei drei Patienten, die eine typische Klinik für einen Defekt in der Atmungskette aufwiesen, eine biochemische Ursache gefunden werden. Bei zwei Patienten wurde eine reduzierte Aktivität im Komplex I gemessen. Sie präsentierten eine milde ausgeprägte myopathische Form. Ein Säugling zeigte einen kompletten Verlust der Komplex-IV-Atkivität. Dieser litt an Krampfanfällen, muskulärer Hypotonie und schwerer Azidose litt. Er verstarb an respiratorischer Insuffizienz am 10. Lebenstag
Aorto-koronare Bypass-Operationen nach fehlgeschlagener koronarer Angioplastie: Risikofaktoren und Langzeitergebnisse
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
In dieser Fall-Kontroll-Studie wurden präoperative, intra- und postoperative Risikofaktoren sowie Langzeitergebnisse bei Patienten, die sich nach fehlgeschlagener PTCA einer notfallmäßigen aorto-koronaren Bypassoperation (ACB) unterziehen mussten, untersucht. Zur Beurteilung des Mortalitätsrisikos und des Langzeitverlaufs nach notfallmäßiger Bypassoperation diente ein im selben Zeitraum operiertes elektives Vergleichskollektiv mit einem vergleichbaren Risikoprofil. Ein weiterer Aspekt dieser Untersuchung galt der Einschätzung einer erhöhten perioperativen Myokardinfarktinzidenz in der Notfallgruppe. Darüber hinaus wurde untersucht, ob die Verwendung der A. mammaria interna (IMA) die operativen und mittelfristigen Ergebnisse bei den notfallmäßigen ACB-Operationen nach fehlgeschlagener PTCA beeinflusst. Der Gebrauch der IMA wird in der elektiven aorto-koronaren Bypassoperation wegen der vorteilhaften Langzeitergebnisse empfohlen. Bei notfallmäßiger ACB bevorzugen jedoch viele Operateure die Revaskularisation vor allem mit venösen Grafts, da die Operationszeiten kürzer und die initialen Flussraten höher sind. Von Januar 1990 bis März 1993 wurde bei 56 Patienten aus 7 kardiologischen Zentren 1h bis 114 h (durchschnittlich 7,5h) nach fehlgeschlagener PTCA eine notfallmäßige ACB durchgeführt. Diese Patienten wurden auf bestimmte Risikofaktoren und auf Kriterien einer anatomisch ungünstigen Stenose für eine PTCA hin untersucht. Als Kriterien für die Beurteilung einer ungünstigen Stenose galten: langstreckige Stenosen, Verschluss eines anderen Hauptgefäßes, Tandemstenosen, exzentrische Stenosen, Stenosen in oder an einer Gefäßkrümmung/Gefäßaufzweigung und distal gelegene Stenosen. 23,2% der Patienten wiesen ein Kriterium, 41,1% zwei, 8,9% drei und 3,6% vier Kriterien auf. Bei nur 13 Patienten (23,2%) wurden die Stenosen als ideal für eine PTCA eingestuft. Alle Patienten unterzogen sich 14,6 +/- 8,2 Monate post operationem einer echokardiographischen und anamnestischen Nachuntersuchung. Das operative Mortalitätsrisiko nach fehlgeschlagener PTCA war gegenüber den elektiven ACBs signifikant erhöht (10,7% vs. 1,8%; p
Postoperative Ergebnisse nach Aorten- und Mitralklappenersatz mittels Sorin Bicarbon™ Prothese
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/19
In der Abteilung für Herzchirurgie des städtischen Krankenhauses München Bogenhausen wurde von Januar 1993 bis Oktober 2000 bei 1092 Patienten entweder die Aorten- und oder die Mitralklappe mit einer Zweiflügelprothese vom Typ Sorin Bicarbon ersetzt. 325 Patienten, die zusätzlich einen aortocoronaren Bypass, bei gleichbestehender KHK, erhielten, wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Bei 767 Patienten wurde ein einfacher oder kombinierter prothetischer Klappenersatz durchgeführt. Nach Implantation mechanischer Herzklappenprothesen ist eine dauerhafte Antikoagulation unumgänglich. Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluierung der Inzidenz klinischer Komplikationen, insbesondere der Blutungs- und Thromboembolierate nach Implantation, dieser mechanischen Herzklappenprothese im mittelfristigen Verlauf. Bei 553 Patienten wurden Daten hinsichtlich Mortalität, Morbidität und Lebensqualität bzw. NYHA-Klassifikation retrospektiv im Mittel 49 Monate postoperativ erfasst. Zusätzlich wurden die Patienten schriftlich bzw. telephonisch bezüglich ihres postoperativen Verlaufs und jedweder aufgetretener Komplikationen befragt. 131 Patienten mussten von der Auswertung ausgeschlossen werden, da sie weder direkt noch indirekt erreichbar waren. Das untersuchte Patientenkollektiv bestand aus 354 (64%) männlichen und 199 (36%) weiblichen Patienten. Insgesamt wurde in 387 Fällen ein Aortenklappenersatz (AKE) oder bei 118 Patienten ein Mitralklappenersazt (MKE) bzw. in 48 Fällen ein Doppelklappenersatz (DKE=AKE+MKE) durchgeführt. Präoperativ befanden sich 9 Patienten (1,6%) im NYHA- Stadium I, 61 Patienten (11%) im Stadium II, 439 Patienten (79,4%) im Stadium III und 44 Patienten (7,95%) im Stadium IV. Die kumulative follow up Zeit betrug 2250 Patientenjahre (für AKE: 1574 Pj, für MKE: 458 Pj und für DKE: 218 Pj). Hinsichtlich der Ätiologie des Klappenfehlers (AI/AS, MI/MS) zeigten sich folgende Unterschiede in der Langzeitüberlebensraten: In beiden Gruppen wiesen Patienten, die aufgrund einer Insuffizienz operiert wurden eine höhere 8,5- Jahresüberlebensrate (AI: 88,2%, MI: 94%) im Vergleich zu Patienten mit führender Stenosekomponente (AS: 79,5%, MS: 92%). Postoperativ befanden sich über 79% der Patienten im NYHA- Stadium I oder II. Keiner der untersuchten Patienten zeigte eine strukturelle Prothesendysfunktion. Die Sorin Bicarbon™ Prothese zeigte in der vorliegenden Studie bezüglich Überlebens- und postoperativer Komplikationsrate zufriedenstellende Ergebnisse, die vergleichbar mit anderen auf dem Markt befindlichen Zweiflügelprothesen waren. Weitere follow up’s sind erforderlich für einen Vergleich, der insbesondere die Langzeitergebnisse validieren kann.
Verlauf und palliativmedizinische Behandlung in der Terminalphase bei Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Beinahe alle ALS Patienten entwickeln im Verlauf ihrer Erkrankung Symptome einer respiratorischen Insuffizienz. In diesem Zusammenhang wird von den Betroffenen regelhaft die Angst vor dem Erstickungstod geäußert. Bis zur Erstveröffentlichung der eigenen Ergebnisse gab es nur wenige Daten über die Terminalphase der ALS. Diese betrafen ausschließlich Patienten, die in einem Hospiz gestorben sind oder von einer derartigen Einrichtung in der Sterbephase betreut wurden [O’Brien 1992; Oliver 1996]. Mit der Absicht, diese Erstickungsängste zu entkräften, führten wir eine retrospektive Studie über den Verlauf der Terminalphase der ALS durch. Dazu sichteten wir die Unterlagen und/oder Akten von 202 Patienten der Motoneuronambulanz an der Neurologischen Klinik der Universität München, die mit einer wahrscheinlichen oder sicheren ALS von Januar 1995 bis März 1999 gestorben waren. In 121 Fällen war es möglich, ein strukturiertes Telefoninterview mit der Hauptpflegeperson der Patienten durchzuführen. Die gestellten Fragen konzentrierten sich - jeweils aus Sicht der Hauptpflegeperson - auf die Symptome und den Grad des Leidens sowie des Bewusstseins in der Sterbephase, den Sterbeort, das Verhältnis zu lebensverlängernden Maßnahmen und die Palliativmaßnahmen, die in der Sterbephase angewendet wurden. Insbesondere wurde nach Medikamenten, vor allem nach Opiaten und Benzodiazepinen, wie auch nach Ernährungshilfen und Beatmungsmaßnahmen gefragt. Von den 121 Patienten waren 50 weiblichen und 71 männlichen Geschlechts. Das mittlere Sterbealter war 62,7 Jahre (27-86) und die mittlere Erkrankungsdauer betrug 36,4 Monate (7-131). Bei 84 Betroffenen begann die Erkrankung an den Extremitäten und bei 37 bulbär. Von den Hauptpflegepersonen waren 83 Ehepartner/Lebensgefährte, 25 Kinder, acht Verwandte und zwei Bekannte oder Freunde der Patienten sowie drei Krankenschwestern. Zu Hause oder in einem Pflegeheim starben 74 Patienten. Die übrigen 47 Erkrankten verstarben in einem Krankenhaus oder einer Palliativstation. Zwei Patienten haben sich bewusst zum Sterben in eine Palliativeinrichtung aufnehmen lassen. Die Todesursache war in 99 Fällen eine respiratorische Insuffizienz. Jeweils acht Patienten verstarben an einer Lungenentzündung und Herzversagen sowie zwei an einem Tumorleiden. Einer der Erkrankten beging Selbstmord. Bei den restlichen Patienten hatte der Tod verschiedene andere Ursachen. Der Tod trat bei 33 Erkrankten in wachem, bei 75 in schlafendem und bei 13 in komatösem Zustand ein. Symptome der letzen 24 Stunden waren bei 24 Patienten Dyspnoe, bei zehn Unruhe und Angst, bei neun Verschlucken von Speichel oder Bronchialschleim, bei fünf Hustenanfälle und in zwei Fällen diffuse Schmerzen. Diese Beschwerden wurden bis auf sieben Fälle suffizient palliativmedizinisch gelindert. Kein Patient unserer Studie ist erstickt und 107 (88,4%) der Kranken starben friedlich. Sechs Patienten litten mäßig in der Sterbephase und einer der Kranken starb qualvoll. Eine Reanimation wurde erfolglos bei sechs Patienten durchgeführt und es kam zu einem Suizid. Aktive Sterbehilfe wurde wiederholt von acht Erkrankten gewünscht. Von diesen Patienten nahm sich einer tatsächlich das Leben und drei weitere unternahmen je einen erfolglosen Suizidversuch. Ferner äußerten 35 Betroffene mehrfach Sterbewünsche und sprachen sich zudem, wie 40 weitere Patienten, deutlich gegen lebensverlängernde Maßnahmen aus. Die verbleibenden 39 Untersuchten gaben keine Sterbewünsche oder Stellungnahmen zu möglichen intensivmedizinischen Schritten an. Ohne Beatmungsmaßnahme bis zum Tod blieben 81 (66,9%) Erkrankte. In 21 Fällen wurde über Nasenmaske und viermal über Tracheostoma eine Heimbeatmung angewendet. Die mittlere Beatmungsdauer betrug 297 Tage (2-1695). Bei weiteren fünf Patienten wurde diese Maßnahme wegen Nebenwirkungen nur vorübergehend gebraucht. Das Tracheostoma wurde von zwei Angehörigen und die Nasenmaske von 20 Pflegepersonen als positiv bewertet. Intubationen wurden neunmal vorgenommen, wovon sechs auf ausdrücklichen Patientenwunsch wieder rückgängig gemacht wurden. Keiner der Hauptpflegenden würde, erneut vor die Wahl gestellt, einer Intubation zustimmen. Mit einer PEG versorgt wurden 33 (27%) Patienten im Mittel über 192 Tage (6-1008). An Nebenwirkungen traten zweimal schwere Infektionen auf, die zur Sondenentfernung führten. Einmal kam es bei der Anlage der Sonde zu einem Herzstillstand. Eine erneute Zustimmung zu dieser Ernährungshilfe würden 30 (91%) der Angehörigen geben. Verweigert wurde das erneute Einverständnis zur PEG-Anlage in sechs Fällen. Die Gründe - aus Sicht der Angehörigen - waren zu gleichen Teilen zum einen die Nebenwirkungen und zum anderen die durch diese Maßname herbeigeführte Lebens- und somit Leidensverlängerung Morphin wurde von 33 (27%) Patienten über eine mittlere Dauer von sechs Tagen (1-52) eingenommen. Die mittlere Dosis für ein orales Dosisäquivalent betrug pro Tag 90 mg (10-360 mg). Die Hauptindikationen waren Atemnot (in 25 Fällen) und Schmerzen. Aus Angst vor Nebenwirkungen verweigerten zwölf Patienten sowie vier Ärzte den Einsatz von Morphin. Eine gute symptomlindernde Wirkung bei geringen Nebenwirkungen wurde dem Präparat von 30 Hauptpflegenden bestätigt. Benzodiazepine wurden in 39 Fällen eingesetzt. Die mittlere Anwendungszeit betrug 120 Tage (1-1400). Bei 29 Patienten war die Angst vor Atemnot die Hauptindikation. Aufgrund der Angst vor unerwünschten Wirkungen lehnten vier Erkrankte die Einnahme von Benzodiazepinen ab. Ein sehr guter palliativer Effekt dieser Substanzgruppe wurde von 33 Angehörigen bemerkt. Insgesamt sind etwa 90% der untersuchten ALS-Patienten friedlich gestorben, die Mehrzahl davon im Schlaf. Kein ALS-Patient ist erstickt, und die Dauer der akuten zum Tode führenden Verschlechterung betrug bei 2/3 der Erkrankten unter 24 Stunden. Dies ist im Vergleich mit anderen Studien an Normalpatienten, in denen die Spanne der friedlichen Sterbevorgänge von 47,5% ohne sedierende Maßnahmen bis 94% unter den medizinischen Bedingungen eines stationären Hospizes reicht, als deutlich überdurchschnittlich anzusehen. Wenn eingesetzt, wurden PEG, die nicht-invasive Heimbeatmung, Morphin und Benzodiazepine von den Hauptpflegepersonen in den meisten Fällen als hochwirksame palliative Therapien angesehen. ALS-Patienten sollten demnach, spätestens beim ersten Auftreten von Atemschwierigkeiten, über den natürlicherweise gutartigen Verlauf der Sterbephase aufgeklärt werden. Zudem sind die Betroffenen über die gute Wirksamkeit von palliativen Maßnahmen zu informieren. So können wirkungsvoll die unberechtigten Ängste vor den Erstickungstod bei den Patienten und deren Angehörigen zerstreut und die Lebensqualität aller von der ALS Betroffenen verbessert werden.
Funktionelle Magnetresonanztomographie (MRT) des Beckenbodens
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/19
Harninkontinenz und Deszensus genitalis sind bei Frauen häufig auftretende Probleme, deren Ursache in einer Insuffizienz des Beckenbodenverschlußsystems liegen. Als eine der Hauptursachen für die Schädigung von Muskulatur und Innervation des Beckenbodens gilt die vaginale Geburt. In der vorliegenden Arbeit wurden die Auswirkungen der vaginalen Entbindung anhand funktioneller MRT-Studien an Erstgebärenden nach spontanvaginaler Geburt untersucht im Vergleich zu Probandinnen, die noch nicht geboren hatten. Die MRT bietet sich aufgrund der fehlenden Strahlen- und Kontrastmittelbelastung besonders zur Untersuchung junger Frauen an. Sie ermöglicht dabei eine exzellente Darstellung aller am Beckenbodenaufbau beteiligter Strukturen und erlaubt in den funktionellen Sequenzen die Beobachtung des Zusammenspiels aller drei Beckenbodenkompartimente beim Zwick- und Pressmanöver. Es zeigten sich signifikante Unterschiede beim Vergleich der beiden Kollektive. Die Primiparae wiesen beim Pressen im Durchschnitt ein signifikant ausgeprägteres Tiefertreten von Harnblase, hinterem Scheidengewölbe und anorektalem Übergang auf, die Weite des Levatortores sowie die Rektozelentiefe waren im Vergleich mit den Nulliparae ebenfalls deutlich vergrößert. Eine Häufung von pathologischen MRT-Befunden bei Frauen mit geburtshilflichen Risikofaktoren wie großem Kindsgewicht und Kopfumfang sowie langer Austreibungsperiode fand sich am untersuchten Primiparae-Kollektiv jedoch nicht. In Hinblick auf klinisch vorliegende Harn- und Stuhlinkontinenz ließ sich bis auf eine erhöhte Rate an Rektumdeszensus und erweitertem Hiatus genitalis in der Gruppe der mittel- bis höhergradig stuhlinkontinenten Patientinnen ebenfalls keine Korrelation finden zwischen klinischem Kontinenzbefund und MRT-Bildgebung. Bei diesen Beobachtungen ist jedoch die sehr kleinen Anzahl an untersuchten harn- bzw. stuhlinkontinenten Frauen zu berücksichtigen, so daß hier für eine verlässliche Beurteilung Studien an größeren Kollektiven unerlässlich sind. Zusammenfassend lässt sich feststellen, daß die funktionelle MRT eine sehr gute und umfassende Darstellung der postpartalen Beckenbodenveränderungen ermöglicht. Sie trägt neben Kontinenzanamnese, gynäkologischer Untersuchung, Sonographie und urodynamischer Diagnostik erheblich zu einer differenzierten Beurteilung der postpartalen Beckenbodensituation bei. Weiterführende Studien unter Berücksichtigung der verschiedenen Entbindungsmodalitäten (vaginal-operativ, Sectio) sind bereits in Arbeit und werden das Verständnis der geburtsbedingten Veränderungen am Beckenboden sicherlich noch weiter vertiefen können.
X-Inaktivierung bei heterozygoten Überträgerinnen X-chromosomal gebundener Adrenoleukodystrophie
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Die X-chromosomal gebundene Adrenoleukodystrophie stellt eine vererbte Störung der peroxisomalen ß-Oxidation von Fettsäuren dar, die zu einer Akkumulation von überlangkettigen Fettsäuren in allen Körperflüssigkeiten führt. X-ALD wird durch Mutationen im ALD-Gen verursacht, welches ein peroxisomales Membranprotein aus der Superfamilie der ABCTransporter (ATP-binding cassette) kodiert. Die Erkrankung führt zu einer fortschreitenden Demyelinisierung des ZNS, einer peripheren Neuropathie sowie adrenokortikaler Insuffizienz. Es findet sich jedoch eine sehr hohe Variabilität phänotypischer Verlaufsformen. Aus bislang unklaren Gründen zeigt ein Großteil der heterozygoten Überträgerinnen - im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrzahl anderer X-chromosomal vererbter Erkrankungen - sowohl die biochemischen als auch die klinischen Merkmale einer X-ALD in abgemilderter Form. Zur Erklärung dieses Phänomens sollte die Untersuchung der X-Inaktivierung heterozygoter Überträgerinnen beitragen, da in der Vergangenheit postuliert wurde, daß eine zugunsten des mutierten ALD-Allels verschobene X-Inaktivierung (mit-)verantwortlich sei für das Auftreten erhöhter Konzentrationen überlangkettiger Fettsäuren und neurologischer Symptome bei ALDÜberträgerinnen. Zur Untersuchung der X-Inaktivierung wurde der hochinformative Androgenrezeptor-Test etabliert und in einigen Punkten modifiziert und verbessert. Das Testprinzip beruht auf der PCRAmplifikation eines hochpolymorphen CAG-Repeats im Exon 1 des Androgenrezeptor-Gens nach einer Inkubation von genomischer DNA mit methylierungssensitiven Restriktionsenzymen. Die Verwendung eines fluoreszenz-markierten Primers in der PCR ermöglichte eine präzise automatisierte Auswertung mittels Fragmentanalyse. Neben einer Bestimmung der überlangkettigen Fettsäuren im Plasma wurde der Heterozygotenstatus der ALD-Überträgerinnen durch eine Mutationsanalyse des ALD-Gens eindeutig belegt. Dabei konnten in allen 15 untersuchten Familien Mutationen im ALD-Gen identifiziert werden. Bei 8 Familien fanden sich neue, bislang unveröffentlichte Mutationen. Das Mutationsspektrum umfaßte 10 Missense- (67 %), zwei Nonsense- (13 %), zwei Splice-Site- Mutationen (13 %) und eine Frameshift-Mutation (6 %). Die X-Inaktivierungsmuster in Leukozyten heterozygoter ALD-Überträgerinnen wurden erstmals im Vergleich zu einem verwandten und einem nicht-verwandten Kontrollkollektiv untersucht. Bei 7 von 22 Überträgerinnen (32 %) zeigte sich eine ausgeprägte Verschiebung der X-Inaktivierung (Skewing) zugunsten eines Allels (> 80:100). Im Gegensatz dazu war ein ausgeprägtes Skewing weder bei den Nicht-Überträgerinnen aus ALD-Familien noch bei den Kontrollen zu beobachten. In diesen Gruppen fanden sich nur random X-Inaktivierung und mildes Skewing zu annähernd gleichen Teilen. Bei beiden Gruppen glich die Verteilung der XInaktivierungsmuster einer Gauss’schen Normalverteilungskurve. Die Unterschiede zwischen ALD-Überträgerinnen und unverwandtem Kontrollkollektiv erwiesen sich als statistisch hochsignifikant. Eine Korrelation zwischen dem Grad der X-Inaktivierung in Leukozyten heterozygoter ALDÜberträgerinnen und deren biochemischen Parametern (Konzentration überlangkettiger Fettsäuren im Plasma) war nicht nachweisbar. Unsere Daten belegen, daß das häufige Auftreten einer Verschiebung der X-Inaktivierung zugunsten eines Allels bei ALD-Überträgerinnen mit dem mutierten ALD-Allel in Zusammenhang steht und wahrscheinlich durch Selektionsmechanismen verursacht wird. Diese Selektionsmechanismen wirken nach dem primären X-Inaktivierungsprozeß. Andere sekundäre Einflußvariablen wie Alter oder genetische Faktoren des X-Inaktivierungsprozesses selbst wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Anhand von Transkriptanalysen in kultivierten Fibroblasten konnte darüberhinaus gezeigt werden, daß einerseits eine Selektion zugunsten des Wildtyp-Allels, andererseits jedoch auch eine Selektion zugunsten des mutierten Allels vorkommt. Der bislang in der Literatur postulierte Selektionsvorteil des mutierten ALD-Allels wird somit in Frage gestellt.
Bilaterale massive makronoduläre Nebennierenhyperplasie
Bei einem 46jährigen Patienten bestand seit 10 Jahren eine arterielle Hypertonie. In den letzten beiden Jahren entwickelten sich eine stammbetonte Adipositas sowie weitere typische Stigmata eines Cushing-Syndroms. Hormonanalysen ergaben einen Hypercortisolismus und ein supprimiertes Plasma-ACTH. Der Dexamethason-Hommtest erbrachte keine signifikante Suppression des Serum-Cortisols. Im CRH-Test und im Metopiron®-Test erwies sich das Plasma-ACTH als nicht stimulierbar. Im ACTH-Kurztest fand sich ein überschießender Cortisolanstieg. Die abdominelle Computertomographie zeigte beidseits stark vergrößerte (6 × 4 cm), großknotig veränderte Nebennieren. Eine adrenostatische Therapie mit Ketoconazol (400 mg/d) führte zu Symptomen der adrenalen Insuffizienz, eine reduzierte Dosis von 200 mg/d senkte das Serum-Cortisol auf Werte zwischen 5 und 11 µg/dl und normalisierte den Blutdruck, und die klinischen Symptome des Cushing-Syndroms bildeten sich zurück. Die anschließende bilaterale Adrenalektomie bestätigte die Diagnose einer massiven makronodulären Nebennierenhyperplasie. Postoperativ wurde eine Substitutionstherapie mit zweimal 25 mg/d Cortisonacetat und 0,05 mg/d Fludrocortison eingeleitet.
Die Insuffizienz der intraabdominellen Infektabwehr bei der eitrigen Peritonitis
Despite a high concentration of serum proteins and intact phagocytes peritonitis exudates contain a large number of viable, pathogenic bacteria. The reason for this biological paradox is unknown. Our investigations reveal a pronounced defect in humoral opsonization of foreign particles in peritonitis exudate. We evaluated a modified chemiluminescence system allowing the determination of opsonic activity in serum and exudate. In serum we found a close correlation between opsonic activity and immunologically measurable levels of C3-complement and IgG. In purulent peritonitis exudates, however, the actual opsonizing activity was much less than expected according to the opsonin concentrations. We found a pronounced difference between immunologically determined opsonin levels and impaired opsonic function. Employing crossed immunoelectrophoresis massive C3-splitting into smaller fragments could be demonstrated in peritonitis exudates. In these exudates we found very high concentrations of granulocyte proteolytic (elastase) and oxidative (myeloperoxidase) enzymes which may lead to a functional destruction of opsonins followed by impaired opsonization in peritonitis exudate. The great number of bacteria and foreign particles in addition can cause a pronounced physiological consumption of complement components. The almost complete breakdown of intact C3-complement in intraabdominal exudate explains the deficient host defence in patients with severe peritonitis.
Die venöse Insuffizienz der Corpora cavernosa als (Mit-)Ursache der erektilen Dysfunktion
Thu, 1 Jan 1987 12:00:00 +0100 https://epub.ub.uni-muenchen.de/9132/1/9132.pdf Bähren, Wolfgang; Altwein, J. E.; Schnell, D.; Scherb, Wolfgang; Gall, Helmut; Thon, Walter F.; Stief, Christian Georg
Bei elf von 43 nichtimmunen Patienten mit Malaria tropica traten eine oder mehrere Organkomplikationen auf: zerebrale Malaria, akute respiratorische Insuffizienz, akutes Nierenversagen, Sekundärinfektion, Autoimmunhämolyse, spontane Milzruptur und akute Pankreatitis. Die Parasitämie betrug 0,1 bis 60 %. Initiale antiparasitäre Therapie mit Chinin parenteral führte in neun Fällen zu rascher Rückbildung der Parasitämie. Zusätzlich wurde ein zweites schizontozides Mittel entsprechend der Resistenzlage gegeben. Die supportive Therapie umfaßte intensivmedizinische Überwachung mit Bilanzierung von Elektrolyt- und Wasserhaushalt sowie gegebenenfalls eine frühzeitige Hämodialyse und (oder) endotracheale Intubation mit PEEP-Beatmung. In einem Fall mit exzessiver Parasitämie wurde eine Austauschtransfusion durchgeführt. Heparin wurde nur bei nachgewiesener disseminierter intravasaler Gerinnung gegeben, Corticosteroide nur bei persistierender Autoimmunhämolyse. Alle Patienten überlebten ohne zurückbleibende Defekte. Die retrospektive Analyse zeigt, daß neben einer raschen spezifischen Therapie die supportive Behandlung der einzelnen Organkomplikationen für Verlauf und Prognose der komplizierten Malaria tropica mitentscheidend ist.
Glucosetoleranz, ATCH- und insulinspiegel bei NNR-Insuffizienz
Mon, 1 Jan 1968 12:00:00 +0100 https://epub.ub.uni-muenchen.de/7976/1/Scriba-Peter_C._7976.pdf Scriba, Peter Christian; Schwarz, K.; Dieterle, P.; Bittermann, P. ddc:610, Medizin