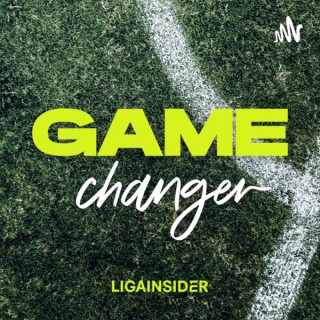Podcasts about niederschl
- 162PODCASTS
- 236EPISODES
- 27mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Jan 27, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about niederschl
Latest podcast episodes about niederschl
260127PC Harter Winter Mensch Mahler am 27.01.2026Wir hatten Glück. Als wir am vergangenen Sonntag mit dem Auto von Berlin nach Bad Urach fuhren, ging alles noch glatt. Bis kurz vor dem Ziel. Mehr als 2 Stunden Stau. Und dann kam auch noch der Wintereinbruch und die Nacht. Wir haben uns durchgekämpft, auch als der Wagen auf eisglatter Fahrbahn einmal ausbrach – trotz Allrad und guter Winterreifen – konnte meine Frau ihn gekonnt abfangen.Anderswo ist es nicht so glimpflich abgegangen. In ganz Deutschland jede Menge Unfälle. Aber das ist ja jedes Jahr so. Bei Extrem-Wetter das Auto stehen lassen – wer tut das schon?Die USA erleben einen dramatischen Wintersturm. Das gab es früher auch – aber selten in dieser Häufigkeit und in dieser Härte. Studien deuten darauf hin, dass sich Winterstürme durch den Klimawandel in ihrer Intensität und Häufigkeit verändern können. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern, was zu stärkeren Niederschlägen während Stürmen führt, während veränderte Jetstream-Muster die Zugbahnen von Stürmen verschieben und extremere Wetterlagen begünstigen. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Viel zu lange haben wir die Erderwärmung nicht ernst genommen. Aber als ob das nicht reichen würde, benützt Putin auch im 4. Kriegswinter die Kälte als Waffe gegen die Zivilbevölkerung und greift erbarmungslos die Infrastruktur der Ukraine an. Es ist niederträchtig, dass einem dazu eigentlich nichts mehr einfällt. In der Haager Landkriegsordnung heißt es unter anderem: Zivilpersonen, andere Nichtkombattanten und zivile Einrichtungen sind so weit wie möglich zu verschonen. Aber die hat Russland weder unterzeichnet noch jemals ernstgenommen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Man nennt es Winter. Und siehe, es schneite. Die Überraschung bei der Bahn war natürlich groß. Winterliche Betrachtungen über Niederschläge, die Gefahren des Schneeschippens und sonstige Katastrophen von WDR 2 Satiriker Dieter Nuhr. Von Dieter Nuhr.
Streit ums Heizungsgesetz, EU verschiebt entwaldungsfreie Lieferketten, Regen in Teheran
Diesmal mit Susanne Schwarz und Jonas Waack. Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag das Gebäudeenergiegesetz abschaffen, das der Grüne Robert Habeck als Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht hatte, um die fossilen Heizungen nach und nach auszutauschen. Der Koalitionsausschuss hat einen neuen Namen für das Werk gebracht: Gebäudemodernisierungsgesetz. Was drin stehen soll, ist aber immer noch unklar. Das liegt auch daran, dass SPD und Union jeweils unterschiedliche Dinge wichtig finden. Die Europäische Union verschiebt zum zweiten Mal das Greifen ihrer Waldverordnung - und geht ihr auch inhaltlich an den Kragen. Dabei sollte sie eigentlich für entwaldungsfreie Lieferketten sorgen: Unternehmen, die Produkte in der EU verkaufen wollen, sollten nachweisen, dass dafür nicht gerodet wurde. Doch dieses Projekt ist jetzt deutlich verwässert. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat es am Mittwoch geregnet. Der ganze Iran und Teheran insbesondere erleben diesen Herbst eine beispiellose Dürre. Die iranische Regierung hatte schon angekündigt, die Hauptstadt evakuieren zu müssen, falls Niederschläge die Stauseen um die Stadt herum nicht noch auffüllen. Die Wasserkrise hat mit dem Klimawandel zu tun. -- Das klima update° wird jede Woche von Spender:innen unterstützt. Wenn auch du dazu beitragen willst, geht das HIER https://www.verein-klimawissen.de/spenden. Wir danken hier und jetzt - aber auch noch mal namentlich im Podcast (natürlich nur, wenn ihr zustimmt).
Marc Mielke - 9 von 10 Selbständige scheitern!
Erfolg ist kein Zufall – Der Erfolgspodcast für finanzielle Freiheit
Marc Mielke kommt aus dem Vertrieb, hat selbst den Weg von der klassischen Kaltakquise bis hin zur erfolgreichen Online-Akademie geschafft und hilft heute Selbstständigen und Dienstleistern dabei, planbar Kunden zu gewinnen. Seine Vertriebsreise ist geprägt durch Durchhaltevermögen, Niederschlägen, Millionenumsätzen und vielen Learnings. Mit Sales-Education.com hat er ein Unternehmen aufgebaut, das in über 30 Branchen dabei unterstützt, Vertrieb klar zu strukturieren, das richtige Mindset aufzubauen, Umsatz zu steigern und dabei authentisch zu bleiben. Seine Programme gelten für viele als echter „Gamechanger“ – nicht wegen großer Versprechen, sondern weil die Ergebnisse sichtbar und spürbar sind.Marc verbindet Vertrieb mit Mindset, Ehrlichkeit und echter Praxiserfahrung – ohne Druck, ohne Show. ✘ HIER kannst du den Erfolg ist kein Zufall – Abreißkalender 2026 - Tägliche Impulse für mehr Erfolg! bestellen.✘ Mein neues Buch "Erfolg ist kein Zufall" ist HIER bestellbar. #pflichtlektüre✘ Bewirb dich für Deutschlands stärkstes Wachstumsnetzwerk www.die-wichtigste-Stunde.de #nobrainer✘ Bestelle dir jetzt mein SPIEGEL-Bestseller-Buch "Du kannst nicht nicht verkaufen: Beruflicher und privater Erfolg dank der 22 Gesetze eines Topverkäufers" KLICKEHIER✘ Du möchtest endlich ein Immobilien-Portfolio aufbauen? Dann frage unbedingt bei meinem Unternehmen "Erfolg mit Immobilien" an und vereinbare HIER ein Kennenlern-Termin.#mustdo✘ Folgt mir auch auf Instagram:https://www.instagram.com/mb_maurice_bork/
•Adán Augusto López: Respekt ja, Umarmung nein •Sieben Hektar weniger: PRI-Vorsitzender wird enteignet •Salinas Pliego in der Defensive •Amparos sollen abgeschwächt werden •Claudia Sheinbaum weiter sehr beliebt •Mexiko-Stadt: 3500 Häuser durch Niederschläge beschädigt •USA wollen USMCA bilateral verhandeln •Remesas gehen weiter zurück •ChatGPT lernt Tzotzil. Nachgefragt: Rodolfo Peña Sommer zu gespendeten Musikinstrumenten für das Jugend-Symphonieorchester in Chiapas.
50 - Die Depression trifft viele Menschen mit einem statistisch späteren Eintrittsalter in den 30ern – eine Lebensphase, in der viele Menschen bereits in einer festen Partnerschaft sind. Kaum jemand hat dieses Risiko für sich oder bei der Partnerwahl auf dem Schirm; und dennoch kann es jeden treffen. Was nun? Eine Depression kann viele Auslöser haben; ob Verlusterfahrungen wie eine schwere Trennung, der Tod einer nahestehenden Person oder wiederholte Niederschläge bei der Arbeit. Und dennoch tritt sie in vielen Fällen auch scheinbar „aus dem Nichts“ auf, ohne Vorahnung oder jegliche vorangehende Ereignisse. Auch wenn diese psychische Störung eine der meist erforschten Erkrankungen mit soliden Behandlungsmethoden darstellt und eine Beziehung an sich einen wichtigen Schutzfaktor: Im Fall einer Erkrankung reagieren die meisten Partner*innen instinktiv falsch. Denn durch das wohlwollende, unterstützende Verhalten, welches in liebevollen Beziehungen oft aufkommt, wird eine Depression paradoxerweise psychologische verstärkt, und nicht viel später leidet die ursprünglich gesunde Partei nicht selten selber unter klinisch relevanten Symptomen; aus einem Betroffenen werden zwei. Aber warum ist das so, wie funktioniert das? Und die vielleicht wichtigste Frage: Was kann man dagegen tun? Wir besprechen die psychologischen Prozesse hinter der Entstehung einer Depression, die ungewollten Verstärkungsprozesse durch die Partner*innen, und wie man diese Erkrankung gemeinsam überwindet und diese tiefe Schauerwolke über der Beziehung an sich vorbeiziehen lässt, ohne zusammen darin zu versinken.Diese Episode behandelt Depression, Suizid (erwähnt, nicht explizit).
Die Herbstpilze sind da! Die (vielleicht) schönste Jahreszeit hat begonnen, diesmal könnten die Bedingungen fast nicht besser sein, es gab ausreichend Niederschläge, es ist noch relativ warm, bestes Pilzwetter also. Und da verwundert es nicht, wenn gefühlt die Artenvielfalt von Tag zu Tag zunimmt. Diese Folge haben wir am 11.9.2025 aufgenommen, da spürte man so richtig, dass die Pilze in den Startlöchern stehen. So durften wir uns über tolle Funde freuen, begleitet uns also auf unseren kleinen Gang in den Wald! Viel Spaß beim Hören!
#190 // Episode 190: Bundesligasaison 25/26 - 4. Spieltag. Viel Spaß beim Zuhören! Konstruktives Feedback ist über die Kommentarfunktion bei www.ligainsider.de herzlich willkommen!Du möchtest uns supporten und noch mehr Infos: iOS // Android
Erntebilanz 2025 durchwachsen
Neckar-Alb Podcast von RTF1 & RTF3 | Reutlingen Tübingen Zollernalb
Für die Landwirte in der Region Neckar-Alb war es ein schwieriges Anbaujahr voller Herausforderungen. Zuerst der heiße, trockene Juni, dann langanhaltende Niederschläge zur Erntezeit im Juli. Dazu kommt die angespannte Marktlage. Die sorgt dafür, dass die Preise auf einem sehr niedrigen Niveau liegen, während gleichzeitig die Betriebsmittelkosten gestiegen sind. So fällt die Erntebilanz 2025 eher durchwachsen aus. | Videos in der RTF1 Mediathek: www.rtf1.tv | RTF1 - Wissen was hier los ist! |
Katastrophe als Wendepunkt: Die Lehren aus dem Schweizer Hochwasser von 2005
Im August 2005 führten tagelange Niederschläge in der Schweiz zu verheerenden Überschwemmungen. Es war eine der schwersten Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte. Sechs Menschen kamen ums Leben, rund 1000 mussten evakuiert werden. Der Schaden belief sich auf über 3 Milliarden Franken. Doch dieses katastrophale Ereignis hat auch dazu geführt, dass die Schweiz den Hochwasserschutz ausbaute.
Tomek Piotrowski - Die Kraft des Dranbleibens
Erfolg ist kein Zufall – Der Erfolgspodcast für finanzielle Freiheit
Tomek Piotrowski ist heute ein Immobilien-Unternehmer. In seinem Leben hat er vieles durch und hat trotz einiger harter Niederschläge niemals aufgegeben. Sein Leben ist ein Beweis für die Kraft des Dranbleibens und für mich ein großer Erfolg, weil er stetige Entwicklung aufzeigt. Das neue Buch von Tomek Piotrowski findet ihr HIER. Falls du auch die Mieten in deinen Objekten optimieren willst, findest du HIER weiterführende Infos. Wenn du an seiner Buchaktion teilnehmen möchtest, sende ihm deinen Bestellnachweis über seine Webseite. Diese findest du HIER.✘ Mein neues Buch "Erfolg ist kein Zufall" ist HIER ab sofort bestellbar. Das MUSST du dir JETZT sichern! Buchaktion: Bestellnachweis an podcast@die-wichtigste-stunde.de✘ Bewirb dich für Deutschlands stärkstes Wachstumsnetzwerk www.die-wichtigste-Stunde.de✘ Du möchtest endlich ein Immobilien-Portfolio aufbauen? Dann frage unbedingt bei meinem Unternehmen "Erfolg mit Immobilien" an und vereinbare HIER ein Kennenlern-Termin.✘ Bestelle dir jetzt mein SPIEGEL-Bestseller-Buch "Du kannst nicht nicht verkaufen: Beruflicher und privater Erfolg dank der 22 Gesetze eines Topverkäufers" KLICKEHIER✘ Folgt mir auch auf Instagram:https://www.instagram.com/mb_maurice_bork/
Claudius Haug – Bio, PIWI und Bodensee-Charme
Der Bayerische Bodensee ist ein Gebiet der Superlative: Hier liegen die südlichsten, höchstgelegenen und regenreichsten Weinberge Deutschlands. Claudius Haug bewirtschaftet in dieser einzigartigen Landschaft einen Familienbetrieb, der Wein- und Obstanbau vereint, seit vielen Jahren ökologisch arbeitet und einen hohen Anteil pilzwiderstandsfähiger Rebsorten pflegt. Wir sprechen über die besonderen klimatischen Bedingungen zwischen See und Alpen, die Chancen und Herausforderungen des Bio-Anbaus in einer Region mit hohen Niederschlägen, die Dynamik einer engagierten Winzergemeinschaft – und verkosten zwei Weine, die den Charakter des Bodensees ins Glas bringen.
Spitze Stein Kandersteg: trotz Regen keine grösseren Abbrüche
Nach den vielen Niederschlägen hatte sich die Lage am Spitze Stein in Kandersteg seit Sonntagabend erst verschärft, es kam zu Abbrüchen sowie Murgängen im Oeschibach. Seit Montag hat es jedoch keine grösseren Abbrüche mehr gegeben. Weiter in der Sendung: · Nach dem Nein zur Tramverlängerung nach Köniz: Am Montag beginnen die Arbeiten, damit auf der Buslinie 10 künftig Doppelgelenkbusse mehr Passagiere transportieren können. · Autobahn A1 braucht neue Fahrbahn: Zwischen der Raststätte Grauholz und Kirchberg werden in zwölf Nächten die Spuren reduziert.
Ein Erdrutsch nach Starkregen könnte die Zugentgleisung bei Riedlingen verursacht haben. Viele Bahnlinien in Deutschland führten durch rutschanfällige Gebiete, sagt Geologe Michael Krautblatter. Durch die starken Niederschläge träten Rutschungen vermehrt auf. Von WDR 5.
Regenwasser zu sammeln und zu speichern ist eine einfache und wirkungsvolle Massnahme um wertvolles Trinkwasser zu sparen und bei starken Niederschlägen wird das Kanalisationsnetz geschont. Stechmücken legen ihre Eier gerne in ein offenes Regenfass – deshalb Deckel verwenden oder Insektenschutznetz darüber spannen. An einem schattigen Standort an der Nordseite des Hauses oder in einem geschlossenen, lichtundurchlässigen Regenwasserfass bilden sich keine Algen.
#143 ⚔️ Bulle gegen Bär, BayWa-News & TACO ist das neue TINA
In Folge 143 diskutieren wir, dass Niederschläge wieder Linderung für Nordeuropa bringen, dass die BayWa ein neuerlichen Milliardenverlust einfährt und im Deep Dive kämpfen wir Bulle gegen Bär: Wo jetzt die Märkte hingehen...(00:00) Intro: Fabian ist jetzt Boomer(01:42) Marktupdate: Agrar(06:14) Marktupdate: Makro(10:57) Bulle gegen Bär
Flops #83: Fitzcarraldo lässt grüßen – mit Christian Rommel auf Borneo (2/2)
Ist das Hollywood oder die Realität? – Diese Frage stellt sich der Vielreisende Christian Rommel gelegentlich, wenn er sich an seine wildesten Reise-Abenteuer erinnert. Zum Beispiel: an jenes, von dem er diesem zweiten Teil unserer Doppelfolge erzählt. In ihr nimmt Christian uns mit in einige unwegsame Gebiete irgendwo auf Borneo – und mitten hinein in eine Serie von Hindernissen, Niederschlägen und Rückschlägen, die ihm alles abverlangten. Mehr über Christian Rommel: www.christianrommel.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Hochwasser nimmt zu - Was Hausbesitzer und Städte tun müssen - PREFA
Der Klimawandel führt zu häufigeren und intensiveren Starkregenereignissen. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, was zu erhöhten Niederschlägen führt. So verursachte beispielsweise das Tief “Katinka” im Mai 2024 in Baden-Württemberg erhebliche Überschwemmungen.
Droht uns 2025 ein Dürresommer? Dr. Andreas Marx, Leiter des deutschen Dürremonitors, spricht über die möglichen Auswirkungen von Niederschlägen auf die trockenen Böden und die Landwirtschaft.
Teile der Schweiz sind von starken Niederschlägen betroffen - vor allem das Wallis sowie das Berner Oberland. Wegen starker Schneefälle hat die Walliser Kantonsregierung für den ganzen Kanton die besondere Lage ausgerufen. Zudem sind mehrere Gemeinden von Stromausfällen betroffen. Weitere Themen: In den Reihen der israelischen Armee und der Geheimdienste formiert sich Widerstand gegen den Krieg im Gazastreifen. Tausende Veteranen, aber auch aktive Reserve-Soldaten haben Petitionen unterschrieben, in denen ein Ende des Kriegs gefordert wird. Das ist eine neue Entwicklung. Italiens Kult-Espressokanne Bialetti ist in die Jahre gekommen und hat mit viel Konkurrenz zu kämpfen. Nun geht der verschuldete Hersteller an einen chinesischen Investor, der den Relaunch wagen will. Ob das gut kommt?
Die Stadt Mainz bekommt einen Straßenbahnring, Mainz-05 rutscht erstmals seit Februar aus den Champions-League-Plätzen und fehlende Niederschläge sorgen für Dürrephase. Das und mehr heute im Podcast. Alle Hintergründe zu den Nachrichten des Tages finden Sie hier: https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/stadt-mainz/mainz-bekommt-eine-strassenbahn-durch-die-innenstadt-4548779 https://www.allgemeine-zeitung.de/sport/fussball/fussball-bundesliga/bundesligist-mainz-05-stolpert-bei-der-tsg-hoffenheim-4535512 https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/worms/stadt-worms/totes-maedchen-im-rhein-eiskalter-mord-so-das-urteil-4544422 https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/alzey/kompromiss-in-der-maibaum-debatte-in-dautenheim-4544722 https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/wissenschaft/fruehjahrstrockenheit-ist-das-wirklich-duerre-4547311 Ein Angebot der VRM.
Emotionales Benefizturnier beim FC Klarenthal für verstorbene Fünffach-Mutter
Überwältigende Anteilnahme beim Benefizturnier des SC Klarenthal, Schierstein plant Storchen-Ampel und fehlende Niederschläge führen zu Dürre in weiten Teilen Deutschlands. Das und mehr heute im Podcast. Alle Hintergründe zu den Nachrichten des Tages finden Sie hier: https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/emotionales-benefizturnier-fuer-verstorbene-fuenffach-mutter-4541906 https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/schiersteiner-stoerche-live-und-bald-auch-auf-ampeln-4539757 https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/biebricher-aergern-sich-ueber-raser-in-der-anliegerstrasse-4536987 https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/stadt-wiesbaden/hilft-eine-dna-datenbank-gegen-die-wiesbadener-hundehaufen-4510120 https://www.wiesbadener-kurier.de/panorama/wissenschaft/fruehjahrstrockenheit-ist-das-wirklich-duerre-4547311 Ein Angebot der VRM.
Skandal um Löhnberger Bürgermeister, THW baut Brücke zur Naunheimer Insel und fehlende Niederschläge sorgen für außergewöhnliche Dürre. Das und mehr heute im Podcast. Alle Hintergründe zu den Nachrichten des Tages finden Sie hier: https://www.mittelhessen.de/lokales/kreis-limburg-weilburg/loehnberg/so-laufen-die-ermittlungen-gegen-loehnberger-ex-buergermeister-4541692 https://www.mittelhessen.de/lokales/kreis-limburg-weilburg/weilmuenster/kein-apfelweinfest-in-laubuseschbach-4544156 https://www.mittelhessen.de/lokales/lahn-dill-kreis/wetzlar/aufbau-der-pontonbruecke-bei-naunheim-thw-im-grosseinsatz-4515039 https://www.mittelhessen.de/lokales/lahn-dill-kreis/solms/solmser-bruecke-ueber-die-lahn-ab-anfang-mai-nicht-befahrbar-4540268 https://www.mittelhessen.de/panorama/wissenschaft/fruehjahrstrockenheit-ist-das-wirklich-duerre-4547311 Ein Angebot der VRM.
Hoher Gewinn für den Berner Energiekonzern BKW
Der Berner Energiekonzern BKW hat das vergangene Jahr mit einem hohen Gewinn abgeschlossen. Tiefere Abschreibungen, reichlich Niederschläge zur Stromproduktion aus Wasserkraft oder gut laufende Finanzmärkte trugen zum Gewinnanstieg bei. Mit Blick auf 2025 bleibt das Management vorsichtig. Weiter in der Sendung: · Keine Drohnenshow mehr am Vorabend des Nationalfeiertags über dem Bielersee. · Die Kiebitze sind zurück im Berner Seeland.
Nach Konzessionsentscheid: Anrecht auf Schadenersatz?
Roger Schawinski hat bereits Hunderttausende von Franken in sein Radioprojekt investiert. Weil das Bakom mit der ursprünglichen Vergabe gemäss Urteil einen Fehler gemacht hat, stellt sich nun die Frage nach Schadenersatz. Weitere Themen: · Nach den Niederschlägen der letzten Tage rechnen Geologen mit einem schnelleren Rutsch in Brienz. · Marcus Caduff will doch nicht Bundesrat werden. Der Mitte-Regierungsrat sagt, der Zeitpunkt stimme nicht. · In Davos sterben zwei Skitourengänger in einer Lawine.
Der Berg beruhigt sich, die Situation bleibt kritisch
Der Rutsch oberhalb von Brienz ist auch in den letzten Tagen langsamer geworden. Dennoch sei es wichtig, nun zu evakuieren, so die Behörden. Auch wegen angekündigter Niederschläge. Weitere Themen: · Sandra Maissen kehrt nach einem Schlaganfall zurück in den Churer Stadtrat. Im Interview spricht sie über die Rückkehr und ihre vier Jahre im Stadtrat. · Das Frauenteam des HC Davos verpflichtet die Bündnerin Evelina Raselli für den Trainerstab.
Hochwasser in Mittel- und Osteuropa, Kritik an Aserbaidschans Klimapolitik, Patientin Erde
Mit Verena Kern und Sandra Kirchner. 01:53 Hochwasser in Mittel- und Osteuropa Nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden so heftige Niederschläge dokumentiert wie bei dem Starkregen, der Mitte September für großflächige Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa sorgte – von Österreich und Deutschland über Tschechien, Polen und die Slowakei bis Ungarn und Rumänien. Eine Analyse der Forschungsgruppe World Weather Attribution zeigt, dass die Klimakrise die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten solch einer extremen Wetterlage verdoppelt hat. 06:48 Aserbaidschans Klimapolitik Eigentlich sollen Länder, die eine Klimakonferenz ausrichten, den Klimaschutz international voranbringen. In diesem Jahr findet der UN-Klimagipfel Mitte November in Aserbaidschan statt, dessen Wirtschaft zum großen Teil auf fossilem Erdgas fußt. In den nächsten Jahren will das Land seine Gasförderung noch steigern. Weil Aserbaidschan auch sein Klimaziel verwässert hat, beurteilen Wissenschaftler:innen der Initiative Climate Action Tracker die Klimapolitik des Landes als "kritisch unzureichend". 11:52 Erde im Gesundheitscheck Wichtige lebenserhaltende Systeme und Prozesse der Erde befinden sich in einem schlechten Zustand. Das ergab der "planetare Gesundheitscheck" der Forschungsinitiative Planetary Boundaries Science. Das Funktionieren des gesamten Ökosystems Erde ist durch menschliche Einflüsse stark gefährdet, die Erde droht irreversibel Schaden zu nehmen. Auch beim Klima sind kritische Werte schon überschritten. -- Das klima update° wird jede Woche von Spender:innen unterstützt. Wenn auch du dazu beitragen willst, geht das HIER https://www.verein-klimawissen.de/spenden. Wir danken hier und jetzt - aber auch noch mal namentlich im Podcast (natürlich nur, wenn ihr zustimmt).
Energiearbeit im Geschäftsleben. Oliver Wachter #858
Energiearbeit für Unternehmer: Vom Heiler und Therapeuten zum Business Coach Oliver Wachter hilft Unternehmern und ihren Unternehmen. Zuerst wird der Unternehmer als Mensch analysiert und mit Klassischer Homöopathie, Coaching, Counseling und Energiearbeit in seine beste Form gebracht. Zum Heilen gibt es bei jedem etwas, meist fehlt nur der Zugang zu den eigenen "Baustellen". Wenn der Mensch nach diesen Behandlungen besseren Zugang zu sich selber hat, kann er auf gutgestellte Fragen selbst seine besten Antworten geben, ohne irgendwelchen Fremdbestimmungen des Elternhauses oder der Gesellschaft zu folgen. Energiearbeit: Der Zugang zu deinem Dharma und deiner Bestimmung Was ist mein Dharma, meine Bestimmung, was ist meine Fähigkeit, was kann ich der Gesellschaft Gutes tun? Freude und Erfolg kommen, wenn man aufhört, nur an sich zu denken, sondern versteht, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Was spirituell anmutet, ist auch ein Gesetz der Wirtschaft. Das Interessante an Olivers Arbeit ist, dass er nicht nur den Menschen als Energiekörper sieht und behandelt, sondern auch die Summe aller Mitarbeiter und das Unternehmen als komplexes Energiefeld. Die Verbindung von Therapie und Energiearbeit: 30 Jahre Erfahrung Oliver Wachter ist seit fast 30 Jahren Therapeut und Berater. Als Kind war er bereits der spirituellen Welt zugeneigt. Er sah und spürte Dinge, die eigentlich nicht der materiellen Welt zuzuordnen sind. Später als Physiotherapeut und Manualtherapeut hörte er oft die Frage, wo die Energie herkomme, die aus seinen Händen zu fließen scheint. Oliver folgte dieser Frage und studierte viele Jahre Osteopathie. Nicht zufrieden damit, arbeitete er mit Schamanen der Tolteken und Quechua und lernte von Geistheilern. Dank dieser jahrelangen Ausbildung konnte er diese Energie kultivieren. Energiearbeit als Schlüssel zur Heilung: Wunderbare Erfolge Techniken der Energiearbeit, Aura- und Chakraarbeit sowie systemische Aufstellungen halfen ihm intellektuell zu verstehen, was er bereits fühlte. Trotz einiger wunderartiger Erfolge dank Geistheilung blieb er immer auf dem Boden, wohlwissend, dass nicht der Heiler heilt, sondern eine höhere Macht, manche nennen sie Gott. Der Heiler dient nur als Kanal. So konnte er mit Energiearbeit einer Patientin nach Hirnblutung helfen, die wegen einseitiger Lähmung im Rollstuhl saß. Während der Behandlung spürte sie die Energie in den betroffenen Körperteilen und konnte später den Arm wieder heben und auch laufen. Ein anderer Patient hatte Phantomschmerzen im, nach Amputation, nicht mehr existierenden Bein. Durch Behandlung des immer noch vorhandenen Energiekörpers verschwanden diese Schmerzen. Energiearbeit in der Praxis: Heilung von Arthrose und mehr Genauso konnte Oliver Wachter Arthrose behandeln, indem das Chakra, der Energiewirbel, des Gelenks geheilt wurde. Materie ist verdichtete Energie und folgt dieser. Oliver Wachter war als selbständiger Physiotherapeut durchaus erfolgreich und vor allem finanziell zufrieden. Dann kündigte ihm der Praxisinhaber die Teilhaberschaft. Auch als freier Mitarbeiter hörte er von Praxisinhabern Aussagen wie: "Ich habe Angst, dass ich Patienten an Dich verliere..." Als extrem freiheitsliebender Mensch war er nur kurz angestellt, dann als freier Mitarbeiter tätig und nach diesem nächsten Schritt, Kompagnon, folgte er seinem Herzen und eröffnete endlich seine eigene Praxis als Heilpraktiker. Die Reise zur eigenen Praxis: Energiearbeit als Berufung Obwohl er teilweise in drei verschiedenen Praxen als freier Mitarbeiter gearbeitet hatte oder dann als Kompagnon, studierte er nebenbei Naturheilkunde und Klassische Homöopathie. Noch als Physiotherapeut kristallisierte sich heraus, dass die Patienten wohl wegen körperlichen Symptomen kamen, aber eigentlich seinen geistigen Rat suchten. Damals war ihm der Begriff Coaching noch nicht bekannt. Ein schamanischer Lehrer nannte ihn "Las palabras que curan" – die Worte, die heilen. Aura und Chakraarbeit: Der Weg zur Energiearbeit Während der jahrelangen Aura- und Chakraausbildung konnte man anhand der Aurafotografie sehen, dass Olivers Aura magenta wurde und ein deutlicher Trichter über dem Kopf zu sehen war. Das bedeutet, seine Stärken sind Eingebungen aus dem morphogenen Feld. Also nicht aus dem Verstand etwas sagen oder wiedergeben, sondern Wissen kommt aus dem Äther, vom Göttlichen. Warum Oliver Wachter trotz Erfolg seiner wahren Berufung folgte Immer noch weigerte sich Oliver Wachter, seiner eigentlichen Berufung zu folgen. Etwas Handfestes, Seriöses sollte es schon sein. Er lernte von T.Harv Eker, Blair Singer, Anthony Robbins, Damian Richter und anderen Coaches, um zu wissen, dass er anders arbeiten möchte. Man kann seiner Bestimmung ausweichen, dann kommt sie mit noch mehr Kraft. In den Jahren 2006 und 2007 traf Oliver einen gottrealisierten Meister – Paramahamsa Vishwananda. Als Freigeist weit davon entfernt, einem Guru zu folgen, verlor er den Kontakt, um 7 Jahre später "zufällig" durch Heirat in die Nähe seines Ashrams zu ziehen. Energiearbeit und spirituelle Führung: Die Bedeutung von Paramahamsa Vishwananda Nochmals 8 Jahre dauerte es, bis er durch weitere Fügungen des Schicksals zu ihm geführt wurde, und ihm seitdem als Schüler folgt. Paramahamsa Vishwananda gilt als einer von 5 weltweit existierenden Sathgurus, also gottrealisierte Meister mit göttlichen Aspekten. Bei einer Pilgerreise nach Indien meinte der Meister, Oliver solle sich auf Geschäftsberatung und Coaching konzentrieren. Somit besuchte er eine Schule für Business Coaching (IHK) und ist seit diesem Jahr, von der IHK anerkannter, Business Coach. Dein größter Fehler als Unternehmer? Es gibt keine Fehler. Alles läuft nach Gottes Plan. Das Ziel ist, mit Demut sein Ego aufzulösen und so in Verbindung mit dem Göttlichen zu treten. Manche brauchen mehr Niederschläge und Niederlagen, um das Ego aufzulösen und die Kontrolle loszulassen und sich von Gott, Universum, der göttlichen Energie führen zu lassen. Viele Menschen arbeiten aus egoistischen Motiven, um dieses oder jenes Bedürfnis zu erfüllen, merken aber nicht, dass echte Zufriedenheit ausbleibt. Oft ist Existenzangst eine treibende Kraft. Wenn man den Zugang zu seiner Göttlichkeit in sich, in allem und außerhalb davon spüren lernt, dann geht man mit vollem Vertrauen ins Unbekannte und wird vom Göttlichen unterstützt. Somit wäre Angst und mangelndes Vertrauen ein "Fehler". Aber jeder hat andere Herausforderungen in seinem eigenen, ganz speziellen Leben. Spiritueller Erfolg durch Energiearbeit: Der Weg zum Wohl aller Es gibt eine schöne hinduistische Geschichte, wo ein Heiliger Gott bittet, ihn mit vielen Problemen zu belasten, damit er immer an ihn denken möge. Für mich ist Erfolg, zum Wohle aller zu handeln, um so Gott zu dienen. Deine Lieblings-Internet-Ressource?: Youtube statt TV, gezielt Satsangs von Bhakti Marga, der Organisation von Paramahamsa Vishwananda. Informationen, die gut tun. Nicht Angst aufbauen. Website bhaktimarga.org Chat GPT Deine beste Buchempfehlung: Buchtitel 1: Just Love: A journey into the heart of god; Paramahamsa Vishwananda Buchtitel 2: Autobiographie eines Yogi; Paramahamsa Yogananda Kontaktdaten des Interviewpartners: www.oliverwachter.de oliverwachter@web.de 0049-171-475 7214 Und denk immer daran: Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Tschüss, mach's gut. Dein Tom. Hol Dir jetzt Dein Hörbuch "Selfmade Millionäre packen aus" und klicke auf das Bild! Buchempfehlung bei Amazon: Denken Sie wie Ihre Kunden +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mehr Freiheit, mehr Geld und mehr Spaß mit DEINEM eigenen Podcast. Erfahre jetzt, warum es auch für Dich Sinn macht, Deinen eigenen Podcast zu starten. Jetzt hier zum kostenlosen Podcast-Workshop anmelden: https://Podcastkurs.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ So fing alles an. Hier geht´s zur allerersten Episode von TomsTalkTime.com – DER Erfolgspodcast. Und ja, der Qualitätsunterschied sollte zu hören sein. Aber hey, das war 2012…
Wassermassen am Rheinfall locken mehr Touristen an
Das häufig nasse Wetter hat auch sein Gutes: Dank der vielen Niederschläge kommt der Rheinfall so imposant daher wie schon lange nicht mehr. Viele Touristinnen und Touristen wollen sich diesen Anblick nicht entgehen lassen. Souvenirshops, Restaurants und die Schifffahrt profitieren. Weitere Themen: * Der FCZ gewinnt sein Auftaktspiel in der Conference League gegen Shelbourne souverän mit 3:0. * Sommerserie «Die Schweiz lässt liefern»: Auch Drogen gelangen heute per Mausklick via Internet frei Haus zu den Konsumentinnen und Konsumenten.
Trotz starken Niederschlägen kaum Schäden in Graubünden
Der Kanton Graubünden ist trotz starker Niederschläge am Samstag und in der Nacht auf Sonntag glimpflich davongekommen. Es sei zu keinen nennenswerten Schäden gekommen, sagte die Kantonspolizei am Sonntag. Im Misox sei es zu einem kleinen Murgang ohne grössere Auswirkungen gekommen. Weitere Themen: * VCS stellt sich im Deponienstreit hinter den Kanton St. Gallen * Rehetobel AR steht hinter dem Weiterbetrieb des Bundesasylzentrums * Seenachtsfest Arbon zieht positive Bilanz * «Stützli-Bus» in Kreuzlingen erfreut sich grosser Beliebtheit * Stadt St. Gallen will klimafreundlichen Konsum fördern * Fabian Bächi, der Blechblasinstrumentenbauer aus dem Thurgau
Pegelstände an Rhein und Thur gehen leicht zurück
Der Regenunterbruch hat die Pegelstände an Rhein und Thur etwas sinken lassen. Die Hochwasser-Warnungen des Bundes konnten auf "mässig" herabgesetzt werden. Für den Bodensee gilt weiterhin "erheblich". Neue starke Niederschläge sind angekündigt. Weitere Themen: * Öl-Unfall in St. Margrethen * Keine E-Scooter Vermietung in Herisau * Rhätische Bahn weniger pünktlich im 2023 * Halbmast am Reitturnier CSIO reisst finanzielles Loch in Kasse * Kochen und Essen wie die Pfahlbauer
In der Schweiz ist es wieder eisig kalt, aber im Mittelmeer und im Nordatlantik ist es so warm wie noch nie. Das zeigt der neue Bericht des EU-Klimabeobachtungsdienstes Copernicus und der Welt-Wetterorganisation. Wir zeigen auf, welche Folgen das haben kann – auch für das Wetter in der Schweiz. Die steigenden Meerestemperaturen in Europa wirken sich nämlich nicht nur auf die Ökosysteme in den Ozeanen aus, sondern auch auf das Leben an Land. Das sagt der Klimaforscher Thomas Frölicher von der Universität Bern. Er forscht unter anderem zu marinen Hitzewellen. Die warmen Ozeane dürften in der Schweiz künftig für mehr Wetterextreme sorgen, wie etwa heftige Niederschläge oder Überschwemmungen. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge? Schickt uns gerne eine Mail an newsplus@srf.ch oder eine Sprachnachricht an 076 320 10 37.
heute: Nach den Bauernprotesten: Was bleibt? ++ Regen, Regen, Regen - die vergangenen Wochen zeigten oft nur eines: Niederschläge am laufenden Band. Besonders zu spüren bekamen dies die Landwirte. Äcker waren überflutet, auf denen bereits die Wintersaat ausgebracht war. Nach den vehementen Bauernprotesten - was haben sie gebracht? Agrardiesel kommt - dies war ein Teil der Forderungen. Was bleibt? Ein Gespräch mit einer der herausragenden Persönlichkeiten der Bauernbewegung, Anthony Lee, selbst Landwirt an der Weser. Er selbst muss jetzt auf seine Felder, zur politischen Auseinandersetzung bleibt kaum Zeit. Wie sieht es denn im Augenblick aus? Seine Flächen standen lange unter Wasser. Wichtigste Frage: Hat der Winterweizen die Nässe überlebt? ++ Webseite: https://www.tichyseinblick.de
Bauernproteste zeigen weiter Wirkung: Was das für den Green Deal der EU-Kommission bedeutet
Alles erreicht? Die EU macht Zugeständnisse an die Bauern / Fleisch bald teurer? Debatte um die Pläne für eine Tierwohlabgabe / Schluss mit dem Labelchaos? Neues Herkunftskennzeichen für Produkte aus Deutschland / Bald alles Gentechnik? EU-Parlament stimmt für neue genomische Züchtungsverfahren / Kommentar: Neue Regeln für Gentechnik sind überfällig / Schon über 1,5 Grad: EU-Parlament reagiert auf Klimaziele der Kommission / Weniger Schnee, weniger Niederschläge: Folgen für die Wasserkraft in Bayern / Autoren: Lorenz Storch, Eva Ellermann, Marie Müller, Johannes Hofmann, Sabrina Fritz, Kathrin Schmid, Doris Fenske / Moderation: Angelika Nörr
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Bernhard Fiedler aus dem Burgenland berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen und deutschsprachigen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Herbert Zillinger aus dem Weinviertel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen und deutschsprachigen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Martin Gojer aus Bozen berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Florian Wecker aus Kinheim an der Mittelmosel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Jonas Dostert aus Nittel an der Obermosel berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Hanspeter Ziereisen aus Efringen-Kirchen im Markgräflerland berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Matthias Wörner aus Durbach in der Ortenau berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - der Winzer Jochen Beurer aus dem Remstal berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - die Winzerin Laura Seufert aus Iphofen berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - Robert Haller vom Bürgerspital in Würzburg berichtet
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Der Weinjahrgang 2023 - Gerd Bernhart berichtet über die Bedingungen in der Südpfalz
In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf 2023 ausgesetzt waren. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltau-Befall günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, z.T. heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachte Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der 2. Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die schnell sehr groß werden, neigen dazu sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in machen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Dort, wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung.
Mal regnet es zu viel und mal zu wenig, das war schon immer so. Neu ist aber die Erkenntnis, dass Niederschläge vor allem in den Industrienationen enorme Einflüsse auf Wirtschaftswachstum und Wohlstand haben.// Von Heike Sicconi/ WDR 2023/ www.radiofeature.wdr.de Von Heike Sicconi.
Nach der Wahl in der Türkei: Auf welche Seite schlägt sich Erdogan?
Erdoğan steuert auf bald ein Vierteljahrhundert an der Macht zu. Wie demoralisiert ist die Opposition in der Türkei? Und mit einem wie selbstbewussten Führer wird der Westen zu tun haben?Am Ende war es doch eindeutig: Recep Tayyip Erdoğan bleibt Präsident der Türkei und könnte damit ein Vierteljahrhundert an der Macht komplettieren. Die Frage ist: Wofür wird er seine Macht nutzen? Wird er nach dem Ende des Wahlkampfs wieder offen sein für neue Verhandlungen? Schlägt er sich eindeutiger auf die Seite des Westens und der Nato - oder geht er weiter auf Putin zu und verfestigt die Achse Türkei-Russland? Da das Wunder des Machtwechsels ausblieb, wird das Hoffen auf mehr Demokratie in der Türkei fürs Erste genau das bleiben: eine sehr leise Hoffnung. Eine Kehrtwende ist hier nicht zu erwarten. Denn in den letzten Jahren hat sich der Umgang mit Kritikern und freiem Journalismus immer weiter verschärft – und auch im Wahlkampf wurde gezielt auf Desinformation gesetzt. Wie geht die Opposition mit der Niederlage um? Die Hoffnungen auf Kemal Kılıçdaroğlu wurden enttäuscht, und auch der Hoffnungsträger enttäuschte einige seiner Anhänger mit einem verzweifelten Versuch, vor der Stichwahl seinen Gegner noch rechts außen zu überholen. Nun muss die Opposition sich neu sammeln und erstmal wieder neue Einigkeit finden. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl - und die nächsten Kommunalwahlen in Istanbul werden heiß umkämpft werden. »Die Frage ist, wie viele Rückschläge, Niederschläge eine Opposition einstecken kann. Da irgendwann nicht komplett demoralisiert zu sein, nicht fatalistisch zu sein, ist schwer. Und viele denken tatsächlich auch darüber nach, das Land zu verlassen, sagt Max Popp nach Gesprächen mit Menschen, die bei dieser »Schicksalswahl« an eine Wende glaubten. Jetzt werden islamistische Splitterparteien auf dem AKP-Ticket mit regieren und die Konsequenzen davon sind nicht abzusehen. »Da wird sich die demokratische Zivilgesellschaft zu Recht bedroht fühlen. Da gibt es Stimmen aus diesen Parteien, die sagen zum Beispiel alleinstehende Frauen, derer müsse man sich annehmen - das lässt nichts Gutes erahnen. Auch Frauenorganisationen sind alarmiert und schauen sich das ganz genau an, was aus der Ecke kommt«, beobachtet Özlem Topcu. Beide Popp und Topcu waren über Wochen im Land, um über den Wahlmarathon zu berichten. Warum ausgerechnet Menschen mit türkischem Pass in Deutschland in dem unrühmlichen Ruf stehen, Erdoğan zu dem entscheidenden Vorteil verholfen zu haben und woher diese Nähe zu Erdoğan historisch kommt, auch darüber sprechen wir in dieser Episode des SPIEGEL-Auslandspodcasts Acht Milliarden. Mehr zum Thema Nach Erdoğans Wahlsieg: Was jetzt auf die Türkei zukommt – und auf den Westen Erdoğans Sieg in der Türkei: Jetzt wird es düster. Oder? CDU-Politikerin über die Türkeiwahl: Warum hat Erdoğan in Deutschland so viel Erfolg, Frau Güler? Stichwahl in der Türkei: Erdoğan verteilt Geldscheine vor dem Wahllokal Schicksalswahl in der Türkei: Was, wenn Erdoğan eine Niederlage nicht akzeptiert? Sie haben Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge zu dieser Sendung? – Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an die Adresse acht.milliarden@spiegel.de.Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie bei SPIEGEL+. Jetzt für nur € 1,– im ersten Monat testen unter spiegel.de/abonnieren Informationen zu unserer Datenschutzerklärung
Onlineshops aufgebaut: €15 Mio in 5 Jahren. Uwe Prasse #781
Von Null auf Millionen: Mit Onlineshops zum erfolgreichen Online-Marketing-Experten Ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer. Im Jahr 2000 habe ich mich in der Finanzbranche selbständig gemacht. Als ich 2009 ein Seminar besuchte, an dem dem Dr. Oliver Pott als Gastredner eingeladen war, habe ich Feuer für die Onlinewelt gefangen und wollte unbedingt versuchen, dort mein Geld zu verdienen. Aber ich wusste nicht wo ich anfangen sollte, denn ich hatte keinerlei Erfahrung oder Ahnung von dieser Branche. Auch hatte ich vom erstellen von Webseiten etc. keine Ahnung. So hatte ich einige Kurse gekauft aber nie wirklich den Einstieg gefunden. Erst 2016, 7 Jahre später hab ich dann die ersten, richtigen Versuche gestartet. Onlineshops: Amazon FBA als Einstieg in die digitale Welt Ich war sehr unzufrieden in meinem Job. Meine Arbeit machte mir kein Spaß mehr. Irgendwann war es fast unerträglich und ich wusste, jetzt muss ich etwas starten. Ich wollte damals digitale Informationsprodukte verkaufen, merkte aber schnell, dass ich keine Infoprodukte über etwas erstellen konnte, von dem ich keine Ahnung hatte :-) Also bin ich irgendwann auf das Thema Amazon FBA gestoßen. Produkte über Amazon zu vertreiben schien mir ein guter Einstieg zu sein, um mein erstes Geld online zu verdienen. Der Plan war, mich in dieses Thema reinzuarbeiten und dann einen Kurs zu erstellen, wie man mit Amazon Geld verdienen und sich ein eigenes Onlinebusiness aufbauen kann. Ich bin gestartet und war bereits nach 6 Monaten sehr erfolgreich. Daraufhin habe ich einen Kurs erstellt und diesen dann vermarktet. Nun habe ich meine ersten Erfahrungen mit Facebookwerbung, Funnel und Marketingprozessen im Internet gesammelt. Das Amazon Business lief parallel weiter. Onlineshops: Unabhängigkeit von Amazon FBA schaffen Ich wollte von meinem Onlinebusiness leben und machte erste Pläne, mein altes Leben in der Finanzbranche komplett hinter mir zu lassen. Da ich jedoch eine Familie zu ernähren hatt und daher nicht von Amazon abhängig sein wollte, habe ich den Entschluss gefasst, einen eigenen Onlineshop zu erstellen. Nun musste ich mich aber auch selbst um die Kunden kümmern. Deshalb habe ich angefangen, mich intensiv mit Facebook Werbung und allgemein mit Pushmarketing zu beschäftigen. Ich habe mich in kurzer Zeit zu einem Experten in diesem Gebiet entwickelt. Von 2017 bis 2022 habe ich mehrere Onlineshops aufgebaut und über 5 Millionen Euro, alleine für Facebook Werbung ausgegeben. Das war ein Reise, die einer Achterbahnfahrt glich und in der ich viele Erfolge feiern durfte aber natürlich auch viele Niederschläge einstecken musste. Die Vorzüge, die ein Onlinebusiness mit sich bringt und die Faszination dafür, sind heute noch stärker denn je. Für mich gibt es nichts schöneres. Aus diesem Grund habe ich mich, Anfang 2022 dazu entschieden, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Onlinebusiness aufzubauen. Hierbei geht es jedoch nicht nur um Onlineshops. Denn das ist nur ein Weg von vielen. 3 Bausteine für ein Onlinebusiness Um als one man oder one women show ein Onlinebusiness aufzubauen, benötigt man 3 Bausteine. Man muss wissen, wie man Traffic generiert. Wie man also potentielle Kunden auf seine Seite leitet. Man muss diese Menschen durch einen Verkaufsprozess (Funnel) leiten. Jetzt erst kommt das Produkt oder die Dienstleistung. Wer diese 3 Punkte beherrscht und vereint, kann jede Art von Onlinebusiness aufbauen. Und genau das möchte ich den Menschen bei KICKDOWN MARKETING beibringen. Ich möchte Ihnen also nicht nur beibringen, wie sie Geld mit einem Onlineshop verdienen können. Denn das wäre so, als würde ich jemandem ein Rezept verraten. So etwas funktioniert immer nur kurzfristig. Mein Ziel ist es nicht, Rezepte zu verraten, sondern meinen Kunden das Kochen beizubringen. Wenn sie das können, können Sie kochen, was immer ihnen schmeckt und alle Vorzüge eines profitablen Onlinebusiness´ genießen. Dein größter Fehler als Unternehmer?: Mein größter Fehler war, dass ich viel zu lange gewartet habe um anzufangen. Ich habe viel zu viele Hindernisse gesehen. Vor allem technischer Art. Heute wäre dieser Fehler noch viel fataler, da es inzwischen wirklich für alles Tools und Lösungen gibt. Und trotzdem stehen sich viel aus demselben Grund im Weg, wie ich damals. Deine Lieblings-Internet-Ressource?: Shopify, Funnelcockpit, dropispy, Memberspot. Deine beste Buchempfehlung: Buchtitel 1: Kontaktdaten des Interviewpartners: www.kickdown-marketing.de Goodie für unsere Hörer: Mit Code "TomsTalkTime" kannst Du Dir einen von Uwe Kurse aussuchen und erhältst darauf 50% Rabatt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mehr Freiheit, mehr Geld und mehr Spaß mit DEINEM eigenen Podcast. Erfahre jetzt, warum es auch für Dich Sinn macht, Deinen eigenen Podcast zu starten. Jetzt hier zum kostenlosen Podcast-Workshop anmelden: http://Podcastkurs.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ So fing alles an. Hier geht´s zur allerersten Episode von TomsTalkTime.com - DER Erfolgspodcast. Und ja, der Qualitätsunterschied sollte zu hören sein. Aber hey, dass war 2012... :) 001 – Willst Du mehr Erfolg im Leben? Erfolg kann man lernen. Jeder. Im Erfolgspodcast TomsTalkTime von Tom Kaules lernst Du in inspirierenden Interviews und einzelnen Storys die Strategien von erfolgreichen Unternehmern und Prominenten. Du lernst in Experten-Interviews wie erfolgreiche Menschen erfolgreich geworden sind und warum sie erfolgreich bleiben. Wie sie den richtigem Umgang mit Erfolg und auch den Umgang mit Niederlagen gelernt haben. Das richtige Mindset ist wichtig, um richtig viel Geld zu verdienen, glückliche Beziehungen führen, mit sich selbst im Einklang zu sein und dadurch Beruf und Familie bestens miteinander vereinbaren zu können. Einschalten. Zuhören. Sich motivieren und Inspirieren. Lernen. Tun. Erfolg haben.
Es klingt wie ein Agentenfilm, doch gerade vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine erscheint der mutmaßliche Spionagefall beim Bundesnachrichtendienst (BND) besonders dramatisch. Ein BND-Mitarbeiter soll über einen Hintermann geheime Dokumente an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Der Leiter des ZEIT-Investigativressorts, Holger Stark, hat zu dem Fall recherchiert. Er berichtet im Gespräch mit Azadê Peşmen, was über den mutmaßlichen BND-Maulwurf bekannt ist und welche Schäden für den BND drohen könnten. Erst im Sommer litt Frankreich wie ganz Europa unter einer extremen Dürre und Wassermangel. Daran hat sich in den vergangenen Monaten wenig geändert. Seit über einem Monat hat es in Frankreich keine nennenswerten Niederschläge mehr gegeben. Durch die ausbleibenden Niederschläge fehlt den Flüssen das Wasser und der Grundwasserspiegel sinkt immer mehr ab. ZEIT-ONLINE-Autorin Annika Joeres berichtet, was die Wasserknappheit im Alltag bedeutet, was die französische Regierung dagegen unternimmt und was für den Sommer drohen könnte. Und sonst so? Ein Peruaner hat eine Mumie als "spirituelle Freundin". Moderation und Produktion: Azadê Peşmen Mitarbeit: Johann Stephanowitz und Anne Schwedt Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de. Weitere Links zur Folge: Bundesnachrichtendienst: Spion sollte wohl Positionsdaten von Raketenwerfer an Russland geben (https://www.zeit.de/politik/2023-02/russischer-spion-bnd-himars-raketenwerfer) Russischer Spion: Hintermann in der BND-Spionageaffäre festgenommen (https://www.zeit.de/politik/2023-01/russischer-spion-bnd-mittaeter-carsten-l) Bundesnachrichtendienst: Mutmaßlicher russischer Spion im BND enttarnt (https://www.zeit.de/politik/2022-12/mutmasslicher-russischer-spion-im-bnd-enttarnt) Klimawandel: Frankreich erlebt ungewöhnlich lange Dürreperiode im Winter (https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2023-02/duerre-frankreich-rekord-32-tage-ohne-regen-klima) Käse aus Frankriech: Adieu, Käse (https://www.zeit.de/2022/38/frankreich-kaese-salers-hitzewelle-klimakrise) Dürre in Frankreich: Eine Region wacht auf (https://www.zeit.de/politik/2022-07/duerre-frankreich-hitze-wassermangel-klimawandel) Peruvian delivery man carried ancient mummy around in his bag (https://www.bbc.com/news/world-latin-america-64797080) Melden Sie sich für das ZEIT ONLINE Podcast-Festival am 30. April in Berlin an. (https://www.zeit.de/gesellschaft/2023-02/podcast-festival-2023)
Überschwemmungen in Pakistan, Dürre in Ostafrika, schmelzende Gletscher in Bolivien oder sterbende Wälder in Deutschland – die Folgen der Klimakrise sind längst sichtbar und verändern das Leben von Millionen Menschen weltweit. Während die Welt auf der Weltklimakonferenz in Ägypten nach Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise sucht, wollen wir den Menschen Raum geben, die täglich mit den Folgen der Erderwärmung leben müssen. Im Podcast erklärt die ZEIT-ONLINE-Redakteurin Elena Erdmann, wie ihre Geschichten mit der Klimakrise zusammenhängen. Hinter der Podcast-Folge steht das ZEIT-ONLINE-Blog "Stimmen der Klimakrise". Erst erlebte Fahad Saeed wochenlange Hitze, dann kam die Flut. Die Klimakrise trifft Pakistan besonders hart und mache Extremwetter wahrscheinlicher, sagt der Klimaforscher. Manche Regionen könnten in Zukunft unbewohnbar werden. Evelyn Acham sieht die Folgen des Klimawandels jeden Tag in Uganda. In diesem Jahr war die Dürre so schlimm, dass ihr Vater kaum etwas ernten konnte. "Wir haben kaum etwas zum Klimawandel beigetragen und leiden am meisten", sagt Evelyn. Seit 2019 engagiert sie sich deshalb bei Fridays for Future und dem Rise Up Movement. Auch in den bolivianischen Anden werden die Temperaturen extremer und die Niederschläge weniger. Von der Landwirtschaft zu leben, wird immer schwieriger. Gemeinsam mit anderen Landwirten entwickelt Germán Vargas dort deshalb ökologische Anbaumethoden und versucht sich an den Klimawandel anzupassen. Doch auch in Deutschland zeigen sich längst die Folgen der Klimakrise: Tausende Bäume musste Förster Michael Rudolph in den letzten Jahren fällen. Er berichtet von kargen Flächen, wo einst dichter Wald stand. Moderation und Produktion: Constanze Kainz Redaktion: Jannis Carmesin Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt@zeit.de. In diesem Schwerpunkt lesen Sie mehr über die UN-Klimakonferenz in Scharm al-Scheich: https://www.zeit.de/thema/klimakonferenz Hier finden Sie den Blog "Stimmen der Klimakrise", hier den freundlichen Krisenpodcast "Auch das noch?" und unter diesem Link die Sonderfolge zur Hungerkrise.