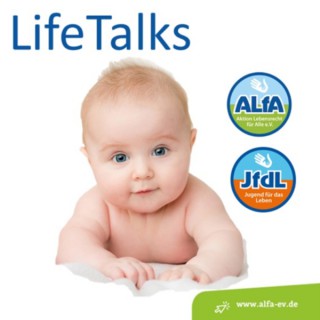Podcasts about skandalisierung
- 33PODCASTS
- 34EPISODES
- 38mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Nov 27, 2025LATEST
POPULARITY
Latest podcast episodes about skandalisierung
Kanzler Merz wirbt für seine Rentenpläne: Reformturbo, Aktivrente, längere Lebensarbeitszeit. Doch ist das wirklich Reform – oder politisches Verschiebespiel? Darüber sprechen wir mit Hauptstadtkorrespondent Frank Wahlig. Auch die Wirtschaft ringt mit ihrer Haltung zur AfD: Der Verband der Familienunternehmer hat die Brandmauer aufgegeben, als Reaktion darauf treten Rossmann und Thalia aus. Was bedeutet die Situation für Unternehmen, und wie groß ist die Not? Einschätzungen dazu von Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Gudula Walterskirchen blickt auf die EU-Beitritts-Frage der Ukraine, und Roger Letsch beschäftigt sich in seinem Kommentar mit der Skandalisierung von ganz normalen Vorgängen.
Best-of »Firewall«: Andreas Scheuer – Die geheime Spenderliste des Ex-Ministers
Diese Folge des SPIEGEL-Podcasts »Firewall« ist ursprünglich am 24. Juli 2025 erschienen. Im Rahmen des aktuellen Highlight-Programms während der Sommerpause von »Acht Milliarden« veröffentlichen wir sie hier noch einmal. Andreas Scheuer steht für einen der größten Polit-Skandale der letzten Jahre: das Debakel um die PKW-Maut. Trotzdem stand er bei Wahlkampf-Spendern hoch im Kurs. Mindestens 132.000 Euro flossen 2021 in die Kampagne des damaligen Bundesverkehrsministers. Das geht aus einer geheimen Liste hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. Viele der Geldgeber waren, ausgerechnet, im Verkehrssektor tätig. Die Unterlagen zeigen, wie deutsche Unternehmer und ihre Vertreter einen Bundesminister umgarnten. Hat sich Scheuer von den Zahlungen beeinflussen lassen? Er selbst sagt zu einzelnen Spenden nichts. Sein Anwalt wirft dem SPIEGEL eine „Skandalisierung von Sachverhalten“ vor, die »mit der Rechtsordnung und dem Parteiengesetz im völligen Einklang stehen und von der Rechtsordnung sogar gewünscht sind«. Der SPIEGEL-Podcast »Firewall« erzählt, wie Wahlkampf-Spender sich offensiv mit ihren Anliegen in Scheuers Ministerium meldeten. Und er rekonstruiert, wie Scheuer mit der PKW-Maut scheiterte, zum unbeliebtesten Minister des Landes wurde. Heute baut er sich eine zweite Karriere in der Wirtschaft auf. Und wieder unterstützen unterstützen ihn einige seiner damaligen Gönner. Auszüge aus der Spenderliste und noch mehr Details lest ihr hier (S+) und unsere große Recherche zum Maut-Debakel findet ihr hier.+++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Den SPIEGEL-WhatsApp-Kanal finden Sie hier. Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie mit SPIEGEL+. Entdecken Sie die digitale Welt des SPIEGEL, unter spiegel.de/abonnieren finden Sie das passende Angebot. Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.
Robin Alexanders Letzte Chance, Realität vs Resonanz, Salon-Teaser
Sat, 05 Jul 2025 04:00:00 +0000 https://feed.neuezwanziger.de/link/21941/17075154/a9d6ef39-1f90-4234-8676-2ed2d782ad20 173d9691e6cc2ce1c5a3e9284072aa7d Wolfgang und Stefan treffen sich vorm Salon Live-Termine 2025 Fr. 19.09. / Fr. 19.12. Tickets per Mail: neuezwanziger@diekaes.de SOMMERSALON am 23. August! Tickets gibts hier Alles hören Komm' in den Salon. Es gibt ihn via Webplayer & RSS-Feed (zum Hören im Podcatcher deiner Wahl, auch bei Apple Podcasts und Spotify). Wenn du Salon-Stürmer bist, lade weitere Hörer von der Gästeliste ein. Literatur Springer-Journalist Robin Alexander erzählt in „Letzte Chance. Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie“ das Scheitern der Ampel nach und versucht sich an Erklärungen für den ganz auf Migration ausgerichteten Wahlkampf. Das Sittenbild der Politik ist unfreiwillig auch eines des Journalismus. penguin.de Der große Regisseur Dominik Graf legt mit „Sein oder Spielen. Über Filmschauspielerei“ ein anekdotenreiches Erinnerungsbuch über seine Arbeit mit Schauspielern vor, das zugleich ein Kompendium über Schauspielerei und ein persönlich gehaltenes Lexikon großer Momente der Filmgeschichte ist. chbeck.de Sam Altman verkauft uns seine KI als „Gentle Singularity“. Wenn die Versprechen so gut aufgehen wie alle vorherigen des Silicon Valley, wird es schlimm. blog.samaltman.com Wie ist es, wenn man plötzlich durch Krypto-Investments einen Klassensprung vollzieht? In seinem Buch „Tausendmal so viel Geld wie jetzt“ trifft sich der Schriftsteller Juan S. Guse mit ungewöhnlichen Krypto-Millionären: Sie protzen nicht in Dubai oder auf Yachten, sie sind Sleeper. fischerverlage.de In der NYT diskutieren die Demoskopen Nate Silver und Kristen Soltis Anderson über Trumps Umfragewerte. Wir ziehen auch Lehren für die Bundesregierung daraus. nytimes.com Die Schriftstellerin Barbi Marković nennt ihre Poetikvorlesungen „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ und erklärt ihr Schreiben so geistreich wie amüsant. rowohlt.de MIT-Forschung zu KI als Assistenz im Schreibprozess zeigt das Phänomen kognitiver Verschuldung. Was sich einfach anfühlt, wird doch recht schnell belastend. media.mit.edu Tausende indische Studenten liefern auf Fahrrädern Essen aus: Ein Abkommen zwischen Deutschland und Indien hat vielen ein Studium in Berlin und in anderen Städten ermöglicht. Nina Scholz erzählt in der „taz“ unglaubliche, aber wahre Geschichten der Ausbeutung. taz.de Apple hat sich kritisch mit LLMs befasst. Es gebe „fundamentale Grenzen“ für die neuen KIs, die offensichtlich die Produktentwicklung erschweren. machinelearning.apple.com Wozu noch Journalismus, wenn doch alles offensichtlich ist? Tyler Pager mit einem sehr wichtigen Pointen-Kommentar zu Donald Trump. nytimes.com Das preisgekrönte Simply Quartet interpretiert furios Streichquartette von Mendelssohn und Dvořák. genuin.de Shownotes 00:00:00 Vor dem Salon Wolfgang und Stefan beginnen den Podcast mit einer Diskussion über die sommerliche Hitzewelle und die unterschiedlichen Strategien, damit umzugehen – von der heimischen Klimaanlage bis hin zur KI-gestützten Planung des perfekten Schattenplatzes im Freibad. Diese Alltagsbeobachtung leitet über zur zentralen Frage, wo Technologie wirklich hilft und wo sie unnötig verkompliziert. Das Hauptthema der Folge wird vorgestellt: eine kritische Auseinandersetzung mit dem Buch „Letzte Chance“ des Journalisten Robin Alexander. Die Gastgeber kritisieren bereits im Vorfeld den von Alexander repräsentierten Politikjournalismus, der auf Emotionalisierung und personalisierte Storys setzt, anstatt strukturelle Probleme zu analysieren. Anhand eines Vergleichs von Alexanders Auftritten bei „hart aber fair“ und „Table Media“ wird dessen argumentativer Opportunismus aufgezeigt. Ein Exkurs zum Magier Penn Jillette dient als philosophische Grundlage, um über Wahrheit, Erinnerung und die Notwendigkeit von Vertrauen zu reflektieren. Diese Kritik wird auf die mediale Berichterstattung zu Ereignissen wie den Attentaten in Magdeburg und Aschaffenburg ausgeweitet, bei denen die emotionale Reaktion von Politikern wie Friedrich Merz im Mittelpunkt steht, während die Rolle der Medien, insbesondere des Springer-Verlags, unreflektiert bleibt. 00:57:15 Robin Alexander: Letzte Chance Im Hauptteil der Folge sezieren Wolfgang und Stefan das Buch „Letzte Chance“. Sie kritisieren die narrative Strategie, Politik als eine Abfolge von persönlichen Krisen und emotionalen Reaktionen darzustellen. Als zentrales Beispiel dient die Szene, in der Friedrich Merz durch das Video von Selenskyjs Demütigung im Oval Office angeblich zur Reform der Schuldenbremse bewegt wird – eine Darstellung, die die Gastgeber als vorgeschobene Rechtfertigung für einen längst geplanten Politikwechsel entlarven. Das Buch, so die Kritik, biete keine tiefgehende Analyse, sondern eine oberflächliche Chronik der Ampel-Koalition, um Friedrich Merz als alternativlose Führungsfigur zu inszenieren. Dabei werden wichtige politische und soziale Themen wie die Kindergrundsicherung oder die tatsächliche Substanz des CDU-Wirtschaftsprogramms komplett ausgeblendet. Auch die Darstellung der Greichen-Affäre und des Heizungsgesetzes wird als beispielhaft für einen Journalismus kritisiert, der die Rolle der eigenen Medien bei der Skandalisierung ignoriert. Ein besonderer Fokus liegt auf der undurchsichtigen Rolle der FDP beim Bruch der Koalition und der bemerkenswerten Zusammenarbeit der Union mit der Linkspartei, um Merz' Kanzlerwahl zu sichern. Die Analyse gipfelt in der Feststellung, dass das Buch ein Paradebeispiel für einen Journalismus ist, der in seiner eigenen Blase gefangen ist und durch seine Fixierung auf Insider-Geschichten die eigentlichen Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Probleme verschleiert. 02:58:40 Dominik Graf: Sein und Spielen Wolfgang stellt das Buch „Sein oder Spielen“ des Regisseurs Dominik Graf vor. Es ist keine systematische Abhandlung, sondern ein sehr persönliches Kompendium und eine Sammlung von Anekdoten und Beobachtungen zur Kunst der Filmschauspielerei. Graf teilt seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Schauspielern wie Götz George und analysiert die Techniken von Ikonen wie James Dean oder Alain Delon. Dabei werden gegensätzliche Ansätze wie Method Acting und reines Handwerk gegenübergestellt. Ein zentraler Gedanke ist die Bedeutung von Verletzlichkeit und emotionaler Instabilität als kreative Ressource, die durch moderne Tendenzen zur Selbstoptimierung und „Resilienz“ verloren zu gehen droht. Das Buch wird als eine Fundgrube für Film- und Schauspiel-Enthusiasten beschrieben, die Lust darauf macht, die besprochenen Filme und Szenen neu zu entdecken. 03:11:46 Sam Altman: The Gentle Singularity Stefan analysiert einen Text von OpenAI-CEO Sam Altman, in dem dieser seine Vision einer „sanften Singularität“ skizziert. Stefan äußert von Beginn an fundamentale Skepsis gegenüber Altmans optimistischem Zukunftsbild. Altman prophezeit, dass künstliche Superintelligenz bald zur Routine gehören und enorme Fortschritte in Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen wird, angetrieben von einem Überfluss an Intelligenz und Energie. Stefan kritisiert diese Vorhersage als naiv und gefährlich, da sie die realen Probleme der Machtkonzentration, der wirtschaftlichen Ungleichheit und der gesellschaftlichen Verwerfungen, die durch KI entstehen könnten, völlig ausblendet. Der Text dient als Dokumentation einer bedenklichen Ideologie aus dem Silicon Valley. 03:31:39 Juan S. Guse: Tausendmal so viel Geld wie jetzt Wolfgang bespricht das Buch von Juan S. Guse, eine literarische Reportage über die verborgene Welt der Kryptomillionäre. Guse porträtiert nicht die lauten Neureichen, sondern die sogenannten „Sleeper“ – Menschen, die im Stillen durch Krypto-Investitionen reich geworden sind und oft mit der daraus resultierenden Perspektivlosigkeit und Verunsicherung kämpfen. Das Buch ergründet die Motivationen junger Menschen, die in alternativen Vermögensbildungen eine letzte Chance sehen, den ökonomischen Abstieg zu verhindern. Besonders eindrücklich schildert Guse die Atmosphäre einer Kryptokonferenz in Barcelona, die er als quasi-religiöses Ereignis für eine Gemeinschaft von Eingeweihten beschreibt, die an einen bevorstehenden technologischen und gesellschaftlichen Umbruch glauben. 03:48:51 Nate Silver und andere zu Trumps Umfragewerten Stefan fasst eine Diskussion aus der New York Times mit den Analysten Nate Silver und Kristen Soltis Anderson über die politische Lage von Donald Trump zusammen. Obwohl Trumps Zustimmungswerte relativ stabil sind, zeigen sich deutliche Schwächen bei zentralen Wirtschaftsthemen wie der Inflation. Das Thema Einwanderung hingegen ist eine Stärke, da er hier von vielen als entscheidungs- und handlungsstark wahrgenommen wird. Die Experten diskutieren mögliche Strategien für die Demokraten, die sich von ihrem Image des „Insider-Spiels“ lösen und mit jüngeren, radikaleren Kandidaten und Themen punkten müssten, um eine Chance zu haben. 03:56:59 Barbi Marković: Stehlen, Schimpfen, Spielen Wolfgang stellt begeistert die Poetikvorlesungen der Schriftstellerin Barbi Marković vor. Das Buch ist humorvoll als Countdown zur Abgabe der Vorlesung gestaltet und reflektiert auf brillante Weise den Schreibprozess selbst. Marković demonstriert ihren spielerischen Umgang mit Sprache und Literatur, etwa durch einen Remix eines Thomas-Bernhard-Textes oder die Verwendung von Disney-Figuren als universelle Identifikationsfiguren für ihre Alltagsbeobachtungen in Wien. Im Kern des Buches steht die komplexe Beziehung zwischen Realität, Fiktion und der subjektiven Wahrheit des Textes, was es zu einer intelligenten und unterhaltsamen Lektüre über das Wesen des Schreibens macht. 04:10:55 MIT: Your Brain on ChatGPT Stefan diskutiert eine Studie des MIT Media Lab, die die neuronalen Auswirkungen der Nutzung von ChatGPT beim Verfassen von Texten untersucht. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Probanden, die KI-Hilfe nutzten, zeigten eine geringere Gehirnaktivität und eine stärkere Entfremdung vom eigenen Text. Originalität und Vielfalt der Texte nahmen ab, während die Konformität stieg. Die Studie legt nahe, dass die Bequemlichkeit von KI-Werkzeugen einen kognitiven Preis hat und die tiefere Auseinandersetzung mit einem Thema behindern kann. Interessanterweise wird in der Studie die Google-Suche, einst selbst als oberflächlich kritisiert, nun als positiver Vergleichsmaßstab zur LLM-Nutzung herangezogen. 04:22:19 Nina Scholz: Das Geschäft mit den Studis Wolfgang fasst eine umfangreiche Recherche der Journalistin Nina Scholz für die taz zusammen. Der Artikel beleuchtet das Geschäft mit indischen Studierenden in Deutschland. Diese werden von privaten Hochschulen wie der IU mit hohen Studiengebühren und dem Versprechen auf eine exzellente Ausbildung nach Deutschland gelockt. Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Die Studierenden landen in teuren, überfüllten möblierten Wohnungen und müssen hauptsächlich an Online-Kursen teilnehmen. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, arbeiten viele unter prekären Bedingungen als Lieferfahrer. Der Text kritisiert die mangelnde Verantwortung von Bildungsinstitutionen und Politik. 04:31:14 Apple: The Illusion of Thinking Stefan bespricht ein bemerkenswertes Forschungspapier von Apple, das die Grenzen der aktuellen KI-Modelle aufzeigt. Entgegen dem Hype um die „Reasoning“-Fähigkeiten von LLMs demonstriert Apple, dass diese Systeme bei neuartigen und komplexen Problemen oft versagen. Die Modelle neigen zu „Overthinking“ oder geben bei schwierigen Aufgaben vorschnell auf. Mit dieser Veröffentlichung positioniert sich Apple als ein Unternehmen, das auf robuste und verlässliche technologische Lösungen abzielt, anstatt auf die unberechenbaren „Gimmicks“ der Konkurrenz. Es ist eine deutliche Kritik an der aktuellen Praxis, unausgereifte KI-Produkte auf den Markt zu bringen. 04:41:14 NYT: Online and IRL, Trump Offers a Window Into His Psyche Stefan verweist kurz auf einen Artikel der New York Times, der argumentiert, dass man für das Verständnis von Donald Trumps Politik keine tiefschürfenden Deutungsbücher brauche. Alles Wesentliche sei direkt in seinen öffentlichen Äußerungen und Handlungen sichtbar. 04:41:42 Simply Quartet: Streichquartette von Mendelssohn und Dvořák Zum Abschluss empfiehlt Wolfgang eine Aufnahme des Simply Quartet. Im Mittelpunkt steht Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichquartett Nr. 6 in f-Moll, op. 80. Das Werk entstand als direkte Reaktion auf den plötzlichen Tod seiner geliebten Schwester Fanny und ist ein Ausdruck tiefsten Schmerzes. Es ist ein dramatisches, leidenschaftliches und fragmentiertes Stück, das mit den klassischen Konventionen bricht und in seiner harmonischen Kühnheit bereits auf das 20. Jahrhundert vorausweist. Wolfgang lobt die außergewöhnliche Dynamik und Präzision der Interpretation durch das Simply Quartet. full Wolfgang und Stefan treffen sich vorm Salon no Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmitt 3377
Der Schweizer Journalist Roger de Weck plädiert für "Das Prinzip Trotzdem" gegen die in den Sozialen Medien verbreiteten Methoden von Zuspitzung, Übertreibung und Skandalisierung. E Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Roger de Weck: Die Jagd auf Klicks zerstört den Journalismus
Als junger Journalist hat Roger de Weck den ersten Schweizer Bankenskandal aufgedeckt, als SRG-Generaldirektor setzte er sich für einen starken Service Public ein. Geblieben ist die Liebe zum Journalismus. Einem Journalismus, den wir, wie er in seinem neusten Buch schreibt, vor den Medien retten müssen. Was ist damit gemeint und wie soll das funktionieren? Wie verändert die Medienkrise die politische Debatte? Und wieso ist Elon Musk die grössere Bedrohung für einen unabhängigen Journalismus als die Halbierungs-Initiative? ((00:39)) Journalismus: Den Mächtigen auf die Finger schauen ((07:50)) Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen ((19:35)) Wie die Skandalisierung die politische Debatte verändert ((28:16)) Sind Journalist:innen zu links? ((34:25)) False Balance statt Objektivität ((37:33)) Halbierungs-Initiative: Rechte Machtfantasien ((48:05)) Was wir von anderen Ländern lernen können (und andere Länder von uns) ((59:06)) Ein Vorbildmodell aus dem Kanton Fribourg ((1:04:50)) Ein hoffnungsvoller Schluss
Robert Misik im Gespräch mit Roger de Weck DAS PRINZIP TROTZDEMWarum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen Über die Krise des Journalismus als demokratiepolitische Herausforderung Autoritäre Populisten trumpfen auf. Desinformation und Fake News grassieren. Und der Journalismus, der dem wehren sollte? Er kommt aus der Krise nicht heraus. Es gibt zwar mehr Medien, aber immer weniger Mittel für den Journalismus. Verlage wollen ihre Einbußen wettmachen, indem sie noch mehr laute Meinungen und Soft-Themen bringen. Doch die »Boulevardigitalisierung« nützt just den Populisten, die sich derselben Stilmittel bedienen: Zuspitzung, Skandalisierung, Aufregung. Roger de Weck liebt Journalismus als Beruf. Er kennt ihn in allen Facetten – als Zeitungsmacher und Rundfunkchef, Reporter und Moderator. Und er macht sich Sorgen, weil die Gesetze des Medienbetriebs und die des Journalismus immer weiter auseinanderlaufen. Dagegen setzt de Weck auf das »Prinzip Trotzdem«: Recherchieren, abwägen, sich treu bleiben – trotz Sparmaßnahmen, trotz X & Co. Doch wie geht das? Der Autor zeigt, wie sich Journalismus stärken lässt. Denn ohne diesen wertvollen Spielverderber läuft das Spiel nicht in der Demokratie. Roger de Weck, geboren 1953, war Zeit-Chefredakteur, Generaldirektor des Schweizer Radios und Fernsehens, Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Im Suhrkamp Verlag erschien zuletzt Die Kraft der Demokratie, das mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2020 ausgezeichnet wurde. Robert Misik, Autor und Journalist
Friedrich Kleine: Was macht die Seele im Gefängnis?
Es heißt, dass das Gefängnis ein Spiegel der Gesellschaft sei. Nur, wie kann man in einen Spiegel schauen, wenn man sich nicht vor ihn stellt? Deshalb habe ich einen alten Bekannten aus Vikarszeiten in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel besucht. Friedrich Kleine arbeitet dort als evangelischer Gefängnisseelsorger. Anschaulich erzählt er mir von seinem besonderen Arbeitsalltag. Wie er morgens in sein Büro geht und die Anträge von Häftlingen durchgeht, die mit ihm sprechen möchten, und sich dann auf den Weg durch die große, geschlossene Anlage macht. Er hat es mit sogenannten Langstrafigen zu tun, die mehr als vier Jahre einsitzen müssen, manchmal bis zu lebenslang. Was wollen sie von ihm, und was kann er für sie tun? Gefängnisseelsorger haben einen Vorteil: Sie sind zwar Teil der Gefängniswelt, besitzen aber auch eine pastorale Unabhängigkeit. Was Häftlingen oder Bedienstete ihnen sagen, bleibt bei ihnen. In unserem Gespräch räumt Kleine mit so einigen Klischees auf, die ich mitgebracht hatte. Z.B. dass es im Gefängnis besonders gewalttätig zuginge. Das Hauptproblem seien die Langeweile, die ewig gleichen Routinen, das Abstumpfen und die Vereinsamung. Engagiert spricht Kleine sich dafür aus, an den Prinzipien des humanen Strafvollzugs und der Resozialisierung festzuhalten. Einzelne Sicherheitsverstöße (z.B. geflohene Freigänger) – und deren mediale Skandalisierung – führten zu schnell dazu, dass sinnvolle Lockerungen plötzlich eingeschränkt würden. Ein Schwerpunkt unseres Gesprächs war die Frage, was Seelsorge an Tätern sein kann. Sollte die Kirche sich nicht ausschließlich um die Opfer von Gewalt und Kriminalität kümmern? Wie kann man mit Tätern seelsorgerlich arbeiten, wenn diese sich gar nicht als Täter verstehen, weil sie ihre Schuld noch nicht angenommen haben? Im Laufe unseres Gesprächs darüber ging mir auf, dass diese Fragen, die im Gefängnis natürlich eine besondere Schärfe haben, mir auch draußen, in meiner vermeintlich normalen seelsorgerlichen Arbeit begegnen können. Das Gefängnis ist zwar eine Sonderwelt, aber eben auch ein Spiegel unserer Gesellschaft.
#266 "Eine gleiche Brust für alle bedeutet mehr Freiheit für alle"
Ob im Schwimmbad oder auf dem Festival: Warum ist es für uns normal, dass Männer in der Öffentlichkeit ihre Nippel zeigen können, während es für Frauen und Queers weitgehend ein Tabu ist? In ihrem Buch "Oben ohne" schreibt Julia Fritzsche über patriarchale Strukturen bei Kleider- und Körperfragen. Ein Gespräch über die Geschichte der Skandalisierung der weiblichen Brust, die aktuellen Kämpfe um #FreeTheNipple und eine Gesellschaft ohne Oben-ohne-Privileg für Männer.
Die Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ullrich: Warten auf den Kipppunkt
31.03.2024 – Der Philosoph Prof. Dr. Norbert Bolz, der Literaturkritiker und Essayist Dr. Walter van Rossum sowie der Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler Dr. habil. Ulrich Vosgerau diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über die schwarze Magie des RKI und die Brisanz des Verborgenen, über die von den Regierungsmedien immer subtiler betriebene Kunst der Skandalisierung, über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, die in Wahrheitsverwalter und Häretiker zerfällt, sowie über die längst vollzogene Aufhebung der Gewaltenteilung im Kartellparteienstaat.
Ein Mitschnitt der digitalen Jour fixe Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG) vom 14. Februar. In der heutigen Ausgabe des mosaik-Podcast setzen wir uns mit munizipalistischen Bewegungen auseinander. Sowohl in Barcelona als auch in Zagreb regierten in den vergangenen Jahren neue linke Akteurszusammenhänge, sogenannte munizipalistische Initiativen, die Stadt. Entstanden aus vielfachen und teils massiven Protestbewegungen haben sie sich als hybride Form zwischen Bewegung und Partei institutionalisiert. In ihrer Praxis sind munizipalistische Plattformen mit dem konfrontiert, was Marx die „Staatsmaschinerie“ nannte: ein Ensemble von Apparaten, die den Status quo der kapitalistischen Akkumulation schützen. Angesichts dieser Realität ist es für munizipalistische Bewegungen schwierig, das ursprüngliche Tempo bei der „Erstürmung der Rathäuser“ aufrechtzuerhalten, sobald sie das genuin institutionelle Terrain betreten haben. Mit Blick auf Barcelona En Comú (Barcelona Gemeinsam) und Zagreb Je NAŠ! (Zagreb gehört uns!) geht es um die Frage, welche Erfahrungen munizipalistische Akteur:innen machen, wenn sie die Staatsmaschinerie aus nächster Nähe inspizieren. Hierzu werden Spuren identifiziert, die sie in der Materialität des (lokalen) Staates hinterlassen: die Organisation von Partizipation als Konflikt, die Skandalisierung der Bedienung partikularer Interessen und die Auseinandersetzung mit den Geschlechtsverhältnissen innerhalb patriarchal strukturierter Apparate. Die beiden Beispiele verdeutlichen trotz des politischen Wandels die systemische Trägheit der hegemonial programmierten Staatsapparate und die Schwierigkeiten, neoliberale und maskulinistische Politik zu überwinden. Zu diesem Thema hören wir in der heutigen Folge einen Beitrag von Norma Tiedemann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel) und Martin Sarnow (Arbeitsgruppe Stadt- und Bevölkerungsgeographie an der Universität Kiel) mit dem Titel „Die neoliberale Staatsmaschinerie unterbrechen? Strategische Selektivitäten und munizipalistische Praxis in Zagreb und Barcelona“, den die beiden im Kontext der online jour-fix Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung präsentiert haben. Zu Beginn haben sich die beiden Redner:innen noch einmal kurz für ihre Zuhörer:innen vorgestellt.
Ein Mitschnitt der digitalen Jour fixe Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG) vom 14. Februar. In der heutigen Ausgabe des mosaik-Podcast setzen wir uns mit munizipalistischen Bewegungen auseinander. Sowohl in Barcelona als auch in Zagreb regierten in den vergangenen Jahren neue linke Akteurszusammenhänge, sogenannte munizipalistische Initiativen, die Stadt. Entstanden aus vielfachen und teils massiven Protestbewegungen haben sie sich als hybride Form zwischen Bewegung und Partei institutionalisiert. In ihrer Praxis sind munizipalistische Plattformen mit dem konfrontiert, was Marx die „Staatsmaschinerie“ nannte: ein Ensemble von Apparaten, die den Status quo der kapitalistischen Akkumulation schützen. Angesichts dieser Realität ist es für munizipalistische Bewegungen schwierig, das ursprüngliche Tempo bei der „Erstürmung der Rathäuser“ aufrechtzuerhalten, sobald sie das genuin institutionelle Terrain betreten haben. Mit Blick auf Barcelona En Comú (Barcelona Gemeinsam) und Zagreb Je NAŠ! (Zagreb gehört uns!) geht es um die Frage, welche Erfahrungen munizipalistische Akteur:innen machen, wenn sie die Staatsmaschinerie aus nächster Nähe inspizieren. Hierzu werden Spuren identifiziert, die sie in der Materialität des (lokalen) Staates hinterlassen: die Organisation von Partizipation als Konflikt, die Skandalisierung der Bedienung partikularer Interessen und die Auseinandersetzung mit den Geschlechtsverhältnissen innerhalb patriarchal strukturierter Apparate. Die beiden Beispiele verdeutlichen trotz des politischen Wandels die systemische Trägheit der hegemonial programmierten Staatsapparate und die Schwierigkeiten, neoliberale und maskulinistische Politik zu überwinden. Zu diesem Thema hören wir in der heutigen Folge einen Beitrag von Norma Tiedemann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel) und Martin Sarnow (Arbeitsgruppe Stadt- und Bevölkerungsgeographie an der Universität Kiel) mit dem Titel „Die neoliberale Staatsmaschinerie unterbrechen? Strategische Selektivitäten und munizipalistische Praxis in Zagreb und Barcelona“, den die beiden im Kontext der online jour-fix Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung präsentiert haben. Zu Beginn haben sich die beiden Redner:innen noch einmal kurz für ihre Zuhörer:innen vorgestellt.
Anne Frank soll weg! Zumindest als Name der Kita in Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. Dort könnte es nämlich bald zu einer Umbenennung kommen. Das Thema ist dort nicht neu und wird schon lange diskutiert, dennoch bleibt die Frage: Skandal oder nicht? Und muss das gerade jetzt entschieden werden? Darüber und über das Medienecho redet Sarah mit ihrem Gast, dem Kabarettisten HG. Butzko, zuerst. Beide wägen die aktuell hitzige Diskussion und fragen sich, wem die Skandalisierung nützt und welche Auswirkungen eine Umbenennung hätte – Stichwort Erinnerungskultur! Dazu kommt der aktuelle Shitstorm. Aber Shitstorm gegen eine Kita? Sowas bitte generell nicht, finden beide. Weiteres Thema: Die Frage, wie der Prozess gegen den jüdischen Sänger Gil Ofarim eingeordnet werden sollte. Hat er gelogen? Das wissen nur die Beteiligten, was hätte es aber für Auswirkungen, wenn dem so wäre? Welches Signal geht überhaupt von diesem Prozess aus? Gerade in der momentanen Situation. Diese und weitere Fragen beschäftigen beide intensiv. Und dabei - selten in diesem Podcast- lernt der an sich sehr gut vorbereitete Gast HG. Butzko sogar noch was dazu und entwickelt sogar ein zartes "Sendung mit der Maus Feeling". Eine XXL-Version dieser Folge mit extra Content findet ihr in der ARD-Audiothek - der kostenlosen Audio-App der ARD: https://www.ardaudiothek.de/sendung/extra-3-bosettis-woche/10358817 00:01:35 Heute zu Gast: Kabarettist HG. Butzko 00:09:52 "Cringe der Woche": Die Anne Frank Kita in Tangerhütte sorgt für Wirbel, weil sie über eine Namensänderung nachdenkt 00:24:37 "Verlierer der Woche": Der Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim hat begonnen. Doch wer verliert hier was? Gebt uns Feedback oder schickt uns eine Frage an unseren nächsten Gast Dietmar Wischmeyer: bosettiswoche@ndr.de Unser Podcast-Tipp: Loriot 100 – mehr Lametta mit Ariana Baborie: https://www.ardaudiothek.de/sendung/loriot-100-mehr-lametta-mit-ariana-baborie/12866833/ Mehr Satire zum Hören aus der extra 3-Redaktion in der NDRInfo Intensiv-Station: https://www.ardaudiothek.de/sendung/intensiv-station-satire-von-ndr-info/41988596/ Mehr extra 3 auf allen Kanälen: Website: https://www.x3.de ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/extra-3 Facebook: https://www.facebook.com/extra3 Instagram: https://www.instagram.com/extra3 TikTok: https://www.tiktok.com/@extra3
Besonnenheit gilt seit der Antike nicht nur als persönliche Eigenschaft, sondern als politische Tugend. In der Mediendemokratie der Gegenwart wird sie besonders gebraucht. Ein Gegenentwurf zur Skandalisierung und zur Manipulation der Wahrheit. Was macht Besonnenheit aus? Kann man sie lernen? Autorin: Beate Meierfrankenfeld
Grundsatz #27: Wie wir in bewegten Zeiten die Demokratie stärken können - mit Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch und Akademie-Präsidentin Bettina Rausch.
Zu Beginn der ersten Folge von „Grundsatz“ im Jahr 2023 dankt Akademie-Präsidentin Bettina Rausch der scheidenden Akademie-Direktorin Elisabeth Mayerhofer für ihre Arbeit und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem Nachfolger Christian „Jimmy“ Tesch. Rausch schildert ihre ersten Eindrücke vom renovierten Parlament, das viele Angebote zur demokratischen Teilhabe bietet. „Das Gebäude ist eine Begegnungszone für Politik und Gesellschaft“, so Rausch und „man spürt das Erbe der Vorgängerinnen und Vorgänger, die für Demokratie gekämpft haben und vor allem in den ersten Jahren daran geglaubt haben“. Die Akademie-Präsidentin hofft, dass sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Würde des Hauses gerecht werden und mehr auf Gemeinsamkeiten fokussieren und weniger das Trennende in den Vordergrund stellen.Zu Gast in dieser Folge ist neben Bettina Rausch auch der Politikwissenschafter Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard Heinisch (PHD). Er beschreibt gleich zu Beginn einen wichtigen Unterschied: „Bei Umfragen zur Politikzufriedenheit muss man zwischen der Zufriedenheit mit einem konkreten demokratischen System und der Demokratie allgemein als System unterscheiden“. Auch Rausch differenziert: „Das Parlament wurde nie als Ort der Harmonie oder zur vordergründigen Einstimmigkeit konzipiert. Es ist der Ort, an dem man mit friedlichen Mitteln die Möglichkeit hat Meinungen vorzutragen, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, sich im besten Sinne auseinanderzusetzen und dann letztendlich mit einer Mehrheit zu einer Lösung zu kommen“. Allerdings, so konstatiert Rausch, würden Skandalisierung, Moralisierung und persönliche Untergriffe so manche Auseinandersetzung überlagern oder gar ersetzen, das sollte nicht so sein.Ein Problem ortet Wissenschaftler Heinisch in der hohen Erwartungshaltung der Menschen an die Politik, die jedoch ständig mit hoch komplexen Zielkonflikten zu kämpfen hat. Konsolidierte Demokratien wie jene Österreichs würden jedoch solide funktionieren, bleibt Heinisch optimistisch. Im Gespräch betonen beide die Bedeutung des Vereinswesens für die Demokratie-Konsolidierung. „Der Austausch mit anderen Menschen, die anders denken, zum Beispiel beim Sport oder bei einem sozialen Engagement, ist der Kitt für unsere Gesellschaft. Wir müssen zum Wohle der Demokratie lernen, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, ohne das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten, den anderen zu verurteilen oder der Diskussion überhaupt gleich aus dem Weg zu gehen“, appelliert Rausch. Heinisch ergänzt, dass in diesem Prozess politische Parteien eine große Rolle spielen, weil sie die Aufgabe des Aufsammelns und Organisieren der Interessen, deren Austausch und Abtausch und die Lösung von Zielkonflikten innehaben.Rausch beobachtet kritisch die Entwicklung, dass manche Menschen den Eindruck haben, die Meinungsfreiheit komme unter Druck. Das Gefühl, nicht mehr repräsentiert zu werden, Rede- und Sprechverbote zu haben, stärke Populismus und schade der Demokratie, warnt Rausch. Heinisch sieht einen Grund für diese Entwicklung in den neuen Medien: „Die Kommunikation ist der demokratischen Entwicklung vorausgeeilt“, so Heinisch. Er beschreibt auch, dass Politikerinnen und Politiker den Mittelweg zwischen „responsive“, also reagieren und „responsible“, also verantwortungsvoll, finden müssen und das Pendel nicht nur in eine Richtung ausschlagen sollte.Beim Blick in die Zukunft sind sich beide einig, dass ein Schlüssel zur Stärkung der Demokratie die politische Bildung ist. Daneben kann eine kluge Nutzung der neuen Medien, zum Beispiel zur Rekrutierung von neuen Repräsentantinnen und Repräsentanten für demokratische Institutionen, das demokratische System zu unterstützen. Akademie-Präsidentin Bettina Rausch schlägt einen Mittelweg vor: „Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen sowohl die Mittel der Digitalisierung als auch den persönlichen Kontakt“, und dazu würden unter anderem die neu geschaffenen Begegnungsmöglichkeiten im Parlament beitragen.
Wer kontrolliert die Politik? Christoph Konrath mit Stefan Wally im Gespräch
Die Kontrolle politischen Handelns steht zur Debatte: Nach welchen Maßstäben soll sie erfolgen? Wer soll sie durchführen? Welche Konsequenzen soll sie haben? – Das sind Grundfragen des demokratischen Zusammenlebens, die im Schnittpunkt von Politik, Recht und Moral, von Umsicht und Verantwortung ebenso wie von Empörung und Skandalisierung stehen. Die Zukunft demokratischer Politik hängt davon ab, ihre Bedeutung zu erkennen, sie zu unterscheiden, aber auch die Beziehungen und das Zusammenspiel zwischen ihnen wahrzunehmen. Impuls: Christoph Konrath, Universität Salzburg / Jurist und Politikwissenschaftler in der Parlamentsdirektion, Wien Mehr Informationen: https://jungk-bibliothek.org/
Die Bio-Branche boomt. Verbraucher:innen interessieren sich zunehmend für die Herkunft ihrer Lebensmittel - und dafür, ob wo "bio" draufsteht auch wirklich "bio" drin ist. Für das ARD radiofeature war der Journalist Jörn Klare mit Lebensmittelkontrolleuren unterwegs, besuchte Legebetriebe und Gemüsebauern. Im Podcast erzählt er Palina Milling von Bauern am Limit, die Sorge vor Skandalisierung und warum vermeintlich teurere Bio-Produkte volkswirtschaftlich sogar günstiger sind. Von Milling, Palina.
Die Bio-Branche boomt. Verbraucher:innen interessieren sich zunehmend für die Herkunft ihrer Lebensmittel - und dafür, ob wo "bio" draufsteht auch wirklich "bio" drin ist. Für das ARD radiofeature war der Journalist Jörn Klare mit Lebensmittelkontrolleuren unterwegs, besuchte Legebetriebe und Gemüsebauern. Im Podcast erzählt er Palina Milling von Bauern am Limit, die Sorge vor Skandalisierung und warum vermeintlich teurere Bio-Produkte volkswirtschaftlich sogar günstiger sind. Von Milling, Palina.
Die Bio-Branche boomt. Verbraucher:innen interessieren sich zunehmend für die Herkunft ihrer Lebensmittel - und dafür, ob wo "bio" draufsteht auch wirklich "bio" drin ist. Für das ARD radiofeature war der Journalist Jörn Klare mit Lebensmittelkontrolleuren unterwegs, besuchte Legebetriebe und Gemüsebauern. Im Podcast erzählt er Palina Milling von Bauern am Limit, die Sorge vor Skandalisierung und warum vermeintlich teurere Bio-Produkte volkswirtschaftlich sogar günstiger sind. Von Milling, Palina.
Skandalisierung, Mobilsierung und Politisierung: die Strategie der Abtreibungslobby
Der Dreischritt von Skandalisierung, Mobilisierung und Politisierung ist die erfolgreichste Strategie der Abtreibungslobby. Damit hat sie fast alle ihre Ziele erreicht - in Deutschland unter anderem die Entlassung der Pille danach aus der Rezeptpflicht. Wie das ging, erzählen wir in diesem Podcast - anhand des Kölner Klinikskandals um Kardinal Meisner, der in Wahrheit ein Medienskandal war. Von Rainer Klawki und Cornelia Kaminski. Musik: BAP
Im heutigen Podcast gibt es nur ein Thema - die kommende Bundestagswahl 2021. Max leitet uns anhand von Fragen durch den Wahlkampf. Wir sprechen über die Kanzlerkandidatin Baerbock (Bündnis 90/ Die Grünen) und die Kanzlerkandidaten Scholz (SPD) und Laschet (CDU) und über Skandale und Skandalisierung. Wir sprechen über die Parteien und die Performance der Akteure und geben am Ende eine kurze Prognose ab. (Aufnahmedatum 19.09.2021) Links: Lisa: Wahlkampf undercover (ARD Doku) Max: Lobbyland Podcast Gök: Rezo-Videos zum Wahlkampf Sascha: Uncharted Territories (Blog)
Demokratischer Meinungsstreit am Beispiel #allesdichtmachen
Die mediale Skandalisierung der Video-Performance "alles dicht machen" war ein Paradebeispiel für die diskussionsunfähigkeit der Gesellschaft - meint Timo Rieg, Host dieses Podcasts ?Macht:Los! Es widerspricht Dr. Robert Jende, der meint, die Aktion sei einfach schlecht gewesen, mindestens missverständlich. Obwohl sich die beiden vorgenommen hatten, möglichst wenig über #allesdichtmachen konkret zu diskutieren und mehr auf die allgemeinen Strukturen einzugehen, ging es nicht ohne Bezug zu einzelnen Videos. Beispielhaft zitiert der Podcast den Text, den Jan-Josef Liefers in seinem kurzen Beitrag spricht. Ferner wird aus einem Interview der Welt mit Regisseur Dietrich Brüggemann zitiert sowie der Instagram-Post von Dr. med. Carola Holzner. Die Quellen folgen hier in den Shownotes. Dr. Robert Jende https://twitter.com/PerformSoz https://fordemocracy.hypotheses.org/3127 Timo Rieg https://twitter.com/Helgolaender https://www.timo-rieg.de/ Dietrich Brüggemann https://d-trick.de/ Dr. Carola Holzner https://www.doccaro.de/ Nachricht zur Aktion #allesdichtmachen https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_89899510/-allesdichtmachen-ueber-50-deutsche-stars-fordern-lockdown-fuer-immer-.html Interview mit Dietrich Brüggemann, Welt Nachrichtensender (2 Ausschnitte) https://www.youtube.com/watch?v=PebsFjx9zxw Zitat aus "Gästeliste Geisterbahn, Folge 143 "Splitter aus Glück" Es spricht vor allem Nilz Bokelberg. https://gaestelistegeisterbahn.de/ DocCaro's Aufruf "Alle mal 'ne Schicht machen" https://www.youtube.com/watch?v=dGnRFPfmQBM
Schuld und Bühne - Die mediale Fixierung auf Fehler und wie man sie überwindet
Je komplexer die Welt, desto größer der Wunsch nach einfachen Antworten. Wir sehnen uns nach klaren Zuständigkeiten und - idealerweise - nach einer Person, die zur Rechenschaft gezogen werden kann, wie in der Coronakrise zuletzt häufig NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Personalisierung und Skandalisierung, das ist nicht neu. Doch gerade in Pandemiezeiten fällt auf, dass solche medialen Diskurse unsere Gesellschaft und unser Denken auf eine ungute Weise beeinflussen. So sieht es zumindest unser Hörer Florian Städtler, der uns schreibt: "Die Gesellschaft muss sich klar werden, dass auch Politik zu einem gewissen Grad Experiment, Versuch und Irrtum ist." Sein Wunsch: "Wir brauchen in den Medien eine Balance aus Kontroverse und Hinterfragen." Gemeinsam mit der Neurowissenschaftlerin und Journalistin Maren Urner und Stephan Beuting aus der DLF-Medienredaktion sprechen wir mit dem Hörer über die Mechanismen hinter diesem "Blame-Game" und über mögliche Alternativen. Diesen Podcast finden Sie auch in unserer Dlf Audiothek App, unter www.deutschlandfunk.de/medienpodcast und in den gängigen Podcast-Apps. @mediasres" finden Sie auch im Internet auf dem Portal www.deutschlandfunk.de/mediasres www.deutschlandfunk.de, Themenportal Nach Redaktionsschluss Direkter Link zur Audiodatei
Die Linke stellt sich neu auf. 600 Delegierte wählen die Nachfolgerinnen von Katja Kipping und Bernd Riexinger: Susanne Hennig-Wellsow aus Thüringen und die hessische Oppositionspolitikerin Janine Wissler sollen den Parteivorsitz übernehmen. ZEIT-ONLINE-Politikredakteurin Katharina Schuler spricht mit Pia Rauschenberger über den Führungswechsel bei den Linken, der die Partei ökologischer und, im Jahr der Bundestagswahl, regierungsfähiger machen soll. In der Corona-Pandemie stellen Wissenschaftlerinnen fest: Die öffentliche Aufmerksamkeit und die zwangsläufige Politisierung ihrer Fachbereiche haben ihnen das Forschen nicht unbedingt erleichtert. Manche werden bedroht, andere bemängeln Lagerbildung und die Skandalisierung einzelner Forschungsergebnisse in den Medien. ZEIT-Wissensredakteur Ulrich Schnabel hat analysiert, warum die Botschaften der Wissenschaft gerade dann leicht misszuverstehen sind, wenn sich Politik, Medien und Öffentlichkeit besonders für sie interessieren. Im Podcast erklärt er, wie Wissenschaftskommunikation funktionieren kann. Und sonst so? Endlich runter mit der Wolle: https://www.youtube.com/watch?v=hx6pbkKaxyI Weitere Infos: Die Linke: Mehr Sozialstaat, mehr Klimaschutz, weniger Nato https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/die-linke-wahlprogramm-bundestagswahl-2021-soziale-sicherheit-klimaschutz Janine Wissler: „Wir wollen eine grundsätzlich andere Gesellschaft“ https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/janine-wissler-hessen-die-linke-fraktionschefin-hessischer-landtag-systemwechsel Wissenschaft: Auf der großen Bühne https://www.zeit.de/2021/09/wissenschaft-oeffentlichkeit-kommunikation-medien-politik Moderation und Produktion: Pia Rauschenberger Mitarbeit: Alexander Eydlin, Christina Felschen Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.
Mit Vincenzo Paolino www.almacasa.ch
Bodo Ramelow spielt mit dem Handy - Skandalisierung oder Skandal? DNEWS24-Podcast vom 25.1.2021
Es ist gut, wenn Menschen - also auch Politiker - ehrlich sind. Und so ist es zu begrüßen, wenn Bodo Ramelow erzählt, dass er die MPK dazu nutzt, sein Level bei Handy-Spielen zu verbessern. Darauf ist er stolz. Weniger stolz kann er auf die Situation seiner Landeskinder sein, die an Covid-19 erkranken oder gar sterben. Und weder Schüler noch Eltern wird das Spiel-Level des Ministerpräsidenten interessieren, wenn die Schulen bis Ostern geschlossen bleiben und der Distanz-Unterricht nicht funktioniert. DNEWS24Radio-Podcast am 25.1.2021 von Uwe-Matthias Müller. DNEWS24-Podcast - überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Die Intro-Musik stammt mit freundlicher Genehmigung von Ronald Kah.
1970 wurde die erste Schweizer Frauenfussball-Liga gegründet. Seitdem ist einiges ins Rollen gekommen – und die Forderungen nach mehr finanziellen Mitteln und stärkerer medialer Präsenz sind gewachsen. «Kulturplatz» am Ball mit starken Frauen. Heute ist das kaum mehr vorstellbar, aber im Jahr 1970 war es eine Revolution: Junge Frauen rebellierten dagegen, dass nur Knaben und Männer Klubfussball spielen durften, und gründeten eine eigene Liga. Seit 50 Jahren ist einiges geschehen, der Frauenfussball spielt heute eine ganz andere Rolle. Der Weg aber war steinig und geprägt von Verachtung, Sexualisierung und Skandalisierung. Und der Kampf der Fussballerinnen um Chancengleichheit ist längst nicht zu Ende: Die Frauen fristen weiterhin ein Dasein im mächtigen Schatten der Männer. Das Ringen der Fussballerinnen um öffentliche Anerkennung, sportlichen Erfolg und ein minimales finanzielles Auskommen ist auch 50 Jahre nach der Gründung der Schweizer Frauenfussball-Liga in vollem Gang. Und auch beim Schweizer Fernsehen geht etwas: Neu werden ausgewählte Spiele der Women’s Super League gezeigt. Ausserdem: – Sarah Akanji – Ein Gespräch mit der wohl bekanntesten Schweizer Fussballspielerin. – Big Zis – Die Zürcher Rapperin ist zurück mit einer ordentlichen Portion Feminismus. – Rebecca Solnit – Die grosse amerikanische Intellektuelle blickt auf 40 Jahre Emanzipation zurück. – Florentina Holzinger – Die österreichische Choreographin tanzt Anti-Ballett.
1970 wurde die erste Schweizer Frauenfussball-Liga gegründet. Seitdem ist einiges ins Rollen gekommen – und die Forderungen nach mehr finanziellen Mitteln und stärkerer medialer Präsenz sind gewachsen. «Kulturplatz» am Ball mit starken Frauen. Heute ist das kaum mehr vorstellbar, aber im Jahr 1970 war es eine Revolution: Junge Frauen rebellierten dagegen, dass nur Knaben und Männer Klubfussball spielen durften, und gründeten eine eigene Liga. Seit 50 Jahren ist einiges geschehen, der Frauenfussball spielt heute eine ganz andere Rolle. Der Weg aber war steinig und geprägt von Verachtung, Sexualisierung und Skandalisierung. Und der Kampf der Fussballerinnen um Chancengleichheit ist längst nicht zu Ende: Die Frauen fristen weiterhin ein Dasein im mächtigen Schatten der Männer. Das Ringen der Fussballerinnen um öffentliche Anerkennung, sportlichen Erfolg und ein minimales finanzielles Auskommen ist auch 50 Jahre nach der Gründung der Schweizer Frauenfussball-Liga in vollem Gang. Und auch beim Schweizer Fernsehen geht etwas: Neu werden ausgewählte Spiele der Women’s Super League gezeigt. Ausserdem: – Sarah Akanji – Ein Gespräch mit der wohl bekanntesten Schweizer Fussballspielerin. – Big Zis – Die Zürcher Rapperin ist zurück mit einer ordentlichen Portion Feminismus. – Rebecca Solnit – Die grosse amerikanische Intellektuelle blickt auf 40 Jahre Emanzipation zurück. – Florentina Holzinger – Die österreichische Choreographin tanzt Anti-Ballett.
Politologe Oberreuter: Kräftige Delle für Söders Krisenmanagement-Perfektionismus
In Bayern sind mehr als 44.000 Corona-Testergebnisse bis gestern Abend noch nicht verschickt worden. Die 900 positiv Getesteten sollen heute informiert werden. Der Politologe und CSU-Kenner, Heinrich Oberreuter, hält die Kritik am bayerischen Ministerpräsidenten Söder in diesem Zusammenhang für berechtigt. Söders Ziel sei offensichtlich “Aktionismus, Perfektionismus und Problemlösungskompetenz in großer Eile zu signalisieren, und da geht offensichtlich der Realitätssinn verloren,“ sagte Oberreuter im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. “Söder muss abwägen, ob die Panne für ihn nicht noch größer wird, wenn er deren Skandalisierung durch die Entlassung einer Ministerin aus dem Amt noch zusätzlich bestärkt,“ so Oberreuter. “Der Södersche Krisenmanagementperfektionismus, der ihn nach oben gespült hat in der Demoskopie, hat eine kräftige Delle erhalten. Und das wird sich in der Kanzlerkandidatendiskussion auf jeden Fall auswirken.“
In dieser Episode beschäftige ich mich mit der Frage, wann diffamierende Äußerungen im Internet rechtswidrig sind und welche Maßnahmen wir als Einzelner gegen Beleidigungen haben? Anhand der viel diskutieren Entscheidung des Landgericht Berlins im Zusammenhang mit den Beleidigungen gegenüber der Politikerin Renate Künast und deren Bewertung durch das Landgericht Berlin als rechtmäßig, werfe ich die Frage auf, ob wir uns dem Ende der sachbezogenen Streitkultur in einer demokratischen Gesellschaft gegenübersehen oder ob es uns gelingt, trotz eines Interesses an Skandalisierung und aufgeregter Selbstversicherung, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen.
Folge 2: Skandalisierung und der Verlust der journalistischen Glaubwürdigkeit
Folge 2: Skandalisierung und der Verlust der journalistischen Glaubwürdigkeit by Kloiber und Welchering
#04 Die Macht der Täter brechen
FAZ Essay – der Podcast für die Geschichte hinter den Nachrichten
Sosehr die Skandalisierung von sexueller Gewalt gegen Kinder wie jüngst in Staufen zu einer notwendigen gesellschaftlichen Debatte beiträgt, sosehr können einzelne Fälle den Blick auf die Gesamtdimension des Problems verstellen. Kevin, Lea-Sophie und „Staufen“ sind nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Ein Essay von Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm.
Sommer-Interview 2018: Uwe Vetterick über konstruktiven Journalismus, Zukunft der Zeitung und die neue Online-Strategie
In unserem großen FLURFUNK-Podcast-Sommerinterview ist Uwe Vetterick zu Gast, der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung. Konstruktiver Journalismus: Funktioniert das überhaupt? Wir sprechen über die Erfahrungen der SZ-Redaktion mit konstruktivem Journalismus und stellen fest, dass “lösungsorientierter Journalismus” wohl der passendere Begriff wäre. Uwe Vetterick erzählt von Leserinnen und Lesern, die ihre Alltagsprobleme zur Diskussion stellen, aber auch von einer gewissen Ambivalenz bei der Rezeption der lösungsorientierten Texte. Außerdem sind in unserem Gespräch Boulevardisierung, Skandalisierung und Effekthascherei ein Thema. Kann diese “neue” Art des Journalismus eine Antwort darauf sein, die Distanz zwischen Nutzern und Medien zu überbrücken? In diesem Zusammenhang stellt sich unser Gesprächspartner der Kritik, lösungsorientierter Journalismus sei oft nicht von Werbung für bestimmte Unternehmen zu unterscheiden. Gedruckte Zeitungen: Gibt es noch eine Zukunft? Kaum noch sieht man Menschen, die in der Öffentlichkeit Zeitung lesen. Alle starren auf Ihre Smartphones und beziehen Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wie kann eine regionale Tageszeitung auf diese Veränderungen reagieren? Mit welcher Online-Strategie macht das die Sächsische Zeitung? Worüber wir noch hätten Sprechen können: Wie steht’s um den Nachwuchs? Ein besonderes Thema in unserer bunten Fragen-Kategorie widmen wir jungen Journalistinnen und Journalisten. Haben die regionalen Tageszeitungen überhaupt noch Nachwuchs? Wer möchte denn noch in Zittau oder Niesky journalistisch arbeiten? Außerdem bekommen wir endlich eine Antwort auf die drängendste aller Fragen: Wie oft ruft eigentlich die Bundeskanzlerin in der Redaktion an und gibt die Themen durch?
Steuerhinterziehung, Pferdefleisch, außereheliche Liebschaften oder abgeschriebene Doktorarbeiten - täglich werden neue Normverstöße aufgedeckt und angeprangert. Meist sind es Politiker und Prominente, die in den Fokus geraten, doch in Zeiten digitaler Medien kann es jeden und alles treffen. Selbst die Skandalisierung wird manchmal zum Skandal erklärt. Allerdings stößt nicht mehr jedes Empörungsangebot auf Resonanz. Im Publikum macht sich Skandalmüdigkeit breit. Für Medien ist das bedrohlich, denn die öffentliche Erregung ist für viele ein lukratives Geschäft. (Produktion 2014)
Benni und Antje sprachen heute über: Warum die Episode 11 fehlt. (3:44) Über die "Kofferträger von Schwäbisch Gmünd" und Bennis angebliches Trollen in Antjes Blog (25:00) Skandalisierung als Politikform - wirkt die noch angesichts einer immer bizarrer werdenden Aufmerksamkeitsöffentlichkeit und was kann man stattdessen tun? (49:40) Wertschätzung im Internet durch Likes, Kommentare, Retweets - ist das übertragbar auf die Öffentlichkeit - mit Hinweis auf "Darknet" von Daniel Suarez Folge direkt herunterladen Download file directly