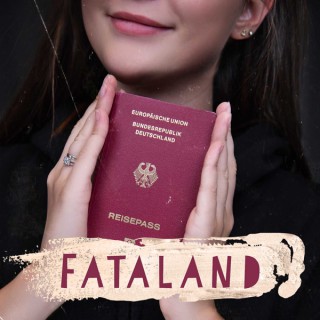Podcasts about bosnienkrieg
- 64PODCASTS
- 84EPISODES
- 32mAVG DURATION
- 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
- Dec 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about bosnienkrieg
Latest podcast episodes about bosnienkrieg
Frieden auf dem Papier? 30 Jahre Dayton-Abkommen
Mit Winfried Gburek, Journalist und Buchautor. Vor 30 Jahren endete der Bosnienkrieg. Dieser war bis zum Krieg in der Ukraine, der blutigste Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Grundlage für den Frieden war das Abkommen von Dayton, mit dem auch der Staat Bosnien und Herzegowina gegründet wurde. Aber wie stabil ist Bosnien und Herzegowina heute? Wie gestaltet sich das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und wie ist die Lage der katholischen Minderheit im Land? Antworten bekommen wir von dem Journalisten und Buchautor Winfried Gburek.
Vor 30 Jahren beendete das Abkommen von Dayton den Bosnienkrieg
Michael Köhler www.deutschlandfunk.de, Kultur heute
14. Dezember 1995: Abkommen von Dayton
Heute vor 30 Jahren wurde das Abkommen von Dayton in Paris unterzeichnet, das den dreieinhalb Jahren dauernden Bosnienkrieg offiziell beendete – den blutigsten der Jugoslawienkriege.
Balkankonflikt - Das Abkommen von Dayton 1995
Der Balkan gleicht einem Pulverfass: Immer wieder kommt es in der Geschichte zu Konflikten und Kriegen. Einer der blutigsten war der Bosnienkrieg, der 1995 endete – vor 30 Jahren. Doch Spannungen bestehen bis heute.**********Ihr hört in dieser Folge "Eine Stunde History":5:23 - Norbert Mappes-Niediek18:09 - Carl Bethke32:34 - Alexsander Rhotert**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Industriegigant: Die Gründung der IG Farben 1925Römer in Britannien: Der Keltenaufstand unter Boudicca 60 n. Chr.Von COP1 zu COP28: Die Geschichte der Weltklimakonferenzen**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: TikTok und Instagram .**********In dieser Folge mit: Moderation: Markus Dichmann Gesprächspartner: Dr. Matthias von Hellfeld, Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte Gesprächspartner: Carl Bethke, Osteuropa-Historiker Gesprächspartner: Alexander Rhotert, Politikwissenschaftler
Italiener als «Sniper-Touristen» im Bosnienkrieg? Ein Journalist deckt auf
Reiche Ausländer die Geld bezahlten, um in Sarajevo auf Zivilisten zu schiessen. Der italienische Journalist Ezio Gavazzeni recherchiert zum Scharfschützen-Tourismus in Sarajevo während des Bosnienkriegs. Er will, dass die italienischen Behörden endlich aktiv werden. Gast: Luzi Bernet, Italien-Korrespondent Host: Nadine Landert Die neue 5-teilige Podcast-Serie der NZZ und der Brost-Stiftung "250 Dollar - Wie ich einen Menschen freikaufe" findet ihr hier https://open.spotify.com/show/55Js1YIOLAcxvC9qGbfBvC Du willst die NZZ testen? Dann empfehlen wir dir das digitale Probeabo https://abo.nzz.ch/m_22031148_1/?trco=22034481-05-07-0001-0007-014761-00000004&tpcc=22034481-05-07-0001-0007-014761-00000004&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD5QrmmaoPhGS-tcx7VY7SPwQyR8s&gclid=EAIaIQobChMIv8f-_eb6jAMVcoCDBx3yeCu-EAAYASAAEgKWHPD_BwE
Die Scharfschützen-Touristen von Sarajevo
Sie sollen in dunkler Nacht eingeflogen worden sein, übers Wochenende in den Krieg und wieder zurück. 200'000 Euro für einen Jagdausflug in die Hügel von Sarajevo.Ein Jagdausflug aus Menschen. Vor dreissig Jahren endete der Krieg in Bosnien-Herzegowina, seither halten sich hartnäckig die Gerüchte von wohlhabenden Westlern (auch aus der Schweiz), die auf «Sarajevo-Safari» gegangen sein und von den Hügeln gegen Bezahlung auf Zivilisten geschossen haben sollen. Handfeste Beweise für die Vorwürfe gibt es bislang keine. Eine Untersuchung in Mailand könnte das nun ändern – nach der Recherche eines italienischen Journalisten ist die Staatsanwaltschaft aktiv geworden.Wie gross sind die Erfolgschancen einer solchen Untersuchung? Und was bedeutet diese neue Entwicklung für die Menschen in Bosnien? Darum geht es in einer neuen Folge von «Apropos». Zu Gast ist Elisa Britzelmeier, die neue Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tages-Anzeigers in Italien.Host: Philipp LoserProduzentin: Sibylle HartmannMehr zum Thema:Scharfschützen-Tourismus im Bosnienkrieg: «Es ist unfassbar für mich, dass jemand aus Vergnügen das Kind eines anderen tötet»Apropos-Folge über Amina Ovcina Cajacob, die den Krieg in Bosnien überlebt hat: «Ich war ein Kind und dann nicht mehr» Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Sniper-Touristen im Bosnienkrieg: Warum töten Menschen zum Spass?
Im Bosnienkrieg sollen reiche Personen über Jahre hinweg nach Sarajevo gereist sein, um dort - offenbar zum Spass - als Scharfschützen-Touristen auf Zivilpersonen zu schiessen. Das zeigt eine neue Recherche. Wie kann sich jemand dermassen am Leid anderer Menschen ergötzen? Die reichen Leute sollen sehr viel für einen Wochenendtrip nach Sarajevo bezahlt haben, wo sie gezielt auf Zivilpersonen als Sniper-Touristen schiessen konnten. Das sagt der italienische Investigativ-Autor Ezio Gavazzeni. Töten sei für diese Menschen ein Vergnügen gewesen. Wir sprechen mit Marc Graf, Professor für forensische Psychiatrie an der Universität Basel darüber, warum Menschen solche Taten begehen. Und SRF-Korrespondent Peter Balzi erklärt, was die Aufarbeitung dieser Fälle für die Menschen in Sarajevo bedeutet. ____________________ Habt Ihr Fragen oder Themen-Inputs? Schreibt uns gerne per Mail an newsplus@srf.ch oder sendet uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37. ____________________ In dieser Episode zu hören - Ezio Gavazzeni, Investigativ-Autor - Marc Graf, Professor für forensische Psychiatrie Universität Basel - Peter Balzli, Korrespondent SRF ____________________ Team: - Moderation: Raphaël Günther - Produktion: Martina Koch - Mitarbeit: Nicolas Malzacher ____________________ Das ist «News Plus»: In einer Viertelstunde die Welt besser verstehen – ein Thema, neue Perspektiven und Antworten auf eure Fragen. Unsere Korrespondenten und Expertinnen aus der Schweiz und der Welt erklären, analysieren und erzählen, was sie bewegt. «News Plus» von SRF erscheint immer von Montag bis Freitag um 16 Uhr rechtzeitig zum Feierabend.
Im Jahr 1942 erklären die NS-Besatzer Serbien für "judenfrei". Es ist der Ausgangspunkt des Romans von Marko Dinic. Er erzählt aus acht verschiedenen Perspektiven, auch aus der eines Hundes mit einem Halsband mit hebräischen Schriftzeichen um den Hals. Der letzte Jude Belgrads Isak Ras stolpert durch die Stadt, auf der Suche nach seiner Mutter. Wir begegnen einem Kollaborateur, einem Anarchistenpaar, einem jungen Rom, der zum Partisanen wird und in den 1990er Jahren einem Milizionär, der im Bosnienkrieg auf ein Buch schießt, das er für ein muslimisches hält. Zemun, heute Stadtteil von Belgrad, war einst auch Keimzelle des Zionismus – die Familie des Zionisten Theodor Herzl gehörte der jüdischen Gemeinde dort an. Über den Donauraum als Raum der Gewalt, die Shoa in Serbien, die politische Aufgabe des Schriftstellers, literarische Traditionen und die Vielfalt der "Donauliteratur" hat sich Stephan Ozsváth mit Marko Dinic an seinem Schreibort unterhalten, der Wiener Rathausbibliothek. Das Buch Marko Dinic: "Das Buch der Gesichter". Zsolnay-Verlag. 464 Seiten, 28,00 Euro. Stephan Ozsváth empfiehlt Henrik Szántó: "Treppe aus Papier". Blessing. 224 Seiten, 23,00 Euro. Marko Dinic empfiehlt Ronya Othmann: "Rückkehr nach Syrien". Rowohlt. 192 Seiten, 22 Euro. Der Ort Wiener Rathausbibliothek Der Autor Marko Dinic wurde 1988 in Wien geboren, er wuchs in Belgrad auf. In Salzburg studierte der Autor mit serbischem Pass Germanistik und Jüdische Kulturgeschichte. Sein Debütroman "Die guten Tage" erzählt vom "Gastarbeiter-Express", einem Bus, der zwischen Wien und Belgrad verkehrt und der Verlorenheit der jungen serbischen Generation. Das "Buch der Gesichter" stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2025.
Der Wildfluss Neretva - Ein bedrohtes Naturparadies verbindet und trennt
Die Neretva in Bosnien-Herzegowina ist einer der letzten Wildflüsse Europas. Doch Staudämme gefährden die Natur. Der Protest dagegen eint Menschen, 30 Jahre nach dem Bosnienkrieg. Der Fluss ist aber auch eine Grenze, die manche nicht überschreiten. (Erstsendung am 16.11.2024) Götzke, Manfred www.deutschlandfunk.de, Gesichter Europas
Abkommen von Dayton - "Gerechter als die Fortsetzung des Krieges"
Als die Staatschefs von Serbien, Kroatien und Bosnien im November 1995 in Dayton zusammenkamen, um den Bosnienkrieg zu beenden, verweigerten sie sich zunächst den Handschlag. Nach drei Wochen dann der Kompromiss - unter großem internationalen Druck. Ernst, Sonja www.deutschlandfunk.de, Kalenderblatt
30 Jahre nach dem Bosnienkrieg – Wie geht es den Menschen heute
Gespräch mit der Psychologin Professorin Dr. Selvira Draganović.
Überleben (2/4): Der Krieg in Bosnien
«Überleben bedeutet für mich, Hoffnung zu haben, eine positive Einstellung und Zusammenhalt.»Amina Ovcina Cajacob ist 11 Jahre alt, als der Bosnienkrieg beginnt. Sie lebt zu dieser Zeit mit ihrer Familie in Sarajevo. Die Hauptstadt wird von der serbischen Armee fast vier Jahre belagert und ist abgeschnitten vom Rest des Landes.1995, knapp ein Jahr vor dem Ende des Krieges, erhält sie ein Stipendium in den USA und kann Sarajevo verlassen. Sie reist allein nach Amerika, nach einem Jahr kehrt sie nach Sarajevo zurück. Danach erhält sie ein zweites Stipendium in Wien und absolviert dort ihr Studium. Heute lebt sie in Chur und ist Professorin für Markt- und Medienforschung an der Fachhochschule Graubünden.Sabrina Bundi hat die Geschichte von Amina Ovcina Cajacob für die Serie «Survivors»: Wir haben überlebt» aufgeschrieben und ist Gast in einer neuen Folge des täglichen Podcast «Apropos».Host: Philipp LoserProduzent: Tobias HolzerSurvivors: Wir haben überlebtJournalistinnen und Journalisten berichten oft über Unglücke, Skandale und den Tod. Nicht in dieser Serie. Hier erzählen wir von vier Menschen, die überlebt haben: den Krieg, ein Unglück im Schnee, das eigene Familientrauma. Unsere Protagonistinnen und Protagonisten berichten, wie sie sich zurückkämpften, wie der Bruch im Leben sie veränderte – und was sie daraus gelernt haben.Unglück, Krieg, Familientrauma: Wir haben überlebt«‹Zickzack, zickzack!›, hat mein Vater immer gerufen. Damit die Sniper mich nicht treffen» Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch
Völkermord vor 30 Jahren: Srebrenica zwischen Erinnern und Vergessen
Bekir ist noch ein Baby, als sein Vater 1995 beim Massaker von Srebrenica getötet wird. 30 Jahre später lebt Bekir zwei Autostunden entfernt von der Stadt in Bosnien und Herzegowina, aber er besucht Srebrenica regelmäßig. Seine Mutter lebt noch im alten Haus der Familie. Und Bekir hat einen Verein gegründet “Adopt Srebrenica”, der Jugendlichen eine Perspektive bieten und gleichzeitig die Erinnerung an den Völkermord wachhalten soll. Wie lebt es sich in einer Stadt, die auch 30 Jahre später von der Vergangenheit gezeichnet ist? In dieser 11KM-Folge erzählt uns Filmemacher Ralph Weihermann, wie es in Srebrenica heute aussieht und wie die Stadt zwischen Erinnern und Vergessen aufgerieben wird. Hier geht's zum Film “Srebrenica - Leben im Schatten des Völkermords” von Ralph Weihermann: https://www.arte.tv/de/videos/120880-003-A/re-srebrenica-leben-im-schatten-des-voelkermords/ In dieser früheren 11KM-Folge begleiten wir Kriegsveteranen verfeindeter Lager des Jugoslawienkrieges: „Nach Krieg & Terror: Wie geht Versöhnung?”: https://1.ard.de/11KM_Versoehnung Hier geht's zu Weltspiegel, unserem Podcast-Tipp: https://1.ard.de/weltspiegel_podcast?cp Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Charlotte Horn Mitarbeit: Hannah Heinzinger Host: Elena Kuch Produktion: Timo Lindemann, Konrad Winkler, Christine Dreyer, Jürgen Kopp Planung: Nicole Dienemann und Hardy Funk Distribution: Kerstin Ammermann Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim NDR.
30 Jahre nach Srebrenica – Wie stabil ist Bosnien und Herzegowina?
Am 11. Juli 1995 begann der serbische Völkermord an mehr als 8300 bosniakischen Jungen und Männern rund um die Kleinstadt Srebrenica. Die serbische Seite leugnet den Genozid bis heute, was eine Aufarbeitung und Strafverfolgung erheblich behindert. Wenige Monate nach dem Völkermord endete der Bosnienkrieg mit dem Friedensvertrag von Dayton. Dieser sollte dem Land eine ausgewogene ethnische Struktur geben, führte jedoch zu lähmender Blockadepolitik. Wie leben die Menschen heute zusammen? Wie stabil ist Bosnien und Herzegowina angesichts serbischer Spaltungspolitik? Andrea Beer diskutiert mit Aida Cerkez – Investigativjournalistin Sarajewo; Prof. Dr. Vahidin Preljević – Literatur- und Kulturwissenschaftler, Universität Sarajewo; Tanja Topić – Journalistin aus Banja Luka
Im Juli 1995 schaute die Welt zu, wie das grösste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Serbische Truppen erschossen in Srebrenica über 8000 bosnische Muslime. Wie konnte das passieren? Und was sind die Folgen bis heute? Janis Fahrländer ist SRF Auslandredaktor. Srebrenica markierte einen entscheidenden Wendepunkt im Bosnienkrieg und zählt zu den schwerwiegendsten Verbrechen in der jüngeren europäischen Geschichte. Zwischen dem 11. und 19. Juli 1995 wurden rund 8.000 Jungen und Männer getötet. Es handelte sich um den ersten Völkermord in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Opfer, mehrheitlich muslimische Bosniaken, waren unbewaffnet und hielten sich in einer von den Vereinten Nationen als Schutzzone ausgewiesenen Region auf. Wie kam es zu diesem Genozid? Vor welchem geschichtlichen Hintergrund passierte es? Ein Verbrechen mit Folgen, die internationale Politik bis heute prägen. SRF Auslandredaktor Janis Fahrländer ist zu Gast bei David Karasek.
Der Musiker und Sänger Marius Bear und die Gynäkologin und Frauenrechtlerin Monika Hauser geben bei Olivia Röllin Einblicke in ihre Lebenswelten. Marius Bear (31) sollte dereinst als Baumaschinenmechaniker die Firma des Vaters übernehmen. Im Militär wird er allerdings von Kollegen auf seine Stimme angesprochen und so beginnt Marius Hügli, wie der Musiker bürgerlich heisst, noch in der Kaserne auf der Gitarre zu schrummen und zu singen. Mit 22 Jahren macht er das erste Mal Musik, 7 Jahre später, 2022, vertritt er bereits die Schweiz am Eurovision Song Contest mit seinem Track «Boys Do Cry». Kurz nachdem der ganze Eurovision-Trubel vorbei ist, wird er hart mit der Realität konfrontiert: Sein Vater, der für Marius Hügli stets ein grosses Vorbild war, ist an einem aggressiven Hirntumor erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Inzwischen lebt der Musiker seit acht Jahren von der Musik, hat gerade eine Single herausgegeben und tourt im Herbst durch die Schweiz. ____________________ Monika Hauser (65) hat schon in viele menschliche Abgründe geblickt, das hat sie nicht daran gehindert, ihren Weg zu gehen. Empörung sei ihre Triebfeder, sagt die Gynäkologin mit Widerstandsgeist. Seit über 30 Jahren setzt sie sich für Frauen und Mädchen in Krisen- und Kriegsgebieten ein. Durch ihre Eltern wurde sie schon früh im Leben damit konfrontiert, was mit Menschen geschieht, die von Krieg und Gewalt traumatisiert sind und beschliesst später, etwas dagegen zu tun. Mit gerade mal 33 Jahren reist sie in den Bosnienkrieg und eröffnet dort zusammen mit lokalen Fachfrauen ein Frauentherapiezentrum und gründet die Organisation Medica Mondiale, die heute weltweit in Kriegsgebieten tätig ist. ____________________ Moderation: Olivia Röllin ____________________ Das ist «Persönlich»: Jede Woche reden Menschen über ihr Leben, sprechen über ihre Wünsche, Interesse, Ansichten und Meinungen. «Persönlich» ist kein heisser Stuhl und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur Person und über ihr Leben. Die Gäste werden eingeladen, da sie aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben, das über den Tag hinaus Gültigkeit hat.
Kindheit im Krieg: Tijan Sila und sein Roman „Radio Sarajevo“
Das Warten und das Grauen, der Wagemut und der Kontakt zur Außenwelt: Tijan Sila stellt im Gespräch mit Elena Witzeck im Literaturhaus Frankfurt seinen Roman „Radio Sarajevo“ vor.
Jänner 1993, Traiskirchen bei Wien: Hier kommt Vedran Džihić auf seiner Flucht vor dem Bosnienkrieg an. In Österreich fühlt er sich sicher, erlebt aber auch Gleichgültigkeit und Benachteiligung. Parallel zu seinem bemerkenswerten Bildungsaufstieg machen sich in Europa Populismus und Nationalismus breit. Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten werden immer mehr zur Gefahr stilisiert. Džihić hat über sein "Ankommen" ein vielbeachtetes Buch geschrieben.
Das Sarajevo Filmfestival ist das grösste Filmfestival in Südosteuropa. Dies allein ist bemerkenswert. Denn entstanden ist das Festival mitten im Bosnienkrieg, während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Aufgrund dieser Geschichte will das Festival mehr sein als ein reines Filmfestival. Selbst von den grausamen Folgen von Krieg und Nationalismus betroffen, hat sich das Filmfestival neben einer kulturellen auch eine aufklärerische und politische Mission gesetzt. Es versteht sich als Ort des Austausches, als Ort, der den Dialog über Landesgrenzen hinweg in der gesamten Region fördert. Gerade jetzt, wo weltweit die Spannungen wieder zunehmen und auch auf dem Balkan die Rhetorik aggressiver wird, ist dieser Ansatz so aktuell wie lange nicht. Davon ist der Festivaldirektor Jovan Marjanovic überzeugt. Doch nicht nur am Filmfestival, in ganz Bosnien Herzegowina sind die Folgen des Krieges weiterhin überall spürbar. Das Land ist weiterhin gespalten zwischen den einzelnen Volksgruppen. Bosnien ist geografisch und politisch aufgeteilt zwischen muslimischen Bosniaken, katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Die meisten Parteien sind ethnisch definiert und verstehen sich als Verteidiger ihrer jeweiligen Volksgruppen. Dabei haben sich die Politiker aller Seiten längst ein Klientelsystem aufgebaut, das einzig ihrem Machterhalt dient. Die Situation scheint zerfahren. Viele verlassen daher das Land und suchen ihr Glück anderswo. Das Filmfestival gab den Bewohnerinnen und Bewohner Sarajevos in den dunkelsten Stunden der Stadtgeschichte Halt. Und es bietet noch immer jenen Hoffnung, die auf Dialog und Verständigung setzen. Es nimmt damit eine Gegenposition ein in einer Region, in welcher der Nationalismus zuletzt in vielen Ländern wieder stärker wurde. Erstausstrahlung: 7. September 2024.
Das Sarajevo Filmfestival ist das grösste Filmfestival in Südosteuropa. Dies allein ist bemerkenswert. Denn entstanden ist das Festival mitten im Bosnienkrieg, während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Aufgrund dieser Geschichte will das Festival mehr sein als ein reines Filmfestival. Selbst von den grausamen Folgen von Krieg und Nationalismus betroffen, hat sich das Filmfestival neben einer kulturellen auch eine aufklärerische und politische Mission gesetzt. Es versteht sich als Ort des Austausches, als Ort, der den Dialog über Landesgrenzen hinweg in der gesamten Region fördert. Gerade jetzt, wo weltweit die Spannungen wieder zunehmen und auch auf dem Balkan die Rhetorik aggressiver wird, ist dieser Ansatz so aktuell wie lange nicht. Davon ist der Festivaldirektor Jovan Marjanovic überzeugt. Doch nicht nur am Filmfestival, in ganz Bosnien Herzegowina sind die Folgen des Krieges weiterhin überall spürbar. Das Land ist weiterhin gespalten zwischen den einzelnen Volksgruppen. Bosnien ist geografisch und politisch aufgeteilt zwischen muslimischen Bosniaken, katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Die meisten Parteien sind ethnisch definiert und verstehen sich als Verteidiger ihrer jeweiligen Volksgruppen. Dabei haben sich die Politiker aller Seiten längst ein Klientelsystem aufgebaut, das einzig ihrem Machterhalt dient. Die Situation scheint zerfahren. Viele verlassen daher das Land und suchen ihr Glück anderswo. Das Filmfestival gab den Bewohnerinnen und Bewohner Sarajevos in den dunkelsten Stunden der Stadtgeschichte Halt. Und es bietet noch immer jenen Hoffnung, die auf Dialog und Verständigung setzen. Es nimmt damit eine Gegenposition ein in einer Region, in welcher der Nationalismus zuletzt in vielen Ländern wieder stärker wurde. Erstausstrahlung: 7. September 2024.
Arno Frank: Kriegstrauma ist für Tijan Sila „Glutkern“ seines Schreibens
Der gebürtige Kaiserlauterer Schriftsteller hält Donnerstag (5.12.2024) die Laudatio auf Tijan Sila, der mit dem Martha-Saalfeld-Preis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wird. Sila floh als 13-jähriger mit seiner Familie vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland und lebt heute in Kaiserslautern. Das Kriegstrauma sei ein Thema, das er in jedem seiner Romane spiralförmig umkreise. Jedes Buch scheine wie ein neuer Anlauf, eine neue Annäherung an das, was man den „Glutkern“ seines Schreibens nennen könne, so Arno Frank. Zudem sei Tijan Sila beim Schreiben „wahnsinnig diszipliniert: als Berufsschullehrer hat er abends „Schreibtischhunger“, ich muss mir das Literarische eher erkämpfen. Tijan schreibt wie ein Radrennfahrer, ich wie ein Fußgänger“. Unterschiedlich sind auch die Blicke der beiden Autoren auf die alte bzw. neue Heimat Kaiserslautern: Tijan Sila lasse auf die Stadt nichts kommen – er liebe ihren rauen Charme. Wohingegen Arno Frank die Verbindungen zu Kaiserlautern längst gekappt hat. Aber förderlich fürs kreative Schreiben sei die Stadt durchaus: „Schreiben ist Arbeit und, freundlich formuliert, hält einen diese Stadt, anders als z.B. Berlin, nicht von der Arbeit ab“. Der Schriftsteller Arno Frank holt sich seine Inspiration fürs Schreiben eher im Pfälzer Wald: „Seit ich dort eine Schreibhütte habe, schreib ich zwar immer noch nicht wie ein Radrennfahrer, aber wie ein Waldläufer. Das hilft mir schon“.
Der Wildfluss Neretva - Ein bedrohtes Naturparadies verbindet und trennt
Die Neretva in Bosnien-Herzegowina ist einer der letzten Wildflüsse Europas. Doch Staudämme gefährden die Natur. Der Protest dagegen eint Menschen, 30 Jahre nach dem Bosnienkrieg. Der Fluss ist aber auch eine Grenze, die manche nicht überschreiten. Götzke, Manfred www.deutschlandfunk.de, Gesichter Europas
Marina Abramovic: Die Künstlerin mit der Pistole am Kopf
Sie liess sich eine Pistole an den Kopf setzen. Zeigte sich nackt, bevor das viele Influencer machten. Oder putze während dem Bosnienkrieg an der Biennale eine Woche lang blutige Rinderknochen.Marina Abramovic geht mit ihrer Kunst an die Grenze – und darüber hinaus. Ihre Radikalität hat sie zur bedeutendsten Performance-Künstlerin der Welt gemacht.Ab dieser Woche ist im Kunsthaus in Zürich eine grosse Retrosepktive von ihr zu sehen. Kulturredaktor Andreas Tobler hat die Künstlerin im Vorfeld in New York besucht. Von seiner Begegnung – und überraschenden Eindrücken– erzählt er in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».Host: Philipp LoserProduktion: Tobias Holzer Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch
Helfried Carl im Gespräch mit Vedran Džihić ANKOMMEN Sind wir bald da?Vom Flüchtling zum anerkannten Wissenschaftler: Vedran Džihić ist angekommen. Doch was braucht es, um den Neubeginn zu schaffen? Wann fühlen wir uns einer Gesellschaft wirklich zugehörig? Jänner 1993, Traiskirchen bei Wien: Hier kommt Vedran Džihić auf seiner Flucht vor dem Bosnienkrieg an. In Österreich fühlt er sich sicher, erlebt aber auch Gleichgültigkeit und Benachteiligung. Parallel zu seinem bemerkenswerten Bildungsaufstieg machen sich in Europa Populismus und Nationalismus breit. Geflüchtete und Migrant:innen werden immer mehr zur Gefahr stilisiert. Eindringlich beschreibt Vedran Džihić sein persönliches Ankommen und warnt vor der grassierenden Politik der Angst und Ausgrenzung. Wie geht unsere Gesellschaft mit „Anderen“ um? Was ist nötig, damit sich alle zuhause fühlen? Verdran Džihić wurde 1976 in Prijedor, Bosnien und Herzegowina, geboren. 2009 schloss er sein Doktorat in Politikwissenschaften an der Universität Wien ab. Heute ist er Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip) und unterrichtet an der Universität Wien. Džihić ist Initiator zahlreicher politischer und zivilgesellschaftlicher Initiativen in Österreich und Südosteuropa. Er gehört zu den gefragtesten Balkan Experten im deutschsprachigen Raum, kommentiert dazu in internationalen und nationalen Medien und veröffentlicht regelmäßig Essays. Helfried Carl, Diplomat, seit 2019 Partner des von ihm mitbegründeten Innovation in Politics Institute in Wien und Gründer der Initiative European Capital of Democracy. Von 2014-2019 war er Botschafter Österreichs in der Slowakischen Republik, davor, von 2008-2014, Büroleiter und außenpolitischer Berater von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer.
Dem Krieg trotzen: Das Sarajevo Filmfestival als Spiegel Bosniens
Das Sarajevo Filmfestival ist das grösste Filmfestival in Südosteuropa. Dies allein ist bemerkenswert. Denn entstanden ist das Festival mitten im Bosnienkrieg, während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Aufgrund dieser Geschichte will das Festival mehr sein als ein reines Filmfestival. Selbst von den grausamen Folgen von Krieg und Nationalismus betroffen, hat sich das Filmfestival neben einer kulturellen auch eine aufklärerische und politische Mission gesetzt. Es versteht sich als Ort des Austausches, als Ort, der den Dialog über Landesgrenzen hinweg in der gesamten Region fördert. Gerade jetzt, wo weltweit die Spannungen wieder zunehmen und auch auf dem Balkan die Rhetorik aggressiver wird, ist dieser Ansatz so aktuell wie lange nicht. Davon ist der Festivaldirektor Jovan Marjanovic überzeugt. Doch nicht nur am Filmfestival, in ganz Bosnien Herzegowina sind die Folgen des Krieges weiterhin überall spürbar. Das Land ist weiterhin gespalten zwischen den einzelnen Volksgruppen. Bosnien ist geografisch und politisch aufgeteilt zwischen muslimischen Bosniaken, katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Die meisten Parteien sind ethnisch definiert und verstehen sich als Verteidiger ihrer jeweiligen Volksgruppen. Dabei haben sich die Politiker aller Seiten längst ein Klientelsystem aufgebaut, das einzig ihrem Machterhalt dient. Die Situation scheint zerfahren. Viele verlassen daher das Land und suchen ihr Glück anderswo. Das Filmfestival gab den Bewohnerinnen und Bewohner Sarajevos in den dunkelsten Stunden der Stadtgeschichte Halt. Und es bietet noch immer jenen Hoffnung, die auf Dialog und Verständigung setzen. Es nimmt damit eine Gegenposition ein in einer Region, in welcher der Nationalismus zuletzt in vielen Ländern wieder stärker wurde.
Dem Krieg trotzen: Das Sarajevo Filmfestival als Spiegel Bosniens
Das Sarajevo Filmfestival ist das grösste Filmfestival in Südosteuropa. Dies allein ist bemerkenswert. Denn entstanden ist das Festival mitten im Bosnienkrieg, während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Aufgrund dieser Geschichte will das Festival mehr sein als ein reines Filmfestival. Selbst von den grausamen Folgen von Krieg und Nationalismus betroffen, hat sich das Filmfestival neben einer kulturellen auch eine aufklärerische und politische Mission gesetzt. Es versteht sich als Ort des Austausches, als Ort, der den Dialog über Landesgrenzen hinweg in der gesamten Region fördert. Gerade jetzt, wo weltweit die Spannungen wieder zunehmen und auch auf dem Balkan die Rhetorik aggressiver wird, ist dieser Ansatz so aktuell wie lange nicht. Davon ist der Festivaldirektor Jovan Marjanovic überzeugt. Doch nicht nur am Filmfestival, in ganz Bosnien Herzegowina sind die Folgen des Krieges weiterhin überall spürbar. Das Land ist weiterhin gespalten zwischen den einzelnen Volksgruppen. Bosnien ist geografisch und politisch aufgeteilt zwischen muslimischen Bosniaken, katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Die meisten Parteien sind ethnisch definiert und verstehen sich als Verteidiger ihrer jeweiligen Volksgruppen. Dabei haben sich die Politiker aller Seiten längst ein Klientelsystem aufgebaut, das einzig ihrem Machterhalt dient. Die Situation scheint zerfahren. Viele verlassen daher das Land und suchen ihr Glück anderswo. Das Filmfestival gab den Bewohnerinnen und Bewohner Sarajevos in den dunkelsten Stunden der Stadtgeschichte Halt. Und es bietet noch immer jenen Hoffnung, die auf Dialog und Verständigung setzen. Es nimmt damit eine Gegenposition ein in einer Region, in welcher der Nationalismus zuletzt in vielen Ländern wieder stärker wurde.
Bachmann-Preis 2024 für Tijan Sila und seinen Text "Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde". Er erzählt von einer bosnischen Familie nach dem Bosnienkrieg. "Man kann alles reparieren", beharrt der Vater. Aber das stimmt nicht. Tijan Silas Lesung und Ausschnitte aus der Jury-Diskussion"Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte, und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. 'Setz dich‘, sprach sie. 'Setz dich, wir müssen reden.‘ "Die Belagerung von Sarajevo begann 1992, die Familie in Tijans Silas Text hat sie erlebt und überlebt. Aber ihre Auswirkungen erstrecken sich bis 2007, bis zu dem "Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde" - und noch viel länger. In einem kurzen Vorgriff macht der Autor deutlich, dass er aus den 2020er Jahren heraus erzählt. Die Mischung aus "Wut und Wahn" wird zur andauernden Wirklichkeit, einer skurrilen, sogar lustigen und gleichzeitig abgründig grauenhaften Alltagswirklichkeit. Die Mutter versinkt in der Schizophrenie, der Vater stellt die Wohnung voll mit günstig gekauftem Elektroschrott. "Man kann alles reparieren", sagt er dazu. Der Bayern 2 Podcast "Buchgefühl - reden und lesen" in dieser Ausgabe mit der Lesung, für die es im Juni bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt den Bachmann-Preis gab. Dazu Ausschnitte aus der Jury-Diskussion. Moderation: Judith Heitkamp.
In dieser Folge sprechen wir mit Jasmina Hostert über ihren Weg aus dem Bosnienkrieg bis in den Bundestag. Sie erzählt, was es bedeutet, einen Arm durch eine Granate zu verlieren, warum die Einbürgerung für sie ein ganz besonderer Moment des Ankommens war – und dass es unbedingt mehr Kommunikation über Para-Sport-Angebote braucht. Ergänzender Link zu dieser Folge: Unabhängige Ansprechstelle Safe Sport https://ansprechstelle-safe-sport.de/
In dieser Folge spreche ich mit Mirsada Simchen-Kahrimanovic über ihr Buch 'Lauf Mädchen Lauf' und die Thematik des Bosnienkriegs. Wir diskutieren über die mangelnde Aufmerksamkeit für den Krieg und die Schwierigkeiten, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Mirsada gibt Ratschläge, wie man angemessen auf solche Themen reagieren kann und wie man Gutes tun kann. Sie betont die Bedeutung von Hoffnung und Vertrauen in schwierigen Zeiten. Außerdem sprechen wir über das politische Engagement junger Menschen und den Werdegang von Mirsada vom Autohaus zum Wirtschaftsgipfel. Hier bekommst du das Buch von Mirsada Simchen-Kahrimanović:https://yourbook.shop/books/27625959?ref=tobiandbooksHier kannst du Mirsada Simchen-Kahrimanović kontaktieren:https://www.instagram.com/mirsada_autorin/https://www.linkedin.com/in/mirsada-simchen-312850179/
«Radio Sarajevo» von Tijan Sila: In der Hölle der Belagerung
Der deutsche Autor Tijan Sila schildert in seinem aktuellen Roman «Radio Sarajevo», wie er in den 1990ern als Kind den Kriegshorror in der eingekesselten bosnischen Hauptstadt erlebt hat. Host Felix Münger überzeugt Silas «radikal subjektiver Blick» auf das Grauen von damals. Tijan Sila wurde 1981 im damals noch jugoslawischen Sarajevo geboren. Er war elf Jahre alt, als der Bosnienkrieg ausbrach und serbische Kräfte um seine Stadt einen Belagerungsring zogen: Knapp vier Jahre lang Hunger, Kälte, Krankheiten und anhaltender Beschuss. Mehr als 11'000 Menschen starben. Sila floh 1994 nach Deutschland. Im Podcast erzählt er, wie er die traumatischen Erlebnisse für Jahre verdrängte. Bis es ihm gelang, sich den quälenden Erinnerungen zu stellen. Und sie schliesslich zu diesem Buch zu verarbeiten, das durch die Augen des Kindes von damals zeigt, was Krieg Menschen antut – im zerfallenden Jugoslawien und anderswo. Dieses Buch steht im Zentrum der Folge: * Tijan Sila: Radio Sarajevo, Hanser Berlin 2023. Im Podcast zu hören sind: * Tijan Sila, Buchautor * Fana Asefaw, Psychiaterin Weiter erwähnte Bücher: * Ales Adamowitsch, Daniil Granin. Blockadebuch. Leningrad 1941-1944, Aufbau 2018. * Mina Hava. Für Seka. Suhrkamp, 2023. * Erich Maria Remarque. Im Westen nichts Neues. Kiepenheuer & Witsch. 8. Aufl. 2013.
Eine bittere Erkenntnis aus dem Bosnienkrieg wird plötzlich wieder relevant. Leseempfehlung: Bei seinem Besuch in Ghana hat Olaf Scholz Überraschendes erlebt: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100270812/scholz-in-ghana-fachkraefte-gewinnen-kann-das-gelingen-.html Den „Tagesanbruch" gibt es auch zum Nachlesen unter www.t-online.de/tagesanbruch Anmerkungen, Lob und Kritik gern an podcasts@t-online.de Den „Tagesanbruch“-Podcast gibt es immer Montag bis Freitag gegen 6 Uhr zum Start in den Tag. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie uns bei Spotify (https://open.spotify.com/show/3v1HFmv3V3Zvp1R4BT3jlO?si=klrETGehSj2OZQ_dmB5Q9g), Apple Podcasts (https://itunes.apple.com/de/podcast/t-online-tagesanbruch/id1374882499?mt=2), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90YWdlc2FuYnJ1Y2gucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw?ep=14) oder in Ihrer Lieblingspodcast-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gern eine Bewertung da. Am Wochenende diskutiert Chefredakteur Florian Harms mit weiteren Experten aus der t-online-Redaktion über ein aktuelles Thema im Podcast „Diskussionsstoff”. Diesen Podcast finden Sie über die folgenden Links bei Spotify (https://open.spotify.com/show/3ClozyyjHAhdKBGM4iiQD8), Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/podcast/id1686917996), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaXNrdXNzaW9uc3N0b2ZmLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM) oder YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL7bR88NaY8TSSS6oLqZ0nwmb68sWUMGQm). Abonnieren Sie den Podcast am besten gleich dort, um keine neuen Folgen zu verpassen. Alle Podcasts von t-online gibt es auf www.t-online.de/podcasts
Ricardo Muti zu Gast bei der Filharmonie Sarajevo zum 100. Geburtstag
Ein Konzert als Mission für Frieden und Menschlichkeit erscheint im Hinblick auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen und in der Ukraine erschreckend naheliegend. In Erinnerung an den Bosnienkrieg leitete Riccardo Muti am 11. Oktober das Festkonzert des philharmonischen Orchesters in Sarajevo. Trotz übervollem Terminkalender kam der Maestro für drei Tage extra aus New York nach Sarajevo. Kirsten Liese war bei Konzert und Proben dabei.
Massaker im Bosnienkrieg: Der Junge, der überlebte
Als 13-jähriger Junge erlebt Adnan Zec in seinem Heimatdorf Ahmići in Zentralbosnien wie seine Eltern von kroatischen Soldaten ermordet werden – weil sie bosnische Muslime sind. Mit Glück überlebt Adnan 1993 dieses kroatische Massaker, eines der schlimmsten des Bosnienkrieges zwischen 1992 und 1995. Genau 30 Jahre später kehrt Adnan nun zurück an den Ort des grausamen Verbrechens. ARD-Korrespondent Oliver Soos begleitet ihn und erzählt in dieser 11KM-Folge, wie Adnan als Überlebender und Zeuge vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gelernt hat, mit seinen Rachegefühlen umzugehen. Hier ist der Link zur ausführlichen Reportage von Oliver Soos: https://www.ardaudiothek.de/episode/ndr-info-hintergrund/bosnienkrieg-30-jahre-nach-dem-massaker-in-ahmici/ndr-info/12616753/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Linda Becker Mitarbeit: Marc Hoffmann Produktion: Jonas Teichmann, Alex Berge, Konrad Winkler Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge liegt beim NDR. ...und hier geht's zu “Was geht - was bleibt? Zeitgeist. Debatten. Kultur.” unserem Podcast-Tipp: https://www.ardaudiothek.de/episode/was-geht-was-bleibt-zeitgeist-debatten-kultur/ein-jahr-krieg-gegen-die-ukraine-wie-praegt-der-schrecken-die-menschen/swr2/12409335/
Adnan Zec war 13 Jahre alt, als er das schlimmste kroatische Massaker des Bosnienkrieges miterlebte: Kroatische Soldaten überfielen 1993 sein Heimatdorf Ahmići in Zentralbosnien, steckten die Häuser von Muslimen in Brand und töteten 116 Zivilisten. Darunter seine Eltern und seine jüngere Schwester. Das Kriegsverbrechen gilt als eines der grausamsten in diesem Konflikt - und als Tiefpunkt der ethnischen Säuberungen. Der heute 43-jährige Adnan wurde angeschossen und versteckte sich eine Woche lang in einem halb ausgebrannten Nachbarhaus. 30 Jahre nach dem Massaker hat unser Korrespondent mit dem heute 43-jährigen Adnan Zec sein Heimatdorf Ahmići besucht.
Das Massaker von Ahmici - Kroatisches Verbrechen im Bosnienkrieg
Adnan Zec überlebte das schlimmste kroatische Massaker des Bosnienkriegs: Vor 30 Jahren töteten Soldaten 116 Bosniaken im Dorf Ahmici in Bosnien-Herzegowina. Zum Jahrestag kehrt Zec ins Dorf zurück. Dort ist das Gedenken bis heute schwierig. Soos, Oliverwww.deutschlandfunk.de, HintergrundDirekter Link zur Audiodatei
Schon mehrfach schrieb Dževad Karahasanüber den Bosnienkrieg. "Tagebuch der Aussiedlung" hieß das Kriegstagebuch, mit dem er 1993 bekannt wurde. Nun, dreißig Jahre und einige Bücher und Preise später, erzählt er wieder von der Belagerung Sarajevos. "Einübung ins Schweben" heißt dieser meisterhafte Roman. Trotz allen Leids ein lebensfrohes Buch. Rezension von Cornelia Zetzsche. Übersetzt von Katharina Wolf-Grießhaber Suhrkamp Verlag, 304 Seiten, 25 Euro ISBN 978-3-518-43122-1
Die NBE reist mit Globetrotter Georgine Kellermann durch die Zeit und um die Welt! Von Duisburg in den 70er Jahren ins damalige Jugoslawien, nach Malta, Ruanda, Hongkong, über Washington in den 2000er und Paris zurück nach Essen, wo sie heute das WDR-Studio leitet. Nach mehreren Jahrzehnten aufregender Ereignisse blickt Georgine auf eine fulminante Karriere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Als Regional- und Auslandskorrespondentin für den WDR war sie immer am Zahn der Zeit: Arbeitskämpfe im Ruhrgebiet, der Bosnienkrieg und die Amtszeit Bill Clinton sind nur eine Handvoll der wichtigsten Ereignisse, über die sie hautnah berichtet hat. Geschichten kann die trans Aktivistin also eine ganze Menge erzählen und Nilz fühlt sich sehr geehrt, dass sie diese zur NBE mitgebracht hat.
30 Jahre nach dem Bosnienkrieg - Mostar: Die Angst vor einer neuen Eskalation
Auch 30 Jahre nach dem Bosnienkrieg ist Mostar, die größte Stadt im Süden Bosnien-Herzegowinas, eine geteilte Stadt. Es gibt kaum Kontakte zwischen Bosniaken und Kroaten, Schulunterricht findet getrennt statt. Anwohner fürchten eine neue Eskalation.Von Cornelius Wüllenkemperwww.deutschlandfunk.de, HintergrundDirekter Link zur Audiodatei
30 Jahre Bosnienkrieg - ehemalige Feinde begegnen sich
Govedarica, Srdjanwww.deutschlandfunk.de, HintergrundDirekter Link zur Audiodatei
Im Frühling 1992 begann der Krieg in Sarajevo. Rund vier Jahre kesselten bosnische Serben die Stadt ein. Mehr als 10.000 Menschen wurden getötet. Wie blicken die ehemaligen Soldaten heute auf den Krieg? Was ist geblieben vom Hass und der Kriegspropaganda? Zwei damals jugendliche Kämpfer blicken zurück. Srdjan Govedarica über die Begegnung ehemaliger Feinde.
Russland: Geschäfte gehen trotz Sanktionen weiter
Wie westliche Unternehmen immer noch in Russland Geschäfte machen. Und: Was die Aufklärung von Vergewaltigungen im Bosnienkrieg so langwierig macht.
30 Jahre Bosnienkrieg – die Wunden sind noch nicht verheilt
Im Frühling 1992 beginnt die Belagerung von Sarajevo. Insgesamt 1425 Tage lang kesseln bosnische Serben die Stadt ein - die längste Belagerung einer Stadt im 20. Jahrhundert. In SWR Aktuell Kontext porträtieren wir zwei Soldaten, die gegeneinander an der Front gekämpft haben. Damals Feinde sind sie heute beide Bürger der gleichen Stadt und treffen mit uns zum ersten Mal aufeinander.
30 Jahre Bosnienkrieg - Ehemalige Feinde begegnen sich
Im Frühling 1992 beginnt die Belagerung von Sarajevo. Insgesamt 1425 Tage lang kesseln bosnische Serben die Stadt ein – die längste Belagerung einer Stadt im 20. Jahrhundert. Wir porträtieren zwei Soldaten, die heute beide in Sarajevo wohnen und damals gegeneinander gekämpft haben. Der Bosniake Kemal Salaka war 1992 minderjährig, meldete sich aber freiwillig und kämpfte drei Jahre lang. Er hat inzwischen drei Kinder. Der ehemalige serbische Soldat heißt Srdjan Kenjic, bei Kriegsausbruch war er 21 Jahre alt. Auch er hat inzwischen Familie und lebt in dem Stadtteil von Sarajevo, der jetzt zum serbischen Landesteil gehört. Die beiden ehemaligen Feinde treffen zum ersten Mal aufeinander.
Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Parlamentswahlen statt. NUPES – die neue ökologisch-soziale Volksunion - reklamiert den Posten des Premiers für sich.Im Frühling 1992 begann die Belagerung Sarajewos und damit der Bosnien-Krieg.
30 Jahre Bosnienkrieg - ehemalige Feinde begegnen sich
Govedarica, Srdjanwww.deutschlandfunk.de, HintergrundDirekter Link zur Audiodatei
30 Jahre Bosnienkrieg - ehemalige Feinde begegnen sich
Govedarica, SrdjanDirekter Link zur Audiodatei
Bosnienkrieg: Handshake unter ehemaligen Feinden
Im Frühling 1992 beginnt die Belagerung von Sarajevo. Insgesamt 1.425 Tage kesseln bosnische Serben die Stadt ein – die längste Belagerung einer Stadt im 20. Jahrhundert. Srdjan Govedarica hat zwei Männer zusammengebracht, die sich einst bekämpften. Von Srdjan Govedarica.
Sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel
Schon jetzt gibt es Berichte aus der Ukraine, die ein schreckliches Bild zeichnen: Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen, aber auch Jungen und Männern kommen immer wieder vor. Sie gehören zu den zivilen Opfern des Krieges.Es ist kein neues Phänomen: Immer wieder bringen Kriege zivile Opfer hervor, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. In einigen Fällen, wie im Bosnienkrieg, konnten Gerichte nachweisen, dass Vergewaltigungen systematisch als Kriegsmittel eingesetzt wurden. In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Gesellschaftsredaktorin Aleksandra Hiltmann, wie und weshalb Vergewaltigungen in der Kriegsführung als Waffe eingesetzt werden. Wie das ganze Gesellschaften über Generationen betrifft – und welche juristischen Mittel Betroffenen zur Verfügung stehen. Host ist Mirja Gabathuler.Mehr zum Thema:Schon jetzt zeichnet sich ein schreckliches Bild ab: https://www.tagesanzeiger.ch/schon-jetzt-zeichnet-sich-ein-schreckliches-bild-ab-208729998004Den Tagi 30 Tage kostenlos testen: tagiabo.chTriggerwarnung: Diese Folge enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt und Gewalt im Krieg. Sollten Sie sich unwohl fühlen, Inhalte zu diesen Themen zu hören, überspringen Sie diese Folge. Ressourcen für Betroffene: torturevictims.ch, frauenberatung.ch, opferhilfe-schweiz.ch.
30 Jahre Bosnienkrieg - Ehemalige Feinde begegnen sich
Als 1992 in Bosnien und Herzegowina die Kämpfe begannen, waren viele fassungslos. Nun sollte man aufeinander schießen, obwohl man eben noch als Nachbarn zusammengelebt hatte? Zwei ehemalige Soldaten erinnern an den Wahnsinn, der Krieg heißt.Von Srdjan Govedaricawww.deutschlandfunkkultur.de, WeltzeitDirekter Link zur Audiodatei
Jasmina Hostert x Wolfgang Heim | Erzähl mir was Neues
Die Bilder aus dem Ukraine-Krieg erinnern die Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert an ihre eigene Kindheit im Krieg. In Sarajevo erlebte sie den Bosnienkrieg und floh mit ihrem Vater mit nach Deutschland, nachdem sie von einer Granate schwer verwundet wurde. In Sicherheit angekommen, startet sie ein neues Leben in Bonn, das Bleiberecht bleibt ihr trotz des schweren Traumas lange verwehrt. Heute ist Jasmina Hostert Bundestagsabgeordnete der SPD und sagt aufgrund ihrer Biografie: “Ich bin Pazifistin.” Die Waffenlieferungen in die Ukraine findet sie dennoch wichtig, denn sobald der Krieg erst ausgebrochen sei, helfe nicht nur Diplomatie. Im Gespräch mit Wolfgang Heim spricht Jasmina Hostert über die Parallelen zwischen ihrer Kriegserfahrung und den Geflüchteten heute, über die Unterstützung und den Neuanfang in Deutschland und warum sie schon immer in die SPD wollte.
West-Balkan-Politik steckt tief in der Sackgasse: Interview mit der Historikerin Marie Janie Calic
Ost- und Südosteuropa-Expertin Marie-Janine Calic über Parallelen zwischen Ukrainekrieg und Bosnienkrieg // "Oase der Straflosigkeit" an den Münchner Kammerspielen // Gespräch mit Max Mutze zur 2. Staffel der ARD-Musik-Talkshow "Lebenslieder" // Bilderbuch mit neuem Album "Gelb ist das Feld"
Im April 1992 eskaliert der Bosnienkrieg. Matthias von Hellfeld erzählt. Die passende Ausgabe “Eine Stunde History” läuft am 28. März 2022 auf DLFnova.
Im April 1992 eskaliert der Bosnienkrieg. Matthias von Hellfeld erzählt. Die passende Ausgabe “Eine Stunde History” läuft am 28. März 2022 auf DLFnova.
Bosnienkrieg - Die Belagerung Sarajevos
Der 5. April 1992 wird zum Schicksalstag der Stadt Sarajevo: Demonstrierende überqueren die Vrbanja-Brücke, unter ihnen sind auch Suada Dilberović und Olga Sučić. Die beiden jungen Frauen werden von Heckenschützen erschossen. Damit eskaliert der Konflikt zwischen Muslimen und orthodoxen Christen zu einem Krieg, der Tausende Opfer fordern wird. Ihr hört in Eine Stunde History: - Der Zeitungsjournalist Erich Rathfelder hat Anfang der 1990er Jahre für die taz aus Sarajevo berichtet und erinnert sich an die Lage in der eingeschlossenen Stadt.- Der Historiker Hajo Funke wirft dem Westen schwere Versäumnisse und Fehler während des Bosnienkrieges vor.- Der ARD-Korrespondent Srdjan Govedarica erläutert, wie sehr der Bosnienkrieg heute noch im Alltag der Menschen präsent ist.- Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld schildert die komplizierte ethnische, politische und religiöse Situation im ehemaligen Jugoslawien nach 1992- Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthis Jungblut erinnert an die Belagerung Sarajevos zwischen April 1992 und Februar 1996. ***********************Mehr History-Podcasts gibt es hier.***********************Deutschlandfunk Nova bei Instagram.
#52 Mentaltraining, Vorurteile gegenüber Ausländern und der Flucht vor dem Krieg - Darko Banovic
Darko Banovic erzählt von den neuen Kampf-Plänen, seinen Kindheitstraumata, sowie den Hindernissen seiner Familie während dem Bosnienkrieg und später in Wien.
Wed, 16 Feb 2022 08:10:10 +0000 https://surprisetalk.podigee.io/66-bosnien 18a2fdf37301fd6c876119f22811f2c9 Der Surprise Talk zum Surprise Strassenmagazin #519 Hundertausend Tote und zwei Millionen Vertriebene forderte vor dreissig Jahren der Bosnienkrieg. Bis heute gibt es viele offene Wunden. Am schlimmsten sind die Feindbilder. Klaus Petrus, Co-Redaktionsleiter des Strassenmagazins, sagt im Gespräch mit Simon Berginz, weshalb es ihn immer wieder zu Reportagen in das Land zieht. 66 full Der Surprise Talk zum Surprise Strassenmagazin #519 no Bosnien,Krieg,Feindbilder,Konflikte,Surprise Strassenmagazin Simon Berginz
Die Lage in Bosnien und Herzegowina ist so angespannt wie seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr. Der mächtige Serbenführer Milorad Dodik scheint die aus zwei Teilstaaten bestehende Republik zerstören und den serbischen Teil des Landes abspalten zu wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, greift er zu korrupten und brutalen Mitteln und gefährdet den zerbrechlichen Frieden, der in seinem Land seit dem Bosnienkrieg herrscht. ARD-Korrespondenten Anna Tillack und Srdjan Govedarica berichten in der neuen Folge des Weltspiegel-Podcasts von einem Land, das tief gespalten ist. Im Gespräch mit Fumiko Lipp außerdem Neven Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“. Er erzählt von Krieg, Auswanderung und dem Traum von einem neuen Miteinander.
Punk, Pfalz und Baseballschlägerjahre. In Tijan Silas Roman Krach geht es um den 18-jährigen Gansi, der eigentlich Sabahudin heißt. Er spielt Gitarre in einer Punkband und tourt durch versiffte autonome Zentren des vereinigten Deutschlands 1998 und muss sich dort mit Nazis herumschlagen. Gansis Eltern kommen aus Bosnien, er ist in Deutschland aufgewachsen. Sein älterer Bruder ist ein Chirurg und Bildungsaufsteiger, der sich daran stört, dass die Deutschen sich immer noch für was Besseres halten. Seine beiden kleinen Schwestern hören Tic Tac Toe und sind in der ersten Klasse sitzen geblieben. Seine Eltern haben einen Trödelladen, den sie aber lieber Antiquariat nennen. Gansi interessiert sich nicht sehr für seine Herkunft, denn er ist Punk und Punks don't give a fuck. Doch als Hikmet aus dem Bosnienkrieg in seine Klasse kommt, ist Gansi gezwungen, sich mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen. Mit Tijan Sila sprechen wir darüber, wie Identitäten und Zugehörigkeit Ende der 90er verhandelt wurden und warum er neben Deutsch und Bosnisch auch auf Pfälzisch schreibt.
Wir sind Pazifisten, aus gutem Grund. Aber was tut man, wenn Gewalt bereits geschehen ist? Eine schwierige Frage, über die es sich zu sprechen lohnt. Vielen nicht (mehr) so geläufig: Nach dem blutigen Bosnienkrieg 1992-1995 galt es den labilen Frieden zu sichern. Mit dabei auch erstmals seit dem 2. Weltkrieg die Bundeswehr und damit Deutschland. Ab 1996 waren 2600 Frauen und Männer im - auch für sie - ersten Auslandseinsatz der Geschichte der Bundesrepublik. Einer von Ihnen war unser Gesprächspartner Frank, zufälligerweise Johanns Vater. Er erzählt im zweiten Teil (ab 1h17min) von seinen Erfahrungen im sechsmonatigen Einsatz im kroatischen Trogir, einer Fahrt im Konvoi nach Sarajevo in Bosnien und Herzegowina, der Vor- und Nachbereitung in Deutschland und der gesellschaftlichen und politischen Stimmung zu dieser Zeit. Wir bedanken uns für den sehr persönlichen und nachdenklichen Bericht und freuen uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt, die Folge zu hören. Im ersten Teil sprechen wir über den Coronasommer 2021, Benedikts Arbeitsbelastung, die Grenzen der Migrationsforschung, die Macht des Dialogs und die Strapazen des Wakeboardens.
Lebenslang für Ratko Mladić. Aber der Völkermord von Srebrenica wirkt auch ein Vierteljahrhundert nach dem Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien weiter. Grausames Finale des bosnischen Bürgerkrieges war im Juli 1995 das Massaker von Srebrenica, bei dem serbische Soldaten mindestens 8372 Jungen und Männer exekutiert haben. Ratko Mladić hatte den Auftrag alle Bosniaken, bosnischen Muslime aus der Region zu vertreiben. Am Montag hat ein Berufungsgericht der Vereinten Nationen in Den Haag die Verurteilung von Mladić zu lebenslanger Haft bestätigt. Wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Beweise gegen Mladić waren überwältigend. "Ein anderes Urteil als lebenslänglich war nicht möglich", sagt SZ-Osteuropa-Korrespondent Florian Hassel. Doch mehr als 40 Kriegsverbrecher würden noch in Serbien offen leben. Selbst in den höchsten Kreisen der serbischen Politik seien sie noch heute vertreten. Nie kam es dort zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit - und so reiche auch die Leugnung von Kriegsverbrechen bis in die Spitzen der Politik auch der bosnischen Serben. Dabei seien sowohl Serbien als auch Bosnien-Herzegowina EU-Beitrittskandidaten. Bosnien-Herzegowina aber sei ein völlig dysfunktionaler Staat ohne Zentralregierung, sagt Hassel. Ein Staat, in dem nicht nur die Nachbarn Kroatien und Serbien mitmischen, sondern der auch durch Russland kaum regierbar gehalten werde. Auch die Aussöhnung der Volksgruppen habe keine Fortschritte gemacht, zieht Hassel eine ernüchterte Bilanz. Weitere Nachrichten: Neue Vorwürfe gegen Jens Spahn, Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn, US-Milliardäre zahlen kaum Steuern. Redaktion, Moderation: Lars Langenau Redaktion: Antonia Franz Produktion: Justin Patchett Zusätzliches Audiomaterial über BBC.
Mladić-Urteil I Drohende Bahnstreiks I Peru-Wahl I 0630
Premiere bei 0630: Jan und Minh Thu sind zusammen für euch am Start. Minh Thu springt heute für Caro ein und spricht mit Jan hierüber: Was das Urteil gegen den „Schlächter von Bosnien“ Ratko Mladić jungen Menschen aus Bosnien bedeutet (01:10) Warum die "Gewerkschaft der Lokomotivführer" wieder mit Streiks droht (07:10) Warum die Präsidentschaftswahl in Peru für viele eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist (10:30) Ihr habt Feedback oder einen Themenwunsch? Dann meldet euch an 0630@wdr.de oder schickt uns eine Sprachnachricht: 0151 15071635
Alems Geschichte ist die eines jugoslawischen Gastarbeiterkindes in Westdeutschland und gleichzeitig eine europäische Familiengeschichte mit vielen Facetten und Brüchen, die offenbart, wie viele Aspekte von Migration noch nicht erzählt worden sind.
Als Vierzehnjähriger kam Saša Stanišić mit seinen Eltern 1992 in Deutschland an, auf der Flucht vor dem Bosnienkrieg. Er lebte in einem Stadtteil von Heidelberg, lernte Deutsch, machte Abitur und begann, Deutsch als Fremdsprache und Slawistik zu studieren. Eine Aufenthaltsgenehmigung erhielt er, aber diese war gekoppelt an seine Tätigkeit als Schriftsteller, was, wie er in seinem Buch anmerkt, ihm nur recht war, denn er wollte sowieso nichts anderes tun. Vorgespult: 2019 erhält er für "Herkunft" den Deutschen Buchpreis für den besten Roman des Jahres. Darin erzählt Stanišić seine Lebensgeschichte in Form von Fragmenten, Anekdoten, Erinnerungen und Gedanken - und auch mit Abschweifungen, Mutmaßungen und was-wäre-wenn. Aber ist das überhaupt ein Roman? Und ist die allgemeine Begeisterung, die das Buch erhalten hat, in unseren Augen gerechtfertigt? Viel Spaß mit der neuen Folge! Kapitelmarken: 00:00 - Autor, zur Form, Prämisse und Aussagen 50:52 - Bewusste Sprache, Fazit, über den deutschen Buchpreis 1:15:16 - Ausblick Shownotes: Rede zum Gewinn des deutschen Buchpreises 2019 Nachtrag: Unser Tweet, wie Stephen King ES ausspricht. Saša Stanišić: Herkunft btb Verlag, 368 Seiten, 2019 Taschenbuch: 12 Euro E-Book: 9,99 Euro Die nächste reguläre freie Folge erscheint am 9. Februar 2021. Dann geht es um dieses Buch: Andrzej Sapkowski: Der letzte Wunsch (Vorgeschichte 1 zur Hexer-Saga) dtv Verlag, 384 Seiten, Ausgabe von 2020, dt. Erstausgabe 1998 Taschenbuch: 16 Euro E-Book: 12,99 Euro Unsere nächste Bonusfolge für Abonnent*innen erscheint sehr bald. Dann geht für Backer weiter mit: Dmitry Glulkhovsky: Metro 2033. Heyne, 816 Seiten, 2008, Ausgabe von 2012 Taschenbuch: 9,99 Euro E-Book: 9,99 Euro
Dayton-Abkommen von 1995 - Ein Frieden, der viele Konflikte auf dem Balkan nicht löste
Nach Tod und Flucht Hunderttausender und dem Völkermord von Srebrenica griff die internationale Gemeinschaft ein: 1995 vermittelten die USA das Abkommen von Dayton. Es beendete den Bosnienkrieg, doch viele Konfliktlinien blieben, entlang derer der Frieden bald wieder aufriss. Von Norbert Seitz www.deutschlandfunk.de, Hintergrund Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Dass Davor Ljubičić den Boden seines Ateliers als Palette benutzt macht die Betonfläche quasi selbst zum Bild. Schichten von Graphit und Ölfarbe lagern hier. Momentan ist alles komplett schwarz. Überall liegt zerbröselte Zeichenkohle, mit der Ljubičić gerade auf seinen großformatigen Papierbahnen zeichnet, die frei schwebend im Raum verteilt hängen. Seine Malereien und Zeichnungen sind wuchtige abstrakte Formengebilde. Vor fast 30 Jahren ist Davor Ljubičić, der in den 1980ern in Sarajevo Kunst studierte, vor dem Bosnienkrieg nach Konstanz geflüchtet. Seither ist er als Künstler und Dozent eng mit der Bodenseeregion verbunden. Für sein künstlerisches Gesamtwerk erhält er nun den Konstanzer Kunstpreis 2020.
"Solche wie wir dürfen in Österreich nur arbeiten, nicht studieren" - diesen und ähnliche Sätze hat Melisa Erkurt zuhauf gehört, seit sie als Kind vor dem Bosnienkrieg nach Österreich floh. Das Wiener Bildungssystem ist auf Schüler zugeschnitten, denen zuhause geholfen wird, und die fließend Deutsch sprechen. Doch viele Kinder mit Migrationshintergrund haben niemanden der sie unterstützt und darüber hinaus schwere sprachliche Defizite. Sie fallen immer weiter zurück, ohne Chance, jemals an eine Universität zu kommen oder ihre Träume zu verwirklichen. Ein Gespräch mit Melisa Erkurt, die den Beststeller "Generation Haram - Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben" geschrieben hat. Moderation: Andreas Rainer Produktion: Anna Muhr Gast: Melisa Erkurt
Goethepreis für Dževad Karahasan - "Wenn ich unter Freunden sein will, muss ich zum Friedhof"
Dževad Karahasan erhält den Goethepreis der Stadt Frankfurt. Seine Romane speisen sich aus der Erinnerung und kippen gern mal ins Fantastische. Sein Humor hat den Autor im Bosnienkrieg am Leben erhalten, ist aber stets melancholisch grundiert. Von Tobias Wenzel www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Über 8000 muslimische Bosniaken wurden im Juli 1995 von serbischen Truppen ermordet. Es handelt sich um das grösste Kriegsverbrechen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Weitere Informationen zum Thema: https://www.nzz.ch/international/die-muetter-von-srebrenica-ziehen-vor-den-europaeischen-gerichtshof-ld.1535323 Hörerinnen und Hörer von «NZZ Akzent» lesen die NZZ online oder in gedruckter Form drei Monate lang zum Preis von einem Monat. Zum Angebot: probeabo.nzz.ch/akzent
Gerade erst feierte Peter Schneider seinen 80. Geburtstag. Sogar der Bundespräsident gratulierte. Die große Feier aber musste wegen Corona ausfallen. Darüber spricht Peter Schneider mit Nadine Kreuzahler und liest aus seinem neuen Buch: „Denken mit dem eigenen Kopf“. In der Essaysammlung guckt Peter Schneider mit dem Blick von heute auf sein Geschriebenes aus den letzten 30 Jahren. Er legt seine Irrtümer offen – und geht auch mit denen anderer ins Gericht. Die Themen: der Mauerfall, der Bosnienkrieg, und natürlich: die 68er.
#012 - Melina Borčak - Bosnien-Krieg, Völkermordleugnung & fehlende Empathie
Das neue Interview mit der freien Journalistin & Filmemacherin Melina Borčak. Melina teilt mit uns ihre Erfahrungen aus und mit dem Bosnienkrieg, die Flucht nach Deutschland und die darauf folgende Abschiebung in das zerstörte Bosnien. Gemeinsam sprechen wir über die Gefahr, die die Leugnung von Völkermorden mit sich bringt, welch ein Standard dadurch gesetzt werden kann und vieles mehr.
Neues vom Ballaballa-Balkan Episode 32: Do the Dayton-Dance oder Noch mehr Ärger in Bosnien
Vor nicht ganz 25 Jahren wurde das kleine Städtchen Dayton im US-Bundesstaat Ohio plötzlich weltbekannt, als dort nach dreieinhalb Jahren endlich mit einem Abkommen der blutigste aller jugoslawischen Sezessionskriege beendet wurde: der Bosnienkrieg. 2020 hält dieses Abkommen - noch muss man wohl sagen. Denn diversen Politikern in Bosnien, geht dieser Vertrag gegen den Strich. Vor allem denjenigen, deren Macht er zumindest ansatzweise im Zaum hält. Und so sind Forderungen nach einer Revision von Dayton, dem Ende von Dayton oder im Gegenteil der Rückkehr zum ursprünglichen Dayton oft zu vernehmen - manchmal sogar aus dem Munde ein- und desselben Politikers. Krsto und Danijel schauen sich in dieser Episode an, was es mit diesem Dayton-Vertrag auf sich hat, wer sich daran stört und warum. Sie haben sich dazu etwas Hilfe geholt von Aleksandar Brezar vom "Sarajevo Calling"-Podcast. Nebenbei geht es heute auch noch in die Karibik, was etwas mit dem Kosovo zu tun hat - klingt merkwürdig und ist es auch. Außerdem feiern die beiden Moderatoren sich selbst und zeigen nebenbei noch ein bisschen Mitleid für Kroatiens Rechte. Ein ganz klein bisschen.
Krieg und Flucht. Mein Freund Izi und ich reden in dieser Folge über unser Leben als Kinder von Flüchtlingen.Wie sind unsere Familienmitglieder geflohen? Wie war das Leben unsrer Eltern zwischen Bürokratie und Angst abgeschoben zu werden? Diese Fragen beschäftigen uns und wir erzählen euch, wie sich der Krieg auf unser jetziges Leben ausgewirkt hat. Wäre unser Leben so, wie es jetzt ist, wenn es den Bosnienkrieg nicht gegeben hätte?
Eigentlich soll Großbritannien in nicht einmal zwei Wochen aus der EU austreten. Doch weil sich das Parlament in Großbritannien bisher nicht auf einen Austrittsvertrag einigen konnte, wurde der Brexit schon mehrfach verschoben. Wie stehen die Chancen, dass das britische Parlament dem neu ausgehandelten Deal diesmal zustimmt? Im Podcast berichtet ZEIT-ONLINE-Autorin Bettina Schulz aus London über den Stand der Verhandlungen beim EU-Gipfel – und ob nicht am Ende doch alles ganz anders kommt und die Briten in der EU bleiben. Am Wochenende steht die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt allen Interessierten offen. Kontrovers diskutiert wird die Auszeichnung von Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis. Kritiker werfen Handke eine unreflektierte Parteinahme für Serbien im Bosnienkrieg vor. Ist die Kritik berechtigt? Fragen an Kulturredakteur David Hugendick, der das Messegeschehen für ZEIT ONLINE beobachtet. Und sonst so? Das eigene Haustier essen oder Vegetarier werden? Moderation: Rita Lauter Mitarbeit: Diana Pieper, Mathias Peer
Willkommen am Tor zur Hölle! Grell und überlebensgroß darf es sein. Nicht alles Drachen, was Feuer speit, aber allerlei Gestalten menschlicher und monströser Natur natürlich. Das schaffen wir für die Sommershows sogar innerhalb von 60 Minuten, damit Ihr ein bisschen länger draußen im Sonnenfeuer schmoren dürft. Wir kündigten es ja bereits an: GODZILLA II wagte das Gefecht mit uns, ebenso die deutsche Wald- und Wiesenproduktion TAL DER SKORPIONE und die aus Wolfgang Petersens BOOT aufgetauchten Seeungeheuern. Kampf den Stereotypen, da kennen wir bei Deep Red Radio nix! Wieder von ganz unterschiedlicher Couleur waren unsere Segmente aus dem Heimkino, so etwa NO MAN'S LAND über den Bosnienkrieg anno 1993 – dank geht an Pandastorm Pictures für dieses tolle Re-Release, da freut sich nicht nur Benedikt. Und Max beginnt mit der Glückszahl 13 und seinem ersten PUPPET MASTER-Teil. Julia serviert Euch noch Rock, Love & Perestroika mit LETO… und man könnte die Titelliste um Verdammte, Verteufelte und Verknackte noch fortsetzen, wäre da nicht unser Max, der uns Deep Red Radionisten mit viel Amore aus dem Land von Soße und Spaghetti Geschenke mitbrachte. Fundstücke, Goodie Bags – Ihr wisst ja, bei uns bekommt Ihr immer ein schön geschnürtes Paket. Apropos: Dank Pandastorm bekamen wir Bill Watterson, den Regisseur von DAVE MADE A MAZE vors Mikrofon. Was für ein cooler Typ das ist, das hört Ihr demnächst nur hier! Und für Euch warten schon jetzt weitere Verlosungsexemplare dieses noch jungen Kultfilms! Checkt unsere Seite, auch hier bei Facebook und empfehlt uns weiter. Hier könnt Ihr nicht bloß Payback-Punkte sammeln, bei Deep Red Radio werdet Ihr monstermäßig belohnt!
Willkommen am Tor zur Hölle! Grell und überlebensgroß darf es sein. Nicht alles Drachen, was Feuer speit, aber allerlei Gestalten menschlicher und monströser Natur natürlich. Das schaffen wir für die Sommershows sogar innerhalb von 60 Minuten, damit Ihr ein bisschen länger draußen im Sonnenfeuer schmoren dürft. Wir kündigten es ja bereits an: GODZILLA II wagte das Gefecht mit uns, ebenso die deutsche Wald- und Wiesenproduktion TAL DER SKORPIONE und die aus Wolfgang Petersens BOOT aufgetauchten Seeungeheuern. Kampf den Stereotypen, da kennen wir bei Deep Red Radio nix! Wieder von ganz unterschiedlicher Couleur waren unsere Segmente aus dem Heimkino, so etwa NO MAN'S LAND über den Bosnienkrieg anno 1993 – dank geht an Pandastorm Pictures für dieses tolle Re-Release, da freut sich nicht nur Benedikt. Und Max beginnt mit der Glückszahl 13 und seinem ersten PUPPET MASTER-Teil. Julia serviert Euch noch Rock, Love & Perestroika mit LETO… und man könnte die Titelliste um Verdammte, Verteufelte und Verknackte noch fortsetzen, wäre da nicht unser Max, der uns Deep Red Radionisten mit viel Amore aus dem Land von Soße und Spaghetti Geschenke mitbrachte. Fundstücke, Goodie Bags – Ihr wisst ja, bei uns bekommt Ihr immer ein schön geschnürtes Paket. Apropos: Dank Pandastorm bekamen wir Bill Watterson, den Regisseur von DAVE MADE A MAZE vors Mikrofon. Was für ein cooler Typ das ist, das hört Ihr demnächst nur hier! Und für Euch warten schon jetzt weitere Verlosungsexemplare dieses noch jungen Kultfilms! Checkt unsere Seite, auch hier bei Facebook und empfehlt uns weiter. Hier könnt Ihr nicht bloß Payback-Punkte sammeln, bei Deep Red Radio werdet Ihr monstermäßig belohnt!
"Die leben einfach weiter, als ob wir nie existiert haben."
Wir müssen reden. Über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Über den Völkermord an den Bosniaken. Über Nationalismus und Faschismus in den Balkanstaaten. Melina Borčak ist freie Journalistin und hat unter anderem für CNN, die Deutsche Welle und den RBB gearbeitet. Ich hab sie bei Twitter gefunden, weil ich über einen ihrer Tweets gestolpert bin. Zufällig. Es war ein Tweet zum 6. Dezember 2018. Darin erinnert sie an den Geburtstag der Antifaschistischen Frauenfront Jugoslawiens. Antifaschistischen Frauenfront Jugoslawiens. In ihrem Tweet nennt sie acht Partisaninnen, die sich als Teil der Frauenfront im Zweiten Weltkrieg den Faschisten in den Weg stellten. Darunter ihre Ur-Großmutter Fatima. Wenn ich ehrlich bin: Ich habe noch nie zuvor davon gehört.
Als Jugendlicher wollte Adnan Softić (*1975 in Sarajevo) Architekt werden. Als der Bosnienkrieg ausbricht, folgt er seiner Schwester nach Hamburg und lebt die ersten Monate auf einem Flüchtlingsschiff. Von Anfang an trotzt er den Erwartungen, mit denen er sich als Bildender Künstler mit Migrationshintergrund konfrontiert sieht. Das bedeutet nicht, dass seine persönliche Geschichte keinen Einfluss auf seine Arbeit hätte. Seinen ersten Film («Festes Gewerbe oder Der Körper ist mein Tempel», 1999) dreht er im vom Krieg gezeichneten Sarajevo, und auch die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wasser und in exterritorialen Räumen wird in mehreren seiner künstlerischen Arbeiten verhandelt. Der Kurzfilm «Bigger Than Life» (2018), und das ein Jahr zuvor veröffentlichte Buch «A Better History / Eine bessere Geschichte» gehen direkt aus Softićs vertieften Auseinandersetzung mit dem monumentalen Bauvorhaben «Skopje 2014» hervor, anhand dessen der Künstler untersucht, wie eine Regierung – in diesem Fall die mittlerweile abgelöste Regierung Mazedoniens – für sich beansprucht, grosse Geschichte zu schreiben und eine (nationale) Erinnerung ohne jegliche archäologische Basis frei zu erfinden. Filmfiguren wie Vasil, der Nationalist, oder Jovana, die dem schleichenden Verlust der Vergangenheit von ihrem Küchenfenster aus zuschaut, vertreten unterschiedliche Standpunkte, die in Adnans Film genauso wie in Skopje nebeneinander bestehen. «Bigger Than Life» feierte dieses Jahr auf den 64. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen Premiere und wurde mit dem 3sat-Förderpreis ausgezeichnet. Adnan Softić ist der fünfte und letzte artist in residence, der im Rahmen von Esther Eppsteins Kunstprojekt «message salon embassy Zürich Nord» für elf Wochen zu Gast in der Wohnbaugenossenschaft «mehr als wohnen» im Hunzikerareal, Zürich Örlikon, war. Das Gespräch fand fand am 27. September 2018 statt und wurde von «message salon embassy» und Madame l'Ambassadeur Esther Eppstein koproduziert. https://www.kinolom.com http://messagesalon.ch
Kein Frieden ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit
1993 - mitten im Bosnienkrieg – nachdem Erzählungen von ethnischen Säuberungen im bosnischen Prijedor an der kroatischen Grenze die Runde machten, nahm der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien – ICTY - seine Arbeit in Den Haag auf. 25 Jahre später beendete der ICTY seine Arbeit 2017 und hinterlässt ein wegweisendes Kapitel für die internationale Rechtsgeschichte. Mandy Schielke war bei der Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit der Arbeit des ICTY beschäftigt hat. Foto: CC-BY 2.0 Michał Huniewicz / War damage on Sarajevo buildings (Flickr)
Kein Frieden ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit | Böll.Fokus
1993 - mitten im Bosnienkrieg – nachdem Erzählungen von ethnischen Säuberungen im bosnischen Prijedor an der kroatischen Grenze die Runde machten, nahm der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien – ICTY - seine Arbeit in Den Haag auf. 25 Jahre später beendete der ICTY seine Arbeit 2017 und hinterlässt ein wegweisendes Kapitel für die internationale Rechtsgeschichte. Mandy Schielke war bei der Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit der Arbeit des ICTY beschäftigt hat. Foto: CC-BY 2.0 Michał Huniewicz / War damage on Sarajevo buildings (Flickr)
Kein Frieden ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit | Böll.Fokus
1993 - mitten im Bosnienkrieg – nachdem Erzählungen von ethnischen Säuberungen im bosnischen Prijedor an der kroatischen Grenze die Runde machten, nahm der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien – ICTY - seine Arbeit in Den Haag auf. 25 Jahre später beendete der ICTY seine Arbeit 2017 und hinterlässt ein wegweisendes Kapitel für die internationale Rechtsgeschichte. Mandy Schielke war bei der Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit der Arbeit des ICTY beschäftigt hat. Foto: CC-BY 2.0 Michał Huniewicz / War damage on Sarajevo buildings (Flickr)
Kein Frieden ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit | Böll.Fokus
1993 - mitten im Bosnienkrieg – nachdem Erzählungen von ethnischen Säuberungen im bosnischen Prijedor an der kroatischen Grenze die Runde machten, nahm der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien – ICTY - seine Arbeit in Den Haag auf. 25 Jahre später beendete der ICTY seine Arbeit 2017 und hinterlässt ein wegweisendes Kapitel für die internationale Rechtsgeschichte. Mandy Schielke war bei der Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit der Arbeit des ICTY beschäftigt hat. Foto: CC-BY 2.0 Michał Huniewicz / War damage on Sarajevo buildings (Flickr)
Anläßlich des Spooktobers sprechen übers Doomsday Prepping. Shownotes Apokalypes Forschung Räuber Beute Beziehungen technologische Singularität Transhumanismus doomsday Argument Fermies Paradox AWS Terms of Service (§57.10) Überleben im Bosnienkrieg original (Englisch) In Deutschland ist es schwieriger an Antibiotika zu kommen, auch für Fische. Aber der Vollständigkeit halber: Fischantibiotika Kuhfuß Armbrust u.a. rechtliche Lage Zombie Survival Guide The Walking Dead Night of the living dead Notrationen Wasserfilter Mindesthaltbarkeit und Lagerung The Core
Moschee der Hoffnung: Versöhnung in Bosnien
Im bosnischen Banja Luka wird eine im Bürgerkrieg von Serben geschändete Moschee wiedereröffnet. In der bosnischen Stadt Banja Luka ist die historische Ferhadija-Moschee nach ihrem Wiederaufbau eingeweiht worden. Serben hatten das Gotteshaus 1993 im Bürgerkrieg gesprengt. Kemal Gunic hat sich jahrelang für den Wiederaufbau eingesetzt - hat Spenden gesammelt, die Aufbauarbeiten mit organisiert. Doch immer wieder kam es zu gewaltsamen Protesten serbischer Nationalisten, die die Moschee nicht in der Stadt haben wollten. Bei der Grundsteinlegung im Jahr 2001 musste Kemal Gunic mit ansehen, wie ein Bosniake gesteinigt wurde. Er hofft, dass es bei der feierlichen Eröffnung der Moschee nicht zu Ausschreitungen kommt. Denn eine friedliche Eröffnung wäre ein wichtiges Zeichen: für alle Muslime, die dem Frieden zwischen Serben und Bosniaken nicht trauen.
Das Massaker von Srebrenica gilt als das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Südosteuropa-Korrespondenten im ARD-Studio Wien haben das Geschehen in fünf sehr persönlichen Porträts aufgearbeitet.