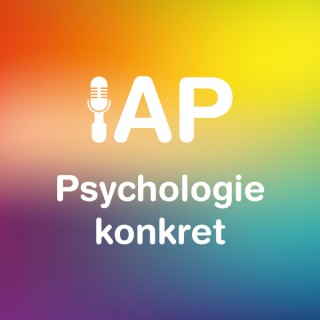Podcasts about schweizer bev
- 98PODCASTS
- 217EPISODES
- 32mAVG DURATION
- 1WEEKLY EPISODE
- Feb 24, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about schweizer bev
Latest podcast episodes about schweizer bev
Die weltweiten Militärausgaben haben 2,6 Billionen Dollar erreicht. Die Aufwendungen fürs Militär stiegen auch im vergangenen Jahr deutlich: um 13 Prozent. Das geht aus dem Standardwerk «The Military Balance» hervor, das jährlich vom Londoner Strategieinstitut IISS publiziert wird. Weitere Themen: vor genau vier Jahren hat Russland seinen Grossangriff auf die Ukraine gestartet. Anzeichen für ein baldiges Ende des Krieges gibt es nicht. Russland scheint kein Interesse daran zu haben und auf Zeit zu spielen. Wie populär ist die «Spezialoperation» in Russland noch? Ferien in die USA sind bei der Schweizer Bevölkerung aktuell nicht angesagt. Die Nachfrage nach Reise in die USA sei vergleichsweise gering, heisst es in der Reisebranche. Das hat mit Donald Trump zu tun, aber nicht nur.
Am 14. Juni kommt die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» der SVP zur Abstimmung. Die SP spricht von einer «Chaos-Initiative». Was aber hat sie Besseres zu bieten? Samira Marti, Co-Präsidentin der SP-Fraktion, nimmt Stellung. Die SVP will in der Bundesverfassung festschreiben, dass die Wohnbevölkerung der Schweiz die Zahl von 10 Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Die SP lehnt das kategorisch ab und hat im Parlament auch einen milderen Gegenvorschlag verhindert. Dies, obschon die Zuwanderung gemäss Umfragen seit Jahren zu den grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung gehört. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion wird in der «Samstagsrundschau» mit der Frage konfrontiert, ob ihre Partei diese Ängste nicht ernst nimmt. Zudem verrät Samira Marti, wie ihre Partei mit der Situation umgeht, dass der Bundesrat die Mehrwertsteuer nicht nur zur Finanzierung der 13. AHV-Rente, sondern auch zur Aufstockung des Armeebudgets erhöhen will. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion stellt sich den Fragen von Philipp Burkhardt. Ergänzend zum "Tagesgespräch" finden Sie jeden Samstag in unserem Kanal die aktuelle "Samstagsrundschau".
Redet die SP die Probleme mit der Zuwanderung klein, Frau Marti?
Am 14. Juni kommt die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» der SVP zur Abstimmung. Die SP spricht von einer «Chaos-Initiative». Was aber hat sie Besseres zu bieten? Samira Marti, Co-Präsidentin der SP-Fraktion, nimmt Stellung. Die SVP will in der Bundesverfassung festschreiben, dass die Wohnbevölkerung der Schweiz die Zahl von 10 Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Die SP lehnt das kategorisch ab und hat im Parlament auch einen milderen Gegenvorschlag verhindert. Dies, obschon die Zuwanderung gemäss Umfragen seit Jahren zu den grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung gehört. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion wird in der «Samstagsrundschau» mit der Frage konfrontiert, ob ihre Partei diese Ängste nicht ernst nimmt. Zudem verrät Samira Marti, wie ihre Partei mit der Situation umgeht, dass der Bundesrat die Mehrwertsteuer nicht nur zur Finanzierung der 13. AHV-Rente, sondern auch zur Aufstockung des Armeebudgets erhöhen will. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion stellt sich den Fragen von Philipp Burkhardt.
Milliarden für den Klimaschutz? Darum geht es bei der Klimafonds-Initiative
Im März stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Klimafondsinitiative ab. Diese will, dass der Bund bis zu neun Milliarden Franken jährlich in die Bekämpfung des Klimawandels steckt – deutlich mehr als bisher.Mit dem Geld wollen die Initiantinnen und Initianten Gebäude besser isolieren, Wärmepumpen einbauen oder den öffentlichen Verkehr ausbauen. Sie sehen darin einen notwendigen Schritt zum Schutz künftiger Generationen und zur Einhaltung der Pariser Klimaziele. Gegnerinnen und Gegner kritisieren vor allem die unklare Finanzierung und argumentieren, der Bund tue bereits genug für den Klimaschutz.Welche Argumente sprechen für und gegen die Initiative? Weshalb lehnt die GLP sie ab? Und warum haben Klimavorlagen an der Urne oft einen schweren Stand?Cyrill Pinto hat sich vertieft mit der Klimafonds-Initiative befasst und geht diesen Fragen in der neuesten Folge des täglichen Podcasts «Apropos» auf den Grund.Host: Alexandra AreggerProduzentin: Valeria MazzeoMehr zur Klimafonds-InitiativeCyrill Pintos Analyse zur Initiative: Was würde ein Klimafonds bringen? Und woher käme das Geld?Rösti und Mazzone liefern sich in der «Arena» Schlagabtausch Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Alles fährt Ski oder Schnee von gestern? – Philosophie der Piste
Skilager und Sportferien gehörten lange zur Schweiz wie Fondue und Ovomaltine, noch heute ist das Skifahren für viele Kulturgut. Über die Faszination und die Kehrseiten eines Sports, der die Schweiz geprägt hat. Noch immer verbringen in der Schweiz viele Kinder während der Schulzeit mindestens eine Woche in den Bergen, rund 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung fahren regelmässig Ski. Und wenn Ausnahmetalente wie Marco Odermatt oder Lara Gut die Piste runterbrettern, fiebert die Nation mit. Wie wurde Skifahren zum Kulturgut? Und weshalb werden Rennfahrerinnen und Rennfahrer immer schneller: Liegt es am Material oder am Können? Zu Gast sind die Skilegende Bernhard Russi, der auch als Architekt von Rennstrecken die Skiwelt über Jahrzehnte geprägt hat, und die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, die einst Skilehrerin werden wollte und Langlauf als Übung des Denkens versteht. Olivia Röllin fragt, worin der Reiz des Tempos besteht, wie Hightech-Sport zur Idee der unberührten Natur passt und ob Hundertstelsekunden im Abfahrtsrennen punkto Können wirklich einen Unterschied machen.
US-Präsident Donald Trump trifft heute am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos ein. Wichtige Mitglieder der US-Regierung sind bereits vor Ort und haben davor gewarnt, sich gegen Trumps Ansprüche auf Grönland zu wehren. Weitere Themen: Bereits 2018 soll die Gemeinde Crans-Montana die Unglücksbar «Le Constellation» aufgefordert haben, Verbesserungen beim Brandschutz vorzunehmen. Das zeigt eine Recherche des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS. Möglicherweise hat die Gemeinde danach nicht mehr kontrolliert, ob die Änderungen umgesetzt wurden. Was bedeutet Neutralität? Das beurteilt die Schweizer Bevölkerung offenbar pragmatischer als die Politik. Eine neue Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo zeigt: Ein Grossteil kann sich sogar vorstellen, die Ukraine direkt militärisch zu unterstützen.
Alles fährt Ski oder Schnee von gestern? – Philosophie der Piste
Skilager und Sportferien gehörten lange zur Schweiz wie Fondue und Ovomaltine, noch heute ist das Skifahren für viele Kulturgut. Über die Faszination und die Kehrseiten eines Sports, der die Schweiz geprägt hat. Noch immer verbringen in der Schweiz viele Kinder während der Schulzeit mindestens eine Woche in den Bergen, rund 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung fahren regelmässig Ski. Und wenn Ausnahmetalente wie Marco Odermatt oder Lara Gut die Piste runterbrettern, fiebert die Nation mit. Wie wurde Skifahren zum Kulturgut? Und weshalb werden Rennfahrerinnen und Rennfahrer immer schneller: Liegt es am Material oder am Können? Zu Gast sind die Skilegende Bernhard Russi, der auch als Architekt von Rennstrecken die Skiwelt über Jahrzehnte geprägt hat, und die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, die einst Skilehrerin werden wollte und Langlauf als Übung des Denkens versteht. Olivia Röllin fragt, worin der Reiz des Tempos besteht, wie Hightech-Sport zur Idee der unberührten Natur passt und ob Hundertstelsekunden im Abfahrtsrennen punkto Können wirklich einen Unterschied machen.
Zu Gast: Was es für eine mehrheitsfähige Klimapolitik braucht
In Umfragen fordert eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mehr Klimaschutz. Sobald aber konkrete Massnahmen zur Abstimmung kommen, sinkt die Zustimmung. Aus ökonomischer Sicht wäre eine umfassende CO₂-Abgabe die beste Variante. Doch wie kann man die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von dieser Lösung überzeugen? Oder sollten wir über andere Massnahmen nachdenken? Und ist die direkte Demokratie eine zu hohe Hürde für wirksame Klimapolitik? Darüber spricht Isabelle Stadelmann-Steffen in der Podcast-Folge. Die Professorin für Vergleichende Politik lehrt und forscht an der Universität Bern. Das Gespräch führt Patricia Schafer, Fellow bei Avenir Suisse. Jetzt reinhören! The post Zu Gast: Was es für eine mehrheitsfähige Klimapolitik braucht appeared first on Avenir Suisse.
Kirchen leeren sich, aber es keimt Neues auf | Livenet-Talk@Explo
Stimmt es, dass sich die Gotteshäuser entleeren und die Säkularisierung fortschreitet, oder gibt es Anzeichen eines neuen geistlichen Aufbruchs in den Kirchen? Zu diesen Fragen unternahm Livenet im Rahmen der Workshops an der Explo eine Spurensuche. Passend zur diesjährigen Allianzgebetswoche der Schweizer Kirchen werden diese Talks am 12. und am 15. Januar 2026 ausgestrahlt.Die Statistiken sind ernüchternd: Rund 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung gibt heute an, konfessionslos zu sein. Entsprechend kämpfen die Landeskirchen mit massiv rückläufigen Mitgliederzahlen. Bei den Freikirchen nimmt das Engagement ebenso ab, wenn auch weniger schnell. Wie gehen wir als Christen damit um? Darüber sprach Livenet-Chefredaktor Florian Wüthrich im Rahmen der Explo in Zürich mit je einem Vertreter der reformierten und der katholischen Landeskirche:Simon Weinreich ist ref. Pfarrer und leitet unter dem Dach der EMK Schweiz das Projekt www.netzkloster.ch.Nikola Baskarad ist Jugendarbeiter der Kath. Kirche Heilig Kreuz Zürich und Leiter des Gebetshauses Dietikon. Dieser Talk ist Teil einer Serie von Livenet-Talks, welche im Rahmen der Explo 2025 in Zürich aufgenommen wurden.Zum Buch von Stefan Schweyer: https://schweyer.ch/gemeinde-mit-mission/ oder an der Verlosung teilnehmen mit einem Email an: redaktion@livenet.chZum Interview mit Bettlers: https://www.hope-schweiz.ch/lebensgeschichten/spiritualitaet/80915_zwei_rubine_fuer_spiez_und_region
Alfred Angerer spricht mit Pascal Brack, Head of IT Services Digital Health bei der Schweizerischen Post, über die Digitalisierung in Schweizer Arztpraxen. Wie fragmentiert ist die IT-Landschaft im Gesundheitswesen? Welche KI-Lösungen unterstützen Ärzte bereits heute bei der Dokumentation? Und wie entwickelt sich das elektronische Gesundheitsdossier (EGD) weiter? Brack erklärt, warum die grösste Herausforderung darin besteht, die Schweizer Bevölkerung auf dieser digitalen Journey mitzunehmen, weshalb fliessende Daten die Grundlage für bessere Behandlungsqualität sind und was passieren muss, damit Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur geplant, sondern auch gelebt wird.
Schweiz macht dicht für Auswanderer? Die 10-Millionen-Initiative kommt (Abstimmung 2026)
Die Politik hat entschieden: UKW wird weitersenden. Die SRG will mit ihren Sendern zurückkehren. Am lautesten für UKW gekämpft hat der Radiopionier Roger Schawinski. Wird er nun leiser? 2025 war ein weiteres, schwieriges Jahr für den Journalismus. Die Zahl der Newsdeprivierten steigt. Rund 47% der Schweizer Bevölkerung haben kaum oder, wenn überhaupt, nur noch sporadischen Kontakt mit Nachrichtenjournalismus. Gleichzeitig ist die Zahl der journalistischen Stellen weiter gesunken und international steht die Pressefreiheit so stark unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir ziehen Bilanz. Und: der Hass in den Kommentarspalten. Erstmals misst ein Projekt die Zahl der verfassten Kommentare und erste Resultate zeigen: Der grösste Teil der Hassnachrichten stammt von wenigen Userinnen und Usern. Die Gäste im Medientalk: Valentin Rubin (Reporter ohne Grenzen) Susanne Wille (Direktorin SRG) Roger Schawinski (Radio 1) Laura Bronner (Public Discourse Foundation)
Podcasts oder Radio hören ist für den Grossteil der Menschen selbstverständlich. Konzerte besuchen, sich frei bewegen, sich mal kurz ein Ticket online kaufen – gehört oft einfach zum Alltag. Trotzdem geht das nicht für alle. Rund 21% der Schweizer Bevölkerung haben eine Beeinträchtigung. Max Hummler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Orte zu schaffen, die für alle Menschen zugänglich sind, mit oder ohne Beeinträchtigung.
Live: Die Folgen des Kriegs im Nahen Osten
Am 11. Oktober dieses Herbsts eskaliert in Bern eine unbewilligte Pro-Palästina-Demo . Sie endet in wüsten Szenen, in Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei.An diesem 11. Oktober ist zum ersten Mal so richtig zum Ausdruck gekommen, was dieser Konflikt auch mit der Schweizer Bevölkerung macht. Welche gesellschaftlichen und politischen Gräben er auch hier aufgerissen hat.Was ist seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 im Nahen Osten passiert? Was in der Schweiz? Warum löst dieser Konflikt so viel aus? Wie gehen wir damit um? Und welche Perspektiven gibt es jetzt in Gaza?Gegen Ende dieses Jahres beschäftigte sich «Apropos» nochmals mit den grossen Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten. Am Montagabend empfingen die Hosts Alexandra Aregger und Philipp Loser live auf der Bühne im Zürcher Kaufleuten Tagesleiterin und Inlandredaktorin Anja Burri und Auslandchef Christof Münger zum Gespräch. Die Aufzeichnung des Livegesprächs hören Sie jetzt als neue Folge des täglichen Podcasts «Apropos».Hosts: Alexandra Aregger und Philipp LoserProduzent: Noah Fend Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung des Bundesamts für Statistik fühlen sich gut 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung manchmal bis häufig einsam. In der Adventszeit wird dieses Gefühl oft noch verstärkt. Doch das muss nicht sein. In der Sendung «Treffpunkt» stellen wir Projekte vor, die es Menschen, die sich einsam fühlen, ermöglicht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Wir besuchen das Café Solino in Zürich, wo nicht nur Kaffee, sondern auch Gespräche und Begegnungen Trumpf sind und wir stellen das Freiwilligen-Projekt «Tim - Tandem im Museum» vor. Eine einfache Möglichkeit, mit einer «Timlerin» oder einem «Timler» zu zweit und kostenlos eines der 160 Museen in der Schweiz zu besuchen, die bei diesem Projekt mitmachen. Zudem geben unsere Hörerinnen und Hörer Tipps, was man sonst noch alles unternehmen kann, um die «schönste Zeit im Jahr» auch als solche zu erleben. Im Austausch und Kontakt mit anderen. Etwas, das uns nachweislich gut tut.
Bei einer Kundgebung 2017 in Bern zeigten Demonstrierende ein Transparent mit der Aufschrift «Kill Erdogan». Nun bestätigt das Bundesgericht: Die vom Berner Obergericht verhängten Geldstrafen gegen vier Personen wegen des Mitführens des Transparents sind rechtskräftig. Weitere Themen: Die steigenden Krankenkassenprämien sind eine der Hauptsorgen der Schweizer Bevölkerung. Deren Stimme findet in den Verhandlungen aber kaum Gehör. Dagegen formiert sich allmählich Widerstand. So auch an einer Tagung in Bern. Die Waadtländer Regierung will nächstes Jahr insgesamt 300 Millionen Franken einsparen. Die Einsparungen treffen vor allem Schulen, Spitäler, Heime und Sozialdienste. Kampflos wollen die Staatsangestellten den Sparentscheid aber nicht hinnehmen.
News-Müdigkeit in der Schweiz: Warum immer mehr abschalten
«In den Nachrichten kommt so viel Negatives – das tut mir nicht gut», sagt Susanne. Sie liest keine Zeitung mehr, hört keine Nachrichten am Radio und schaut keine News am Fernseher. Damit ist sie nicht allein: Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gilt laut einer neuen Studie der Universität Zürich als News-depriviert.Medienforscher Marc Eisenegger warnt: «Das Resultat ist demokratiepolitisch sehr problematisch – News-Deprivierte wissen weniger und nehmen seltener am demokratischen Prozess teil.»Warum wenden sich so viele vom Nachrichtengeschehen ab? Welche Rolle spielen Social Media, Negativität und Überforderung? Und wie kann man News-müde wieder erreichen?Antworten auf diese Fragen hat Denise Jeitziner, Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat mit News-Deprivierten gesprochen und berichtet darüber in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Host: Alexandra AreggerProduzentin: Jacqueline WechslerLinks zur Folge:Hier geht's zum Artikel von Denise JeitzinerHier zur Studie der Universität ZürichHier unsere Alternativen gegen den News-Frust Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Das Jahrbuch des Forschungszentrums für Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich zeigt: Die publizistische Qualität der Schweizer Medien bleibt stabil. Nur interessiert das immer weniger Leute. Demnach zählen fast 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu den News-Deprivierten.
Über ein Drittel der Schweizer Bevölkerung leidet an Schlaflosigkeit. Schlafforscher Albrecht Vorster vom Inselspital Bern warnt vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Der Bundesrat prüft deshalb, die Prävention von Schlafstörungen in die nationale Gesundheitsstrategie aufzunehmen. Der Leidensdruck durch gestörten Schlaf ist in der Schweizer Bevölkerung sehr hoch und die gesundheitlichen sowie wirtschaftlichen Folgen von Schlafstörungen sind erheblich. 2022 waren durchschnittlich 32,4 % der Bevölkerung von Schlafstörungen betroffen. Der Ständerat hat eine Motion angenommen, welche den Bundesrat auffordert, das Thema Schlafstörungen in die Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) zu integrieren, was der Nationalrat in der Herbstsession ablehnte. Auch der Bundesrat hat die Aufnahme von Schlafstörungen in den aktuellen Massnahmenplan abgelehnt, ist aber bereit, das Thema ab 2029 wieder zu prüfen und in die Gesundheitsstrategie aufzunehmen. Abrecht Vorster, Neurobiologe und Schlafforscher am Inselspital in Bern kritisiert, dass Schlafstörungen in der Schweiz zu selten behandelt werden. Er ist zu Gast bei David Karasek.
Hauchdünnes Ja zur E-ID: Misstraut die Bevölkerung der Politik?
Rund 20'000 Stimmen haben bei der Abstimmung über die E-ID den Ausschlag für ein Ja gegeben. Das Resultat wird als Misstrauensvotum der Schweizer Bevölkerung gegenüber dem Bund interpretiert. Doch Wirtschaft und Politik sehen noch andere Gründe für das knappe Ergebnis. Weitere Meldungen: · Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts: Warum war das Ergebnis so deutlich? · Die Europäische Umweltagentur lobt die Schweiz für die Verbesserung bei Artenvielfalt und Luftqualität. · Parlamentswahlen in Moldau: Das Volk bestätigt den proeuropäischen Kurs.
Am Mittwochabend ist in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon eine Standseilbahn entgleist. Mindestens 15 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Standseilbahn, die verunfallt ist, ist die historische Bahn «Elevador da Gloria». Die Bahn ist bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Weitere Themen in dieser Sendung: · Die Zufriedenheit der Schweizer Bevölkerung ist gross, der Blick in die Zukunft macht einigen aber Sorgen. Das zeigt die dritte grosse SRG-Umfrage «Wie geht's, Schweiz?». · Dänemark nimmt künftig CO2 aus der Schweiz entgegen und lagert es im Boden ein. Die beiden Länder haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen. · Im Bündner Dorf Maienfeld soll ein Platz nach dem neuen Schwingerkönig Armon Orlik benannt werden. Orlik ist am Mittwoch in seiner Heimat Maienfeld von tausenden Menschen gefeiert worden.
Seit sieben Jahren sollten in der Schweiz neue Aufklärungsdrohnen im Einsatz sein. Trotz Millioneninvestitionen stieg bisher aber keine einzige der sechs israelischen Drohnen in den Himmel. Dennoch hält VBS-Chef Martin Pfister am Drohnenprojekt fest. Weitere Themen: Wie geht es der Schweizer Bevölkerung? Der neue Nationale Gesundheitsbericht zeigt: Die Hälfte der Menschen ist einmal im Leben auf Hilfe wegen psychischer Probleme angewiesen. Die psychische Gesundheit geht also alle etwas an. Wegen rassistischer und sexistischer Chat-Nachrichten sind in Lausanne mittlerweile acht Polizisten vom Dienst suspendiert. Der Skandal in der Lausanner Polizei erschüttert auch die Polizeikorps in anderen Kantonen. Was tun diese in Sachen Prävention?
Stille Krise im Büro: Mentale Gesundheit in der Leistungsgesellschaft
Neuste Studien zeigen: Über ein Viertel der Schweizer Bevölkerung hat psychische Probleme. In Deutschland sind es sogar über ein Drittel. Viele können die Belastungen am Arbeitsplatz nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr bewältigen. Im Podcast spricht Prof. Dr. Imke Knafla darüber, was passiert, wenn wir ausgebrannt sind. Warum viele die Warnzeichen ignorieren und weiter machen, bis sie krank werden. Wie Organisationen eine gesundheitsbewusste Kultur entwickeln können. Und welchen Beitrag Führungspersonen dazu leisten müssen. Reinhören lohnt sich. Weiterführende Links https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/knaf https://www.linkedin.com/in/imke-knafla-30622547/ https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/gund https://www.linkedin.com/in/ellen-gundrum
Weil das Geld für Investitionen in teure Hochgeschwindigkeitszüge knapp ist, will die SBB für den internationalen Personenverkehr diese Züge leasen. Damit muss die SBB weniger Geld aufwerfen. Sie betritt damit allerdings auch Neuland. Weitere Themen: · Eine repräsentative Umfrage zeigt: 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung steht hinter der Gleichstellung für Schwule, Lesben und Transmenschen. · Das israelische Militär hat sich zu einem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen geäussert. Nach eigenen Angaben galt der Angriff einer Überwachungskamera. Die palästinensische Seite berichtet hingegen, dass dabei 20 Menschen ums Leben gekommen seien, darunter fünf Medienschaffende.
Rund 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung leidet an Kaufsucht, zeigt eine Umfrage. Der Leidensdruck ist gross, Betroffene schämen sich. In unserer Sommerserie «Espresso to go!» erzählt eine mutige Betroffene, wie sie die Erkrankung erlebt. Und wir fragen: Was hilft?
Regnet es morgen? Oder scheint in drei Tagen die Sonne? Erreicht uns ein Hochdruckgebiet? Zentrale Fragen im Arbeitsalltag von Simon. Der Medien-Meteorologe ist Teil des Teams von SRF Meteo und gibt der Schweizer Bevölkerung im Fernsehen regelmässige Prognosen zur Wetterlage.
Viele empfinden den blühenden Frühling mehr als Plage denn als Freude, weil Pollen häufig Heuschnupfen auslösen. Diese Medikamente, Mittel und Methoden lindern Allergie-Symptome. Wenn es Sie juckt, beisst und brennt, sobald Gräser, Bäume oder Wiesen blühen gehören Sie zu den 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit einer Pollen-Allergie. Die einzige Therapie, die das Problem an der Ursache bekämpft ist eine Desensibilisierung, eine Immuntherapie. Mit Tabletten oder Spritzen will man das Immunsystem davon wegbringen, bei eigentlich harmlosen Stoffen aus der Umwelt mit Antikörpern zu reagieren. Eine Immuntherapie dauert etwa drei Jahre und ist schon bei Kindern möglich. Ganz allergie-frei wird man auch damit nicht, aber: «Etwa 80 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind zufrieden und sagen, sie können wieder draussen Sport machen», sagt die Andrina Neff vom Kantonsspital St Gallen. Wer trotz Heuschnupfen Zeit in der Natur verbringen möchte, dem empfiehlt die Allergologin Antihistaminika. Wer stark unter Heuschnupfen leidet, könne Antihistamin-Tabletten sogar täglich nehmen oder kortisonhaltige Nasensprays und Asthma-Inhalatoren nutzen. Wer alternative Heilmethoden ausprobieren möchte: Nach der evidenzbasierten Medizin gibt es keinen Beweis, dass z.B. Akupunktur oder Hypnose wirken. Das sei aber sehr individuell, sagt Andrina Neff und die Studienlage noch dünn. Eine Herausforderung für Studien zu Heuschnupfen: Der Pollenflug ist jedes Jahr anders. Auch die Klimaerwärmung verstärkt den Anstieg der Pollen-Allergie, weil mehr Pollen, längere Zeit in der Luft sind.
Die Schweiz sagt, es gebe einen Fixpreis für die bestellten F-35A-Flugzeuge. Die USA sagen, die Schweiz habe das falsch verstanden. Wie kann diese Patt-Situation gelöst werden? Das Aussendepartement hat den Lead bei den anstehenden Gesprächen. Fragen an Staatssekretär Alexandre Fasel. Bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer könnte der Kampjet-Deal für die Schweiz werden, das hat Verteidigungsminister Martin Pfister diese Woche kommuniziert. Grund ist ein Missverständnis zwischen der Schweiz und den USA. Um dieses aufzuklären, hat das Aussendepartement EDA Gespräche mit den amerikanischen Verantwortlichen aufgenommen. Was ist das Ziel dieser Gespräche? Und wieso muss das EDA ausbaden, was das Verteidigungsdepartement verpasst hat? Die Beziehung mit den USA kümmert Staatssekretär Alexandre Fasel auch in anderen Bereichen. Vor zehn Tagen traf er sich mit dem US-Vizeaussenminister Christopher Landau. Unter anderem zum Thema des US-Schutzmachtmandates der Schweiz in Iran. Wie offen ist der Austausch? Und wie gut kann die Schweiz das Schutzmachtmandat ausüben, ohne die Botschaft in Teheran offen zu halten? Ein Erfolg konnte Staatssekretär Alexandre Fasel im Europa-Dossier verbuchen: Jetzt liegt das Vertragswerk zwischen der Schweiz und der EU auf dem Tisch. Doch innenpolitisch sind die Bedenken noch gross. Wie will er die Schweizer Bevölkerung von den EU-Verträgen überzeugen? Und was wäre bei einem Nein an der Urne? Staatssekretär Alexandre Fasel ist Gast in der «Samstagsrundschau» bei Eliane Leiser. Ergänzend zum «Tagesgespräch» finden Sie jeden Samstag in unserem Kanal die aktuelle «Samstagsrundschau».
Gibt es eine diplomatische Lösung beim Kampfjet, Herr Fasel?
Die Schweiz sagt, es gebe einen Fixpreis für die bestellten F-35A-Flugzeuge. Die USA sagt, die Schweiz habe das falsch verstanden. Wie kann diese Patt-Situation gelöst werden? Das Aussendepartement hat den Lead bei den anstehenden Gesprächen. Fragen an Staatssekretär Alexandre Fasel. Bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer könnte der Kampjet-Deal für die Schweiz werden, das hat Verteidigungsminister Martin Pfister diese Woche kommuniziert. Grund ist ein Missverständnis zwischen der Schweiz und den USA. Um dieses aufzuklären, hat das Aussendepartement EDA Gespräche mit den amerikanischen Verantwortlichen aufgenommen. Was ist das Ziel dieser Gespräche? Und wieso muss das EDA ausbaden, was das Verteidigungsdepartement verpasst hat? Die Beziehung mit den USA kümmert Staatssekretär Alexandre Fasel auch in anderen Bereichen. Vor zehn Tagen traf er sich mit dem US-Vizeaussenminister Christopher Landau. Unter anderem zum Thema des US-Schutzmachtmandates der Schweiz in Iran. Wie offen ist der Austausch? Und wie gut kann die Schweiz das Schutzmachtmandat ausüben, ohne die Botschaft in Teheran offen zu halten? Ein Erfolg konnte Staatssekretär Alexandre Fasel im Europa-Dossier verbuchen: Jetzt liegt das Vertragswerk zwischen der Schweiz und der EU auf dem Tisch. Doch innenpolitisch sind die Bedenken noch gross. Wie will er die Schweizer Bevölkerung von den EU-Verträgen überzeugen? Und was wäre bei einem Nein an der Urne? Staatssekretär Alexandre Fasel ist Gast in der «Samstagsrundschau» bei Eliane Leiser.
Einkäufe im Ausland bei Schweizer Bevölkerung beliebt, Schluss mit sozialen Medien für australische Kinder, die Schweizer Fussballerinnen mussten lange um ihren Platz kämpfen
In der Nacht zum Sonntag haben die USA iranische Atomanlagen bombardiert. Derweil setzt Israel seine Luftangriffe gegen den Iran fort. Die Schweiz als Schutzmacht der USA im Iran evakuierte die Botschaft in Teheran, was Aussenpolitikerinnen- und politiker nicht nur erfreut. Weitere Themen: Dieser Tage flüchten viele Menschen ans kühle Nass oder in die Höhe. Besonders beliebt sind die Berge: Nicht nur bei ausländischen Gästen, sondern gerade auch bei der Schweizer Bevölkerung. Grund dafür ist nicht nur das Klima, sondern auch ein gewisser Corona-Effekt. Im Val de Bagnes im Unterwallis haben Gesteinsmassen Anfang Juni zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres eine Brücke mitgerissen und das Dorf Lourtier von der Umwelt abgeschnitten. Dort schwankt man zwischen Sorgen, Ärger und Gleichmut.
Schweizer Bevölkerung wächst 18-mal schneller als in Deutschland – Weltwoche Daily CH
Werden Sie JETZT Abonnent der Weltwoche. Digital nur CHF 9.- im ersten Monat. https://weltwoche.ch/abonnemente/Aktuelle Ausgabe der Weltwoche: https://weltwoche.ch/aktuelle-ausgabe/KOSTENLOS: Täglicher Newsletter https://weltwoche.ch/newsletter/App Weltwoche Schweiz https://tosto.re/weltwocheDie Weltwoche: Das ist die andere Sicht! Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.Schweizer Bevölkerung wächst 18-mal schneller als in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Václav Klaus. Egerkinger Mehrfachmord. Parlamentssession. Eindrücke aus Sankt PetersburgDie Weltwoche auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/weltwoche/Twitter: https://twitter.com/WeltwocheTikTok: https://www.tiktok.com/@weltwocheTelegram: https://t.me/Die_Weltwoche Facebook: https://www.facebook.com/DIE.WELTWOCHE Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Zucker: So sehr schadet er unserem Körper wirklich
Zucker steckt nicht nur in Süssigkeiten oder vielen Getränken wie Coca Cola, Fanta oder Eistee. Quasi in allem was wir essen, ist Zucker drin. Und davon konsumiert die Schweizer Bevölkerung zu viel. Im Schnitt essen wir knapp 90 Gramm Zucker pro Tag – die WHO empfiehlt, 25 bis 50 Gramm nicht zu überschreiten.Nun will der Bundesrat klarere Regeln, wie viel Zucker in welchem Lebensmittel sein darf. Ein Vorhaben, das im Parlament umstritten ist. Denn es stellt grundsätzliche Fragen wie: Wie sehr soll der Staat für gesundes Essen sorgen? Oder wie sehr geht das nur uns selbst etwas an?Über die politische – und zugleich emotionale – Diskussion rund um Zucker spricht Jacqueline Büchi, Leiterin des Ressorts «Reportagen und Storytelling», in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».Host: Mirja GabathulerGast: Jacqueline BüchiProduktion: Tobias Holzer und Sara SpreiterMehr zum Thema: Interview mit Zucker-Forscher: «Das Schlechteste vom Schlechten sind Süssgetränke»Wie viel Zucker ist zu viel? Joghurts und Getränke sollen noch weniger süss werden Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: podcast-abo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch
Die sozialen Medien gelten als Brandbeschleuniger: es wird verurteilt, gehasst und gehetzt. Sich dagegen zu wehren ist schwierig bis unmöglich, das Netz hat seine eigenen Gesetze. Damit werden Anfeindungen im Netz zunehmend zu einer Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Im Internet wird gehasst und gehetzt, die Methoden erinnern zuweilen ans Mittelalter: Menschen werden an den Pranger und öffentlich blossgestellt. Anstelle einer rechtlichen tritt eine moralische Gerichtsbarkeit, es gibt keine Unschuldsvermutung und kein rechtliches Gehör. Mit dem Argument der Meinungsfreiheit soll im Netz alles gesagt werden dürfen, obschon allein das Teilen oder Liken von hasserfüllten Kommentaren strafbar sein kann. Davon betroffen können alle sein. Ob Bäuerin auf dem Land, queere Person in der Stadt oder Lokalpolitikerin. Der Hass findet seine Opfer und Verbündete im Netz. Gleichwohl zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo: Eine grosse Sorge der Schweizer Bevölkerung ist, dass die Anfeindungen im Netz einer offenen Gesellschaft schaden können.
Die sozialen Medien gelten als Brandbeschleuniger: es wird verurteilt, gehasst und gehetzt. Sich dagegen zu wehren ist schwierig bis unmöglich, das Netz hat seine eigenen Gesetze. Damit werden Anfeindungen im Netz zunehmend zu einer Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Im Internet wird gehasst und gehetzt, die Methoden erinnern zuweilen ans Mittelalter: Menschen werden an den Pranger und öffentlich blossgestellt. Anstelle einer rechtlichen tritt eine moralische Gerichtsbarkeit, es gibt keine Unschuldsvermutung und kein rechtliches Gehör. Mit dem Argument der Meinungsfreiheit soll im Netz alles gesagt werden dürfen, obschon allein das Teilen oder Liken von hasserfüllten Kommentaren strafbar sein kann. Davon betroffen können alle sein. Ob Bäuerin auf dem Land, queere Person in der Stadt oder Lokalpolitikerin. Der Hass findet seine Opfer und Verbündete im Netz. Gleichwohl zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo: Eine grosse Sorge der Schweizer Bevölkerung ist, dass die Anfeindungen im Netz einer offenen Gesellschaft schaden können.
Seit über 40 Jahren kämpft die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gegen den türkischen Staat. Nun hat der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen und die PKK aufgefordert, sich aufzulösen. Weitere Themen: Musliminnen und Muslime werden in der Schweiz oft benachteiligt. Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat Vorbehalte ihnen gegenüber. Eine aktuelle Studie des Bundes zeigt nun das Ausmass des antimuslimischen Rassismus und schlägt Massnahmen vor. Unter dem Titel "Romance Scam. Wahre Liebe kostet nicht" lancieren die Schweizerische Kriminalprävention und die kantonalen und städtischen Polizeikorps Anfang März eine Kampagne gegen Liebesbetrug im Internet. Laut der Polizei agieren die meisten Täter professionell und aus dem Ausland. Der Kanton Zürich schickt Sexualstraftäter in ein Lernprogramm, so wie das schon verschiedene andere Kantone auch tun, zum Beispiel Basel. Dank der Lernprogramme sollen Rückfälle verhindert werden.
(00:00:41) Helena Hefti hat buchstäblich einen «coolen» Job. Sie bietet Atem- und Kältetrainings an sowie Coachings für körperliche und mentale Stärke. Daneben geht sie im Winter gerne wandern – im Bikini. Helena Hefti war heute unser Morgengast. Weitere Themen: (00:13:46) Ukrainekrieg, Konflikt im Nahen Osten, steigende Mietpreise und Krankenkassenprämien: Generationenbarometer 2025 zeigt, was Schweizer Bevölkerung umtreibt. (00:17:52) 200 Jahre Brailleschrift: Zum Jubiläum erscheint neues Spiel «Braille mit Weile». (00:22:47) Lausanne ehrt Kunstmäzenin Alice Pauli mit grosser Ausstellung im Musée des Beaux Arts. (00:26:52) Graphic Novel «Tsai Kun-lin» bietet Einblick in Taiwans komplexe Geschichte und das Leben des verstorbenen Schriftstellers.
PHGR will herausfinden: Wie sprechen Sie Romanisch?
Obwohl das Rätoromanische seit fast 90 Jahren eine der offiziellen Landessprachen ist, gibt es bis heute keinen eigenen Sprachatlas. Ein Werk, das aufzeigt, welches Idiom wie gesprochen wird. Das wollen die PH Graubünden und die Uni Freiburg ändern. In einem ersten Schritt gibt es eine Umfrage. Weitere Themen: · Zweieinhalb Wochen vor dem Engadin Skimarathon: Die Veranstaltung ist auf Kurs. Rund 11'700 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. · Biathlon-WM auf der Lenzerheide: Der Schweizer Biathlon-Chef Lukas Keel im Interview. Der Sarganserländer hofft, dass die Heim-WM den Sport der Schweizer Bevölkerung näherbringt.
Darmdysbiose ein unterschätztes Gesundheitsproblem Eine Darmdysbiose bezeichnet ein Ungleichgewicht der natürlichen Darmflora, bei dem schädliche Bakterien überhandnehmen und die Gesundheit beeinträchtigen können. Weltweit wird die Prävalenz einer Darmdysbiose auf 5–20 % geschätzt. Wenn man aber liest, dass geschätzt wird, dass schon 10-20% der Bevölkerung bei uns an Reizdarm leidet, dann würde ich eher meinen, dass mindestens 20% der Bevölkerung an einer Dysbiose leidet. Zumal es auch Untersuchungen aus Deutschland und Belgien gibt, die gezeigt haben, dass 70% der Bevölkerung mindestens 1x jährlich unter Magen-Darm-Beschwerden leiden. Eine weitere interessante Zahl, die ich gefunden habe, ist aus dem Jahr 2023. Da sagt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, dass im Jahr 2022 19% der Schweizer Bevölkerung Antibiotika eingenommen hat. Eine andere aufschlussreiche Zahl stammt von ANRESIS, dem schweizerischen Zentrum für Antibiotika Resistenzen, welches vom Institut für Infektionskrankheiten (IFIK) der Universität Bern geführt wird. Sie sagt, dass 2023 in der Schweiz mehr als 5.6 Millionen Packungen Antibiotika verkauft wurden.
Wie Expats die Schweiz erleben
Sie sprechen Englisch und verdienen viel Geld in der Schweiz: Etwa 50'000 gut ausgebildete Expats kommen jedes Jahr in die Schweiz. Besonders in Städten sind die Zuzügerinnen und Zuzüger sicht- und spürbar. Wie sie in der Schweiz leben, sich bewegen und sich mehr oder weniger integrieren, das ist ein häufiges Thema von Kontroversen unter Einheimischen.Umgekehrt funktioniert das jedoch genauso. In Onlineforen tauschen sich potenzielle Expats regelmässig mit bereits Erfahrenen aus – und das nicht nur «pro» Schweiz. Es fallen Sätze wie: «Die Schweiz ist sauber, sicher und gut organisiert. Wer das schätzt, kann die Macken der Einheimischen gut in Kauf nehmen» oder auch «Mein erster Eindruck ist, dass die Schweiz feudal, konservativ und in manchen Fällen rückständig ist».Wohin die Expats in der Schweiz ziehen, ist kein Zufall. Die Unterschiede zwischen den Landesregionen seien spürbar. Das bestätigt auch Melissa Bean. 2008 ist sie aus London nach Genf gezogen, später nach Zürich und mittlerweile lebt sie im Kanton Thurgau.Moritz Marthaler, Reporter beim «Tages-Anzeiger», hat Bean porträtiert und mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen. In einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» erzählt er von seiner Recherche im Expats-Milieu.Host: Philipp LoserGast: Moritz MarthalerProduktion: Sara SpreiterMehr zum Thema:Tun sich Expats mit der Deutschschweiz wirklich so schwer?Können Expats und Schweizer Freunde werden? Ein Selbstversuch am KüchentischUmfrage zu Schweizer Bevölkerung: Distanziert, langweilig und pedantisch – warum Expats Schweizer so seltsam finden «How to be Swiss»: Eingebürgerter Expat und Bestsellerautor erklärt die Schweiz Unser Tagi-Spezialangebot für Podcast-Hörer:innen: tagiabo.chHabt ihr Feedback, Ideen oder Kritik zu «Apropos»? Schreibt uns an podcasts@tamedia.ch
Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sind in der heissen Phase. Noch vor Weihnachten soll das neue Abkommen über die künftigen Beziehungen stehen. Ein letzter Knackpunkt sind die Kohäsionszahlungen. SRF-Recherchen zeigen nun, wie hoch dieser Betrag sein dürfte. Weitere Themen in dieser Sendung: · Die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung ist nicht sehr hoch, schreibt das Bundesamt für Kommunikation. Vielen Befragten einer Studie fällt es unter anderem schwer zu erkennen, ob ein Beitrag in den Medien informieren will oder ob es sich um einen Kommentar, Werbung oder Fake News handelt. · Nach dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad hat der Anführer der Rebellen-Gruppen gesagt, dass Syrien kein weiterer Krieg bevorstehe. Die Menschen seien von den Kämpfen erschöpft. · Noch nie gab es bei jungen Menschen so viele akute Krisenfälle wie im Moment. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres mussten Polizei und Sanität 140-mal ausrücken. Der Ständerat debattiert heute über einen Vorstoss, der verlangt, dass Anlaufstellen für Menschen in psychischer Not finanziell gesichert werden.
KI hat sich rasch im Alltag der Schweizer Bevölkerung integriert
Fast alle jungen Leute in der Schweiz nutzen künstliche Intelligenz oder haben es zumindest schon mal genutzt. Und über die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat schon mal Erfahrung mit einem Programm gemacht, das KI nutzt. Das zeigen neue Zahlen der Uni Zürich. Weitere Themen in dieser Sendung: · Die Bündner Gemeinde Brienz möchte die Bevölkerung in andere Dörfer Umsiedeln. Der Plan ist umstritten. · Fünf Monate nach der Europawahl hat sich die Spitze des Europaparlaments offenbar auf eine Besetzung der EU-Kommission geeinigt. · US-Regierung will, dass Google seinen Internet-Browser «Chrome» verkauft. Dies weil Google bei der Internetsuche ein Monopol habe.
Nach seinem Wahlsieg lässt sich Donald Trump feiern und spricht von einem politischen Sieg, wie ihn die USA noch nie erlebt hätten. Derweil hat sich die Verliererin Kamala Harris noch nicht geäussert. Weitere Themen: (01:08) USA: Trump feiert – Harris schweigt (07:45) Wirtschaft dürfte ein Hauptfaktor für Trumps Sieg gewesen sein (15:59) Wahlnacht in Pennsylvania (22:48) So reagiert die Welt auf Trumps Wiederwahl (30:17) Was bedeutet Trumps Sieg für Israel? (33:55) So wirkt sich die US-Wahl auf die Schweizer Wirtschaft aus (38:04) Stimmen aus der Schweizer Bevölkerung zu Trumps Sieg (41:14) Verhandlungen Schweiz-EU: Bundesrat nimmt Stand zur Kenntnis
Der Leistungsdruck wird immer grösser: Viele kämpfen mit Müdigkeit und Erschöpfung. Das hat die Gesundheitsstudie im Auftrag der CSS ergeben. Studienleiter ist der Politgeograf Michael Hermann. Aus aktuellem Anlass nimmt er auch Stellung zu Unterschriftenfälschungen bei Volksinitiativen. Die CSS-Gesundheitsstudie untersucht seit 2020, wie es der Schweizer Bevölkerung geht. Sie wird vom Forschungsinstitut Sotomo durchgeführt. Befragt wurden knapp 3000 Personen in der deutsch-französisch- und italienischsprachigen Schweiz. Politologe Michael Hermann kann als Kenner der politischen Reformdebatte im Gesundheitswesen die Resultate der Studie in einen breiteren Kontext einbetten und Bezug nehmen zu den gescheiterten Gesundheitsinitiativen vom Juni und dem EFAS-Referendum vom November.
Die Ausgaben im Gesundheitswesen steigen – sie haben jüngst die 90-Milliarden-Franken-Marke übertroffen. Einen Teil dieser Kosten bezahlen wir über die Krankenkassen-Prämien. Auf dem Sorgenbarometer der Schweizer Bevölkerung sind die Krankenkassen-Prämien inzwischen auf Platz eins. Die Mitte-Partei will die steigenden Gesundheitskosten bremsen mit der sogenannten Kostenbremse-Initiative, die am 9. Juni zur Abstimmung kommt. Die Initiative verlangt Massnahmen gegen steigende Gesundheits-Kosten, sobald die Kosten deutlich stärker ansteigen als die Löhne und das Wirtschaftswachstum. Bringt die Kostenbremse endlich griffige Massnahmen? Oder gefährdet sie die Gesundheitsversorgung, wie die Gegenseite befürchtet?
Greift der Staat in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person ein, muss diese zustimmen – das fordert die Freiheitsinitiative. Das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit sei bereits heute ein Grundrecht, sagt das Nein-Lager. Während der Corona-Pandemie ergriff der Bundesrat teils einschneidende Massnahmen mit dem Ziel, die Schweizer Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Teil davon war unter anderem die Zertifikatspflicht. Vor diesem Hintergrund wurde die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» von einem Komitee rund um die Freiheitliche Bewegung Schweiz eingereicht. Initiativkomitee will Rechtssicherheit Die Initiantinnen und Initianten verlangen, dass für Eingriffe in die körperliche und geistige Unversehrtheit die Zustimmung der betroffenen Person vorliegen muss. Jeder Mensch solle frei über seinen Körper bestimmen können und die Politik und Pharmaindustrie solle nicht darüber entscheiden, ob beispielsweise Impfungen oder implantierbare Mikrochips in den Körper kommen. Zudem darf eine Person, die einen Eingriff verweigert, künftig gemäss Initiativtext weder bestraft noch beruflich oder sozial benachteiligt werden. Laut Initiativkomitee könnte das Parlament bei einem Ja Rechtssicherheit schaffen und gesetzlich festlegen, was körperliche und geistige Unversehrtheit bedeutet. Zudem dürften die Grundrechte beispielsweise nicht mehr vom Impfstatus abhängig gemacht werden. Nein-Lager warnt vor unklaren Folgen Das Nein-Lager betont, dass das Grundrecht auf körperliche und geistige Unversehrtheit gemäss Bundesverfassung bereits heute gilt – auch für Impfungen. Der Bund könne das Grundrecht zwar einschränken, allerdings nur aus sehr wichtigen Gründen und unter ganz bestimmten Bedingungen, so die Gegnerinnen und Gegner der Freiheitsinitiative. Ausserdem warnen sie vor den Folgen, welche die Initiative für die Arbeit der Justiz und Polizei haben könnte, etwa für Eintrittsuntersuchungen im Strafvollzug. Ist die körperliche und geistige Unversehrtheit in der Schweiz bereits ein Grundrecht? Oder braucht es mehr Rechtssicherheit? Und hätte ein Ja zur Initiative Folgen für die Arbeit der Polizei und Justiz? Zu diesen Fragen begrüsst Sandro Brotz am 10. Mai 2024 in der «Abstimmungsarena» als Befürworter der Initiative: - Richard Koller, Präsident Freiheitliche Bewegung Schweiz und Initiant; - Philipp Gut, Journalist und SVP-Mitglied; und - Pirmin Schwander, Ständerat SVP/SZ. Gegen die Initiative treten an: - Beat Flach, Nationalrat GLP/AG und Co-Präsident Nein-Komitee; - Daniel Jositsch, Ständerat SP/ZH; und - Maya Bally, Nationalrätin Die Mitte/AG.
Prämien-Entlastungs-Initiative – Deckel für Krankenkassenprämien
Ein 10-Prozent-Deckel soll helfen, die Krankenkassenprämien der Schweizer Bevölkerung zu mildern. «Kassensturz» blickt in den Kanton Waadt, wo es dieses Modell gibt. GDK-Präsident Lukas Engelberger hält dagegen. Ausserdem: Darf man einen Parkplatz reservieren? Und: Rollatoren im Test. Prämien-Entlastungs-Initiative – Deckel für Krankenkassenprämien Krankenkassen und teure Prämien stehen auf Platz 1 des Sorgenbarometers der Schweizer Bevölkerung. Dem will die Prämien-Entlastungs-Initiative etwas entgegensetzen und die Krankenkassenprämien bei maximal zehn Prozent des verfügbaren Einkommens deckeln. Der Rest würde via Prämienverbilligungen abgegolten. «Kassensturz» blickt in den Kanton Waadt, wo ein 10-Prozent-Modell schon praktiziert wird. Und «Kassensturz» begleitet eine alleinerziehende Mutter im Kanton Luzern, die auf mehr Prämienverbilligungen angewiesen wäre, aber fast keine bekommt. Der Blick auf die Schweizer Karte zeigt: Die Kantone sind eher knausrig, wenn es um Prämienverbilligungen geht. Im Gespräch kontert Lukas Engelberger, Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK und Basler Die Mitte-Regierungsrat, die Kritik und wirbt für ein Nein. «Darf man das?» – Fussgänger versus Autofahrer Autofahrerinnen wissen es: Parkplätze sind ein rares Gut, gerade in Städten. Das erleben auch Karl und Karla auf ihrer Einkaufstour. Freude herrscht deshalb, als die beiden einen freiwerdenden Parkplatz erspähen. Und damit dieser nicht gleich wieder besetzt wird, stellt Karl sich kurzerhand auf den Platz und reserviert diesen, bis Karla mit dem Wagen ankommt. Doch darf Karl das überhaupt? Das Publikum stimmt ab. Und «Kassensturz»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner erklärt live im Studio, was im Verkehrsgesetz geregelt ist – und was nicht. Test «Rollatoren» – Mobilität für Seniorinnen und Senioren Mobil im Alter, auch wenn die Beine nicht mehr ganz so wollen. Ein Rollator kann da unterstützen und helfen, den Bewegungsradius möglichst lange möglichst gross zu behalten. Doch welches Modell ist das richtige? Vier Räder, zwei Griffe und eine Sitzfläche hat jedes. Die Auswahl ist riesig. Ebenso die Preisspanne: von knapp 70 Franken bis zum mehrere hundert Franken teuren Modell – es ist alles zu haben. «Kassensturz» und das Konsumentenmagazin «Gesundheitstipp» haben acht Rollatoren testen lassen. Die gute Nachricht: Nur ein Modell genügt nicht.
Schweizer Bevölkerung so pessimistisch wie noch nie, Containerschiff bringt Brücke in Baltimore zum Einsturz, Julian Assange darf noch nicht an die USA ausgeliefert werden, Diana Ross feiert ihren 80. Geburtstag
De Santis zieht seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl zurück und unterstützt dafür jetzt seinen Gegner Donald Trump. USA-Korrespondent Andrea Christen ordnet ein. Weiteres Thema: Die Schweizerische Flüchtlingshilfe will mehr Menschen dazu bringen, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. Aber die Bereitschaft in der Schweizer Bevökerung scheint eher klein.
Ein Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ist weiterhin nicht in Sicht. Doch es gibt Szenarien, wie ein solches Ende aussehen könnte. Daniel Gerlach, Chefredaktor des Nahost-Magazins «Zenith», hat zusammen mit dem Staatsrechtler Naseef Naeem ein solches Szenario entworfen. Dieses betont insbesondere die Verantwortung der arabischen Staaten. Weitere Themen: (05:56) Wie der Gaza-Krieg enden könnte (14:13) Sonko-Prozess: Kritik am Bundesstrafgericht (18:59) Schweizer Bevölkerung unterschätzt ihren CO2-Fussabdruck (23:33) Prozessauftakt vor Militärgericht nach F/A-18-Absturz (28:22) Nachruf auf Informatik-Pionier Niklaus Wirth (32:41) «Trumps Worte sollten ernst genommen werden»