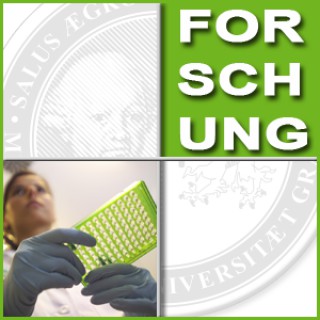Podcasts about gewebeproben
- 32PODCASTS
- 40EPISODES
- 25mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Dec 1, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about gewebeproben
Latest podcast episodes about gewebeproben
Was wissen wir schon? Wenn die KI das Denken übernimmtbeeinflusst
„Künstliche Intelligenz - sie beantwortet Fragen, schreibt Texte und sortiert Informationen. Aber was bedeutet das für unser Wissen? Wird KI zum Türöffner für neue Erkenntnisse oder zum Filter, der bestimmt, was wir überhaupt noch sehen?“ Und jetzt raten Sie mal - habe den Text ich geschrieben oder die Künstliche Intelligenz? Das war tatsächlich ChatGPT Mittlerweile ist es kaum mehr zu unterscheiden, wo KI zum Einsatz kommt und welche Informationen von ihr zusammengestellt sind. Über die Hälfte der Deutschen verwendet mittlerweile ChatGPT & Co. Was heißt das für unser Wissen - wie sehr ist es durch KI beeinflusst? Und wie können wir wahre von falschen Informationen überhaupt noch unterscheiden? Welche Chancen entstehen dadurch? Das fragen wir unseren Kollegen in San Francisco Nils Dampz, den Datenjournalisten Jan Eggers, den Autor und Neuropsychologen an der Uni Magdeburg Bernhard Sabel und Andre Wolf, Autor, Blogger und Pressesprecher beim Recherchenetzwerk Mimikama. Moderator ist Ulrich Sonnenschein. Podcast-Tipp: ARD - Stadt Land Mensch - Die Deutschlandreportage KI im Kittel - Peter Wild geht neue Wege in der Krebsdiagnostik Nach Tübingen und Göttingen wird am Pathologischen Institut des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main die dritte Pathologie der Zukunft aufgebaut. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Früher wurden die hauchdünnen Schnitte von Gewebeproben mit großem Zeitaufwand unter dem Mikroskop befundet. Mit Hilfe der KI gelingt das jetzt am Bildschirm deutlich schneller. Zehntausende Proben von Krebspatienten analysiert das Institut jährlich für sechs Krankenhäuser in der Region. Dass Prof. Peter Wild und sein Team künftig komplett digital arbeiten können, ermöglichen Gelder aus dem Krankenhauszukunftsfonds. Reporterin Petra Boberg mit einem Schulterblick. https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:7830998c968e99c0/
Was wissen wir schon? Wenn die KI das Denken übernimmtbeeinflusst
„Künstliche Intelligenz - sie beantwortet Fragen, schreibt Texte und sortiert Informationen. Aber was bedeutet das für unser Wissen? Wird KI zum Türöffner für neue Erkenntnisse oder zum Filter, der bestimmt, was wir überhaupt noch sehen?“ Und jetzt raten Sie mal - habe den Text ich geschrieben oder die Künstliche Intelligenz? Das war tatsächlich ChatGPT Mittlerweile ist es kaum mehr zu unterscheiden, wo KI zum Einsatz kommt und welche Informationen von ihr zusammengestellt sind. Über die Hälfte der Deutschen verwendet mittlerweile ChatGPT & Co. Was heißt das für unser Wissen - wie sehr ist es durch KI beeinflusst? Und wie können wir wahre von falschen Informationen überhaupt noch unterscheiden? Welche Chancen entstehen dadurch? Das fragen wir unseren Kollegen in San Francisco Nils Dampz, den Datenjournalisten Jan Eggers, den Autor und Neuropsychologen an der Uni Magdeburg Bernhard Sabel und Andre Wolf, Autor, Blogger und Pressesprecher beim Recherchenetzwerk Mimikama. Moderator ist Ulrich Sonnenschein. Podcast-Tipp: ARD - Stadt Land Mensch - Die Deutschlandreportage KI im Kittel - Peter Wild geht neue Wege in der Krebsdiagnostik Nach Tübingen und Göttingen wird am Pathologischen Institut des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main die dritte Pathologie der Zukunft aufgebaut. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Früher wurden die hauchdünnen Schnitte von Gewebeproben mit großem Zeitaufwand unter dem Mikroskop befundet. Mit Hilfe der KI gelingt das jetzt am Bildschirm deutlich schneller. Zehntausende Proben von Krebspatienten analysiert das Institut jährlich für sechs Krankenhäuser in der Region. Dass Prof. Peter Wild und sein Team künftig komplett digital arbeiten können, ermöglichen Gelder aus dem Krankenhauszukunftsfonds. Reporterin Petra Boberg mit einem Schulterblick. https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:7830998c968e99c0/
In dieser Hörgang-Episode beleuchten wir die Welt der Pathologie, abseits von Tatorten und Krimiserien. Prof. Dr. Bernadette Liegl-Atzwanger (Med Uni Graz) erklärt die zentrale Rolle der klinischen und molekularen Pathologie in der modernen Medizin, Präzisionsdiagnostik und Therapieentscheidungen. Sie zeigt, wie aus Gewebeproben, digitalen Mikroskopien und genetischen Analysen konkrete Diagnosen entstehen. Ohne Pathologie wäre personalisierte Krebsmedizin nicht möglich. Dr. Liegl-Atzwanger gibt Einblicke in die Arbeit am Sarkom-Subzentrum und erläutert die Bedeutung von Next-Generation Sequencing und Künstlicher Intelligenz. Sie beschreibt, warum Pathologie ein inspirierendes Fach zwischen Forschung, Klinik und Lehre ist.
Der Pathologe Philip Went hat im Lauf seiner Karriere mehr als 1000 Autopsien gemacht und menschliche Körper buchstäblich auf Herz und Nieren geprüft. Heute analysiert er vor allem Gewebeproben lebender Patienten. In der neuen Megahertz-Folge erzählt er, wie die Arbeit sein Verhältnis zum menschlichen Körper geprägt hat und warum Pathologie sich oft anfühlt wie Detektivarbeit. Host: Alice Grosjean
Zwei gegen Eins-Spezialfolge: Interview mit Jens Hansen und Marius Reichardt von und über „Histomography“
In diesem Podcastinterview unterhalten wir uns mit Jens Hansen und Marius Reichardt über „Histomography“. Das Startup bringt ein 3D-Röntgenmikroskop und eine Auswertungssoftware für pathologische Fragestellungen auf den Markt, mit dem Ziel, die Erforschung und Diagnostik von Krankheiten erheblich zu verbessern. Die Röntgenmikroskope liefern dreidimensionale Daten in subzellulärer Auflösung und ermöglichen die automatische Identifizierung struktureller Biomarker sowie die Klassifizierung von Gewebeproben. Die Auswertung der mit 3D-Daten untersuchter Gewebearchitekturen erfolgt mittels KI-Methoden. Die Folge ist eine kleine Reise in die Zukunft der Pathologie - viel Spaß beim Lauschen! Werbung *** Diese Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Firma Histomography produziert *** Website Histomography www.histomography.com LinkedIn: Jens Hansen: www.linkedin.com/in/xrayhansen Marius Reichardt: www.linkedin.com/in/histomarius Kontakt: pathopodcasts@gmail.com
SPRECHSTUNDE: Eure Fragen zu Laboranalysen und den versteckten Gesundheitsdaten in Blut, Urin, Speichel, Haaren, Stuhl
"Wie aussagekräftig sind Haaranalysen?" "Welche Schlüsse kann ich aus den Cholesterinwerten im Blut ziehen?" "Was ist die beste Anlaufstelle, um ein großes Blutbild machen zu lassen?" "Wie ist Eure Meinung zu den aktuell gehypten Trockenbluttests?" "Liefern Stuhl-Selbsttests für zu Hause brauchbare Ergebnisse?" "Mein Eisenwert liegt bei 4 - ist das gut oder schlecht?" - vielen Dank für Eure Fragen zu unserer aktuellen Podcast-Episode "Blut, Urin, Speichel, Haare, Stuhl: Was uns Laboranalysen über unseren Körper und unsere Gesundheit verraten". Matthias Baum aus dem HEALTH NERDS Wissenschaftsteam liefert hier in der Sprechstunde Antworten. -- Zur Hauptfolge: Unser Körper ist ein gigantischer Datenspeicher. Mit Hilfe von Laboranalysen können wir diesen auslesen und erhalten so zum Beispiel Informationen über Fettstoffwechsel, Hormone, Zellen, Giftstoffe, Zuckergehalt, Spurenelemente und vieles mehr. Fast jede Krankheit hinterlässt Spuren in unserem Körper und vor allem unser Blut verändert dann häufig seine Zusammensetzung. Auch Urin-, Stuhl- und Gewebeproben liefern wichtige Hinweise auf unseren Gesundheitszustand. -- Achtung, Community! Probiert das artgerechte Eisenpräparat NATURAL IRON aus: Die einzigartige Kombination aus pflanzlichem Curryblatt-Eisen, natürlichem Vitamin C aus der Hagebutte und Lactoferrin mit der höchst verfügbaren Bio-Aktivität sind ein starkes Trio. Diese besondere Kombination der Inhaltsstoffe liefert Dir nicht einfach nur Eisen, sondern unterstützt Deinen Körper dabei es genau dorthin zu bringen, wo es benötigt wird: in den Zellen! Mit dem Code IRON15 bekommst Du 15% Rabatt auf Deine NATURAL IRON Bestellung auf artgerecht.com Probiere es direkt aus: https://artgerecht.com/natural-iron -- Ein ALL EARS ON YOU Original Podcast.
Blut, Urin, Speichel, Haare, Stuhl: Was uns Laboranalysen über unseren Körper und unsere Gesundheit verraten
Unser Körper ist ein gigantischer Datenspeicher: Mit Hilfe von Laboranalysen können wir diesen auslesen und erhalten so zum Beispiel Informationen über Fettstoffwechsel, Hormone, Zellen, Giftstoffe, Zuckergehalt, Spurenelemente und vieles mehr. Fast jede Krankheit hinterlässt Spuren in unserem Körper und vor allem unser Blut verändert dann häufig seine Zusammensetzung. Auch Urin-, Stuhl- und Gewebeproben liefern wichtige Hinweise auf unseren Gesundheitszustand. Matthias Baum aus dem HEALTH NERDS Wissenschaftsteam gibt uns einen Überblick: Wie verlässlich sind diese Werte und wie werden sie richtig interpretiert? Welche neuen Technologien und Methoden gibt es, um unseren Körper immer besser zu analysieren? Matthias sagt ganz klar „Regelmäßige Checks sind ein Investment in die eigene Gesundheit.“ HEALTH NERDS – Mensch, einfach erklärt. -- Achtung, Community! Probiert das artgerechte Eisenpräparat NATURAL IRON aus: Die einzigartige Kombination aus pflanzlichem Curryblatt-Eisen, natürlichem Vitamin C aus der Hagebutte und Lactoferrin mit der höchst verfügbaren Bio-Aktivität sind ein starkes Trio. Diese besondere Kombination der Inhaltsstoffe liefert Dir nicht einfach nur Eisen, sondern unterstützt Deinen Körper dabei es genau dorthin zu bringen, wo es benötigt wird: in den Zellen! Mit dem Code IRON15 bekommst Du 15% Rabatt auf Deine NATURAL IRON Bestellung auf artgerecht.com Probiere es direkt aus: https://artgerecht.com/natural-iron -- Ein ALL EARS ON YOU Original Podcast.
Mehr als 400.000 Drohnen sind in Deutschland in Gebrauch - ein Großteil davon für private Zwecke. Nur 56.000 kommerziell genutzte Drohnen sind nach Schätzungen des Verbands Unbemannte Luftfahrt in Deutschland unterwegs. Bis zum Jahr 2030 rechnen die Branchenkenner mit 80.000 Drohnen.Während private Nutzer Drohnen zum Spaß nutzen, setzen immer mehr Unternehmen und Institutionen auf die fliegenden Helfer. "Drohnen transportieren mittlerweile auch Blutkonserven oder Gewebeproben, die schnell mal analysiert werden müssen", erklärt Jan-Erik Putze. Ein Auto wäre in solchen Fällen einfach zu langsam, wenn es sich kilometerlang durch die Stadt quälen muss, erklärt der Manager des Startups Droniq. Außerdem überwachen Drohnen Industriegelände, inspizieren Stromnetze und vieles mehr.Komplett autonom sind sie dabei allerdings noch nicht unterwegs. "Das sehe ich im Moment noch nicht", so Putze. Aber man bewege sich langsam in die Richtung. Ein Beispiel dafür seien Drohnen-Garagen. Die Drohnen machen in diesen Garagen autonom einen technischen Check und sind dann nach einer Stunde wieder einsetzbar. "Sie prüft auch Wetter, Wind und Sichtweite und wenn das nicht passt, geht die Garage gar nicht erst auf", erklärt der Unternehmer, der übrigens auch selbst Fluglehrer ist.Um den Überblick über die unbenannten Flugkörper zu haben, braucht es digitale Angebote. Eines davon ist Droniq, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Flugsicherung und der Deutschen Telekom. Die Idee dahinter ist laut CEO Jan-Eric Putze, "Drohnen digital sichtbar zu machen und sie dann in einer Anzeige bei der Flugsicherung zu fusionieren mit der bemannten Luftfahrt." Dazu nutzt das Unternehmen LTE-Technik, um die Positionsdaten an die Flugsicherung zu senden. Um den Luftraum unter Kontrolle zu behalten, ermöglicht die Europäische Union seit Anfang des Jahres die Einrichtung von U-Spaces. Dort sollen private Firmen wie Droniq den Einsatz von Drohnen überwachen.Regulierung ist wichtig, davon ist auch Putze überzeugt. Dennoch warnt er vor zu strikten Regulierungen. "Ich möchte nicht, dass wir die kleine Pflanze des Drohnenmarktes erdrücken", so der Manager. "Ich würde mir wünschen, einen sicheren Rahmen zu setzen und dafür sind Reallabore perfekt."Warum Verbraucher nicht zeitnah damit rechnen können, dass Pakete oder Pizza von einer Drohne geliefert werden, erklärt Jan-Erik Putze in der neuen Folge von "So techt Deutschland". Sie haben Fragen für Frauke Holzmeier und Andreas Laukat? Dann schreiben Sie eine E-Mail an sotechtdeutschland@ntv.de.”Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html
Mehr als 400.000 Drohnen sind in Deutschland in Gebrauch - ein Großteil davon für private Zwecke. Nur 56.000 kommerziell genutzte Drohnen sind nach Schätzungen des Verbands Unbemannte Luftfahrt in Deutschland unterwegs. Bis zum Jahr 2030 rechnen die Branchenkenner mit 80.000 Drohnen.Während private Nutzer Drohnen zum Spaß nutzen, setzen immer mehr Unternehmen und Institutionen auf die fliegenden Helfer. "Drohnen transportieren mittlerweile auch Blutkonserven oder Gewebeproben, die schnell mal analysiert werden müssen", erklärt Jan-Erik Putze. Ein Auto wäre in solchen Fällen einfach zu langsam, wenn es sich kilometerlang durch die Stadt quälen muss, erklärt der Manager des Startups Droniq. Außerdem überwachen Drohnen Industriegelände, inspizieren Stromnetze und vieles mehr. Komplett autonom sind sie dabei allerdings noch nicht unterwegs. "Das sehe ich im Moment noch nicht", so Putze. Aber man bewege sich langsam in die Richtung. Ein Beispiel dafür seien Drohnen-Garagen. Die Drohnen machen in diesen Garagen autonom einen technischen Check und sind dann nach einer Stunde wieder einsetzbar. "Sie prüft auch Wetter, Wind und Sichtweite und wenn das nicht passt, geht die Garage gar nicht erst auf", erklärt der Unternehmer, der übrigens auch selbst Fluglehrer ist.Um den Überblick über die unbenannten Flugkörper zu haben, braucht es digitale Angebote. Eines davon ist Droniq, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Flugsicherung und der Deutschen Telekom. Die Idee dahinter ist laut CEO Jan-Eric Putze, "Drohnen digital sichtbar zu machen und sie dann in einer Anzeige bei der Flugsicherung zu fusionieren mit der bemannten Luftfahrt." Dazu nutzt das Unternehmen LTE-Technik, um die Positionsdaten an die Flugsicherung zu senden. Um den Luftraum unter Kontrolle zu behalten, ermöglicht die Europäische Union seit Anfang des Jahres die Einrichtung von U-Spaces. Dort sollen private Firmen wie Droniq den Einsatz von Drohnen überwachen.Regulierung ist wichtig, davon ist auch Putze überzeugt. Dennoch warnt er vor zu strikten Regulierungen. "Ich möchte nicht, dass wir die kleine Pflanze des Drohnen-Marktes erdrücken", so der Manager und ergänzt: "Ich würde mir wünschen einen sicheren Rahmen zu setzen und dafür sind Reallabore perfekt."Warum Verbraucher nicht zeitnah damit rechnen können, dass Pakete oder Pizza von einer Drohne geliefert werden, erklärt Jan-Erik Putze in der neuen Folge von "So techt Deutschland". Sie haben Fragen für Frauke Holzmeier und Andreas Laukat? Dann schreiben Sie eine E-Mail an sotechtdeutschland@ntv.de.” Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
So hilft Digitalisierung der Diagnose von Krankheiten, W. Mertz und M. Neubauer, Dell Technologies
In der Medizin werden Bildanalysen von Gewebeproben immer wichtiger. Doch die Auswertung solcher unstrukturierter Bilddaten ist anspruchsvoll. Professionelle Lösungen zur Analyse unstrukturierter Daten können die Ärztinnen und Ärzte bei den Diagnosen unterstützen. Das Interview von Oliver Schonschek, News Analyst bei Insider Research, mit Wolfgang Mertz und Marten Neubauer von Dell Technologies liefert spannende Einblicke in die digitale Pathologie.
MedTech Aignostics sammelt 14 Mio. Euro für KI-gestützte Pathologielösungen in Serie A ein (KI • Wellington Partners)
In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Viktor Matyas, Co-Founder und CEO von Aignostics, über die erfolgreich abgeschlossene Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Millionen Euro. Aignostics ist ein Spin-off der Charité Berlin mit Fokus auf die Entwicklung von KI-Modellen, um Verständnis, Diagnose und Behandlung schwerwiegender Krankheiten zu verbessern. Dazu hat das Startup neuartige digitale Pathologielösungen mit Explainable AI für die pharmazeutische Forschung und Diagnostik entwickelt. Die tiefgreifende Analyse großer Datensätze aus Gewebeproben erfordert den Einsatz einer Künstlichen Intelligenz. Die detaillierte Analyse von Gewebeproben und die zugehörigen Metadaten werden deshalb im Auftrag von Blue-Chip-Kunden aus der Pharma- und Biotechnologiebranche von Aignostics übernommen. Die KI-Modelle gehen nach Unternehmensangaben weit über aktuelle Standardlösungen und etablierte Ansätze hinaus und decken die wichtigsten Gewebefärbetechnologien ab. Sie sollen eine Beschleunigung der prä-klinischen und translationalen Forschung ermöglichen, indem sie das Verständnis der Biologie von Krankheiten und Wirkmechanismen verbessern. Außerdem sollen neuartige Biomarker und Hinweise auf die Wirksamkeit von innovativen Arzneimittelkandidaten identifiziert werden können. Aignostics wurde im Jahr 2018 von Frederick Klauschen, Klaus-Robert Müller, Maximilian Alber und Viktor Matyas in Berlin gegründet. In einer überzeichneten Series-A-Finanzierungsrunde hat das MedTech nun 14 Millionen Euro unter der Führung von Wellington Partners eingesammelt. Der paneuropäisches VC verwaltet ein Fondsvolumen von rund 800 Millionen Euro, welches in Startups in der Gründungs- und Wachstumsphase aus den Bereichen digitale Medien, Cleantech und Biowissenschaften investiert wird. Zum Portfolio gehören mehr als 100 Unternehmen in Europa und Israel. Zudem haben sich auch der Boehringer Ingelheim Venture Fund, der von IBB Ventures verwaltete VC Fonds Technologie, der High-Tech Gründerfonds sowie der von Ascenion initiierte Carma-Fonds an der Serie A beteiligt. Mit dem frischen Kapital möchte das Jungunternehmen seine Präsenz und sein Team weiter ausbauen. Außerdem soll ein stärkerer Fokus auf den US-amerikanischen Markt gelegt werden, auf dem Aignostics seit Anfang 2022 aktiv ist. Zudem wird das Berliner MedTech mit der überzeichneten Finanzierungsrunde ab Anfang 2023 in der Lage sein, einen Entwicklungs- und Analyseprozess anzubieten, der mit „Good Clinical Practice“ konform ist. Im weiteren Verlauf können dann erste KI-Modelle in frühphasigen klinischen Studien eingesetzt werden. Infos der Werbepartner: ROQ: Gehe jetzt auf roq.tech/daily und erhalte die komplette Plattform 3 Monate lang for free. OMR Reviews: One more thing wird präsentiert von OMR Reviews – Finde die richtige Software für Dein Business. Wenn auch Du Dein Lieblingstool bewerten willst, schreibe eine Review auf OMR Reviews unter https://moin.omr.com/insider. Dafür erhältst du einen 20€ Amazon Gutschein.
Zudem: Neue Erkenntnisse zum Erreger der Pandemie von 1918. Und: Stickstoff, herangeweht durch die Luft, führt in Waldökosystemen zu neuen Herausforderungen. (00:42) Russisches Uran: Nicht nur bei Öl und Gas gibt es Abhängigkeiten von Russland, sondern auch beim Uran. So laufen viele Europäische Kernkraftwerke mit Uran aus Russland und Kasachstan – oder sind gar komplett von russischer Nukleartechnik abhängig. In der Schweiz gibt es keine russische Technik, doch beziehen wir aktuell rund die Hälfte des Urans fürs unsere KKW aus Russland. (12:44) Pandemie 1918: Über die Spanische Grippe weiss man bis heute virologisch gesehen recht wenig – umso aufregender sind neue Gensequenzen der Viren, die aus alten Gewebeproben isoliert werden konnten. (19:30) Überdüngung: Zuviel Stickstoff verändert das Ökosystem Wald. Über die Luft wird er eingetragen und entfaltet diverse Wirkungen. Besuch bei der Waldforscherin an der WSL in Birmensdorf.
Was mit Biopsien, Gewebeproben und Körperflüssigkeiten in der Pathologie geschieht…
Der Klinisch Relevant Podcast liefert Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen der Pflegeberufe und medizinischer Fachberufe wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie kostenlose und unabhängige medizinische Fortbildungsinhalte, die Du jederzeit und überall anhören kannst.
ecozentrisch Champions KW 50: Bundesliga, MeaTec 3D, Airbus, P&G, Merck und Co.
Das sind die ecozentrisch Wochenchampions in der 50. KW:Deutsche Bundesliga will nachhaltig werdenNachhaltigkeit jetzt auch im Deutschen Profifußball: Die Deutsche Bundesliga will sich zur Nachhaltigkeit verpflichten. So hat man nun in der Satzung verankert, dass man sich zu gutem Wirtschaften, sozialem Engagement sowie zum Umweltschutz bekennt. Dies soll sogar als Auflage für eine Lizenz werden.Damit folgt die Liga gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Entwicklungen. Zum einen kann man erkennen, dass die Fans mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Zum anderen möchten auch die Sponsoren der Clubs, dass der deutsche Fußball nachhaltiger wird. Die Details zur Änderung der Satzung und was dies ganz konkret bedeutet, sind noch nicht bekannt.https://www.zeit.de/amp/sport/2021-12/fussball-bundesliga-nachhaltigkeit-unweltschutz-sozialesMeaTech 3D druckt dickstes Steak aus künstlichem FleischSteak aus dem 3D-Drucker: Das kann eine Möglichkeit für alternative Nahrungsmittel der Zukunft sein. Die Firma MeaTec 3D hat nun ein echt dickes Stück Fleisch präsentiert- man hat hier ein Steak aus zellkultiviertem Fleisch aus dem 3D-Drucker gefertigt. Dies ist das bislang größte und dickste Steak mit dieser Technologie weltweit. Die verwendeten Zellen sind echte Fett-und Muskelzellen aus tierischen Gewebeproben einer Kuh. Für die so genannte ‚Reifung‘ des künstlichen Steaks werden diese in einen Inkubator gegeben, woraus dann mehr Zellen entstehen. Das Ziel ist verbessertes Fleisch ohne Tier-Leid und mehr Fleisch-Volumen mit einem minimalen Bestand an Tierhaltung.Dies würde dem Klimaschutz entgegenkommen und könnte Hunger in der Welt lindern. Das künstlich kultivierte Fleisch besteht nicht aus Fleisch-Ersatzprodukten und kann echtem Fleisch geschmacklich sehr nahekommen. https://www.cleanthinking.de/110-gramm-clean-meat-meatech-3d-druckt-das-bislang-dickste-kultivierte-steak/Airbus und GP Joule schließen Vertrag für PV-Strom-DirektbelieferungSolarstrom direkt fürs eigene Unternehmen beziehen: Airbus lässt sich demnächst seinen grünen Strom kostengünstig aus einem eigens dafür errichteten Solarpark liefern. Darüber hat das Unternehmen Airbus Helikopters in Donauwörth nun einen Vertrag mit der Firma GP Joule abgeschlossen. GP Joule wird eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemeinde Tapfheim bauen, die eine Leistung von 3,5 Megawatt haben wird. Der Direktbelieferungsvertrag ermöglicht es Airbus, günstigen Strom zu beziehen.Dadurch kann man gleichzeitig seine CO2-Emissionen reduzieren. Die Installation soll Anfang 2022 beginnen. Die Solar-Anlage wird komplett ohne staatliche Förderung realisiert. https://www.solarserver.de/2021/12/14/photovoltaik-gp-joule-und-airbus-schliessen-ppa-vertrag/P&G-Marke Gilette mit Verpackung aus Öko-FasernWeniger CO2-Belastung bei Verpackungen: Die Marke Gilette von Procter & Gamble nutzt ab Dezember ein neues, umweltfreundlicheres Material bei seinen Verpackungen. Es handelt sich um eine Papierart, die aus der pflanzlichen Silphie-Faser hergestellt wird. Entwickelt wurde das Material von der Firma STI Group, die daran bereits seit 2020 forscht. Die Silphie-Pflanze ist in Europa heimisch, ihr Anbau, Transport sowie Weiterverarbeitung gilt als weitaus umweltfreundlicher als herkömmliche Papierfaser-Gewinnung. Außerdem findet die Gewinnung der Faser ohne Einsatz schädlicher Chemikalien statt.https://www.neue-verpackung.de/markt/gillette-setzt-bei-display-aus-silphie-fasern-133.htmlExterner Expertenrat für Nachhaltigkeit bei MerckNeue Wege in puncto Nachhaltigkeit bei Merck: Das Technologie-Unternehmen holt sich für seine Nachhaltigkeits-Bemühungen Rat von außen ein. Man hat einen externen Expertenrat gegründet, der aus sechs unabhängigen internationalen Fachleuten besteht. Damit will man erreichen, dass die eigene Nachhaltigkeitsleistung kritisch und objektiv bewertet werden kann. Die Themen, die hier besetzt werden, reichen von Umweltschutzkonzepten, unternehmerische Nachhaltigkeitsprinzipien über zukunftsorientiertes Wirtschaften und internationalen Handel bis hin zu ESG-Kennzahlen und nachhaltiges Finanzwesen.https://www.umweltdialog.de/de/management/CSR-Strategie/2021/Merck-gruendet-externen-Expertenrat-fuer-Nachhaltigkeit.php Vattenfall und Cloud&Heat mit Pilotprojekt zur Bereitstellung nachhaltiger RechenkapazitätAuch Informationstechnologie muss nachhaltiger werden: Deshalb wollen nun Vattenfall und Cloud&Heat Technologies eine strategische Partnerschaft eingehen. Hierbei soll fossilfreie, zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrechenkapazität bereitgestellt werden.Dafür entsteht ein Rechenzentrum aus zwei Containern in der Nähe von Stockholm. Diese befinden sich auf einem Fernheizwerk von Vattenfall, das mit Biomasse betrieben wird. Die überschüssige Wärme aus den Rechner-Containern kann durch die direkte Wasserkühlung im angrenzenden Fernwärmesystem genutzt werden. Die Kooperation der beiden Unternehmen ist ein Pilotprojekt: Vattenfall stellt die Infrastruktur zur Verfügung, Cloud&Heat betreibt die Rechner.https://www.ee-news.ch/de/article/47610/vattenfall-startet-pilotprojekt-zur-bereitstellung-nachhaltiger-rechenkapazitat?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed Volkswagen und Vulcan Energie setzen auf CO2-freies Lithium Weniger Treibhausgas-Emissionen durch CO2-freies Lithium: Damit will der VW-Konzern seinem Ziel der Klimaneutralität einen Schritt näherkommen.Das Unternehmen will die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eins Fahrzeugs soweit reduzieren, dass es vollständig klimaneutral wird. Nun hat VW mit dem Lithium-Produzenten Vulcan Energie einen verbindlichen Abnahmevertrag für CO2-freies Lithium abgeschlossen. Das Leichtmetall wird im Südwesten Deutschlands abgebaut und soll perspektivisch in den Zellfabriken von Volkswagen in Europa verwendet werden. Hier sollen bis Ende 2030 sechs Batterie-Zellen-Produktionsstandorte entstehen.Mit der Lieferung des Lithiums an VW will Vulcan Energie im Jahr 2026 beginnen.https://www.ee-news.ch/de/article/47602/vulcan-energie-volkswagen-bezieht-co2-freies-lithium-aus-dem-oberrheingraben?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feedUnsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Unabhängige Studien belegen, dass die notzugelassenen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 den Verlauf der Krankheit verschlimmern können. Teil 1/2.Ein Standpunkt von Raymond Unger.Raymond Unger machte in jüngster Zeit mit seinem gewichtigen Buch „Vom Verlust der Freiheit“ Furore, das auch ein ausführliches kritisches Kapitel über die aktuelle Krise rund um Covid-19 enthält. Wichtige Erkenntnisse zur Corona-Impfung lagen bei Abschluss der Arbeiten an diesem Buch noch nicht vor. In diesem zweiteiligen Artikel möchte der Autor den aktuellen Stand der freien Corona-Forschung nachtragen. Teil 1 behandelt die vier wichtigsten (Neben-)Wirkungen der notzugelassenen Impfstoffe. Teil 2 beschäftigt sich dann mit der starren Rolle von Politik und Medien, die diese neuen Erkenntnisse weitgehend ignorieren. Obgleich es inzwischen einige Fachartikel zur Impfproblematik gibt, sind Publikationen in populärer und leicht verständlicher Form rar. Um eine redliche Risikoanalyse des Pro und Contra der SARS-CoV-2-Impfung vornehmen zu können, kann der folgende Text als Einstieg dienen.Spike-Protein als toxisches AgensAm 12. Mai 2021 erschien ein bemerkenswerter Artikel in der Frankfurter Rundschau. Darin zitiert der Redakteur neue Studien, die gleich mehrere Novitäten bezüglich Corona aufdecken. Zum einen wird klar, dass COVID-19 keine „Lungenkrankheit“ ist, sondern mannigfaltige Schäden im Kapillarsystem des Blutkreislaufsystems auslösen kann. Außerdem werden Blutplättchen angegriffen und somit die Blutgerinnung gestört. Zum andern wird deutlich, dass der für diesen Wirkmechanismus zuständige, toxische Teil des Virus ausgerechnet seine „Spikes“ sind. Der Titel des Artikels bringt es auf den Punkt: „Spike-Protein allein reicht aus, um Covid auszulösen — vor allem Blutgefäße nehmen Schaden“. Die Frankfurter Rundschau schreibt:„John Y-J. Shyy vom Department of Medicine an der University of California und sein Team sind in einer Studie dem Mechanismus auf den Grund gegangen, wie genau das Coronavirus im Körper agiert. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Der Schaden, den das Spike-Protein an Zellen anrichten kann, kann erheblich sein. Außerdem können die Forscher:innen bestätigen, dass es sich bei Covid-19 in erster Linie um eine Gefäßkrankheit handelt — und nicht um eine Atemwegserkrankung. (…)In der neuen Studie erzeugten die Forscher:innen ein ‚Pseudovirus‘, das von Spike-Proteinen des Sars-CoV-2-Erregers umgeben war, aber kein echtes Virus enthielt. Die Exposition gegenüber diesem Pseudovirus führte zu Schäden in der Lunge und den Arterien im Tierversuch. Das würde beweisen, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um die Krankheit auszulösen, so die Schlussfolgerung der Forscher:innen. Gewebeproben zeigten nach der Infektion Entzündungen in den Endothelzellen, die die Wände der Lungenarterien auskleiden. Auch im Labor untersuchte das Forscherteam, wie sich gesunde Endothelzellen, die die Arterien auskleiden, nach Kontakt mit dem Spike-Protein verhalten. Auch hier nahmen die Zellen Schaden — unter anderem durch den Kontakt von Spike-Protein und ACE2-Rezeptor“ (1).Der Artikel der Frankfurter Rundschau endet dann überraschend abrupt. Mit der Implikation dieser dramatischen Erkenntnis, lässt man den Leser allein. Der Autor hatte sich offenbar nicht mehr getraut, die naheliegende Schlussfolgerung zu ziehen: Wenn die Forscher der University of California recht haben, wirken Impfungen nicht gegen Corona, sondern lösen es aus. Denn das Ziel von Corona-Impfungen ist es, Körperzellen gentechnisch so zu verändern, dass zukünftig Billionen toxische Spike-Proteine synthetisiert werden. ...weiterlesen hier: https://apolut.net/krank-und-frei-von-raymond-ungerUnterstütze apolut:IBAN: DE40 8506 0000 1010 7380 26BIC: GENODEF1PR2Verwendungszweck: apolutKontoinhaber: apolut GmbHVolksbank Pirna eG_Patreon: https://www.patreon.com/apolutflattr: https://flattr.com/@apolutTipeee: https://de.tipeee.com/apolutInstagram: https://www.instagram.com/apolut_netFacebook: https://www.facebook.com/apolutTwitter: https://twitter.com/apolut_netOdysee: https://odysee.com/@apolut:a See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Christian L. Caballero und seine Firma Flynex sorgen mit ihrer Software dafür, dass unbemannte Fluggeräte ihren Weg finden und zuverlässig funktionieren. Deutschlandweit gibt es rund 500.000 Drohnen, allerdings wird nur ein Bruchteil davon - etwa 20.000 - auch kommerziell genutzt. Testweise zum Beispiel derzeit in Hamburg unter dem Namen Medifly, damit Gewebeproben schnell vom Krankenhaus ins zustände Labor kommen. Geht es nach Caballero ist das erst der Anfang, denn Einsatzgebiete gibt es genug. Das und mehr erzählt der frühere Elitesoldat der Bundeswehr im ntv-Podcast "So techt Deutschland".Sie haben Fragen für Frauke Holzmeier und Andreas Laukat? Dann schreiben Sie eine E-Mail an sotechtdeutschland@ntv.de. Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://datenschutz.ad-alliance.de/podcast.html Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Christian L. Caballero und seine Firma Flynex sorgen mit ihrer Software dafür, dass unbemannte Fluggeräte ihren Weg finden und zuverlässig funktionieren. Deutschlandweit gibt es rund 500.000 Drohnen, allerdings wird nur ein Bruchteil davon - etwa 20.000 - auch kommerziell genutzt. Testweise zum Beispiel derzeit in Hamburg unter dem Namen Medifly, damit Gewebeproben schnell vom Krankenhaus ins zustände Labor kommen. Geht es nach Caballero ist das erst der Anfang, denn Einsatzgebiete gibt es genug. Das und mehr erzählt der frühere Elitesoldat der Bundeswehr im ntv-Podcast "So techt Deutschland". Sie haben Fragen für Frauke Holzmeier und Andreas Laukat? Dann schreiben Sie eine E-Mail an sotechtdeutschland@ntv.de.
Forensische Analytik - Atomwaage erleichtert die Drogenfahndung
Gewebeproben können verraten, wo ein Mensch aufgewachsen ist und wo er sich jüngst aufgehalten hat. Der Schlüssel dazu sind unterschiedlich schwere, aber sonst gleichartige Atome. Jetzt haben Fachleute dieses Verfahren auf die Spitze getrieben und auf eine ganz andere Anwendung ausgeweitet: auf die Drogenfahndung. Von Hellmuth Nordwig www.deutschlandfunk.de, Forschung aktuell Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Wie bringt man Biologie, Biochemie und Mikroelektronik zusammen? Die Antwort ist ein Chip, der unterschiedliche Testproben aus Blut oder anderen Gewebeproben präzise analysieren und eine eindeutige Auskunft über die Bestandteile geben kann, das heißt, das Vorhandensein von Viren oder Antikörpern. Das Fraunhofer IZM hat einen solchen Chip entwickelt, der zum Kernelement eines Testkits gehört, das gerade im Rahmen eines EU-Projekts unter Beteiligung der Firma Bosch für den Einsatz gegen die Corona-Pandemie entwickelt wird. (Veröffentlich Mai 2020)
Künstliche Intelligenz in der Medizin - Kann KI den Krebs besiegen?
Auch in der Medizin wird Künstliche Intelligenz immer wichtiger. So wird sie in Nordrhein-Westfalen bei der diagnostischen Beurteilung von Röntgenbildern und Gewebeproben genutzt. Brustkrebs könnte damit viel effektiver erkannt werden. Von Gerrit Stratmann www.deutschlandfunkkultur.de, Zeitfragen Hören bis: 19.01.2038 04:14 Direkter Link zur Audiodatei
Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, medizinische Bilder auszuwerten, aber auch Gensequenzen oder Gewebeproben. Mediziner und Programmierer arbeiten gerade an vielversprechenden Ansätzen.
Frei zirkulierende methylierte DNA als Tumormarker des kolorektalen Karzinoms
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 18/19
Ziel der Studien war die Untersuchung der prognostischen Aussagekraft der methylierten Gene HLTF, HPP1 und NEUROG1. Bislang wird eine Prognoseabschätzung hauptsächlich über radiologische und pathologische Kriterien erreicht. Im Blut bestimmte Marker haben den Vorteil einer relativ unaufwändigen, nichtinvasiven Gewinnung und könnten eine wertvolle Ergänzung der etablierten Faktoren darstellen. Als Vergleichsmarker wurde mit dem CEA der einzige für das KRK relevante Tumormarker, für den eine prognostische Wertigkeit beschrieben wurde, gewählt. Anhand der vorliegenden Daten konnte gezeigt werden, dass HLTF- und HPP1-Methylierung am häufigsten im Serum von Patienten mit fortgeschrittenen, insbesondere metastasierten, Erkrankungen zu finden sind und Marker für eine deutlich schlechtere Prognose sind. Dieser hochsignifikante Effekt zeigte sich insbesondere bei den Patienten mit Metastasen, bei denen jeweils eine Subgruppe mit einer deutlich schlechteren Prognose identifiziert werden konnte. Im Vergleich mit CEA zeigten HLTF und HPP1 eine mindestens gleichwertige prognostische Bedeutung im vorliegenden Kollektiv. Auch in der multivariaten Analyse blieben HLTF, HPP1 und CEA als voneinander unabhängige prognostische Faktoren im Stadium IV bestehen, wobei der Vorteil von HLTF und HPP1 darin liegt, dass diese weiter als binäre Parameter verwendet werden können, während für CEA erst ein passender Grenzwert innerhalb der Population definiert werden muss. Das Vorliegen von korrespondierenden Gewebeproben zu den untersuchten Blutproben ermöglichte die erstmalige Untersuchung der Korrelation von Methylierung von HLTF, HPP1 und NEUROG1 in Serum und Primärtumor. Alle positiven Serumproben zeigten bis auf eine Ausnahme auch Methylierung der entsprechenden Gene im Gewebe. Damit konnte diese Untersuchung die angenommene Herkunft der frei zirkulierenden methylierenden DNA aus dem Tumor bestätigen. Ein Zusammenhang mit dem Methylierungsphänotyp CIMP ergab sich im Kollektiv nicht. In einer weiteren Untersuchung wurde der Zusammenhang der drei Zielparameter mit LDH im Blut als Surrogatmarker für einen hohen Zellzerfall untersucht. Die hohe Korrelation von HLTF und HPP1 mit erhöhten LDH-Spiegeln legt den Zerfall der Tumorzellen als möglichen Mechanismus der Freisetzung der Tumor-DNA in die Blutbahn nahe. Auf der anderen Seite bestand kein Zusammenhang von LDH und Methylierung von NEUROG1. Somit müssen neben tumorassoziiertem Zelltod weitere Mechanismen bei der Freisetzung von methylierter Tumor-DNA eine Rolle spielen, die aktuell noch ungeklärt sind. Zusammenfassend wurde frei zirkulierende methylierte HLTF- und HPP1-DNA als unabhängiger prognostischer Marker des metastasierten kolorektalen Karzinoms untersucht und charakterisiert. Diese vielversprechenden Ergebnisse stellen wertvolle Ansatzpunkte für die weitere Erforschung der Marker in Folgestudien dar, um klinische Anwendungsgebiete zu evaluieren, beispielsweise in der prätherapeutischen Risikostratifizierung, im Therapiemonitoring oder auch zur Prädiktion des Ansprechens auf spezifische Tumortherapien.
Klinischer Krankheitsverlauf der infektiösen Anämie der Schweine und Ausscheidungswege von Mycoplasma suis nach experimenteller Infektion splenektomierter Schweine mit dem Feldstamm K323/13
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Mycoplasma suis gehört zu der Gruppe der hämotrophen Mykoplasmen und ist Erreger der infektiösen Anämie des Schweins (IAP). Der klinische Krankheitsverlauf und die Inkubationszeit der IAP sind abhängig von der Virulenz des Stammes, der Empfänglichkeit des Wirtstieres und der Infektionsdosis des Erregers (HOELZLE, 2008; STADLER et al., 2014). In der vorliegenden Arbeit wurden der klinische Verlauf und die labordiagnostischen Parameter von splenektomierten Schweinen nach experimenteller Infektion mit einem aktuellen M. suis-Feldstamm K323/13 untersucht. Mittels quantitativer LightCycler® MSG1-PCR erfolgte die Detektion und Quantifizierung der M. suis-DNA im Blut der splenektomierten, infizierten Tiere. Zusätzlich wurden Urinproben, Nasen-, Speichel- und Vaginalsekrettupfer- und Gewebestanzproben sowie Gewebeproben von Leber, Klein- und Großhirn auf M. suis-DNA untersucht. Die humorale Immunantwort nach M. suis-Infektion wurde mittels rHspA1-ELISA evaluiert. Bei allen Tieren wurde eine pathologisch-anatomische und pathologisch-histologische Untersuchung durchgeführt. Um den Einfluss der Splenektomie auf die klinischen und labordiagnostischen Parameter zu ermitteln, wurden zudem splenektomierte, nicht infizierte Tiere als Kontrollgruppe verwendet. Sechs Tage p.i. zeigten alle splenektomierten, infizierten Tiere hochgradige Symptome einer akuten IAP in Form von Ikteroanämie, hohem Fieber und Apathie. Darüber hinaus wurden erstmals nach experimenteller Infektion mit M. suis zentralnervöse Symptome beobachtet. Bis zum achten Tag p.i. verendeten sechs der sieben infizierten Tiere bzw. wurden aufgrund einer hochgradigen, lebensbedrohlichen Hypoglykämie getötet. Labordiagnostisch wurde zudem ein massiver Anstieg der Bilirubin- und der Harnstoffkonzentration im Blut festgestellt. Ein infiziertes Tier zeigte einen chronischen Krankheitsverlauf mit wiederholten Phasen einer akuten IAP und hämorrhagischer Diathese. Eine humorale Immunantwort ließ sich mittels eines rHspA1-ELISAs ab dem 42. Tag p.i. detektieren. Bei einzelnen splenektomierten, infizierten Tieren konnte M. suis-DNA sowohl in Nasensekrettupfern als auch in Urinproben nachgewiesen werden. In der pathologisch-anatomischen und pathologisch-histologischen Untersuchung konnten bei den splenektomierten, infizierten Tieren hochgradige Veränderungen einer IAP erhoben werden. Zusätzlich wurde eine für M. suis bisher noch nicht beschriebene peripherlobuläre Leberzelldegenerationen festgestellt. Die splenektomierten, nicht infizierten Tiere zeigten weder klinische Anzeichen noch pathologisch-anatomische oder pathologisch-histologische Veränderungen einer IAP. Die labordiagnostischen Blutparameter verliefen über den gesamten Versuchszeitraum von 90 Tagen innerhalb des Referenzbereichs.
Untersuchungen zur Expression von Mucin1 im Tumorgewebe von Brustkrebspatientinnen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 17/19
Das Mammakarzinom ist weltweit mit über 508.000 Sterbefällen die häufigste krebsbedingte Todesursache. Um dennoch eine Heilung erzielen zu können, existiert ein multimodales Therapiekonzept mit kurativer Absicht. Zu diesem Konzept gehört unter anderem auch die gezielte Krebstherapie, bei welchem sich ein Pharmakon spezifisch gegen Tumorantigene richtet. Da viele Tumorantigene jedoch nicht von allen Mammakarzinomen exprimiert werden, ist die Suche nach weiteren potentiellen Zielen für dieses Konzept sinnvoll. In der vorliegenden Arbeit wurde daher das Expressionsverhalten einiger relevanter Antigene analysiert. Dabei wurden die Antigene Mucin1, sein Epitop, das Thomsen-Friedenreich Antigen und die Tyrosinkinase Her4, beziehungsweise seine aktivierte, phosphorlierte Form phospho-Her4 untersucht. Mucin1, einem beim Mammakarzinom überexprimierten Transmembranprotein wird dabei eine wichtige Rolle in der Tumorprogression zugeschrieben, indem es sich während der Tumorgenese anreichern und somit die Genexpression beeinflussen kann. Das TF-Antigen wird hauptsächlich von Karzinomen und embryofetalem Gewebe gezeigt. Als Oberflächenepitop wird ihm Einfluss auf Adhäsions- und damit Metastasierungsprozesse zugeschrieben. Die Rolle von Her4 in der Tumorprogression dagegen ist trotz Verwandschaft zum bekannten Onkogen Her2/neu nicht ganz geklärt. Sowohl tumorsupressives, wie auch onkogenes Potential sind beschrieben. In der vorliegenden Studie wurden nun die genannten Antigene zu ihrem Verhältnis zur Zelldifferenzierung und zu ihrer Verteilung bezüglich des histologischen Subtyps, sowie der Herdverteilung untersucht. Des Weiteren wurden die Korrelationen der Antigene untereinander analysiert. Dabei wurde Tumorgewebe von 235 operierten Mammakarzinompatientinnen untersucht. Die in Paraffin eingebetteten Gewebeproben wurde dabei per ABC-Methode immunhistochemisch gefärbt, mittels IRS-Score nach Remmele und Stenger bewertet und danach mit dem Kruskal-Wallis Test, dem Mann-WhitneyTest und der Korrelationsanalyse nach Pearson statistisch ausgewertet. Des Weiteren wurde das Überleben der Patientinnen in Abhängigkeit ihres Mucin1-Expressionsmusters mittels Kaplan Meier Analyse und Cox-Regression untersucht. 6. Zusammenfassung - 69 - Bei der optischen Auswertung von Mucin1 fallen zwei verschiedene Färbereaktionen auf, sodass bei der weiteren Analyse eine membranständige von einer zytoplasmatischen Expression differenziert werden konnten. Auch bei Her4/phospho-Her4 ist die Expression vor allem intrazellulär auszumachen, trotz der Tatsache, dass es sich bei Her4 um ein Transmembranprotein handelt. Eine Erklärung hierfür könnten Veränderungen der Zellstruktur bei Tumoren liefern. Verschiedene Autoren konnten diesbezüglich zeigen, dass in Karzinomen sowohl Mucin1 als auch Her4/phopho-Her4 ihre Lokalisation von der Zellmembran ins Zellinnere verlegen können, um sich dadurch über Beeinflussung der Genexpression am Tumorwachstum zu beteiligen. Das Thomsen-Friedenreich Antigen befindet sich dagegen wie bei einem Oberflächenepitop zu erwarten an der Zellmembran. Die statistische Auswertung beschreibt vor allem bei schlecht differenzierten (G3), duktal-klassifizierten Mammakarzinomen hochsignifikante, positive Korrelationen des zytoplasmatischen Mucin1 mit dem TF-Antigen und mit phosho-Her4. Jenes zytoplasmatische Mucin1 zeigt dabei ein schlechteres Überleben als die membranständige Mucin1-Expression. Diese signifikanten Korrelationen und die Erkenntnis, dass zytoplasmatisch-exprimiertes Mucin1 die Genexpression zu beeinflussen vermag, könnten einen Erklärungsansatz für die TF-Expression bei Karzinomen liefern, deren Regulation noch nicht vollständig geklärt ist. Genauer gesagt, eine Interaktion der beiden Akteure untereinander bei schlecht differenzierten, duktalen Karzinomen ist durchaus denkbar. Die Regulation der proteolytischen Verlagerung von Her4/phospho-Her4 ins Zellinnere, welche Her4 erst ein onkogenes Potential verleiht, ist ebenfalls auf weiten Strecken unerforscht. Auch hier könnte durch die beschriebene Korrelation eine Interaktion mit Mucin1 mitverantwortlich gemacht werden. Wenn eine Zusammenarbeit der beschriebenen Antigene auch auf molekularer Ebene nachgewiesen werden könnten, würden diese ein denkbares, potentes Ziel für die beschriebene „targeted therapy“ darstellen. Denn eine antagonisierende Therapie gegen Proteine, die sich gegenseitig beeinflussen lässt eine Verstärkung der Therpiewirkung, im Sinne eines pharmakodynamischen Synergismus erhoffen. Die intrazelluläre Lage der Antigene könnte dagegen ein pharmakokinetisches Hindernis bei einer monokloalen Antikörpertherapie darstellen.
Analysis of spine plasticity in CA1 hippocampal pyramidal neurons employing live cell nanoscopic imaging
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/06
In der Großhirnrinde von Säugetieren befindet sich die Mehrheit erregender Synapsen auf Dornfortsätzen, kleinen dendritischen Ausbuchtungen, die in Größe und Form stark variieren. Die Auslösung aktivitätsabhängiger synaptischer Langzeitplastizität geht mit strukturellen Veränderungen dendritischer Dornen einher. Da das beugungsbegrenzte Auflösungsvermögen konventioneller Lichtmikroskope nicht ausreicht um die Morphologie der Dornen verlässlich zu untersuchen, stellte die Elektronenmikroskopie bisher das wichtigste bildgebende Verfahren zur Erforschung von struktureller Plastizität dar, blieb dabei jedoch auf die Betrachtung fixierter Gewebeproben beschränkt. Die Anwendung hochauflösender Laser-Raster-Mikroskopie mit Stimulierter-Emissions-Auslöschung hat es mir möglich gemacht, die Dynamik dendritischer Dornenmorphologie in lebenden Zellen zu studieren. Die N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor-abhängige Langzeitpotenzierung von Pyramidenzellen der Cornu-Ammonis Region 1 des Hippocampus bildete dabei den Mechanismus, welcher plastische Veränderungen hervorrief. Nach Potenzierung exzitatorischer Synapsen durch die lokale Ultraviolett-Photolyse von caged-Glutamat wurde ein starker, vorübergehender Anstieg des Anteils dendritischer Dornen mit sichelförmigen Köpfen und ein leichter, anhaltender Zuwachs an pilzförmigen Dornfortsätzen über einen Zeitraum von 50 Minuten beobachtet. Meine Untersuchungen ergänzen frühere Studien zur Wechselbeziehung zwischen synaptischer Potenzierung und struktureller Plastizität dendritischer Dornen und korrespondieren mit dem aktuellen Kenntnisstand der zu Grunde liegenden molekularen Mechanismen.
Molekulare Untersuchungen zum Nachweis von M. tuberculosis-Komplex und deren Subtypen an Paraffin eingebetteten humanen und tierischen Gewebeproben
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 16/19
Mykobakterien sind heterogene Krankheitserreger und befallen Mensch und Tier. Der bekannteste Vertreter ist das Mycobacterium tuberculosis als Hauptverursacher der Tuberkulose und wichtigster Vertreter des M. tuberculosis-Komplexes. Daneben gibt es Mycobacteria other than tuberculosis, die MOTTS, die für verschiedene Krankheitsbilder bei unterschiedlichen Spezies verantwortlich sind. In dieser Arbeit wurde der Versuch der molekularbiologischen Stammdifferenzierung bei einer größeren Zahl Formalin fixierter und in Paraffin eingebetteter Proben vorgenommen. Hierbei wurden sowohl Patientenproben als auch Proben aus dem veterinärmedizinischem Bereich herangezogen, die zunächst histologisch begutachtet wurden. Bei fünf von 12 veterinärmedizinischen Fällen wurden säurefeste Stäbchen in der Ziehl-Neelsen Färbung gefunden. In der molekularen Untersuchung wurden bei allen diesen Fälle bis auf einen, bei dem die DNA vermutlich gehemmt ist, und einem zweiten, der in der Färbung unauffällig war, die Anwesenheit von Mykobakterien bestätigt. Bei diesem in der Färbung unauffälligen Fall wurde das Vorhandensein von unbekannten Mykobakterien nachgewiesen. Bei den übrigen vier Fällen wurde dreimal das M. avium subsp. avium, normalerweise Erreger der Geflügeltuberkulose, und einmal das M. avium subsp. paratuberculosis nachgewiesen. M. avium subsp. paratuberculosis ist Erreger der Paratuberkulose, einer chronischen Enteritis bei Rindern. Es konnten keine Mitglieder des M. tuberculosis-Komplexes nachgewiesen werden. Aus dem Bereich der Humanmedizin wurden Patientenproben aus der Routinediagnostik histologisch und molekularbiologisch mit PCR und Spoligotyping untersucht. In der Ziehl-Neelsen-Färbung wurde histologisch nach Tuberkulose-typischen Auffälligkeiten wie Granulome, Epitheloidzellen und Nekrosen gefahndet. Anschließend wurden die Proben molekularbiologisch mit PCR auf β-Aktin als Hinweis auf replizierbare DNA und auf IS6110 als Hinweis auf Mitglieder des M. tuberculosis-Komplexes untersucht. IS6110-positive Proben wurden mit dem Ziel der genauen Stammdifferenzierung dem Spoligotyping zugeführt. Spoligotyping ist eine auf PCR basierende Technik, die gerne für epidemiologische Fragestellungen genutzt wird. Folgende weitere Ergebnisse wurden gewonnen: Die molekulare Untersuchung mittels PCR zeigte die Anwesenheit von M. tuberculosis-Komplex DNA in 36 von 65 humanen Fällen, wohingegen säurefeste Stäbchen in der Ziehl-Neelsen Färbung nur in elf Fällen entdeckt werden konnten. Alle IS6110 positiven Fälle wurden mit Spoligotyping weitergehend untersucht. Dreizehn Fälle boten M. tuberculosis spezifische Muster, während M. bovis spezifische Muster in vier Fällen erhalten wurden.
Biobank erleichtert Diagnose
In der Biobank der Medizinischen Universität Graz werden Gewebeproben und Körperflüssigkeiten zwecks umfassender Erforschung von Krankheitsursache und zum Ziele der Verbesserung einer Diagnose gelagert.
Gen-Expressionsanalyse aus autoptischen Formalin-fixierten und Paraffin- eingebetteten Gewebeproben von Multiple Sklerose Patienten
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
A protocol for RNA isolation from FFPE brain tissue was introduced and optimized in the laboratory. It was demonstrated that both, RNA yield and the ratio of light absorption at 260 nm vs. 280 nm (OD 260/280) in FFPE tissue are comparable to frozen tissue (23). A total of 27 archival brain specimens of 11 MS donors obtained from different brain banks were screened for the ability to amplify the housekeeping gene PPIA as well as miRNA 181a and miR 124. Results were compared to amplification of the same transcripts in 9 frozen MS tissue samples of 9 MS patients. The ability to amplify PPIA in FFPE tissue specimens was very heterogeneously distributed and the loss of amplifiable transcript copies ranged from 45 fold to 200 000 fold as compared to frozen tissue. In some archival samples PPIA could not be detected at all. These specimens were considered not suitable for further qPCR analysis. In contrast, the amplification ofmiRNA 181a and miR 124 in FFPE tissue was tremendously stable with an average loss of amplifiability of 1.7 fold only (23). Among several factors which possibly have an influence on impaired transcript amplification in FFPE tissue, the effect of length of formalin fixation was investigated in more detail. It was shown that duration of formalin fixation had great impact on loss of subsequent amplification of coding transcripts (e. g. PPIA). Compared to frozen tissue, PPIA amplification was reduced by ~15 fold in samples which were formalin-fixed for a day-long period, which is in contrast to a reduction of PPIA amplification by ~200 fold in specimens which had been fixed for years (23). Here again, miRNA amplification was demonstrated to be remarkably stable in the same FFPE tissue samples (23). Based on the stable miRNA detection in FFPE tissue specimens, 18 FFPE tissue specimens (MS n=13, healthy donor n=5) were included in a study which compared the miRNA expression pattern in MS lesions to healthy brain tissue by qPCR analysis of 365 mature miRNAs (42). Furthermore, an experimental setup was established which allows for precise dissection of MS lesions from surrounding normal appearing white matter (NAWM). To this end, FFPE sections were obtained using a microtome, were flattened in a DEPC water bath and mounted on PEN membrane coated slides. RNA yield and amplification of PPIA were not altered by this approach. Parallel tissue sections were stained with Luxol Fast Blue (LFB) and served as a model to help with the precise dissection of MS lesions. This setup was applied to 5 FFPE tissue samples (MS lesion n=3, healthy donor n=2). RNA was isolated from the dissected tissue specimens to analyse differential expression of 84 extracellular matrix (ECM) related genes in MS lesions compared to healthy tissue using TaqMan® Low Density Array qPCR technology. This was compared to a data set derived from frozen tissue samples that had been processed in a similar way. Detection of gene regulation (MS/healthy) in FFPE tissue was found to be reliable and comparable to frozen tissue, provided that the selected genes were of sufficient abundance (23). The up-regulation of the extracellular matrix component decorin could be validated on protein level by immuno-histochemistry in the same FFPE MS lesions. This result was published as part of a study which investigated the expression of several extracellular matrix related genes in MS lesions with frozen tissue, e.g. collagens and the protein biglycan (61). Furthermore this study showed that fibrillar collagens, biglycan and decorin are part of the perivascular fibrosis. These molecules are expressed inproximity to tissue invading immune cells, therefore suggesting a possible disease modifying function (61). In summary, this work presents a detailed protocol for the use of autoptic FFPE tissue specimens to obtain gene expression profiles from dissected MS lesions (23). This protocol was implemented as part of a study which investigated alterations of ECM in MS lesions (61) and contributed to obtain the first miRNA profile in MS lesions (42).
Therapeutische Neovaskularisation
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 15/19
Die Induktion eines vaskulären Wachstums und Remodelings stellt einen vielversprechenden neuen Therapieansatz für Patienten mit koronarer Herzerkrankung dar. Stickstoffmonoxid (NO) nimmt in der Regulation des Blutflusses, in der Aufrechterhaltung der vaskulären Homöostase sowie als second messenger für die Induktion einer Arteriogenese und Angiogenese eine zentrale Rolle ein. Dank des Systems der druckregulierten Retroinfusion steht daneben ein komplikations- und nebenwirkungsarmes Verfahren zur Verfügung, das eine selektive, homogene und effektive Applikation von gefäßbildenden Faktoren im Myokard ermöglicht. In der vorliegenden Arbeit wurde die retrograde Infusion von eNOS S1177D komplementärer DNA (als konstitutiv aktive Mutante) in die anteriore Koronarvene zur Induktion einer therapeutischen Revaskularisation im chronisch ischämischen, hibernierenden Myokard untersucht. Mittels perkutaner Implantation eines präparierten Koronarstents wurde zunächst eine hochgradige Stenose im proximalen LAD-Segment der linken Koronararterie herbeigeführt. Nach sieben Tagen wurde angiographisch ein Restfluss dokumentiert, um eine langsame aber stetige Abnahme der myokardialen Durchblutung bis zur vollständigen Okklusion zu gewährleisten und die Induktion einer myokardialen Hibernation mit reduzierter kontraktiler Funktion ohne schwerwiegende Infarzierung des Gewebes sicherzustellen. Drei Wochen später wurde den Tieren eNOS S1177D cDNA, eNOS S1177D und L-NAME (unspezifischer NO-Inhibitor) oder eGFP cDNA als Scheintransfektion retrograd in die anteriore Koronarvene infundiert (n,=,6 pro Gruppe). Sowohl am Behandlungstag als auch am Tag,49 der Untersuchung (Versuchsende) wurden Parameter der globalen Herzfunktion bestimmt. Zur Analyse der regionalen myokardialen Perfusion dienten fluoreszierende Mikrosphären; die Bestimmung der regionalen Myokardfunktion als subsegmentale Segmentverkürzung gelang mit Hilfe der Sonomikrometrie. Für das Kollateralenwachstum wurden postmortale Angiographien ausgewertet. Darüber hinaus war zur Ermittlung der Expression von eNOS, des regionalen Blutflusses und der Kapillardichte die Entnahme von Gewebeproben aus dem linken Ventrikel erforderlich. In dieser Untersuchung demonstrieren wir, dass die retrograde Applikation von eNOS S1177D cDNA über die Überexpression von eNOS ein NO vermitteltes Gefäßwachstum induziert, welches mit einer gesteigerten myokardialen Perfusion einhergeht und schließlich zu einer verbesserten kontraktilen Funktion im Zielgebiet führt. Die zum Kontrollareal 2,3-fach gesteigerte Expression von eNOS geht dabei über eine gesteigerte Bildung von NO respektive cGMP (117,1,% der RCx-perfundierten Region) neben einer Proliferation von Kapillaren (Angiogenese) insbesondere mit der Bildung von kollateralisierenden Anastomosen (Arteriogenese) einher. Aus diesem vaskulären Wachstum und Remodeling resultiert im Vergleich zur Kontrollgruppe arealabhängig eine bis zu 2,2-fach gesteigerte myokardiale Perfusion, wodurch sich die regionale Herzfunktion (subsegmentale Segmentverkürzung) bei erhöhtem Sauerstoffbedarf von 7.% auf 41,% (Herzfrequenz von 120 Schägen pro Minute) respektive 33,% (Herzfrequenz von 140 Schlägen pro Minute) des normoxischen Myokards regeneriert.
Vergleichende Untersuchungen zu frühen Wirt-Pathogen-Interaktionen bei akuter und subklinischer Mastitis des Rindes
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 05/07
Die Mastitis des Rindes ist die wirtschaftlich bedeutendste Einzeltiererkrankung in der Milchwirtschaft. Staphylococcus aureus (S. aureus) und Escherichia coli (E. coli) zählen zu den wichtigsten Mastitiserregern, die jedoch zumeist sehr unterschiedliche Krankheitsbilder hervorrufen. So verursacht E. coli hauptsächlich transiente, akute klinische Mastitiden, während S. aureus als bedeutendster Verursacher chronischer bis subklinischer Mastitiden mit persistierendem Verlauf angesehen wird. In den letzten Jahrzehnten wurde die Pathophysiologie der entzündeten Milchdrüse eingehend wissenschaftlich bearbeitet. Frühe Zeitpunkte einer intramammären Infek-tion, zu denen die Pathogene zwar bereits erkannt wurden, aber noch keine klinischen Symptomen in Erscheinung getreten sind, wurden bislang in vivo noch nicht untersucht. Zu den ersten wirtsseitigen Ereignissen nach dem Eindringen und Erkennen der Patho-gene zählen Veränderungen in der Abundanz von mRNA-Transkripten immun-relevanter Gene. Vertreter dieser differentiell exprimierten Gene gehören z.B. zu den Zytokinen, Chemokinen und antimikrobiellen Peptiden. Diese sollen es dem Wirt ermöglichen, eine adäquate Immunantwort zu initiieren, welche als entscheidend für den klinischen Verlauf der Erkrankung gilt. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Tiermodell zur Simulation der ersten 3 h nach dem Eindringen der Pathogene E. coli und S. aureus in das Euter etabliert. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Untersuchung von Expressionsänderungen ausgewählter Kandidatengene nach unterschiedlich langer Erregerexposition (1-3 h) in verschiedenen Kompartimenten der Milchdrüse. Dabei wurden die Lokalisationen Zitzenzisterne (ZZ), Drüsenzisterne (DZ) und das ventrale Euterparenchym (EU) näher untersucht. Großes Augenmerk lag auf einer strengen Standardisierung der Versuchs-tiere, um die Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse sicherzustellen. Der Versuch umfasste 12 erstlaktierende Kühe der Rasse Holstein-Friesian mit makelloser Allgemein- und Eutergesundheit und einer Zellzahl < 50.000/ml Milch in allen 4 Eutervierteln. Bei den Tieren wurden 3 Euterviertel jeweils sequentiell über einen Zeitraum von 1, 2 und 3 h entweder mit 5*106 CFU E. coli1303 (n = 6) oder S. aureus1027 (n = 6) intrazisternal inokuliert. Ein Kontrollviertel blieb unbehandelt und diente der Ermittlung von Basisexpressionswerten. Mit Hilfe der unterschiedlich lange inokulierten Viertel konnte ein zeitlicher Verlauf der Expressionsänderungen ausgewählter Kandidatengene extrapoliert werden. Wie erwartet traten innerhalb des dreistündigen Versuchszeitraumes keinerlei klinische Effekte bei den Versuchstieren auf. Die innere Körpertemperatur, der Leukozytengehalt im Blut, der SCC und verschiedene Milchinhaltsstoffe erfuhren keine Veränderungen, die auf die Pathogen-Exposition zurückzuführen waren. Durch wiederholte Unter-suchung von Milchproben im Versuchsverlauf wurde die bakterielle Vermehrung analysiert. Hierbei konnte eine Vervielfachung von E. coli um durchschnittlich das 30-fache festgestellt werden, wohingegen sich S. aureus innerhalb der ersten 3 h p. inoc. vergleichsweise schwach vermehrte (durchschnittlich 1,8-fach). Die beiden im Tiermodell verwendeten Bakterienstämme wurden parallel in vitro in Milch und in Nährmedium kultiviert, um deren Wachstum und Adaptationsfähigeit zu untersuchen. E. coli erreichte nach 14-stündiger Inkubation in Milch ein Maximum von 1,2*109 ± 2,5*108 CFU/ml (MW ± SD), während S. aureus mit 5,3*108 ± 8,9*108 CFU/ml (MW ± SD) eine deutlich schwächere und heterogenere Vermehrung zeigte. Im Anschluss an diese Vorinkubation in Vollmilch wurde untersucht, ob sich die Pathogene an das spezifische Wachstumsmedium Milch anpassen konnten. Nach Umsetzen in frische Vollmilch zeigten die Pathogene jedoch kein verbessertes und beschleunigtes Wachstum im Vergleich zu in standardisiertem Medium vorkultivierten Bakterien. Um die Vergleichbarkeit mit früheren Experimenten sicherzustellen, wurden E. coli und S. aureus deshalb mit Nährmedium für die in vivo-Versuche präpariert. Drei Stunden nach Inokulation des ersten Euterviertels wurden die Tiere getötet und Gewebeproben innerhalb von 20 min aus den drei zu untersuchenden Lokalisationen (ZZ, DZ, EU) der einzelnen Euterviertel gewonnen. Die Proben wurden unmittelbar nach Entnahme in Stickstoff schockgefroren und bis zur Aufarbeitung bei -80°C tiefgefroren. Im Rahmen weiterer Untersuchungen fand dann die mRNA-Extraktion sowie die Analyse der Transkript-Abundanzen entzündungsrelevanter Kandidatengene (IL6, TNF, CXCL8, CCL20, S100A9, LAP, LCN2, MX2 und CYP1A1) mittels qRT-PCR statt. Die Auswahl geeigneter Gene erfolgte sowohl anhand eines orientierenden Vorversuchs in vivo als auch anhand bekannter, in vergleichbaren in vitro-Experimenten regulierten Genen der Milchdrüsenepithelzelle. Es konnte gezeigt werden, dass die Expressionsänderungen nach Kontakt mit E. coli deutlich stärker und homogener ausfielen als nach Kontakt mit S. aureus. Bereits nach 1-stündiger Erregerexposition konnten signifikante Steigerungen der mRNA-Expression einiger Gene verzeichnet werden. Dies galt vor allem für die Chemokine CCL20 und CXCL8 sowohl nach Exposition mit E. coli, als auch mit S. aureus. Für die Zytokine IL6 und TNF konnte eine rasche mRNA-Expressionssteigerung nach 1-stündiger intramammärer Inokulation von E. coli nachgewiesen werden, während eine Regulation im Euter mit S. aureus inokulierter Tiere erst nach 2 h und vergleichsweise schwächer eintrat. Die antibakteriell wirkenden Faktoren S100A9 und LAP waren den Chemo-kinen und Zytokinen zeitlich nachgeschaltet, wurden aber nur nach Exposition mit E. coli deutlich hochreguliert. Im Gegensatz zu in vitro-Untersuchungen mit Milch-drüsenepithelzellen konnte für die Gene LCN2, MX2 und CYP1A1 keine nennenswerte Regulation nach Inokulation mit E. coli und S. aureus festgestellt werden. Des Weiteren fiel auf, dass die untersuchten Kandidatengene invariant stärker in ZZ und DZ heraufreguliert wurden, als im EU. Meist ähnelten sich ZZ und DZ in Stärke und Verlauf der Expressionsänderung. Im ventralen Euterparenchym dagegen konnte nach Inokulation von E. coli nur für die Gene IL6, TNF, CXCL8 und S100A9 eine vergleichsweise schwache, aber statistisch signifikante Steigerung der mRNA-Expression aufgezeigt werden. Nach Inokulation mit S. aureus konnte in dieser Lokalisation keine Hochregulation der untersuchten Kandidatengene festgestellt werden. Das in dieser Arbeit etablierte Tiermodell zeigt erstmalig in vivo die frühe patho-genspezifische und kompartimentabhängige Regulation immunrelevanter Gene im Eutergewebe der Milchkuh auf. Es bietet damit eine gute Basis für holistische Ansätze zur Untersuchung sehr früher Ereignisse bei der Wirt-Pathogen-Interaktion. Mittelfristig soll hiermit aufgeklärt werden, welche wirts- und pathogenseitigen Mechanismen zur Entstehung akuter und chronischer Mastitiden führen und welche Faktoren persistente Infektionen der Milchdrüse fördern oder verhindern. Detaillierte Kenntnisse über solche frühen Ereignisse ebnen den Weg, Ansätze für eine verbesserte Mastitis-Diagnostik, -Prophylaxe und -Therapie bei der bovinen Mastitis zu finden.
Einfluss verschiedener Zellpopulationen auf die Bildung Freier-Radikal-Spezies während der hyperakuten Abstossung der xenoperfundierten Rattenleber.
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 11/19
Die hyperakute Abstossung stellt die unmittelbarste Hürde für die Leber-Xenotransplantation dar. Das Ziel dieser Arbeit war es die Bedeutung verschiedener Zellpopulationen für die Bildung von freien Radikalen während der hyperakuten Abstossung der xenotransplantierten Leber zu untersuchen. Wir befassten uns mit der Frage ob es einen Zusammenhang zwischen der FR-Freisetzung und der hyperakuten Abstossung gibt und welche Zellpopulationen hauptverantwortlich für den oxidativen Schaden während der hyperakuten Abstossung sind. In einem etablierten Xenoperfusions-System wurden Rattenlebern mit Perfusaten bestehend aus gezielt-isolierten Zellgruppen reperfundiert. Hierbei evaluierten wir ein Leukozytenfiltersystem und wendeten zur Thrombozytengewinnung ein validiertes Separations/Zentrifugationsprotokoll an. Sowohl die physiologische Zusammensetzung der Perfusate, als auch die physiologische Funktion der Zellen konnten durch Coulter Counter, P-Selektin Flowzytometrie und histologische Untersuchungen gewährleistet werden. Zur Erfassung der FR-Produktion, wurden die Lipidperoxidation, NO Abbauprodukte anhand der Griess–Reaktion, Peroxynitrikonzentration und der antioxidative Status mittels Glutathionkonzentration analysiert. Durch die Verwendung dieser Messmethoden, ließen sich freie Radikale nicht direkt messen und mögliche Zwischenprodukte oder Reaktionsschritte nicht vollständig erfassen, aber die Bestimmung derer stabilen Endprodukte bot uns die Möglichkeit auch ohne Hinzufügen von Chemikalien in das Perfusionssystem ein umfassendes Bild des oxidativen Stresses zu erfassen. Die Organfunktion wurde mittels der Galleproduktion und der Freisetzung von Leberenzyme kontrolliert. Der Potaldruck war ein wichtiger Messparameter für die Makrohämodynamik. Nach Ende der Perfusion wurden Gewebeproben zur histologischen Aufarbeitung mit der HE-, Esterase- und Komplementfärbung zum Nachweis der hyperakuten Abstossungsreaktion entnommen. Folgende Ergebnisse konnten wir zusammenfassend aus unseren Daten gewinnen: In unserem Modell der perfundierten Rattenleber gab es einen signifikanten Unterschied bezüglich der Freisetzung von ROS/RNS zwischen der isogenen und xenogenen Reperfusion mit Vollblut. In den xenogen perfundierten Gruppen hatten wir trotz Zeichen einer Komplementaktivierung, d.h. einer hyperakuten Abstossung, in den Versuchsgruppen mit geringen FR-Konzentrationen eine Reduktion der Leberschäden beobachtet. Wir konnten daraus folgern, die ROS-Bildung im engen Zusammenhang mit der Leberfunktion, dem Zellschaden und der hyperakuten Abstoßungsreaktion stand. Wir konnten in unserem Modell nun erstmals zeigen, dass die Aktivierung des Komplementsystems nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von Leukozyten zur Freisetzung von radikalen Stickstoff- und Sauerstoffspezies führt, die dann wiederum die Schädigung des Gewebes und die Dysfunktion des Transplantates verursachen. Es gab signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Zellpopulationen hinsichtlich der Freisetzung von FR in unserem Xenotransplantations-Modell. Unsere Daten weisen darauf hin, dass in der Frühphase der hyperakuten Abstossung weder Erythrozyten noch Thrombozyten oder Hepatozyten eine große Rolle in der Freisetzung von FR spielen. Es ließen sich in den Erythrozyten-und Thrombozytengruppen keine signifikanten Unterschiede zur isogen perfundierten Kontrollgruppe finden. Hauptsächlich für den oxidativen Schaden - also Freisetzung von ROS und RNS - verantwortlich waren in unserem Modell die Leukozyten und in einem geringeren Maße die Kupfferzellen, aber nur in Kombination mit den Leukozyten. Die Leukozytendepletion durch die Filtration wirkte am protektivsten auf die Organfunktion, wogegen die Depletion von KC, nur die ROS-Freisetzung reduzierte, aber keinen protektiven Einfluss auf den Grad der hyperakute Abstossung und Organschädigung hatte. Die Anwesenheit von KC dagegen scheinen NO abzufangen und wirken bezüglich RNS protektiv. Unsere Daten tragen zu dem Verständnis der frühen Vorgänge und insbesondere der Rolle der Freien Radikale während der hyperakuten Abstossung in der Xenotransplantation der Leber bei. Eine Inhibierung oder Modulation der ROS-Freisetzung könnte eine viel versprechende Basis für einen therapeutischen Ansatz der hyperakuten Abstossung darstellen. Inwieweit eine gezielte pharmakologische Hemmung der Leukozytenaktivität und der Einsatz von FR spezifischen Scavengern zu einer Verminderung der hyperakuten Abstoßung von Xenotransplantaten bewirken können, bleibt Inhalt künftiger Untersuchungen.
Gefäßbiologie maligner Hirntumore
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Das Glioblastoma multiforme (GBM, WHO-Grad IV) ist ein äußerst aggressiver und stark vaskularisierter Tumor. Trotz multimodaler Therapiekonzepte mit chirurgischer Resektion, Bestrahlung und Chemotherapie haben die betroffenen Patienten eine schlechte Prognose von lediglich 9 bis 15 Monaten Überlebenszeit nach Diagnosestellung. Innovative Therapiekonzepte sind daher dringend erforderlich. Im Fokus dieser Arbeit stand das abnorme Gefäßsystem maligner Hirntumoren. Aufbauend auf einem besseren Verständnis der Gefäßbiologie dieser Tumoren wurden potenzielle Strategien für Diagnostik und Therapie entwickelt und evaluiert. Progenitorzellen aus dem Knochenmark sind in vielfacher Weise an der Neoangiogenese von Tumorgefäßen beteiligt. Immundefizienten Ratten wurden in dieser Arbeit primäre humane MSC systemisch appliziert, nachdem den Tieren zuvor ein humanes Gliom implantiert worden war. Die Rekrutierung der MSC in den Tumor wurde immunhistochemisch nachgewiesen. Die endotheliale Differenzierung der MSC konnte mit gentechnisch modifizierten MSC-Linien bestätigt werden. Diese Zellen enthielten einen Vektor mit dem Reportergen RFP (red fluorescent protein), dessen Expression unter der Kontrolle des endothelspezifischen Tie2-Promotor/Enhancer-Konstruktes steht. Darauf aufbauend wurde eine MSC-Linie etabliert, bei der statt des Reportergens RFP das Selbstmordgen HSV-TK unter der Kontrolle des Tie2-Promoters steht. Die Hypothese hierzu ist, dass nach systemischer Verabreichung dieser MSC durch Zugabe von Ganciclovir eine selektive Toxizität auf den Tumor bewirkt wird. Zur genaueren Charakterisierung der Gefäßstrukturen in Hirntumoren wurde die Expression Lymphgefäß-assoziierter Moleküle in Gewebe unterschiedlicher Gliome untersucht. Die lymphangiogenen Wachstumsfaktoren VEGF-C,-D und ihr Rezeptor VEGFR-3 zeigten im GBM hohe Expressionswerte. Die Expression von VEGFR-3 unterschied sich signifikant von der in niedriggradigen Astrozytomen (WHO-Grad II). Podoplanin war in allen Gewebeproben des GBM sehr hoch exprimiert, in einigen Zellen zeigte sich eine Co-Lokalisation mit Prox-1. Die Expression war allerdings nicht gefäßassoziiert, sondern ausschließlich auf den Tumorzellen zu finden. Eine streng endotheliale Lokalisation zeigte sich dagegen im anaplastischen Oligodendrogliom (WHO-Grad III), in dem Podoplanin mit VEGFR-3 co-exprimiert ist. Durchgehend negativ für Podoplanin waren alle untersuchten Astrozytome (WHO-Grad II). Für weiterführende Untersuchungen zur Funktion von Podoplanin wurden zwei GBM-Zelllinien etabliert, die einen Podoplanin-Überexpressionsvektor stabil exprimieren. Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstreichen die zentrale Bedeutung des Gefäßsystems für das GBM. Es wurde gezeigt, dass MSC effektiv aus der Peripherie in den Hirntumor rekrutiert werden und dort aktiv an der Angiogenese beteiligt sind. MSC eignen sich somit, nach genetischer Modifikation, als Vehikel für therapeutisch wirksame Gene, mit denen das neu entstehende Gefäßsystem des GBM gezielt angegriffen werden kann. Für die entsprechenden in vivo-Versuche wurde bereits eine gentechnisch modifizierte MSC-Linie entwickelt und ein Therapieschema entworfen. Obwohl das Gehirn unter normalen Bedingungen kein Lymphgefäßsystem besitzt, wurden im Gewebe der malignen Hirntumoren in dieser Arbeit auch Lymphgefäß-assoziierte Moleküle nachgewiesen. Die Expression des Rezeptor-Liganden-Systems VEGFR-3/ VEGF-C,-D korreliert dabei mit dem Malignitätsgrad der Hirntumoren. Das gegensätzliche Expressionsmuster von Podoplanin könnte ein diagnostisches Kriterium darstellen, um Hirntumore mit unterschiedlichem Malignitätsgrad histopathologisch voneinander zu unterscheiden oder es könnte eine potenzielle Zielstruktur für neue Therapieansätze darstellen. Mit den etablierten GBM-Zelllinien steht ein Zellmodell zur weiteren Analyse der noch ungeklärten Funktion des Podoplanins im GBM zur Verfügung.
Analyse der BACE-1-Regulation in der Alzheimer-Krankheit und im Down-Syndrom
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 10/19
Die Alzheimer-Krankheit (AD), die häufigste Form der Demenz, manifestiert sich klinisch meist ab dem 65. Lebensjahr mit langsam progredienten Gedächtnis-, Orientierungs- und Aufmerksamkeitsstörungen. Neuropathologische Korrelate sind die Amyloid-Plaques, die hauptsächlich aus extrazellulären Aggregaten des β-Amyloid-Proteins (Aβ) zusammengesetzt sind, und intrazelluläre neurofibrilläre Bündel, die aus Aggregaten des mikrotubulus-assoziierten Proteins Tau bestehen. Der „Auslöser“ der Alzheimer-Krankheit ist das β-Amyloid-Protein (Amyloid-Kaskaden-Hypothese), welches durch proteolytische Prozessierung von βAPP (β-Amyloid-Vorläufer-Protein) entsteht. Dies geschieht, indem zuerst BACE-1 (β-site APP cleaving enzyme 1) und anschließend der γ-Sekretase-Komplex βAPP schneiden. Menschen mit Down-Syndrom (DS), welches die häufigste autosomale Chromosomenaberration darstellt, entwickeln bereits ab einem Alter von 40 Jahren die typischen neuropathologischen Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit und zeigen mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren die klinischen Symptome der Demenz. Die Gründe für das frühe Auftreten der Amyloid-Plaques sind noch nicht vollständig geklärt. Das Gen für βAPP befindet sich auf dem Chromosom 21, welches im DS dreifach vorhanden ist, und wird daher mit der frühen Plaque-Pathologie im Down-Syndrom in Zusammenhang gebracht. BACE-1 konnte durch Überexpressions- und Knock-out-Experimente eindeutig als alleinige β-Sekretase identifiziert werden. In Gehirnen von Alzheimer-Demenz-Patienten konnten im Vergleich zu Kontrollgehirnen erhöhte BACE-1-Proteinmengen und BACE-1-Aktivitäten nachgewiesen werden. Es war deshalb interessant zu untersuchen, ob auch im Gehirn von Down-Syndrom-Patienten die BACE-1-Proteinexpression erhöht ist. Durch eine Hochregulation von BACE-1 im Down-Syndrom könnte vermehrt βAPP prozessiert und somit Aβ gebildet werden. Daher war es das Ziel der vorliegenden Arbeit die Expression von BACE-1 in Gehirnen (Temporal- und Frontallappen) von DS-Patienten im Vergleich zu Kontrollgehirnen zu analysieren. In der Western-Blot-Analyse der Gewebeproben konnte gezeigt werden, dass die BACE-1-Proteinmengen im Down-Syndrom im Vergleich zu den Kontrollen (K) 1,4-fach erhöht waren. Die Proteinexpressionen von βAPP zeigten sich im DS im Vergleich zu den Kontrollen 1,4-fach erhöht. Diese Ergebnisse erzielten keine Signifikanz, zeigten aber deutliche Trends im Expressionsverhalten. Dies könnte auf die Anzahl der untersuchten Gehirne (Temporal- und Frontallappen je 3 DS, 4 AD und 5 K), Qualitätsmängel der Gehirnproben oder einer ungleichen Verteilung der Proteinexpression im Gewebe zurückzuführen sein. Es ist daher notwendig mehr Gehirne zu untersuchen. Zudem wäre es interessant in Gehirnschnitten das Verteilungsmuster der BACE-1-Expression im DS genauer zu studieren. Die Ergebnisse deuten jedoch auf eine Hochregulation von BACE-1 im DS-Gehirn und somit auf eine Beteiligung der Protease an der Plaquepathologie des Down-Syndroms hin. BACE-1 scheint also sowohl in der Pathogenese der Alzheimer-Demenz als auch in der des Down-Syndroms eine zentrale Rolle einzunehmen. Daher ist es sehr interessant die Regulation von BACE-1 weiter zu analysieren. Da in p25-überexprimierenden Mäusen erhöhte BACE-1-Proteinexpressionen gezeigt werden konnten, vermutete man eine Beteiligung von p25 an der Regulation der β-Sekretase. p25, das im Gehirn der AD-Patienten vermehrt gebildet wird und aus der Proteolyse von p35 entsteht, bindet und aktiviert die Kinase cdk5. cdk5 phosphoryliert unter anderem das Tau-Protein und wird daher mit der Bildung der neurofibrillären Bündel in Zusammenhang gebracht. Durch die Hochregulation von BACE-1 könnte p25 in der Pathogenese der Alzheimer-Erkrankung eine neue Bedeutung zugeschrieben werden. Zur Analyse der p25 induzierten Veränderungen in den Neuronen wurden humane Neuroblastomazellen mit einem induzierbaren p25-Expressionsvektor, Sp25-Zellen, verwendet. In diesen p25-überexprimierenden Zellen konnten sowohl in der Western-Blot-Analyse als auch in der BACE-1-Aktivitätsmessung erhöhte BACE-1-Proteinexpressionen bzw. BACE-1-Aktivitäten gezeigt werden. Die Northern-Blot-Analyse der Sp25-Zellen ergab erhöhte BACE-1-mRNA-Spiegel, die sich jedoch in einer für endogene BACE-1-mRNA untypische Größe detektieren ließen. p35, das membrangebundene Vorläufer-Protein von p25, war indes nicht in der Lage die BACE-1-Proteinexpression in humanen Neuroblastomazellen zu erhöhen. Die Ergebnisse der Sp25-Zellen konnten in p25-überexprimierenden murinen Neuroblastomazellen, Np25-Zellen, nicht reproduziert werden. Daher ist es notwendig, den p25-induzierten BACE-1-Regulationsmechanismus auf seine Reproduzierbarkeit, z.B. in weiteren In-vivo-Modellen, zu überprüfen.
Untersuchungen zur Ätiologie des ösophagealen Adenokarzinoms in Abhängigkeit zur Myosminbelastung durch die Ernährung
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 09/19
Die beiden tabakspezifischen Nitrosamine (TSNA) 4 (Methylnitrosamino) 1-(3 pyridyl)-1-butanon (NNK) und N'-Nitrosonornicotin (NNN) sind kanzerogene Inhaltstoffe des Tabakrauchs. NNK erzeugt im Tierversuch vor allem Tumoren in Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse und der Nasenhöhle. NNN führt dagegen zu Ösophagustumoren, aber auch zu Tumoren der Nasenhöhle. Unter metabolischer Aktivierung bilden beide TSNA eine reaktive Zwischenstufe, die mit Biomolekülen reagiert und nach Hydrolyse 4-Hydroxy-(3-pyridyl)-1-butanon (HPB) abspaltet. Nach Extraktion und Derivatisierung kann das HPB mit hoher Nachweisempfindlichkeit mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) bestimmt werden. Eine andere Quelle für diese Addukte stellt das Myosmin dar. Zwar ist es auch ein Nebenbestandteil der Alkaloidfraktion des Tabaks, aber unabhängig davon kommt es in einer Vielzahl von Nahrungsmitteln vor und kann in Plasma und Speichel des Menschen nachgewiesen werden. Myosmin bildet im sauren Milieu durch Nitrosierung bzw. Peroxidierung ebenfalls HPB-Addukte. Ähnliche Bedingungen liegen in der unteren Speiseröhre bei einer Refluxerkrankung vor. Bei einem Teil der Patienten kommt es zu einer Metaplasie der Speiseröhrenschleimhaut, dem Barrett-Ösophagus, der ein Präkanzerose darstellt, und aus dem sich pro Jahr bei 1-2% der Patienten ein ösophageales Adenokarzinoms (EAC) entwickelt. Das EAC zeigt vor allem in westlichen Industriestaaten eine stark steigende Inzidenzrate. Hauptrisikofaktoren für die Entstehung eines EAC sind neben dem Barrett-Ösophagus das männliche Geschlecht, Übergewicht und eine gemüse-/obstarme Ernährung bzw. der übermäßige Verzehr von tierischen Fetten. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Rolle von HPB-abspaltenden DNA-Addukten in Biopsien der unteren Speiseröhre für das Krankheitsbild, insbesondere der Sequenz Reflux, gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), Barrett, EAC und der mögliche Beitrag des Rauchens und der Myosminbelastung durch die Ernährung. Im Rahmen einer endoskopischen Untersuchung erhielten wir von nüchternen Patienten zwei Biopsien der Ösophagusschleimhaut oral and aboral der magennahen Läsion für die Bestimmung der DNA-Addukte und eine Blutprobe zur Bestimmung der Myosmin- und Cotininkonzentration. Zusätzlich wurden die Teilnehmer gebeten einen Fragebogen zu Lebens- und Ernährungsgewohnheiten auszufüllen. Vorrangiges Ziel war zunächst die Verbesserung der bestehenden analytischen Methoden. Bei der Bestimmung der Plasmakonzentration der Nicotinoide konnte durch Verwendung einer Mischpolymer-Festphase der Zeit- und Materialaufwand deutlich reduziert werden. Insgesamt nahmen 92 Patienten an der Studie teil, wobei von 84 Teilnehmern auch die HPB-Addukte und Plasmakonzentrationen bestimmt werden konnten. Die Konzentration der HPB-Addukte in Schleimhautbiopsien der unteren Speiseröhre war mit 4,75 pmol/mg deutlich höher als zuvor berichtete Adduktlevel von Gewebeproben, die im Rahmen von Autopsien gewonnen worden waren und auch untere Schichten der Ösophaguswand einschlossen. Insgesamt ergab sich keine Abhängigkeit der Adduktkonzentration vom Geschlecht oder Rauchstatus. In der Sequenz Reflux, GERD, Barrett, EAC zeigten Patienten mit Reflux eine deutliche Tendenz zu höheren Werten. Bei Patienten, die häufig unter Sodbrennen leiden, war die Konzentration der HPB-Addukte gegenüber symptomfreien Patienten signifikant erhöht. Diese Ergebnisse stützen die Hypothese der Bildung von HPB-Addukten aus Myosmin in der unteren Speiseröhre. Hinsichtlich der Ernährungsgewohnheiten zeigten sich wenige Auffälligkeiten. Lediglich bei häufigem Verzehr von scharfen Speisen und nusshaltigen Lebensmitteln und bei regelmäßigem Alkoholkonsum zeigte sich eine Tendenz zu höheren Adduktwerten. Beim Milchkonsum verhielt es sich umgekehrt, der häufigere Verzehr führte zu einer Erniedrigung der HPB-Konzentration an der DNA. Die Myosminkonzentration im Plasma der nüchternen Patienten hatte aufgrund der anzunehmenden kurzen Halbwertszeit von Myosmin nur eine geringe Aussagekraft. Es bestand keine Korrelation mit den HPB-Addukten und auch keine Abhängigkeit vom Rauchstatus, während regelmäßiger Alkoholkonsum die Konzentration von Myosmin signifikant erhöhte.
Prognostische Relevanz disseminierter Tumorzellen im Knochenmark sowie tumorbiologischer Faktoren bei 265 Patientinnen mit Mammakarzinom
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 09/19
Das Mammakarzinom ist eine Tumorerkrankung mit einem sehr heterogenen Krankheitsverlauf. Um den individuellen Krankheitsverlauf einer Patientin besser vorhersagen zu können und um individuelle Therapieentscheidungen treffen zu können, bedarf es prognostischer und prädiktiver Faktoren. Neben den etablierten Prognosefaktoren Tumorgröße, Lymphknotenstatus, Metastasierung und Grading werden momentan verschiedene biologische Faktoren untersucht. Darüber hinaus wird in letzter Zeit insbesondere die prognostische Bedeutung von disseminierten Tumorzellen im Knochenmark diskutiert. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die prognostische Relevanz von den biologischen Faktoren HER2, Topoisomerase-IIalpha, Ki67 und p53 sowie deren Korrelation mit dem Nachweis von disseminierten Tumorzellen im Knochenmark bei Patientinnen mit Mamma-CA zu evaluieren. Insgesamt wurden Gewebeproben von 256 primären Mammakarzinomen mit bekanntem Knochenmarkstatus untersucht. Zunächst wurden aus den archivierten Gewebeblöcken sogenannte Tissue-Micro-Arrays (TMAs) hergestellt. An diesen TMAs wurde die Expression von HER2, Topoisomerase-IIalpha, Ki67 und p53 mit Hilfe immunhistochemischer Färbungen analysiert. Zusätzlich wurde das Tumorgewebe auf eine potentielle Genamplifikation von HER2 und Topoisomerase-IIalpha mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) hin untersucht. Es stellte sich heraus, dass die meisten dieser biologischen Faktoren untereinander korrelieren. Darüber hinaus konnte eine signifikante Korrelation zwischen der Überexpression von HER2 und einem kürzerem krankheitsfreien Überleben der Patientinnen nachgewiesen werden. Weitere Korrelationen zwischen den einzelnen Faktoren und dem Krankheitsverlauf wurden nur in einigen Subgruppen gefunden. Keiner der untersuchten Faktoren stellte sich jedoch als unabhängiger prognostischer Faktor bezüglich eines kürzeren krankheitsfreien bzw. metastasenfreien Verlaufs oder eines kürzeren Gesamtüberlebens heraus. Diese Ergebnisse deuten daher lediglich auf einen kausalen Zusammenhang zwischen den von mir untersuchten Tumorsuppressormolekülen, Proliferationsmarkern und Wachstumsfaktorrezeptoren hin. Die Expression von HER2, Topoisomerase-IIalpha, Ki67 und p53 auf dem Primärtumor korrelierte nicht mit dem Vorhandensein von Tumorzellen im Knochenmark. Die Dissemination von Tumorzellen ins Knochenmark scheint daher ein von den untersuchten Faktoren unabhängiger Prozess zu sein. Allerdings korrelierte der Nachweis von disseminierten Tumorzellen im Knochenmark mit einem kürzeren Gesamtüberleben der Patientinnen. Bisher gehört die Knochenmarkspunktion zwar nicht zur Routinediagnostik beim primären Mammakarzinom. Allerdings wird diese Untersuchung in einigen Zentren empfohlen. Die weitere Charakterisierung von disseminierten Tumorzellen im Knochenmark sowie die Evaluation von zirkulierenden Tumorzellen im peripheren Blut sind Gegenstand der aktuellen Forschung.
Immunhistologie von Nickel-Epikutantestreaktionen im Vergleich zu Proben aus Gewebe um revidierte unzementierte Chrom-Kobalt-Molybdän-Hüftendoprothesen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
In dieser Arbeit wurden immunhistologische Charakteristika der Nickel-induzierten (Epikutantest-) Ekzemreaktion im Vergleich mit Nickel-exponierter, reaktionsloser Haut analysiert. Weiterhin wurden immunhistologische Untersuchungen an bei Revisionsoperationen erhaltenen Gewebeproben aus der Umgebung nicht-zementierter CrCOMo-basierter Hüftendoprothesen durchgeführt. Die Analysen wurden aus 10 Biopsien aus Nickelepikutantestarealen (5 Personen mit, 5 Personen ohne Nickelallergie) und an 6 periimplantären Gewebeproben durchgeführt. Für Nickel-allergische Personen (Ekzem im Testfeld) waren im Vergleich mit Nickel-exponierter, klinisch reaktionsloser Haut deutliche Infiltrate CD3+ T-Lymphozyten mit überwiegend CD4+ Zellen sichtbar. Das entzündliche Infiltrat wurde anhand der Expression von IL-2-Rezeptor und CD69 (als früher Aktivierungsmarker) als Hinweis auf aktivierte bzw. dem Wachstumsfaktor IL-2 empfängliche Zellen hinterfragt. Hier zeigte sich eine – wenn auch individuell schwankende – erhöhte Expression im Vergleich zu den nicht-allergischen Personen. Dazu passt auch die über Expression des Markers Ki-67 erkennbare, gesteigerte Proliferation innerhalb der Infiltratzellen in Gruppe 1. Daneben war die „physiologische“ proliferative Aktivität in den basalen Epidermisanschnitten erkennbar. Bei der Untersuchung von Adhäsionsstrukturen fiel in den mit Ekzem reagierenden Nickel-Testfeldern eine vergleichsweise deutliche Expression von ICAM-1 und E-Selektin (CD62E) auf. Dem könnte die bei einer Kontaktallergie unter TH1-Dominanz vorherrschende IFN-γ-Produktion zugrunde liegen. In einem TNF-α/IFN-γ-reichen Umfeld wird auch die Expression von CD40 als kostimulatorische Struktur für aktivierte T-Zellen gefördert. Eine CD40-Hochregulation war speziell in Proben der Gruppe 1 zu beobachten. Wir haben nun innerhalb der Biopsien nickelallergischer Personen auch CD45RO-tragende Zellen nachweisen können. Dies deutet auf die Anwesenheit von (Antigen-erkennenden) Memory-T-Zellen hin. An Gewebeproben aus periimplantärem Gewebe – erhalten bei Revisionsoperationen nicht-infektiöser unzementierter CrCoMo-Hüftgelenke – wurde in unserer Arbeit gefragt, ob sich Elemente wie bei der kutanen Spättypüberempfindlichkeitsreaktion auf Nickel finden lassen. Auch wenn diese Gewebe verschiedenen Legierungsmetallen und Partikeln noch dazu über Jahre hinweg exponiert waren, so fanden sich auch hier individuell schwankend: CD3+ Lymphozyten, meist CD4-dominiert; Hochregulation von Adhäsionsmolekülen; Expression der kostimulatorischen Struktur CD40; IL-2-R+ Zellen. Speziell im Präparat E2 waren auch deutlich CD45RO-tragende Zellen im Sinne von Memory-Zellen sichtbar. Bei diesem Patienten hatten Schmerzen, Lockerung und Ergussbildung zum Wechsel seiner Metall-Metall-Hüftendoprothese geführt. Zusammenfassend konnten mit den beschriebenen Methoden Charakteristika des Nickel-Kontaktekzems untersucht werden. Periimplantäre Gewebe aus revidierten Metall-Metall-Hüftendoprothesen können ebenfalls wie hier beschrieben lymphozytäre Entzündungsphänomene aufweisen. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt zur Untersuchung einer möglichen metallallergischen Komponente bei nicht-infektiöser Endoprothesenunverträglichkeit sein.
Prognostische Bedeutung der EMMPRIN-Expression bei operablen nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/19
Das komplexe Wechselspiel von Krebszellen und anderen Zellen des Körpers ist weitgehend unverstanden. Erste Einsichten brachte die Erforschung der Tumorangiogenese und der Tumorinvasion. Hier zeigte sich, dass Tumorzellen selbst einerseits proteolytische Systeme wie die Matrix-Metalloproteasen (MMP) aktivieren, um die Extrazelluläre Matrix (ECM) abzubauen und zu migrieren, sich andererseits aber auch andere Zellen des Körpers bei diesen Prozessen zunutze machen. So wurde gefunden, dass sie durch das Protein EMMPRIN in der Lage sind, die Expression von MMP in Stromazellen zu induzieren. EMMPRIN erwies sich in der Folge als ein Molekül mit weiteren Funktionen über die Induktion von MMP hinaus. Ziel der vorliegenden Arbeit war zu untersuchen, ob die Expression von EMMPRIN in nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen (NSCLC) einen Einfluss auf das Überleben der Patienten hat. Zu diesem Zweck wurden in Paraffin-eingebetteten Gewebeproben von 150 Patienten mit einem Anti-EMMPRIN Antikörper (HIM6) immunhistologisch gefärbt. Bei der Auswertung wurde für jeden Tumor zunächst ein Färbewert ermittelt, der aus dem Produkt der Färbeintensität und dem Anteil der gefärbten Tumorzellen generiert wurde. Ebenso wurde festgehalten, ob die EMMPRIN-Färbung überwiegend membranständig oder zytoplasmatisch lokalisiert war. Die Färbeergebnisse wurden mit klinischen Parametern korreliert, um die Bedeutung von EMMPRIN auf den Verlauf der Erkrankung und das Überleben der Patienten zu überprüfen. Um den Einfluss von EMMPRIN auf MMP zu untersuchen, wurde zusätzlich die Expression von MMP-2 und MMP-9 mit der EMMPRIN-Expression in den Primärtumoren verglichen. Im untersuchten Kollektiv zeigte sich eine spezifische EMMPRIN-Färbung in 95% aller Primärtumoren. Die ermittelten Färbewerte konnten mit keinem klinischen Faktor und auch nicht mit der Expression von MMP-2 oder MMP-9 in Zusammenhang gebracht werden. Allerdings fand sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen membranständiger Lokalisation von EMMPRIN und der Entwicklung eines Rezidivs. In univariaten Analysen der Subgruppe der Patienten mit geringem Lymphknotenbefall (pN0-pN1) ergab sich, dass Patienten über 60 Jahren und mit einem membranständigen EMMPRIN-Färbemuster ein schlechteres Überleben hatten. Die multivariate Cox-Regressionsanalyse zeigte, dass Patienten mit geringem Lymphknotenbefall mit einer membranständigen EMMPRIN-Expression ein mehr als doppelt so hohes Mortalitätsrisiko hatten als Patienten mit zytoplasmatisch gefärbten Tumoren. Die vorliegende Arbeit zeigt erstmals, dass eine membranständige EMMPRIN-Lokalisation einen unabhängigen Vorhersagewert für ungünstige Krankheitsverläufe bei frühen nicht–kleinzelligen Bronchialkarzinomen darstellt. Da sich kein Zusammenhang zwischen der membranständigen EMMPRIN Expression und der Expression von MMP-2 oder MMP-9 fand, ist momentan offen, durch welche Funktion von EMMPRIN dieser Effekt ausgelöst wird.
Charakterisierung von Chromatinfaktoren mit Hilfe von Antikörpern: Von der Fruchtfliege zum humanen Prostatakarzinom und zurück
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 04/19
Die Organisation der DNA in Nukleosomen hat einen großen Einfluss auf die Regulation von grundliegenden Prozessen wie Transkription, Replikation oder Reparatur der DNA im Zellkern. Um die hinderliche Natur des Chromatins bei diesen fundamentalen Prozessen zu überwinden, existieren mehrere verschiedene Chromatin modifizierende Proteinkomplexe im Zellkern. Chromatin Remodelling Komplexe nützen die Energie der ATP-Hydrolyse um die Position der Nukleosomen so zu verändern, dass verschiedene Abschnitte der DNA für die Interaktion mit regulierenden Faktoren zugänglich werden. Ein Klasse solcher Remodelling Faktoren beinhalten die ATPase ISWI als katalytische Untereinheit. Das Protein wurde zuerst in Drosophila entdeckt und die drei verschiedenen ISWI enthaltenden Komplexe, nämlich NURF, ACF und CHRAC, wurden ausführlich in diesem Modellorganismus untersucht. Homolog zur Fruchtfliege existieren sehr ähnliche Protein Komplexe beim Menschen. Wir haben das humane ISWI mit den Isoformen Snf2h und Snf2L im Prostatakarzinom untersucht. In einem Tissue Microarray wurden Gewebeproben mit Hilfe von polyklonalen Antikörpern gegen ISWI gefärbt. Es folgte ein quantitativer Vergleich der Färbungsintensitäten im Karzinomgewebe sowie in gutartigem Gewebe der Prostata durch Anwendung von digitaler Bildanalyse. Das Ergebnis war eine signifikant stärkere Färbung im neoplastischen Gewebe. Eine Anreicherung von ISWI in Krebszellen ist besonders interessant im Kontext der bekannten Funktionen des Proteins für DNA-Replikation, Zellproliferation und Regulation der Chromatinstruktur. In einem zweiten Projekt sind wir zum Modell der Fruchtfliege zurückgekehrt und entwickelten monoklonale Antikörper gegen Toutatis, das zu einer Proteinfamilie gehört, die auch einige bekannte Interaktionspartner von ISWI umfasst. Die Proteine dieser Familie haben vermutlich eine regulatorische Funktion in den Remodelling Komplexen, denn am Beispiel von Acf1 wurde gezeigt, dass sie die nukleosomale Bindung sowie die Effizienz und Richtung der Mobilisierung von Nukleosomen modifizieren. Unsere Antikörper wurden etabliert, um Toutatis enthaltende Komplexe durch Western Blot Analyse von gereinigten Drosophila-Extrakten und Immunfluoreszenz zu charakterisieren. Mit diesen Methoden fanden wir eine Koelution von Toutatis mit der ATPase Brahma und dem Strukturprotein Spectrin alpha sowie eine Lokalisation in der Lamina des Zellkerns. Ein mögliches Zusammenspiel dieser Proteine in einem neuen Chromatin Remodelling Komplex mit einer Beteiligung an der DNA-Reparatur wird diskutiert.
Mechanismen funktioneller Inaktivierung Tumor-infiltrierender Lymphozyten am Beispiel des Nierenzellkarzinoms
Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/06
Das Nierenzellkarzinom ist die häufigste neoplastische Erkrankung der Niere und stellt das siebthäufigste Malignom beim Mann dar, an der in Deutschland jedes Jahr mehr als 11 000 Menschen erkranken. Bei Erstdiagnose sind etwa 13 % der Karzinome bereits metastasiert. Die 1-Jahres-Überlebensrate dieser Patienten beträgt bei rein operativer Behandlung lediglich 15 %. Da das Nierenzellkarzinom keine Strahlensensitivität zeigt und gegenüber gängigen Chemotherapeutika refraktär ist, wird seit langem nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten gesucht. Hierbei wird berücksichtigt, dass das Karzinom zu der relativ kleinen Gruppe immunogener Tumoren gezählt wird, da es möglich ist in vitro eine Immunantwort gegen den Tumor zu induzieren. Zudem zeigen einige Patienten Remissionen von Primärtumoren oder Metastasen nach systemischer Gabe von IL-2, so dass scheinbar auch in vivo eine Immunantwort gegen den Tumor ausgelöst werden kann. Die Tumorgewebe weisen in den meisten Fällen außerdem eine sehr starke Infiltration von Lymphozyten auf, unter denen beispielsweise bereits Tumor-spezifische T-Zellen identifiziert werden konnten. Die Lymphozyten scheinen im Tumorgewebe allerdings inaktiv zu sein, da sie das Wachstum des Tumors in vivo nicht verhindern können. Die Erkennung und Bekämpfung der Ursachen für diese funktionelle Inaktivität der Lymphozyten könnte zu einer Entwicklung neuer immuntherapeutischer Ansätze führen. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die NK-Zellen innerhalb der infiltrierenden Lymphozyten tatsächlich in einem funktionell inaktivierten Zustand vorliegen. Sie sind nicht in der Lage Zellen zu lysieren, selbst wenn diese keine MHC-Klasse-I-Moleküle exprimieren und deshalb von allen NK-Zellen erkannt werden sollten. Durch die direkte ex vivo-Isolierung der Lymphozyten konnte allerdings gezeigt werden, dass die infiltrierenden NK-Zellen durchaus eine maßgebliche Effektorpopulation bei der Eliminierung der Tumorzellen darstellen können. Ihre Zytotoxizität gegen Tumorzellen konnte bereits über eine Kurzzeitkultivierung der Zellen mit IL-2 induziert werden. Die infiltrierenden NK-Zellen waren in der Vergangenheit wenig untersucht worden, da viele Eigenschaften dieser Zellpopulation erst in den letzten Jahren charakterisiert wurden und sowohl Techniken als auch Reagenzien für ihre Beschreibung fehlten. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine NK-Zell-Subpopulation, die durch die Expression des inhibitorischen Rezeptorkomplexes CD94/NKG2A charakterisiert ist, verglichen mit autologen peripheren Lymphozyten im Tumorgewebe überrepräsentiert ist. Die Charakterisierung weiterer phänotypischer und funktioneller Merkmale der infiltrierenden NK-Zellen ließ vermuten, dass sie sowohl durch das Expressionsmuster der inhibitorischen Rezeptoren, als auch durch die Expression bestimmter Zytokine wie IL-10 sowie durch ihre geringe zytotoxische Aktivität in situ eine Herabregulierung der Immunantwort im Tumorgewebe verursachen. Dass die NK-Zellen jedoch bereits über eine Kurzzeitstimulierung mit IL-2 aktivierbar waren, könnte erklären, warum die Immuntherapie an Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom über IL-2 auch in vivo Wirkung gegen die Tumoren zeigen kann. Die Aktivität der NK-Zellen nach dieser Stimulierung konnte allerdings nur dann festgestellt werden, wenn der Anteil der NK-Zellen innerhalb der TIL hoch lag. Somit konnte ein Zusammenhang zwischen der zytotoxischen Aktivität der NK-Zellen und ihrer Anzahl im Tumor festgestellt werden. Allerdings lag keine Korrelation mit der Größe und Ausbreitung des Primärtumors vor. Dies scheint nicht verwunderlich, da die NK-Zellen im Tumor funktionell inaktiv sind und den primären Tumor somit nicht bekämpfen können. Es wäre allerdings möglich, dass die Anzahl der NK-Zellen nicht nur mit ihrer Aktivierbarkeit im Tumor selbst in Zusammenhang steht, sondern bei diesen Patienten gleichzeitig eine generell bessere Aktivierbarkeit des Immunsystems gegen den Tumor wiederspiegelt. Bei verschiedenen anderen Tumortypen konnte bereits gezeigt werden, dass sowohl die Anzahl als auch die Aktivität der NK-Zellen für die klinische Prognose der Patienten entscheidend sein kann. Somit wäre möglich, dass ein hoher Anteil an NK-Zellen im Tumor einen prognostischen Faktor für das Ansprechen der Patienten auf die systemische Immuntherapie mit IL-2 darstellt und könnte helfen solche Patienten zu selektieren, die somit für diese Therapie mit den zum Teil schwerwiegenden Nebenwirkungen in Frage kommen. Eine Untersuchung dieses Zusammenhangs ist nun retrospektiv auf einfache Weise möglich, da in dieser Arbeit eine Methode dargestellt werden konnte, die es erlaubt die NK-Zellen erstmals über eine einfarbige immunhistochemische Färbung in asservierten Gewebeproben bereits vor längerer Zeit operierter Patienten spezifisch zu identifizieren und die Korrelation mit deren klinischem Krankheitsverlauf zu untersuchen. Bisher ist nicht geklärt, warum verschiedene Tumoren unterschiedliche Anteile infiltrierender NK-Zellen aufweisen. Neben einer verstärkten Einwanderung von NK-Zellen wäre es möglich, dass NK-Zellen in verschiedenen Tumoren unterschiedlich stark proliferieren können. Diese Tumoren weisen dann möglicherweise eine verminderte Fähigkeit auf, das Immunsystem zu unterdrücken und könnten auch aus diesem Grund eine bessere klinische Prognose für die Patienten darstellen. Die Ursachen für die unterschiedliche Aktivierbarkeit der NK-Zellpopulationen konnten bisher ebenso nicht geklärt werden. Hierfür würde sich anbieten, Unterschiede in der Genexpression zwischen verschiedenen NK-Zellpopulationen zu suchen, was beispielsweise mithilfe der Array-Technolgie bewerkstelligt werden könnte. Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der NK-Zellen im Tumor und der Prognose für die Tumorpatienten könnte bestätigen, dass die Population der NK-Zellen in vivo eine ausschlaggebende Effektorpopulation bei der Bekämpfung der Tumoren darstellen. Weiterhin wurden in der vorliegenden Arbeit Untersuchungen an infiltrierenden T-Zellen durchgeführt, die vermuten lassen, dass sowohl aktivierte T-Zell-Populationen als auch regulatorische T-Zellen im Tumorgewebe vorhanden sind. Dies konnte durch die Expression verschiedener Oberflächenmarker und Proteine wie beispielsweise Foxp3, das spezifisch von regulatorischen T-Zellen exprimiert wird, gezeigt werden. Die Anwesenheit verschiedener regulatorischer Zellen könnte einen entscheidenden Beitrag zu einer funktionellen Inaktivierung der Lymphozyten im Tumor und der damit verbundenen Toleranz gegenüber Tumorzellen leisten, da bereits gezeigt wurde, dass regulatorische Zellen beispielsweise die Immunantwort gegen Selbst-Antigene, die auch von Tumorzellen exprimiert werden, unterdrücken können. Erkenntnisse über die Eigenschaften infiltrierender Lymphozyten tragen entscheidend zu einem besseren Verständnis der immunologischen Vorgänge im Nierenzellkarzinom bei. Die in dieser Arbeit aufgezeigten Charakteristika der TIL und die Etablierung einer Methode für die spezifische Identifizierung der NK-Zellen im Gewebe könnten in Zukunft eine Grundlage für die Entwicklung neuer Immuntherapien darstellen, die eine gezielte Aktivierung des Immunsystems gegen den Tumor bewirken könnten.
Osteoneogenese und Innervation des interfragmentären Raumes durch neuropeptidpositive Fasern am Beispiel des Distanzosteosynthesemodells der Kaninchentibia
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 01/19
Bisher wird in der Literatur keine standardisierte tierexperimentelle Methode beschrieben, mit der in der Frühphase der Knochenheilung ausreichend interfragmentäres Gewebevolumen für die histologische, biochemische oder immunocytochemische Analyse gewonnen werden kann. Es wird ein entsprechend variiertes Distanzosteosynthesemodell vorgestellt, das aus dem Frakturbereich der Kaninchentibia ausreichend Gewebe für differenzierte Analysen liefert. Mit guter Vaskularität, hoher Knochenappositionsrate sowie schneller Zellproliferation und –differenzierung scheint der Kaninchenknochen für relativ begrenzte Untersuchungszeiträume und für Fragestellungen zur Frühphase der Knochenheilung besonders geeignet. Untersuchungen an diesem Modell zum qualitativen und quantitativen Nachweis unterschiedlicher Zellen im interfragmentären Raum zu verschiedenen Zeitpunkten der Frakturheilung werden beschrieben, besondes berücksichtigt dabei neuropeptidpositive Nervenfasern, vor allem das Calcitonin gene-related peptide (CGRP). Daten und Fakten zu Vorkommen, Verteilung, Struktur, Sequenz und Biochemie des Peptids, wie sie die aktuelle internationale Literatur dokumentiert, ergänzen den experimentellen Teil der Arbeit. An der Tibia von insgesamt 30 Tieren wurde – in einem standardisierten operativen Verfahren – ein definierter interfragmentärer Raum geschaffen. Nach Ablauf des vorgesehenen Beobachtungszeitraumes erfolgte die Tötung der Tiere vor Entnahme des jeweiligen Präparates. Nach Freilegen der Osteosynthese wurde im interfragmentären Raum ein definiertes 3mm dickes zylinderförmiges Segment entnommen und fixiert; außerdem wurden jeweils osteotomienah und –fern zwei weitere Gewebeproben aus dem Markraum der Tibia isoliert. Die anschließenden Untersuchungen im gewonnenen Material umfaßten mikroskopische Analysen der Morphologie von Hämatom, Fibringerüst, Granulationsgewebe während unterschiedlicher Phasen der Frakturheilung, die immunocytochemische Darstellung neuropeptidpositiver Fasern und mikroskopische qualitative und quantitative Analysen neuropeptidpositiver Fasern zu den gewählten Zeitpunkten. Bei den nach 5 Tagen getöteten Tieren fanden sich in den untersuchten Präparaten vor allem ein konsolidiertes Frakturhämatom. Ein feines Fibrinnetz war in den Randgebieten des interfragmentären Raumes zu sehen. Gefäßlakunen, Kapillaren und Mineralisationsinseln waren nicht erkennbar. In der zweiten Tiergruppe konnte gezeigt werden, daß nach 10 Tagen der Abbau schollig zerfallener Erythrozyten durch Phagozyten weiter vorangeschritten war; Der Zellgehalt verringerte sich insgesamt zugunsten einer beginnenden Faserbildung. Das Fibrinnetz hatte weiter zugenommen und zeigte vereinzelt Septen; Am 15. Tag postop. war das Fibrinnetz nicht mehr erkennbar, stattdessen neu entstandenes Bindegewebe, Gefäßstrukturen und vereinzelte Mineralisations-inseln. Perivaskulär, an den Gefäßsinusoiden und begleitend zu Precursorzell-ansammlungen ließen sich frühestens am 10. und spätestens am 15. Tag nach der Osteotomie mit Hilfe immunocytochemischer Verfahren neuropeptidpositive Fasern nachweisen. In diesen Untersuchungen konnte CGRP im Gegensatz zu bisher durchgeführten Versuchen unterschiedlicher Autoren erstmals schon in der Frühphase der Frakturheilung nachweisen werden. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Innnervation des Knochens ein hochentwickeltes regulatorisches Element repräsentiert, das sowohl lokale Anforderungen registriert wie auch durch Freisetzung aktiver Neuropeptide den gesamten Knochenstoffwechsel unmittelbar beeinflußt. Wie aus früheren Studien hervorgeht, sind Neuropeptide dort zahlreich vorhanden, wo hohe Knochenstoffwechselraten zu verzeichnen sind. Außerdem sind sie häufig in unmittelbarer Nähe von Blutgefäßen konzentriert. Die Beobachtung, daß CGRP während der frühen Frakturheilung hauptsächlich in der Nähe von Blutgefäßen auftritt, legt den Schluß nahe, daß es durch seine bekannten vasodilatierenden Eigenschaften den Blutfluß in die verletzte Region verstärkt und so die Knochenheilung unterstützt. Experimentelle Untersuchungen zeigen, daß neurale Einflüsse auf den Knochen von Neuropeptiden vermittelt werden. Wie alle regulativen Proteine und Faktoren agieren Neuropeptide über Second-messenger-Systeme und können auch in niedrigen Konzentrationen das Remodeling beeinflussen. Durch ihre sensorische Funktion nehmen Nervenfasern mechanische Ansprüche wahr und setzen im weiteren Verlauf Neuropeptide frei. Sie sind in der Lage, die Lücke zwischen systemischen und primär lokalen regulativen Elementen zu füllen. Grundsätzlich ist die Selbstheilung des Knochens durch die Größe des Defekts limitiert. Meist sind chirugische Interventionen nötig und die unterschiedlichsten Hilfsmittel unumgänglich. In jüngster Zeit sind v.a. Knochenersatzmaterialien von zunehmender Bedeutung. Ihre Zukunft scheint in der Entwicklung osteoinduktiver Implantate zu liegen. Auch unter diesem Aspekt gewinnt unser Distanzosteosynthesemodell besondere Bedeutung. Der große interfragmentäre Raum bietet optimale Bedingungen für gezielte Untersuchungen, die zur Weiterentwicklung von Knochen-ersatzmaterialien führen können.