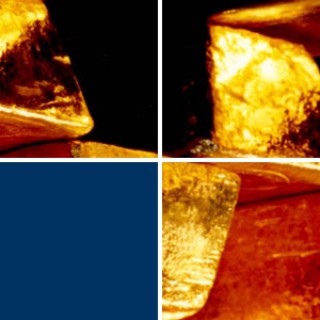Podcasts about sachzw
- 31PODCASTS
- 36EPISODES
- 34mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Mar 14, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about sachzw
Latest news about sachzw
- 37C3: Wir ziehen Nerds an CCC Event Blog - Dec 24, 2023
- Emancipation: Paths and Goals - Johannes Agnoli libcom.org - Oct 25, 2023
Latest podcast episodes about sachzw
#27 Wie ein Ökosystem für Innovation & Weltveränderung entstand | Dominik Hofmann Heimathafen
"Ich bin super dankbar, dass Gott immer krasse Challenges gegeben hat, aber er hat auch immer geliefert das, was eben nur Gott liefern kann."Dominik Hofmann Co-Founder & CEO Heimathafen Wiesbaden Für Dominik Hofmann begann alles mit einem schmerzhaften Zerbruch. Was als Vision einer Hauskirche und christlicher Lebensgemeinschaft anfing, endete in jahrelangem Konflikt und persönlicher Krise. Doch aus dieser Asche entstand etwas Neues: der Heimathafen in Wiesbaden.Heute, 14 Jahre später, leitet Dominik ein Social Business mit 30 Mitarbeitern, das einen "Hub für gutes Leben und Arbeiten" darstellt. In dem ehemaligen Landesgericht hat er auf 3000 Quadratmetern einen Raum geschaffen, in dem “überzufällig oft geile Sachen passieren" - ein Ökosystem für Innovation, Transformation und Gemeinschaft.Der BWL-Absolvent fand seine Berufung erst, als er in New York mit dem Konzept des Social Business in Berührung kam. "Mir hat quasi so bisschen der Purpose gefehlt oder das, wofür man das eigentlich tut, weil für mich Business ein geiles Mittel ist, aber es braucht halt einen Zweck", erklärt Dominik.Die Idee, Unternehmertum zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, wurde zum Funken, der ihn bis heute antreibt.Besonders beeindruckend ist, wie Dominik die vielen und zum Teil millionenteuren Herausforderungen, auf seinem Weg meisterte und dabei immer wieder Gottes Reden und wundersames Eingreifen erlebt hat. In einer besonders heiklen Situation, in der alles auf dem Spiel stand, hörte er "Das ist mein Haus und das will ich so nutzen, wie ich das gesagt habe." und durfte erleben, wie Gott seinen Glaubensmut belohnte und die Hindernisse aus dem Weg räumte.Der Heimathafen ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen Gottes Auftrag annehmen, mit Glaubensmut umsetzen und dabei erleben, wie Gott sich dazu stellt - 100% nachahmenswert, inspirierend und religionsfrei.Mit dem Heimathafen hat Dominik eine Plattform für soziale Innovationen geschaffen, die konkrete gesellschaftliche Probleme lösen: Von Software für erneuerbare Energien bis zu Apps gegen Einsamkeit - hier entstehen Zukunftsentwürfe, die eine positive Vision vermitteln, während die Politik oft nur in Sachzwängen gefangen ist.Neben göttlicher Unterstützung, macht Dominik aber auch klar, dass der Heimathafen und er nur dort sind, wo sie gerade sind, weil es wichtige Menschen, um ihn herum gab, die ihn in entscheidenden Phasen ermutigt, getragen und unterstützt haben. Ein Netzwerk solcher Menschen bietet SPARK - das unter anderem von Marlin Watling (Podcast Episode 21) gegründet wurde.Sein persönliches Lebensmotto fasst Dominik in vier Worten zusammen: "Seelenruhig große Räder drehen." Eine Einladung, aus einer tiefen Verbindung mit Gott ambitionierte Ziele zu verfolgen, ohne dabei die persönliche Gesundheit und die wichtigsten Beziehungen zu opfern.Zentrale Themen der Episode:Der Weg vom gescheiterten Kirchenprojekt ⛪❌ zum erfolgreichen Social Business
Ein Vortrag des Soziologen Steffen MauModeration: Sibylle Salewski ********** Den einen geht es nicht schnell genug, die anderen fühlen sich überrumpelt. In der Politik kommt viel auf das richtige Timing an. Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Vortrag hat den Titel "Keine Zeit. Zum Verhältnis von politischen Entscheidungen und sozialem Wandel". Er hat ihn am 04. Juli 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten im Rahmen der Mosse-Lectures 2024, die das Thema haben "Dramen des Entscheidens". ********** Schlagworte: +++ Soziologie +++ Steffen Mau +++ Politik +++ Makrosoziologie +++ Mosse-Lectures 2024 +++ sozialer Wandel +++ politische Entscheidungen +++**********Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:Soziologie: Warum es immer noch Ost und West gibtPhilosophie: Leben zwischen Selbstwirksamkeit und Sachzwängen**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
Philosophie - Leben zwischen Selbstwirksamkeit und Sachzwängen
Ein Vortrag des Philosophen Dieter ThomäModeration: Sibylle Salewski**********Bin ich nur Spielball gewisser Strukturen, die mich umgeben oder kann ich mein Leben aktiv selbst gestalten? Ein Vortrag des Philosophen Dieter Thomä über zwei widersprüchliche Denkmodelle.Dieter Thomä war bis 2023 Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. Sein Vortrag hat den Titel "Ich war's! Keiner ist es gewesen! Zur Dramatisierung und Entdramatisierung von Entscheidungen". Er hat ihn am 23. Mai 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten im Rahmen der Mosse-Lectures 2024, die das Thema haben "Dramen des Entscheidens. Ihr wollt den Hörsaal live erleben? Am 11. Oktober 2024 ist es wieder so weit – und wir verschenken Tickets! Hier gibt es alle Infos. ********** Schlagworte: +++ Selbstwirksamkeit +++ Verantwortung +++ Sachzwänge +++ Philosophie +++ Dieter Thomä**********Den Artikel zum Stück findet ihr hier.**********Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen: Tiktok und Instagram.
Botschaft für das zweite Rezessionsjahr: Politische Mitte sollte staatspolitischer Verantwortung gerecht werden
Eine große Koalition muss sich zusammenraufen, den Sachzwängen folgen und eine gemeinsame Perspektive entwickeln. Das könnte den Standort Deutschland stabilisieren und den Unternehmen neue Zuversicht geben.
#155 Wenn du einen Konflikt lösen willst, musst du auch wissen, was es für einer ist
Konflikte gehören zum Alltag – auch in Kliniken. Um eine zielgerichtete Lösung zu finden, ist es entscheidend, die verschiedenen Konfliktarten zu verstehen. Ein Konflikt ist halt nicht einfach nur ein Konflikt. Und je länger ein Konflikt gärt, desto komplexer wird es. In dieser Folge gebe ich dir einen Überblick über 11 verschiedene Konfliktarten mit jeweils Beispielen aus meiner Praxis. Hör doch mal rein. Buchempfehlungen/Links: Teamkonflikte erkennen und lösen: Zwischen Emotionen und Sachzwängenvon Franz Will https://amzn.to/3nr0UFW Lösungsfokussiertes Konflikt-Management in Organisationen: Methoden undPraxisbeispiele für Konfliktlösung zwischen Einzelnen, in Teams undOrganisationseinheitenvon Peter Röhrig und Martina Scheineckerhttps://amzn.to/3vmchSn Sozialmanagement: Teamarbeit und Teamentwicklung in sozialen Berufenvon Raimund Ergerhttps://amzn.to/3gGJ6W5 Webseite:https://www.cobaugh.de E-Mail:https://www.cobaugh.de/kontakt/ YouTube: Heike Beck-Cobaugh - YouTube
tl;dr #27: Beverly J. Silver - Forces of Labor. Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870
Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung wurde in den 1990er Jahren von prominenten deutschen Sozialwissenschaftlern wie Ulrich Beck oder Wolfgang Streeck totgesagt. Die politische Diskussion stand unter dem Eindruck der Anpassung an die Sachzwänge des Weltmarkts und den Angriffen der Neuen Mitte auf den Wohlfahrtsstaat. Dem stellte sich eine breite Allianz von Gewerkschafter*innen, Frauen, Umwelt- und Studierendengruppen 1999 mit Protesten in Seattle gegen die Konferenz der Welthandelsorganisation und das Projekt der Globalisierung entgegen. Es war ein Aufbruchssignal, auf das sich auch Silver bezieht. Dass die Kämpfe der Arbeiter*innenbewegung nicht zu Ende sind, ist das zentrale Argument von Silvers Buch, das Weltsystemanalyse und Postoperaismus produktiv für die Forschung der Entwicklung der Weltarbeiter*innenklasse miteinander verbindet. Globalisierungsprozesse bestimmen wellenförmig die kapitalistische Produktionsweise seit dem 19. Jahrhundert. Um seine Profitabilität zu erhalten, weicht das in einer Industrie angelegte Kapital von Region zu Region aus: in der Automobilindustrie seit den 1920er Jahren von den USA nach Westeuropa, von dort nach Brasilien, Mexiko und Japan. In der Aufstiegsphase einer Welle macht das Kapital weitreichende Zugeständnisse. Diese senken die Gewinne, das Kapital sucht nach neuen Standorten. Mit der Verlagerung der Produktion wird auch der Konflikt verlagert. In der Folge sinken die Profite erneut. Das Kapital bemüht sich um neue Lösungen seiner Profitkrise. Eine Strategie ist das, was Silver als technologisch-organisatorischen Fix bezeichnet, die Entwicklung neuer betrieblicher Herrschaftsformen. Damit einher gehen neue Formen des Kampfes. Eine andere Strategie ist die Verlagerung auf andere Produkte und Industriezweige. Historisch untersucht Silver das anhand der Verlagerung von der Textil- zur Automobilindustrie. Sie zeigt, wie die Prozesse der Profiterzielung und die Kämpfe dagegen sich wiederholen und ähnliche Muster bilden. Seit Ende des 20. Jahrhunderts steht der Kapitalismus vor einer neuen Welle. Es bildet sich ein neuer Produktfix: Halbleiter, Dienstleistungen, Logistik, Bildung – und neue Kämpfe entstehen. Silver kann nicht sagen, welche neue Leitindustrie sich bildet. Aber sicher ist: es gibt kein Ende der Arbeiter*innenbewegung, sondern eine Änderung der Klasse und Kampfformen. Zu Gast bei Alex Demirović ist Nicole Mayer-Ahuja, Professorin für Soziologie an der Georg-August-Universität Göttingen.
Viele Menschen müssen ein schreckliches Leben führen, weil sie nicht über genügend Geld verfügen. Sie müssen sich sogenannten Arbeitgebern unterordnen, die sie vermutlich gar nicht mögen.
331 – De Groenen 40 jaar in de Bondsdag: van ‘narrenschip' naar solide regeringspartij
Op 6 maart 1983 brak een nieuw tijdperk aan voor Duitsland en Europa. Bündnis 90/Die Grünen betrad voor het eerst het parlement in Bonn. Een nieuwe generatie met een eigen stijl en dynamiek ging haar stempel drukken. Nu, veertig jaar later, regeren De Groenen op veel plaatsen mee als constructieve hervormers. Ze geven Duitsland opvallend kleur en elan. Jaap Jansen en PG Kroeger verdiepen zich in de kleurrijke historie en de uitdagingen van toen en nu.***Op sommige podcast-apps kun je niet alles lezen. De complete tekst vind je altijd hier***Het eerste optreden van De Groenen was een cultuurschok. Zó zag een beschaafd politicus er toch niet uit? En dat taalgebruik, die gympies in de plenaire zaal, de nachtenlange ideologische knokpartijen en heuse radencommunisten in de fractie! Media en klassieke politiek - voorop de nieuwe bondskanselier Helmut Kohl - moest er nogal aan wennen en lieten zich ook provoceren en overrompelen. En al direct viel daar de goedgebekte straatvechter uit Frankfurt op, de latere minister Joschka Fischer.De nieuwe partij had veel te danken aan Ronald Reagan. Op hem konden antikapitalistisch links, anti-atoomgroepen, milieuactivisten en feministen hun vuur projecteren. Dat bond hen en dat was ook nodig, want de interne machtsstrijd tussen 'Fundis' en 'Realos' - extremen en pragmatici - wilde de partij nogal eens verlammen en verscheuren. Het ging vaak drastisch op en neer, wat te zien was in de verkiezingsuitslagen.Toch overleefden ze zelfs een haast fatale nederlaag bij de Wiedervereinigung in 1990. Wat hielp was hun succes in het Europees Parlement en de kansen die zij pakten in de 'Länder' waar zij met Fischer in Hessen bewezen competent en daadkrachtig te kunnen zijn. Toen Angela Merkel cheffin werd van de CDU konden zij zelfs met die partij gaan regeren in regionale en stedelijke coalities. De als 'Melonenpartei' beschimpte Groenen - vanbuiten groen, vanbinnen rood - werden serieuze partner in het midden.In de regeringen van SPD-bondskanselier Gerhard Schröder bewezen ze Duitsland nieuw elan te kunnen geven en onder Merkel bleven ze overeind. Zij wilde in 2017 een coalitie met hen, maar de FPD zag er uiteindelijk niets in. Tot in 2021, toen ze met Robert Habeck als vicekanselier en superminister van Economie en Klimaat en Annalena Baerbock op Buitenlandse Zaken gingen regeren met SPD en FDP onder Olaf Scholz.Dankzij Vladimir Poetin maken De Groenen zelfs indruk maken met hun daadkracht. Tegelijk valt op hoe hun kernthema's actueel blijven en gemoderniseerd worden. Na de Europese Verkiezingen van 2024 zouden De Groenen in Brussel wel eens kunnen zorgen voor een verrassing waar Ursula von der Leyen niet blij mee is!***Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt met donaties van luisteraars die we hiervoor hartelijk danken. Word ook vriend van de show!En we bedanken onze adverteerders, zoals Bamigo, het kledingmerk van de toekomst. Ga naar Bamigo.com en krijg 20 procent kennismakingskorting met code Bron20En de Staatsloterij, die bij de trekking van 10 maart 2023 bovenop het prijzenpakket een extra geldprijs uitdeelt: tien jaar lang 100.000 euro per jaar!Heeft u belangstelling om in onze podcast te adverteren of ons te sponsoren? Dat zou helemaal mooi zijn! Stuur voor informatie een mailtje naar adverteren@dagennacht.nl***Verder kijkenDie Grünen - Von der Ökosekte zur Regierungspartei (1)Die Grünen - Farbbeutel und Sachzwänge (2)Die Grünen und die Macht | Dokumentation deutsch HD [2020]Robert Habeck im Gespräch mit Joschka Fischer: 40 Jahre Die Grünen***Verder lezenJaap schreef in 1983 al over De GroenenPfarrer, Grafen und Bauern mit (Sonnen-)Blume***Verder luisteren290 - Bondskanselier Olaf Scholz en de razendsnelle ontwikkeling van de EU279 - Jaap de Hoop Scheffer over Poetin, Oekraïne, de NAVO en de toekomst van de EU276 - 30 jaar politiek, 16 jaar bondskanselier en de hond van Poetin: Angela Merkel blikt terug260 - De toesprakentournee van Volodimir Zelenski en de worsteling van de SPD met de erfenis van Brandt en Schröder256 - Na de inval in Oekraïne: 'Nu serieus werk maken van Europese defensiesamenwerking'248 - Oekraïne en de eeuwenoude vriendschap tussen Duitsland en Rusland233 - Kabinetsformatie 2021: Otto Fricke over de Europese ambities van de nieuwe Duitse regering218 - Angela Merkel, een bijzondere bondskanselier - gesprek met biograaf Ralph Bollmann205 – Bondsdagverkiezingen 2021: invloedrijke liberaal Otto Fricke blikt vooruit189 - Volt in het Europees Parlement en de Tweede Kamer: het eerste dubbelinterview met Laurens Dassen en oprichter Damian Boeselager178 - De opvolging van bondskanselier Merkel: vijf kanshebbers156 – 2020: een historisch jaar voor Europa en EU-voorzitter Angela Merkel122 - De EU in de tweede helft van 2020: Voorzitten op z'n Duits24 - Spitzenkandidat Manfred Weber (Europees Parlement, CSU) haalt uit naar premier Mark Rutte20 - Peter Altmaier (Duitse minister van Economie en Energie, CDU) over Nederland in Europa, Brexit en de opvolging van Angela Merkel***Tijdlijn00:00:00 – Intro00:04:29 – Advertentie Staatsloterij00:06:54 – Deel 100:40:47 – Advertentie Bamigo + Deel 201:03:16 – Deel 301:36:40 – Einde Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.
Erststimme #64: Nino Galetti
Italien fasziniert die Deutschen – menschlich, kulturell und kulinarisch. Zudem ist Italien als zweitgrößtes Industrieland Europas sowie als EU-, NATO- und G7-Mitglied einer unserer wichtigsten Partner. Umso verblüffender ist, wie wenig wir politisch von Italien wissen – und wie wenig wir deshalb davon verstehen. Mit unserer Podcast-Folge möchten wir dies ändern: Rund hundert Tage ist es her, als sich im Westen und Norden Europas anlässlich der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Sturm aus wohl kalkulierter politischer Entrüstung, aber auch ernsthafter Sorge erhob. Das Politiklabor Italien hatte die Chefin der „Fratelli d'Italia“ – zuvor im doppelten Sinne des Wortes eine politische Randerscheinung – binnen weniger Jahre an die Spitze einer Regierung geführt, die mindestens auf dem Papier eher als „Rechts“, denn als „Mitte-Rechts“ gelten muss. Welche politischen Optionen und Ambitionen verfolgen Giorgia Meloni und ihre heterogenen Koalitionspartner nun zwischen nationaler Rhetorik und internationalen sowie ökonomischen Sachzwängen? Wie zuverlässig können sich die Beziehungen zu dem langjährigen EU- und NATO-Partner gestalten? Und: Welches Anziehungs- oder Abschreckungspotential kann die italienische Regierungschefin auf die politische Kultur der Europäischen Union entfalten? Droht eine weitere Verrohung des Diskurses über die Mittelmehr-Migration? Oder zwingt die Realpolitik die Regierung in Rom in einen eher gemäßigt-konservativen Kurs „neuen Typs“? Oder beides zusammen? Wir diskutieren diese Fragen mit Dr. Nino Galetti, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung von Rom aus das politische Geschehen in Italien, im Vatikan und auf Malta analysiert. Das Interview wird geführt von Vanessa Verena Wahlig, die selbst vor dem Hintergrund langjähriger Italien-Erfahrung einen eigenen Podcast („Überall Konfetti“) für junge Leute aus dem deutsch-italienischem Kosmos betreibt.
226-Der subjektive Blickwinkel-Buddhismus im Alltag
Buddhismus im Alltag - Der tägliche Podcast - Kurzvorträge und meditative Betrachtungen - Chan - Zen
Wir alle haben immer einen Grund für unser Handeln, jedes Verhalten baut auf vielen Ursachen auf, nach Buddhaspreche ich hier vom Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir wissen, dass jede Aktion auch eine Reaktion mit sich bringt, weshalb wir Verständnis für die Menschen (und ihre vielen Gründe) haben sollten. Anstatt eingeschnappt, aggressiv oder emotional zu reagieren sollten wir uns fragen, warum die besagte Person sich so verhält, ob vielleicht Ängste oder Bedenken aufkommen, ob gar Sachzwänge vorliegen, so dass die betreffende Person gar nicht anders handeln kann? Und der subjektive Blickwinkel auf das Geschehen löst sich schnell auf, wenn wir uns vorstellen, dass wir in den Schuhen der anderen Menschen stehen, was wir jetzt an ihrer Stelle tun würden? Wenn Sie jetzt trotzdem kein Verständnis aufbringen können, an was könnte das liegen? Werden hier Emotionen in Ihnen getriggert, vielleicht Ihre eigenen Ängste oder Nöte angesprochen? Ist das Verhalten der anderen Person wirklich falsch, oder könnte der Fehler auch bei mir liegen? Und gibt es überhaupt ein "objektiv" richtig, oder ein falsch? Ich würde sagen, dass es nur ein "subjektiv" geben kann, denn ein jeder Mensch hält seinen Blickwinkel für richtig, mäkelt an der Sicht des Gegenübers herum. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, so der dem Jesus von Nazareth zugeschriebene Satz, der bereits kaum Auslegung für wirkliche Objektivität übrig läßt. Wäre es weiterhin möglich, dass ich Vorurteile (vorgefertigte Urteile) aufgebaut habe, wo kommt meine Abneigung gerade jetzt her? Erinnert mich diese Situation an vergangene Begebenheiten, bei denen ich vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht habe? Konkret gefragt: Gibt es Dinge oder Begebenheiten, die Sie triggern? Sachverhalte, die Sie in Rage bringen? Einen Typus an Mensch, den Sie einfach nicht mögen? Ertappen Sie sich zum Beispiel dabei, die Jugend für Dinge zu kritisieren, die Sie früher selbst getan haben, die Sie jetzt aber stören, weil Sie eben nicht mehr jung sind? Oder, als weiteres Beispiel, regen Sie sich über das protzige Verhalten von Wohlhabenden auf (dicke Auto, teure Uhren), weil Sie eben nicht "reich" sind? Immer liegen für unseren Handlungen auch tiefere Gründe vor, die selbst wir auf den ersten Blick nicht erkennen können. Der subjektive Blickwinkel stört die Wirklichkeit, nach Buddha gibt es keinesfalls nur die eine Wahrheit, sondern unendlich viele Realitäten. Der subjektive Blickwinkel findet von jedem Subjekt aus statt, der Weg Buddhas wäre aber das Ziel! Höher wirkt ein Blick der Ehrfurcht - Buddha - Ehrenname des Siddharta Gautama - 560 bis 480 vor dem Jahr Null Copyright: https://shaolin-rainer.de Bitte laden Sie sich auch meine App "Buddha-Blog" aus den Stores von Apple und Android.
Zukunft ist mehr als Prognose oder Statistik. Zukunft ist das, was noch nicht ist, aber sein könnte: ein Produkt unserer Vorstellungskraft. Ob es Wirklichkeit wird, hängt davon ab, ob wir uns für oder gegen sie entscheiden. Entscheidungen spielen für demokratische Gestaltung also eine wichtige Rolle. Das beinhaltet auch den Standpunkt, sich nicht entscheiden zu wollen, sowie den Glauben, sich nicht entscheiden zu können. Wie wir zu mehr Entscheidungsfreude gelangen, darüber reden Stephie und Lars in dieser Folge lautdenken. Sich bewusst für das eine und gegen das andere zu entscheiden, wird erschwert durch die Sorge, etwas falsch zu machen, und den drohenden Gesichtsverlust, der mit dem möglichen Scheitern einhergeht. Stephie und Lars plädieren für einen Perspektivwechsel: Was wäre, wenn es gelingt? Damit keine Sachzwänge und nicht die Anderen regieren, brauchen Organisationen, und die Gesellschaft insgesamt, eine neue Fehlerkultur. Und um Freude an der Entscheidung zu entwickeln, braucht es Mut und Zuversicht, weil, wo entschieden, auch gestaltet werden kann. Für Stephie und Lars drückt sich Entscheidungsfreude durch Leichtigkeit aus. Nicht naiv und optimistisch, sondern hoffnungsvoll, beharrlich und neugierig, suchend, tastend und prototypisch. Irgendeine Zukunft wird schließlich kommen, warum also entscheiden wir uns nicht für eine, in der wir auch leben wollen?
ZDET069 - Warum Elisabeth Lauda bei der Mondlandung mit Muffensauen den Dunning Kruger Effekt entdeckte
Zwei Doofe, eine Tanke - Die Wahrheit mit Wenzel und Olumbo.
Diesmal mit Vatertag am Tegernsee, Elternabend in Unis, Affenpocken, Intelligenz und Glück, Mondlandung, Dunning Kruger Effekt, Studentensommer, 9Euro Ticket, Muffensauen in Zuffenhausen, Allgäu, Sachzwängen, Hörgeräten, Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.
Ein Konflikt ist nicht gleich ein Konflikt.Gerade als Führungskraft ist es oft wichtig, hinter die Ursache eines Konfliktes zu kommen, wenn zwei Mitarbeiter*innen einen Konflikt miteinander haben. Oft wissen es die Beteiligten selbst nicht mehr so genau, wie der Konflikt angefangen hat. Nur in einem sind sie sich einig: Der andere ist schuld!Es gibt viele unterschiedliche Konfliktarten. Heute mochte ich 11 dieser Konfliktarten vorstellen und anhand von Beispielen aus meiner Klinikerfahrung erklären und beleuchten.Doch diese Folge ist nicht nur für Klinikmitarbeiter, sondern für alle Führungskräfte, die mit Konflikten innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft zu tun haben.Manchmal braucht es auch die Hilfe eines Externen. Dazu kannst du mich gerne kontaktieren. Buchempfehlungen/Links: Teamkonflikte erkennen und lösen: Zwischen Emotionen und Sachzwängenvon Franz Will https://amzn.to/3nr0UFW Lösungsfokussiertes Konflikt-Management in Organisationen: Methoden und Praxisbeispiele für Konfliktlösung zwischen Einzelnen, in Teams und Organisationseinheitenvon Peter Röhrig und Martina Scheineckerhttps://amzn.to/3vmchSn Sozialmanagement: Teamarbeit und Teamentwicklung in sozialen Berufenvon Raimund Ergerhttps://amzn.to/3gGJ6W5 Webseite:https://www.cobaugh.de Email:https://www.cobaugh.de/kontakt/ YouTube: Heike Beck-Cobaugh - YouTube
Der Ukrainekrieg, die Gefühle und die Sachzwänge aus dem Blickwinkel von Touristikerinnen aus Polen, Lettland und Sachsen. [...] The post DRR188 – Ukrainekrieg und Tourismusauswirkungen first appeared on Deutsches Reiseradio (German Travelradio).
In dieser Podcastfolge geht es um Verantwortung für deine Entscheidungen. Oft glauben wir, dass Sachzwänge uns von Lebensfreude abhalten. Am Ende ist fast alles unsere Entscheidung. Klingt hart, aber bringt dich zurück ans Steuerrad des Lebens. Viel Spaß beim Hören Dein Jacob Shownotes: Online-Programm "Gesunde Stressbewältigung" jetzt mit Code "Podcast" für 75 anstatt 199 Euro: www.drachenberg.de/online-programm Bewirb Dich bei uns: www.drachenberg.de/jobs Bestelle dir mein Buch "Stress dich richtig!": https://www.amazon.de/Stress-dich-richtig-Entscheidungen-Gelassenheit/dp/3833879629/ref=sr_1_1?crid=AUH29OWRCIS4&keywords=stress+dich+richtig&qid=1642509801&s=books&sprefix=stress+dich+richtig%2Cstripbooks%2C74&sr=1-1
"Der Seele eine Heimat geben. Spirituelle Impulse für ein gutes Leben."
P. Christoph Kreitmeir OFM (Franziskaner), psycho-spiritueller Berater, Autor und Klinikseelsorger im Klinikum Ingolstadt Wir gehen in das dritte Jahr in dem wir mit dem Coronavirus leben. Ein weiteres Jahr um das Ringen nach den besten Lösungen im Umgang mit CORONA. Die verschiedenen Positionen haben nicht nur das äußere Gleichgewicht der Gesellschaft und der Familie ins Schwanken gebracht, sondern auch den inneren Seelenfrieden von jedem von uns. In Zeiten wie diesen wird einmal mehr die Sehnsucht spürbar nach innerem Frieden und Freisein von Sachzwängen, Anforderungen und Belastungen. Der Seele Heimat geben, den inneren Seelenfrieden finden, Innehalten und "Aushalten" halt in der Stille, darüber sprechen wir im Standpunkt am Sonntag (9. Jan. 2022) mit dem Franziskaner Pater Christoph Kreitmeir, der sich seit mehr als 15 Jahren intensiv in seinen Büchern und Vorträgen Themen der christlichen Spiritualität und der menschlichen Seele widmet. So auch in dem Buch "Der Seele Heimat geben". www.christoph-kreitmeir.de
Im wissenschaftlich-technischen Zeitalter stellt sich die Frage, wie das Verhältnis von politischer Entscheidungsfindung, wissenschaftlicher Erkenntnis und technischem Fortschritt zu gestalten ist. Die Aussicht, dass die Übermacht der wissenschaftlich-technologischen Sphäre ein Primat über demokratische Abläufe erhalten würde, wird seit dem letzten Jahrhundert von so verschiedenartigen Denkern wie Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Hermann Lübbe, Günter Ropohl, Hans Jonas oder Helmut Schelsky analysiert und kritisiert. Nicht stillschweigend hingenommen werden darf die Technokratisierung der Politik, so vielleicht ein Fazit der Diskussion, wenn sie die Herrschaft der instrumentellen Vernunft, eines reduktionistischen, rein rationalen Menschenbildes, des positivistisch-utilitaristischen Fortschrittsgedankens, der Eigenlogik der (neuen) Technologien oder „der Sachzwänge“ über den Menschen und damit einer Abkehr von echter Volkssouveränität und Demokratie bedeuten würde. Einer der Propagandisten der Technokratisierung der Politik, die in einem schleichenden Übergang hin zur Wissenschaftsdiktatur münden könnte, ist der Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Harald Lesch.
"Der Klimasozialismus führt uns in eine neue Barbarei!" - Ein Artikel von Daniel Matissek
Bei ökumenischen Kirchentag beseitigte Angela Merkel vergangene Woche auch die letzten Zweifel daran, was dereinst als das große „Vermächtnis“ ihrer Kanzlerschaft in die Geschichte eingehen soll: Sie war es, die das Tor aufgestoßen hat in eine düstere Zukunft der postmodernen globalistischen Barbarei, in der Menschen nicht länger selbstbestimmt und freiheitlich ihr Leben leben dürfen sollen, sondern sich dem Diktat ideologischer „Sachzwänge“ jener zu beugen haben, die darüber bestimmen, was allgemeinverträglich, nachhaltig, „gerecht“ und vor allem – ganz wichtig - „zukunftsgerecht“ ist. Denn egal, wer nach ihr regieren wird, eine Grüne als leibhaftige Kanzlerin oder als Strippenzieherin eines Unionkanzlerns: Dem Klimadiktat wird sich alles unterordnen. Corona war dafür nur ein Testlauf. Ein Artikel von Daniel Matissek Gesprochen von: Tobias Gütter © www.hallo-meinung.de
Immer dort, wo mehrere Menschen zusammen arbeiten, kommt es über kurz oder lang zu Konflikten. Und auch wenn eine Gruppe sich als Team sieht, ist auch ein gutes Team nicht frei von Konflikten. Doch leider wird von allen Seiten oftmals versucht dieses Thema zu negieren oder sich erst gar nicht mit Konflikten auseinanderzusetzen. Konflikte sind ja nicht immer was Schlechtes. Sie erzeugen Reibung, unterschiedliche Meinungen kommen zu Tage, Fehler werden aufgezeigt und verschiedene Persönlichkeitstypen treffen aufeinander. Konflikte sind immer auch eine Chance etwas zu lernen, über sich selbst, über andere und auch über die verschiedenen Kräfte im Unternehmen. Konflikte gehören einfach zum Leben dazu!Doch ungelöste Konflikte können einem das Leben erschweren. Sei es als einfacher Mitarbeiter in einem Team oder als Führungskraft eines solchen Teams, in dem Konflikte unbearbeitet schwelen. Diese Teams zeichnen sich aus durch……eine zunehmend abnehmende Leistungsbereitschaft oder ein vermindertes Leistungsvermögen… hohe Zahl an Fehltagen… schlechte Stimmung und destruktive Gerüchte… unfreundliche Umgangs- und Kommunikationsformen… eine fehlende Bereitschaft der Zusammenarbeit… immer mehr Kündigungen, immer weniger Bewerbungen… eine sinkende Wirtschaftlichkeit… ein schlechtes Image nach außen… unzufriedene Kunden… und so weiter In unserer schnelllebigen Zeit und den vielen Veränderungen, denen Mitarbeiter und Führungskräfte ausgesetzt sind, zusätzlich zu den Nebenwirkungen der Globalisierung, sind Konflikte vorprogrammiert. Und je eher Menschen lernen Konflikte anzugehen, auszuhalten und zu verarbeiten, desto mehr besteht auch die Chance Konflikte als Wachstumsmotor zu nutzen. Diese Podcast-Folge ist die erste von vier Folgen, in denen ich dir unterschiedliche Hilfestellungen für Konfliktsituationen in Teams geben möchte.Falls du Unterstützung bei Teamkonflikten brauchst, oder zu anderen Themen einen Coach suchst, dann nutze mein kostenloses Sondierungsgespräch, um zu erfahren, ob ich der richtige Coach für dich bin.Email: hc@cobaugh.de Buchempfehlungen/Links: Teamkonflikte erkennen und lösen: Zwischen Emotionen und Sachzwängenvon Franz Will https://amzn.to/3nr0UFW Lösungsfokussiertes Konflikt-Management in Organisationen: Methoden und Praxisbeispiele für Konfliktlösung zwischen Einzelnen, in Teams und Organisationseinheitenvon Peter Röhrig und Martina Scheinecker https://amzn.to/3vmchSn Sozialmanagement: Teamarbeit und Teamentwicklung in sozialen Berufenvon Raimund Ergerhttps://amzn.to/3gGJ6W5 Webseite:https://www.cobaugh.de Email:https://www.cobaugh.de/kontakt/ YouTube: Heike Beck-Cobaugh - YouTube #Teamkonflikte #KonflikteinTeamslösen #erfolgreicheTeams #Coach-to-go #HeikeBeckCobaugh #Ärztecoach #Klinikkonflikte #FührunginKliniken #CoachinginKliniken #CoachingfürÄrzte#RaimungErger #peterRöhrig #MartinaScheinecker #FranzWill #Konfliktmanagement
#025 Espresso - Die innere Weigerung kleiden wir gerne in das Gewand der äußeren Verhinderung
Führung bedeutet immer auch den Umgang mit Schwierigkeiten und Hindernissen. Dabei bleibt bei vielen Führungskräften keine Zeit sich allein mit sich selbst und der Frage "Wer bin ich?" zu beschäftigen. Als erstes werden Sachzwänge genannt - man sei ja Opfer der Umstände. Oft genug meinen wir doch etwas nicht verwirklichen zu können, weil wir es im tiefsten Inneren gar nicht wollen. Dabei ist es auf dem weg zu Führungspersönlichkeiten mit Herz zu werden unverzichtbar, eine gesunde Liebe zu sich selbst zu entwickeln, damit es zu einer Begegnung mit sich selbst kommt. www.shipleader.de
#15 Christian Böllhoff (CEO Prognos AG): Was halten Sie von radikalen Maßnahmen und „Post-Wachstum“ zur Lösung der Klimakrise?
In dieser Folge interviewt Gabriel den Geschäftsführer der Prognos AG und ehemaligen Geschäftsführer des Handelsblatt, Christian Böllhoff, um der Frage auf den Grund zu gehen, wie radikal der Wandel zur Klimaneutralität für die deutsche Wirtschaft werden wird und welche Schritte es nun von Politik, Unternehmer*innen und der Gesellschaft braucht. Christian Böllhoff ist wohl einer DER Experten für diese Fragen, da die Prognos AG und er im Schnittbereich zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien agieren. Dieses Interview bietet euch bestimmt höchst interessante Einschätzungen und Gedankenanstöße, sodass ihr in der nächsten Wirtschaftsdebatte über den Umgang mit der Klimakrise glänzen könnt. Die Themen & Fragen des Interviews mit Zeitmarkern: 4:31min — Begrüßung und Start des Interviews 5:55min — Wann ist Ihnen das Ausmaß der Klimakrise bewusst geworden? 11:22min — Welche globalen Trends sehen Sie momentan bzgl. der Klimakrise — trotz oder wegen der Corona Pandemie? 14:00min — Wie bewerten Sie den EU Green Deal und die ambitionierteren Reduktionsziele der europäischen Treibhausgas-Emissionen? 17:12min — Wie ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und Industrie angesichts der Prognos Studie „Klimaneutrales Deutschland“? 22:10min — Wie ist die Stimmung und der Wille zum Wandel in der deutschen Wirtschaft? 23:52min — Wie setzen wir den Wandel um — mit Verboten/Bestrafungselementen, Marktmechanismen/Preisen oder Innovation/Technologierettung? 28:53min — Was muss regulatorisch passieren für den schnell nötigen allumfassenden Wandel? Ist das ohne radikale Staatseingriffe möglich? 32:22min — Wie lässt sich das Dilemma aus nationaler Ambition und internationalen Sachzwängen/Wettbewerb aufheben oder abschwächen? 38:02min — Sehen Sie die akademischen Stimmen für „Post-Wachstumsmodelle“ auch im deutschsprachigen Raum und gibt es Ideen, das Thema als Prognos Studie einmal zu beleuchten? 43:58min — Welche Rolle kommt der Prognos AG zwischen den verschiedenen Dimensionen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu? 47:13min — Welchen Rat haben Sie für die „Generation Y“, die kurz vor oder im Berufseinstieg steht? 51:49min — Welche Maßnahmen gegen die Klimakrise würden Sie in der neuen Bundesregierung ab September 2021 umsetzen? 55:38min — Was erwarten Sie von der Wirtschaft? Welche Verantwortung kommt den Medien in der grünen Transformation zu? 59:19min — Ihr Rat an besonders engagierte Klima-Aktivist*innen? 1:00:58 — Welchen Satz würden Sie allen Menschen in Deutschland als E-Mail über den Klimawandel schreiben? 1:02:28 — Was ist das Effektivste, das jeder Mensch gegen den Klimawandel tun kann? 1:05:10 — Ende des Interviews und abschließende Infos Weitere Informationen: Christian Böllhoff (https://www.prognos.com/ueber-uns/koepfe-bei-prognos/christian-boellhoff/) Prognos AG (https://www.prognos.com/) Studie „Klimaneutrales Deutschland“ (https://www.prognos.com/publikationen/alle-publikationen/1035/show/0aa3c5db6aa33fd608d49e908eb61e6f/) Prognos als Arbeitgeber (https://www.prognos.com/karriere) Prognos Karrierenetzwerk (https://www.prognos.com/karriere-bei-prognos/karriere-netzwerk/) Cover-Design: Valerie Helbich-Poschacher Produktion: One Pod Wonder Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und folgt Climaware gerne auf: Facebook (https://www.facebook.com/climaware), Instagram (https://www.instagram.com/climawareglobal/) auf LinkedIn & Twitter Schickt eure Fragen oder Feedback gerne an: info@climaware.org
Ein Standpunkt von Ulrich Teusch. Die Apologeten des „Great Reset“ setzen auf modernste Technik, um die existenzielle Krise des globalen Kapitalismus zu überwinden. Doch dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, denn es basiert auf einem naiven, unterkomplexen Technikbegriff. Der vorliegende Beitrag entwickelt ein alternatives Verständnis moderner Technik und erläutert, warum diese nicht als Rettungsanker taugt, sondern eher als Brandbeschleuniger wirkt. Im Zentrum der Argumentation steht das Konzept eines global ausgreifenden technischen Systems. Teil 1 des Artikels ist hier zu lesen. Auch mit dem, was man landläufig unter „Technikdeterminismus“ versteht, hat die Vorstellung eines technischen Systems nichts zu tun. Der Begriff Technikdeterminismus leistet dem Eindruck Vorschub, die Technik sei ein von vermeintlich technikfreien gesellschaftlichen Sphären eindeutig abgrenzbarer Faktor der sozialen Entwicklung, ein Subsystem der Gesellschaft, das auf andere, nicht-technische Bereiche oder Subsysteme determinierende Wirkungen ausübe. Weit angemessener ist demgegenüber das von dem Philosophen Gernot Böhme vorgeschlagene Bild einer „Technostruktur“, die „den gesellschaftlichen Körper wie ein Pilz [durchzieht]“. Worin sich das Konzept einer Technostruktur von einem deterministischen Erklärungsansatz unterscheidet, hat Böhme wie folgt erläutert: „[Die Technik] ist in die Sozialstruktur eingedrungen, in die Formen sozialen Handelns, in die normativen Erwartungen, oder besser, sie ist selbst eine Sozialstruktur, eine Form gesellschaftlichen Handelns und ein Bestandteil des Regelkanons geworden. Es geht (…) nicht mehr um Technik als Ursache oder Technik als Gegenstand, sondern es geht um die technischen Formen von Gesellschaftlichkeit, oder besser gesagt um die Erkenntnis der fortschreitenden Technisierung gesellschaftlicher Wirklichkeit und der damit verbundenen Probleme.“ Und weiter: „Das Thema einer Theorie der Gesellschaft in der technischen Zivilisation ist (…) nicht so sehr die Technik in der Gesellschaft und der ihr entsprechende gesellschaftliche Wandel, sondern die Technisierung der Gesellschaft. Die Produktion von Technik gehört zur gesellschaftlichen Reproduktion: Mit der Technik produzieren wir gesellschaftliche Strukturen.“ Die Folge: Es entstehen manifeste Sachzwänge und Denkzwänge; die einen sind von den anderen nicht zu trennen. Subjekt und Objekt, Mensch und Technik stehen sich nicht länger in einem Verhältnis von Herr und Knecht oder von Zweck und Mittel gegenüber, sondern sind zu einer neuen Einheit verschmolzen. Die Technik erscheint als autonomes Gebilde, und zwar nicht deshalb, weil sie schon von jeher autonom gewesen wäre, sondern weil der Mensch seine Autonomie verloren oder verspielt hat. Der Mensch hat das technische System zwar erdacht und konstruiert und ist auf vielfältige Weise in die systemischen Zusammenhänge integriert, gleichwohl tritt ihm das System als fremde Macht gegenüber. Obwohl die Technik fraglos von dieser Welt ist, bildet sie eine Welt für sich. Dialektik der Technik Doch sosehr das technische System die Gesellschaft auch durchdringt, es ist mit ihr nicht deckungsgleich. Nicht alle gesellschaftlichen Sphären sind gleichermaßen technisiert oder technisierbar. Analoges gilt für das Verhältnis zwischen technischem System und den natürlichen Lebensgrundlagen. Technik durchdringt die Natur, bedient sich ihrer, verändert oder zerstört sie. Doch sie bleibt auf halbwegs intakte ökologische Systeme ebenso angewiesen wie auf gesellschaftliche Ressourcen. Es ist eine Dialektik am Werk. Auf dem sozialen Feld werden die entsprechenden Spannungen und Widersprüche in der Regel so „gelöst“, dass der weniger technisierte Bereich nachzieht, also eine Art „Frontbegradigung“ (so der Technikhistoriker Thomas Hughes) stattfindet. Gelingt dies jedoch nicht, entstehen große Probleme. Und wenn Technik global ausgreift, entstehen diese Probleme im globalen Maßstab. Wenn der Technisierungsprozess zudem ständig an Geschwindigkeit zulegt, sind die Anpassungsprozesse immer schwerer zu bewerkstelligen – auf individueller Ebene ohnehin, aber auch auf gesellschaftlicher und schließlich auf globaler Ebene. Insofern ist die Vorstellung verfehlt, der Technisierungsprozess würde zu stets größerer Harmonie führen…weiterlesen hier: https://kenfm.de/technik-und-krise-teil-2-von-ulrich-teusch/ Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde https://de.tipeee.com/kenfm https://flattr.com/@KenFM See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Was steckt hinter der Corona-Politik? | Von Paul Schreyer
Ein Standpunkt von Paul Schreyer. Die öffentliche Debatte in Deutschland und anderswo scheint festgefahren: aus „Fallzahlen“ und „Inzidenzen“ folgen „Sachzwänge“ und „Maßnahmen“ – zumeist alternativlos. Kritiker sind „Leugner“, Widerspruch „unwissenschaftlich“. Was bleibt, ist das große Paradox, der sprichwörtliche Elefant im Raum: Die vorliegenden Daten zur Tödlichkeit des Virus, zur Übersterblichkeit, zur Intensivbettenbelegung, zur Infektiosität von Asymptomatischen und zur Aussagekraft des PCR-Tests rechtfertigen die politischen Entscheidungen nicht ansatzweise. Der Eindruck, dass es bei all dem nicht um den Gesundheitsschutz geht, verstärkt sich. Was aber motiviert dann die von Regierungen in aller Welt energisch durchgesetzten Freiheitsbeschränkungen? Offiziell scheint die Situation im Jahr 2020 eindeutig und klar – die Welt befindet sich im Ausnahmezustand und das mit Recht, denn ein neues Virus bedroht alle. Nur Vereinzelung, Isolation, Maske und Impfstoff können die Menschen retten, denn – so erklärt es die Bundesregierung, so sieht man es jeden Tag in den Nachrichten und auf zahllosen Warnhinweisen im öffentlichen Raum – das „neuartige Coronavirus“ bleibt hochgefährlich. ... hier weiterlesen: https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreyer Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde https://de.tipeee.com/kenfm https://flattr.com/@KenFM Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/ Du kannst uns auch mit Bitcoins unterstützen. BitCoin-Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/ KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/ Website und Social Media: https://www.kenfm.de https://www.twitter.com/TeamKenFM https://www.instagram.com/kenfm.de/ https://soundcloud.com/ken-fm See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Die zweite Corona-Welle hat Österreich mittlerweile fest im Griff. Um die drohende Sprengung der Spitalskapazitäten vielleicht doch noch zu verhindern, musste die Regierung nach monatelangem Wegschauen und Beschwichtigen jetzt quasi unvorbereitet einen “Lockdown light” einführen. Darum stellen wir uns in dieser Folge die Frage, warum Österreich nicht in der Lage ist, das Coronavirus nachhaltig zu bekämpfen? Liegt es an der Unfähigkeit der Regierung, wirtschaftlichen Sachzwängen oder vielleicht am Virus selbst? Wie managen andere Länder die Pandemie? Und warum sind manche von ihnen so viel erfolgreicher in der Pandemiebekämpfung als Österreich?
Nr. 226 Berliner Arzt beklagt „Medizin ohne Moral“ – Ärzte werden zu „Erfüllungsgehilfen von Pharma-Unternehmen“
Der Berliner Arzt und Buchautor Dr. Erich Freisleben beklagt in seinem jüngst erschienen Buch eine „Medizin ohne Moral“. Bürokratische Leitlinien, Sachzwänge und falsche Weichenstellungen im Gesundheitssystem würden die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten belasten. Mehr dazu: https://bit.ly/2RE8cqU Zum iTunes Podcast-Kanal: https://podcasts.apple.com/at/podcast/etdpodcast/id1496589910 Zum Spotify Podcast-Kanal: https://open.spotify.com/show/277zmVduHgYooQyFIxPH97 Unsere neue Sonderausgabe über den Coronavirus (erhältlich gedruckt oder als E-Paper) finden Sie in unserem Online-Shop: https://buch.epochtimes.de/collections/all (c) 2020 Epoch Times
Plötzlich sind wir alle wieder frei - wirklich? Sind wir das als Unternehmer*innen jemals gewesen? In eurem Lieblingspodcast für Philosophie, Lifestyle und Business reflektieren Dr. Simone Burel & Jan Roskosch diese Woche über den unternehmerischen Goldstandard: Frei sein. Warum ist es uns wichtig, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu haben? Bedeutet Freiheit gleichzeitig die Aufgabe von Sicherheit? Wie sehr nagen doch letztlich auch Personal- und Sachzwänge an uns? Sind wir letztlich doch nicht alle ins uns selbst gefangen? Von Hippie-Träumen, Yachten und digitalem Nomad*innentum philosophieren wir uns zur Nestwäre des deutschen Krankenversicherungssystems durch. Wie immer: tiefsinnig & unterhaltsam zugleich. Powered by: https://www.mcon-mannheim.de (mcon)
Die Formel 1 hängt immer noch in der Schwebe. Doch inzwischen zeichnet sich eine Exitstrategie für die möglichen Lockerungen nach Corona ab. Deswegen ist es an der Zeit, einen großen Überblick über die jüngsten Entwicklungen der Königsklasse zu bringen. Formel 1-Reporterin Inga Stracke unterhält sich mit PITWALK-Chef Norbert Ockenga über einen möglichen Neustart, Pläne für Doppel- und Geisterrennen, die medialen Störfeuer von Bernie Ecclestone und Max Mosley, die wirtschaftlichen Nöte der Teams – und Sachzwänge hinter den Plänen für eine Lockerung. Wer diesen Podcast hört, erfährt komprimiert und kompakt alles, was man zur derzeiten Lage der Formel 1 wissen muss.
Die Formel 1 hängt immer noch in der Schwebe. Doch inzwischen zeichnet sich eine Exitstrategie für die möglichen Lockerungen nach Corona ab. Deswegen ist es an der Zeit, einen großen Überblick über die jüngsten Entwicklungen der Königsklasse zu bringen. Formel 1-Reporterin Inga Stracke unterhält sich mit PITWALK-Chef Norbert Ockenga über einen möglichen Neustart, Pläne für Doppel- und Geisterrennen, die medialen Störfeuer von Bernie Ecclestone und Max Mosley, die wirtschaftlichen Nöte der Teams – und Sachzwänge hinter den Plänen für eine Lockerung. Wer diesen Podcast hört, erfährt komprimiert und kompakt alles, was man zur derzeiten Lage der Formel 1 wissen muss.
S4 - E2: Was wir alle wollen und was niemand hat
Erfolg mit Leidenschaft - Der Podcast rund um unsere kleine Rebellion gegen das Hamsterrad.
Wie Geld, soziale Erwünschtheit, Erwartungen und Sachzwänge und von dem abhalten, was das wertvollste Gut der Welt ist: nämlich Freiheit. Mehr über unsere kleine Rebellion gegen das Hamsterrad gibt’s auf https://markuscerenak.com
#12 - Freiraum vs Struktur als Existenzgründer
Heute geht es um den Zwiespalt zwischen Struktur und Ordnung bzw. Freiraum und Kreativität. Ich denke, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist einer der Gründe der Freiraum. Kein Chef, der mir sagt, was ich tun oder lassen soll, bin frei in der Wahl, wann und wo ich arbeite und was ich tue. Aber die Realität schaut anders aus. Der Kundenauftrag kommt und der Kunde erwartet mich zu einem bestimmten Termin. Wenn du Ausgaben hast, musst du auch Einnahmen generieren. Es gibt also gewisse Sachzwänge, die dich doch wieder in ein Korsett bringen, das dich einschränkt. Auf der anderen Seite hilft dir diese Struktur, diese Ordnung sehr dabei, Ergebnisse zu erzeugen. Das ist für mich einer der größten Zwiespälte bei der Gestaltung eines Startups. Achte darauf, in welchem Modus du dich befindest, wie dein Tag strukturiert ist, wieviel Freiraum du dir gibst und auf der anderen Seite, wo du dir vielleicht auch selbst ein wenig Struktur geben kannst, um Ergebnisse zu produzieren.
Klaus von Dohnanyi: "Die Zeiten werden sehr stürmisch werden"
Für die Herausforderungen der Zukunft sieht der SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi die liberalen Demokratien schlecht gerüstet. Sie müssten sich grundlegend reformieren. Erst dann ließen sich die Probleme meistern.Nicht über Politik zu sprechen, ist sehr vernünftig - jedenfalls gelegentlich und unter Freunden. Stattdessen, sagt Klaus von Dohnanyi, Jahrgang 1928 und ehemaliger Minister unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt, gehe er mit Angela Merkel lieber ins Konzert. Über Musik und Kunst könne er sich mit der deutschen Kanzlerin sehr gut verständigen - so gut, dass beide seit langem in inniger Freundschaft verbunden sind. Und noch etwas verbinde die beiden, erklärt von Dohnanyi im "Interview der Woche" der DW: "Wir betrachten die Welt sehr pragmatisch". Pragmatik ist für von Dohnanyi, seit 60 Jahren SPD-Mitglied, Grundlage aller vernünftigen Politik: "Wenn man Politik machen will, muss man sie so machen, dass sie sich mit den Wirklichkeiten auseinandersetzt und nicht mit irgendwelchen enttäuschenden Hoffnungen." Diese Haltung vertrete auch die Kanzlerin. Allerdings sei es heute sehr viel schwieriger als früher, Politik zu gestalten. Das liege vor allem daran, dass die Welt komplizierter geworden sei. "Es gibt viel mehr Staaten. Es gibt viel mehr Bedürfnis auch großer Staaten sich wieder zurückzuziehen auf ihre eigenen Interessen. Das sieht man an Amerika, aber auch an anderen Ländern." Paradoxerweise führe die Globalisierung dazu, dass die verschiedenen Regionen sich wieder selbst regieren wollten. "Ihnen ist alles zu weit weg. Brüssel ist zu weit weg. Washington ist zu weit weg. Sie wollen lieber wieder selbst, und das macht die Arbeit natürlich schwer." USA werden zum Problem für die Europäer Eine wesentliche Herausforderung für Europa sei der neue Kurs der USA unter Donald Trump. Das gehe vor allem auf die US-Sanktionspolitik zurück. Mit Hilfe der Sanktionen zwängen die Amerikaner die Europäer und andere dazu, "Dinge zu tun, die die Staaten nicht tun wollen. Das ist Sinn der Sanktionspolitik." Für weniger problematisch hält von Dohnanyi zumindest vom Grundsatz her das Verhältnis zu Russland. "Mit Putin müsste man sehr viel mehr reden." Allerdings: "Da sind die Amerikaner im Wege, weil sie die Gespräche, die Verhandlungen mit Putin blockieren." Dabei sähen auch viele amerikanische Politiker Gespräche als einzige Möglichkeit, das westlich-russische Verhältnis wieder neu zu ordnen. Ein schwaches Europa Europa sieht von Dohnanyi derzeit in einer schwachen Position. Das habe vor allem einen Grund: "Die Europäer können sich nicht auf eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik einigen." Solle sich das ändern, erfordere dies eine verstärkte Führungsrolle von Deutschland und Frankreich. "Deutschland und Frankreich müssen die Dinge in die Hand nehmen, müssen Europa führen. Es hat noch nie eine Einigung eines großen Raumes gegeben ohne einen Hegemonialpartner. Und ehe die Franzosen nicht verstehen welche Chance sie dort haben, auch mit Deutschland hätten, ehe das nicht geschieht, wird auch Europa nicht vorankommen." Ein geeintes Europa sei auch nötig, weil sich Alte und Neue Welt derzeit auseinanderlebten. Beide seien nicht mehr durch identische Interessen verbunden. Das gehe durchaus auch auf geographische Voraussetzungen zurück: "Nach Amerika kommt kein Flüchtling mit dem Ruderboot. Bei uns sind sie alle sofort im Lande." Die Frage, ob die liberalen Demokratien für die Herausforderungen der Zukunft hinreichend gerüstet seien, beantwortet von Dohnanyi zurückhaltend. Deren Hauptproblem - "nicht nur in Europa, auch in Australien, in Neuseeland, in Island also wo immer Sie hinschauen" - sei, dass sie keine festen Verfassungsstrukturen für die neue Zeit hätten. "Wir müssen sehen, ob unserer Form zu wählen, unsere Form Regierungen zu bilden noch stabil genug sind für diese stürmischen Zeiten, die vor uns liegen, und die Zeiten werden sehr stürmisch werden, sehr stürmisch." Niedergang der Sozialdemokratie Just in diese aufgewühlte Zeit fällt der Niedergang der Sozialdemokratie. Diesen sieht von Dohnanyi vor allem dadurch begründet, dass zentrale sozialdemokratische Anliegen - etwa die wachsende Ungleichheit oder das Problem einer gerechteren Verteilung - in einer liberalen Demokratie sehr schwer zu organisieren seien. Zwar stehe Deutschland bei der Einkommensungleichheit sehr gut da. "Aber bei der Vermögensungleichheit haben wir die Probleme aus den vergangenen vielen Krisen. Diese Folgen haben wir noch nicht wirklich im Griff - und das ist ein großes Problem." Für den Niedergang der deutschen Sozialdemokratie sieht von Dohnanyi auch personelle Gründe. Indem sie auf Martin Schulz als SPD-Chef und Kanzlerkandidat setzte, habe die SPD "einen kardinalen Fehler" gemacht. "Der Mann war nicht geeignet eine Partei zu führen, nicht geeignet die SPD zu führen, nicht geeignet, politische Entscheidungen wirklich sorgfältig zu durchdenken. Der ist halt ein netter Kerl, aber kein guter Politiker. Den hätte man da nie an der Spitze haben dürfen." Skeptisch zeigt sich von Dohnanyi gegenüber dem Vorschlag einer linken Sammlungsbewegung aus SPD, Grünen und Linken. Dass diese komme könnte, hält der SPD-Mann für denkbar. Allerdings: "Ich glaube man muss da sehr aufpassen, dass da nicht wie meist in diesem Zusammenhang eher die Radikalen bestimmen, wo es hin gehen soll." Die Geschichte lehre, dass bei einer gemeinsamen Regierung von Sozialdemokraten und Kommunisten immer die Kommunisten regiert hätten - "obwohl sie ursprünglich einen kleineren Anteil hatten". "SPD muss Herausforderungen der Globalisierung verstehen" Seiner Partei macht SPD-Mann von Dohnanyi vor allem einen Vorwurf: Sie habe die Erfordernisse der globalisierten Welt nicht hinreichend verstanden. Als Beispiel nennt er die Senkung der Unternehmenssteuer in den USA. In Reaktion auf sie denke Deutschland sofort darüber nach, sie ebenfalls zu senken. "Das heißt, die Wettbewerbsbedingungen in der Welt bestimmen eigentlich, was man tun kann. Das muss man als Ausgangspunkt akzeptieren." Sachzwänge könne und dürfe man nicht leugnen. Eben das tue aber die SPD, und das sei ihr wesentlicher Fehler. "Natürlich gibt es Sachzwänge, und mit denen muss man sich konstruktiv auseinandersetzen." Dieser Herausforderung müsse sich die SPD noch stellen. "Wenn die SPD einmal dazu sich durchgerungen hat, festzustellen, dass Wettbewerb und Markt und Freiheit zusammenhängen und dazu zwingen, Dinge zu tun die man vielleicht lieber anders machen würde - dann kann man auch anfangen wieder richtig mit der SPD zu segeln." Wesentlich geprägt sieht sich Klaus von Dohnanyi durch seinen Vater, den Juristen und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Hans von Dohnanyi. Er wurde von den Nazis hingerichtet, als sein Sohn Klaus sechzehn Jahre alt war. Von ihm habe er vor allem eines gelernt: "zu seiner Meinung zu stehen und sich nicht zu fürchten, wenn andere anderer Meinung sind."
Wer kennt das nicht: Manchmal glauben wir, zu einem bestimmten Verhalten gezwungen zu sein. Sachzwänge sind das Gegenteil von Souveränität, weil sie dir scheinbar die Wahlfreiheit nehmen. Hier erkennst du, was wirklich dahintersteckt. Außerdem stelle ich dir jemanden vor, der dir hilft, Sachzwänge zu entlarven und zu überwinden. Hier findest du die versprochenen Downloads: www.lemper-pychlau.com Und hier kannst du meiner Facebook-Gruppe beitreten für mehr Souveränität im Job, mehr Einfluss und Respekt: https://www.facebook.com/groups/EinflussundAnsehen/
Vielen Menschen geht es wie dem Löwen im Zoo: früher einmal wild und gefährlich, heute gezähmt und gefangen im Korsett der Umstände, Verpflichtungen und Sachzwänge. In manchen Augenblicken aber spüren wir es: genauso wie der Löwe im Zoo sind auch wir nicht für den Käfig geschaffen, sondern für die freie Wildbahn. Wie gelingt uns ein […]
Zunächst, liebe Hörer, wollen wir darauf hinweisen, dass wir in der Folge die Nummer 390 nennen, dabei ist es „erst“ die 389. Hat technische Gründe, also nicht wundern. Wirklich wichtig ist das natürlich nicht, daher gleich zum Thema! Bist du ein Morgenmensch? Bist aktiv schon um 5 Uhr, machst deine Yoga-Übungen, schreibst Texte oder arbeitest anderweitig? Oder bist du eher die Nachteule, die um 23 Uhr erst so richtig produktiv wird? Wir sprechen heute über ein Buch, ein Konzept, eine Idee, sich früh morgens, z.B. um 5 Uhr, Zeit für sich selbst zu nehmen, um zufriedener durch den Alltag und das Leben zu kommen. Morgenrituale führen dazu, dass du das schaffst, was du wirklich tun willst und nicht das, was deine Umwelt von dir verlangt! Dafür stehen fünf Buchstaben, gekleidet in ein Akronym: SAVERS S steht für Silence oder Stille, A für Affirmation oder Vorsätze, V wie Visualisierung, E für Exercise, R für Reading oder Lesen und das zweite S für Scribing oder Tagebuchschreiben. Viele Menschen weltweit üben dies mittlerweile und finden auf diese Weise zu einem glücklicheren und gesünderen Leben. Probiert das doch mal aus für euch, auch wenn es nicht für jeden leicht umsatzbar ist. Gründe und Sachzwänge, die dagegen sprechen, gibt es immer genug. Auch hier geht es um die Etablierung einer Gewohnheit, ein Thema, das wir hier ja immer mal wieder aufgreifen. Hört euch in der neuesten Folge an, wie Tonys Erfahrungen mit diesem Konzept sind. Hier findet ihr den Link auf das Buch von Hal Elrod: Miracle Morning - Die Stunde, die alles verändert. Diesmal bei iTunes via iBooks. https://itunes.apple.com/de/book/miracle-morning/id1116619358?mt=11 Viel Freude und gute Erfahrungen beim Ausprobieren!
Beach Podcast Goes Deep 7 Mixed by Alexander Schulz
Hallo Freunde hier ist er ganz frisch "Beach Podcast Goes Deep 7" Mixed by Alexander Schulz Viel Spaß....Kurt Kjergaard ..................................................................................................................................... Künstlerinfo: SoundCloud: https://soundcloud.com/alexanderschulzofficial www.hearthis.at/alexanderschulz BOOKINGINFO: info_alexanderschulz@yahoo.de // info@time4artist.de ---------------------------------------------------------------------------------------------------- „Alexander Schulz“ ist unumstritten einer der beliebtesten Locals in der Lausitz und versteht es die Croud auf dem Floor abzuholen. Egal ob Opening, Primetime oder Aftershow, mit Gespür fürs Publikum und Location beweist er jedes Mal aufs Neue, dass er seine Tätigkeit lebt. Mit seiner musikalischen Vielfalt, einer eigenen Handschrift und dem Privileg, sich von den üblichen Sachzwängen freigeschwommen zu haben ist es schwer, seinen Style genauer zu de fi nieren. Irgendwo zwischen Deephouse und Techno fühlt er sich heimisch. Mittlerweile arbeitet er an ersten eigenen Produktionen und spielt sein Lied in Clubs und auf Openairs über den Landkreis hinaus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- play ☑ like ☑ share with your friends ☑ | THANKS FOR YOUR SUPPORT |
Die systemischen Ursachen der neuen Weltwirtschaftskrise
Der jahrelange "Aufbau" des Krisenpotentials auf den Aktien-, Immobilien- und Rohstoffmärkten, seine "Aktivierung" durch die US-Hypothekenkrise und die Ausbreitung der Krise durch anhaltende Vermögensentwertung verweisen auf ihre systemischen Ursachen: In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Gewinnstreben aller wichtigen Akteure von realwirtschaftlichen Aktivitäten zu Finanzveranlagung und -spekulation verlagert ("Lassen Sie Ihr Geld arbeiten"). Wissenschaftlich legitimiert wurde dieser Prozess durch die neoliberale Wirtschaftstheorie, seine Umsetzung wurde durch die Produktion von (vermeintlichen) "Sachzwängen" erleichtert. Mit der Entwicklung der neuen Weltwirtschaftskrise ist das Ende der Sackgasse des Finanzkapitalismus erreicht. Der Übergang zu einer neuen Form realkapitalistischer Rahmenbedingungen (analog zu jenen in denn ersten 25 Jahren der Nachkriegszeit) wird zumindest einige Jahre dauern, und damit auch die Krise. Dr. Stephan Schulmeister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WiFo) im Forschungsbereich Industrieökonomie, Innovation und internationaler Wettbewerb.